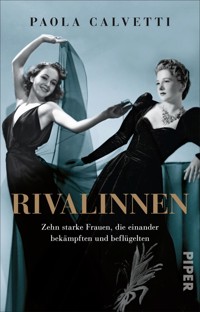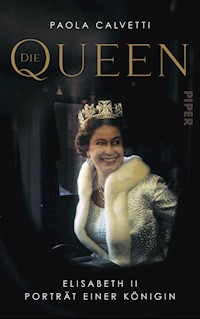
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eindrucksvoll und berührend: private Einblicke in das Leben von Queen Elizabeth II mit zwölf einzigartigen Porträts Stoisch, unnahbar, reserviert: So kannte man Queen Elizabeth II. Über 70 Jahre lang war sie das Oberhaupt der Royal Family, nachdem sie mit nur 25 Jahren den Thron bestiegen hatte. Während das Leben ihrer Schwiegertochter Lady Diana und der Prinzen William und Harry medial ausgeschlachtet wurde, erfuhr man aus dem Privatleben der Queen in all den Jahren kaum etwas. Die italienische Journalistin Paola Calvetti zeichnet in ihrer Biografie ein berührendes Porträt einer Frau, die sich sehr früh in ihrem Leben ihrer Verantwortung stellen musste. Nach außen hin verkörperte die Queen stets die starke Souveränin, die man von ihr erwartete. Doch Calvetti beschreibt auch die zarten Seiten der Königin: ihre Liebe zu Philip, die Beziehung zu ihrer Schwester Margaret, den Druck des Königshauses. 12 Bilder berühmter Fotografen wie Marcus Adams oder Annie Leibovitz ergänzen das Buch und offenbaren das eindrucksvolle Porträt einer Königin mit vielen Gesichtern. Die Macht der Bilder: das bisher schönste "Fotoalbum" über die Queen Paola Calvetti nähert sich der Queen auf besondere Weise: 12 ganzseitige Aufnahmen schmücken die Biografie, die dabei weit über Anekdoten und Insiderberichte hinausreicht. Die ausdrucksstarken Fotos verraten auf den zweiten Blick viel über das Leben einer zielstrebigen und großen Persönlichkeit. Calvetti schafft es, die unnahbare Königin so von einer anderen Seite zu zeigen. »Paola Calvetti zeichnet das elisabethanische Zeitalter durch die Bilder eines idealen Erinnerungsalbums nach.« ― ELLE (Italien)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.deAus dem Italienischen von Esther Hansen© 2019 Paola CalvettiTitel der italienischen Originalausgabe: »Elisabetta II« bei Mondadori Libri S. p. A., Milano 2019© Piper Verlag GmbH, München 2021Lektorat: Fabian BergmannCovergestaltung: Cornelia Niere, MünchenCovermotiv: Lichfield / Kontributor / Getty ImagesSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
Wiltshire, England
Kindheit
Sieben Monate vor dem Dezember-Foto
»Three Photographers«
Lilibet
»Die Crawfie machen«
Thronerbin
Royale Fotoreportagen
Erfolg ist kein Zufall
Der König ist tot. Lang lebe der König!
Der Hofknicks
Ein Zimmer für sich allein
König wider Willen
Auch Verweigerung führt manchmal zu Ruhm
Der Zauber des Kadetten
Weiße Rosen von Cecil Beaton
Trümmer
Frau und Mutter
Auf der anderen Seite des Atlantiks
Ein besonderer Gast
Dienstnummer 230 873
Braut
Ich erkläre vor Ihnen allen
Ein Brautstrauß aus Myrte und Maiglöckchen
Die Frau eines Seemanns
Eine Polopartie
Königin
Der Abschied
Hyde Park Corner
London trauert
Sechsundzwanzig Stunden Flug
Die drei Königinnen
God Save the Queen
Auf der Titelseite
Die Krönung
Die Zeichen der Macht
Eine Fluse auf der Uniform
Einsamkeit
Seitensprünge?
Geheimnis um Andrew
Ein Fotograf in der Familie
Italienreise
Die Queen zu Pferd
Die Swinging Sixties
Ein perfekter Teint
Cecil Beatons letztes Foto
Königsfamilie und Walkabout
Windsormania
Einfach in sie verliebt
Ein letztes Wiedersehen
Die Britannia
Balmoral
Jubilee Line
Die Geschichte darf sich nicht wiederholen
Im Schatten
Der Fotograf, der Lady Di entdeckte
Eine Hochzeit (und zwei Attentate)
Delikatessen
Der Krieg der Windsors
»Annus horribilis«
Schloss in Flammen
Königliche Steuern (und Privatsphäre zu verkaufen)
Dann eben die Scheidung
Und plötzlich ein Lachen
Anruf in tiefster Nacht
Wo ist unsere Königin?
Mit gebeugtem Haupt
Es lebe die Toleranz
Abschied von der Britannia
Eine glückliche Freundschaft
Ein neues Jahrtausend
Die hundertjährige Mutter
Englische Klänge an der Scala
Der Preis, den wir für die Liebe zahlen
Das goldene Zeitalter
Abschiedszeremonien
Endlich frei
Rock Around the Clock
Die Wächterin
Dresscode
Der Moment der Stille
Sechzig gemeinsame Jahre
»Majestät, könnten Sie die Krone absetzen?«
Ein Lichtdouble für die Königin
Ein Job fürs Leben
Ziele fürs Jubiläum
Sechzig Mal Königin
Bond Girl
Markenbotschafterin
Ein Platz in der Geschichte
63 Jahre, 216 Tage, 16 Stunden und 23 Minuten
Vanity Corgis
Seit siebzig Jahren zwei Meter Abstand
Aus dem D-Körbchen geplaudert
Windsor GmbH
London Bridge is down
Schwer ruht das Haupt, das die Krone trägt
Bibliografie
Bildnachweis
Danksagung
Anmerkungen
Wiltshire, England
März 2015
Dezember 1926. Elizabeth, Herzogin von York, mit ihrer sieben Monate alten Erstgeborenen, Elizabeth Alexandra Mary Windsor. [1]
Der Fahrer verstaut die letzten Gegenstände aus dem Cottage in seinem Lieferwagen, alles wertloser Plunder, der in den ebenerdigen Räumen zurückgeblieben ist. Das alte Häuschen braucht nun nicht mehr als einen frischen Anstrich, denn Bausubstanz und Putz sind noch gut. Klar, im Garten wuchert das Unkraut, die Äste der Bäume reichen schon bis ans Dach, das Holz der Fensterrahmen ist rissig, und die niedrigen Steinmauern sind bröckelig und löchrig wie Scheiben vertrockneten Brotes. Doch die Lage des kaum eine Zugstunde von London entfernten Cottages ist einfach unbezahlbar, und die hohen Hecken bieten perfekten Schutz vor neugierigen Blicken.
Hier herrscht vollkommene Stille.
Der Morgen taucht die Umgebung in honigfarbenes Licht.
Als der neue Eigentümer dieser Oase der Ruhe wieder allein ist, geht er in den Keller. Durch die halb geöffnete Tür fallen zwei Lichtstreifen ins Halbdunkel. Von der Decke hängt eine nackte Glühbirne herab, in einer Ecke liegt ein umgestoßener, staubüberzogener Schemel. In den dichten Spinnweben unter einem Balken entdeckt der Eigentümer eine kleine Holzkiste mit verblichenem Schild. Da muss er wohl noch mal den Mann mit dem Lieferwagen rufen, denkt er und klappt gleichmütig ihren Deckel auf, ohne groß Hoffnung zu haben, einen Schatz zu entdecken. Tatsächlich liegen in der Kiste, in fein säuberliche Reihen sortiert, Dutzende cremefarbener Briefumschläge.
Darin alte Fotos.
Manche sind gut erhalten, andere an den Kanten vergilbt. Wie durch ein Wunder sind sie von der Feuchtigkeit verschont geblieben. Auf gut Glück nimmt er einen Umschlag mit der Aufschrift 1926 und zieht vorsichtig das Bild hervor: Eine junge Frau mit klaren Gesichtszügen schaut ihm direkt in die Augen, in langen Bögen fällt ihre Perlenkette auf das dunkle Kleid, die Lippen öffnen sich zu einem Lächeln. Auf ihrem Schoß hält sie ein Kleinkind in weißem Spitzenkleidchen, unter dem die nackten Babyfüße hervorschauen. Die Bildunterschrift auf der Rückseite des Fotos lässt sein Herz höherschlagen: Princess Elizabeth and the Duchess of York, dec. 2 1926.
Deshalb kommt ihm das Gesicht so bekannt vor!
Die geheimnisvolle Frau ist die zukünftige Queen Mum und das blonde Baby niemand anderes als das Kind.
Neunundachtzig Jahre hat das Foto in der Kiste überdauert, zusammen mit vielen Hundert weiteren Erinnerungen an eine vorgezeichnete und allem Anschein nach glückliche Kindheit. Wer wohl die Bilder der Königsfamilie in dieser Zeitkapsel zurückgelassen hat? In der rechten unteren Ecke entdeckt er eine verblasste Signatur: Marcus Adams.
Eine schnelle Onlinerecherche ergibt, dass es sich um den Schwiegersohn der ehemaligen Cottagebesitzerin handelt, der verstorbenen Rosalind Thuillier. Adams ist der Name einer Fotografendynastie, die jahrzehntelang das Leben der Königsfamilie begleitet hat: Marcus’ Vater Walton, Mitglied der British Archaeological Association und Miterfinder der Trockenplatte, war der Lieblingsfotograf von Königin Victoria; Marcus selbst lichtete zwischen 1926 und 1956 ganze Scharen von Aristokratenkindern ab, und sein eigener Sohn Gilbert schließlich hatte als sein Assistent die Ehre, bei der Krönungszeremonie von Elizabeth II. Westminster Abbey auszuleuchten.
Natürlich hat es einen gewissen Reiz, etwas zu besitzen, das mit den Royals zu tun hat, aber was soll der neue Eigentümer des Häuschens nur mit dem Schatz anfangen, der ihm da so unverhofft vor die Füße gefallen ist? Soll er aus dem Cottage vielleicht ein Museum der Zeitgeschichte machen? Oder lieber versuchen, diese Fragmente eines Monarchenlebens möglichst schnell wieder loszuwerden?
Verkaufen, nichts wie verkaufen!
Einige Monate später ist der große Saal des Auktionshauses Dominic Winter in Cirencester, einer Kleinstadt rund 150 Kilometer nordwestlich von London, bis auf den letzten Platz gefüllt, eine eigenartige, angespannte Vorfreude liegt in der Luft. Aus allen Teilen Großbritanniens sind Sammler, Galeristen, treue Windsor-Fans und Schaulustige in die Grafschaft Gloucestershire gekommen, um sich eine der fünfhundert Fotografien zu sichern, die ein anonymer Verkäufer anbietet. Ein echtes Zückerchen: Denn Marcus Adams, der weniger ein braver Chronist der Geschichte als ein wilder Sammler von Erinnerungen war, hat nicht nur ein umfangreiches Werk hinterlassen, die ausdrucksstarken Bromöldrucke sind auch noch alle unveröffentlicht. Sie erzählen vom Beginn eines Lebens, das einige Jahre später eine völlig neue Wendung nehmen sollte. Auf rund der Hälfte der Fotos ist Elizabeth zu sehen, als süßes Baby mit speckigen Beinchen auf dem Schoß von Königin Mary, der strengen Großmutter, oder als Jugendliche, die mit ihren Blicken bereits alles um sich herum zu kontrollieren scheint, oder als junge Mutter Anfang zwanzig mit ihrem erstgeborenen Kind Charles auf dem Arm.
Die Auktion ist ein Riesenerfolg.
Das höchste Gebot bekommt ein Porträt von König George VI. mit seiner Gemahlin Elizabeth, der Queen Consort, und den beiden Prinzessinnen Elizabeth und Margaret aus dem Jahr 1939, wenige Wochen vor Englands Eintritt in den Zweiten Weltkrieg. Vom Nachmittag des 12. bis zum Abend des 13. Oktober 2015 wird der Schatz eines achtlosen Fotografen in alle vier Himmelsrichtungen verstreut. Sämtliche Abzüge sind unter den Hammer gekommen – bis auf einen, den der überglückliche Verkäufer selbst behält: Datiert auf den 2. Dezember 1926 zeigt er das Debüt der kleinen Elizabeth vor der Linse.
Kindheit
(1926 – 1933)
Windsor, Juni 1936. Prinzessin Elizabeth mit ihren Corgis vor der Royal Lodge. [2]
Sieben Monate vor dem Dezember-Foto
Ein eisiger Wind weht über der Themse. Es ist der 20. April 1926, und die Morgenzeitungen verkünden mit wenigen Zeilen, dass es nicht mehr lange dauern kann. Dennoch sind keine Fotografen in die Bruton Street Nummer 17 im Londoner Nobelviertel Mayfair gekommen. Nur eine kleine Gruppe ergebener Untertanen harrt unter den Fenstern des Hauses aus, und im Eckpub Coach and Horses (das es bis heute gibt, eingekeilt zwischen luxuriösen Stadthäusern) stehen die Bierkrüge bereit, um auf das freudige Ereignis anzustoßen. Auch der Streik der englischen Bergarbeiter, den die Gewerkschaften als Protest gegen die angekündigten Lohnsenkungen für den 3. Mai angekündigt haben, trägt zur Londoner Eiseskälte bei. Doch Sir William Joynson-Hicks hat im Moment anderes im Kopf; der Innenminister der konservativen Regierung unter Stanley Baldwin eilt zu einer wichtigen Staatsangelegenheit.
Es ist kurz nach Mitternacht, als sein Fahrer ihn zur Residenz von Claude George Bowes-Lyon fährt, dem 14. Grafen von Strathmore und Kinghorne. Im ersten Stock liegt die fünfundzwanzigjährige Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, die vierte Tochter und das insgesamt neunte Kind des Grafen, seit vierundzwanzig Stunden mit ihrem ersten eigenen Kind in den Wehen. Um die erschöpfte Herzogin von York herum stehen drei Gynäkologen, zwei Hebammen, eine Handvoll Geistliche sowie Angehörige des Hofstaates. Doch damit nicht genug: Um die Geburt eines royalen Kindes zu bezeugen, ist die Anwesenheit des Innenministers erforderlich. Diese Tradition reicht bis in das Jahr 1688 zurück, als man kurz nach seiner Geburt die Legitimität des später so unglückseligen James Stuart, des Sohnes von König James II. und Königin Maria Beatrice d’Este, anzweifelte, und sich unter anderem das Gerücht verbreitete, dass der wahre Sohn des Paares bei der Geburt gestorben und mithilfe einer verschlagenen Hofdame durch ein fremdes Kind ersetzt worden sei.
Sir William muss nicht lange warten.
Da die natürliche Geburt Komplikationen verspricht, entschließt sich der Chirurg Sir Harry Simpson zu einem Kaiserschnitt. Die Operation wird gleich vor Ort durchgeführt, obwohl der Eingriff das Risiko birgt, dass die junge Mutter keine weiteren Kinder bekommen kann. Doch Elizabeths Ehemann Prinz Albert, der Herzog von York, ist kein direkter Thronfolger, also fackelt man nicht lange. Wenige Minuten nach 2:40 Uhr am frühen Morgen des 21. April 1926 teilt Sir Joynson-Hicks dem Premierminister mit, dass die Geburt »institutionell« problemlos verlaufen sei und er sich »persönlich« habe überzeugen können, dass kein Austausch stattgefunden habe. Der Säugling mit einem Geburtsgewicht von 3600 Gramm ist also die erste Enkelin von König George V. Doch vor allem ist sie die innig geliebte Tochter der grazilen, humorvollen Elizabeth, Gemahlin des stotternden und jähzornigen Prinzen Albert, genannt Bertie.
Am 22. April erscheint in der Times eine kurze Mitteilung: »Ihre Königliche Hoheit, die Herzogin von York hat gestern Morgen um 2:40 Uhr in der Bruton Street 17 eine Tochter zur Welt gebracht. (…) Seit der Ankunft ihrer Tochter hat die Herzogin von York ein wenig geruht. Der Zustand Ihrer Königlichen Hoheit und der kleinen Prinzessin entwickelt sich sehr zufriedenstellend.«[1] Am nächsten Tag ist die Daily Mail die einzige Zeitung, die ihre Leser darauf hinweist, dass »dieses Kind, das seit gestern im ganzen Königreich Thema Nummer 1 ist (zumindest bei den meisten), in der Thronfolge auf Platz drei rangiert«. Nämlich hinter Edward, Prince of Wales, der für den Thron und damit auch für Hochzeit und eigene Nachkommen in der unmittelbaren Thronfolge vorgesehen ist, und seinem Bruder Albert.
Den ersten Besuch bekommt das Neugeborene am Nachmittag von den Großeltern väterlicherseits, König George V. und Königin Mary, die um vier Uhr morgens über den Familienzuwachs in Kenntnis gesetzt wurden. Die Großmutter beschreibt den Säugling als »entzückendes kleines Ding mit gesunder Gesichtsfarbe und wunderbaren Haaren«.[2] Am selben Abend schickt ihnen der frischgebackene Vater stolz und überglücklich ein Billett nach Hause:
»Ich hoffe, Du und Vater freut Euch über die Geburt Eurer Enkelin«, begleitet von einer Art Einschränkung (denn Könige bevorzugen bekanntermaßen männliche Nachkommen …), »oder hättet ihr lieber einen weiteren Enkel?«[3]
Bis heute erinnert eine Gedenktafel an die eisige Nacht:
AN DIESER STELLE IN DER BRUTON STREET 17 STAND EINST DAS STADTHAUS DES GRAFEN VON STRATHMORE UND KINGHORNE, WO ELIZABETH ALEXANDRA MARY WINDSOR, SPÄTER IHRE MAJESTÄT QUEEN ELIZABETH II., AM 21. APRIL 1926 DAS LICHT DER WELT ERBLICKTE.
Glücklicherweise haben die Royals seit jeher die Angewohnheit, sich von einem Raum des Palastes zum anderen kleine Botschaften zukommen zu lassen. Jahrzehnte später lässt sich aus diesen Notizen zwar kein Tratsch und Klatsch mehr ziehen, sie enthalten aber immer noch ungeahnte Wahrheiten. Beispielsweise kennen wir so manche Einzelheit über die Verlobung und Hochzeit von Elizabeth Bowes-Lyon aus jenen Briefchen, die erst 2012[4] veröffentlicht wurden und in denen die sonst sehr selbstbewusste und entschlussfreudige junge Frau zugibt, dass sie gar nicht so sicher sei, ob sie den Sohn des Königs heiraten solle. Im Gegenteil, der Gedanke an die Pflichten, die eine solche Verbindung mit sich bringe, jage ihr geradezu »Angst« ein, gesteht sie ihrer ehemaligen Gouvernante Beryl Poignand.[5] Albert hingegen ist wie magisch angezogen von der temperamentvollen Schottin und hofiert sie über Monate, doch er ist nur der Zweitgeborene der Windsors und vielleicht nicht »gut genug« für die ambitionierte Adlige, der die Geschichtsbücher zudem eine Schwäche für den Hofbeamten James Stuart nachsagen.
Doch die Entscheidung der Windsors ist gefällt, und der schüchterne Sohn bekommt Schützenhilfe von Königin Mary. Mit einem attraktiven Posten in den Vereinigten Staaten wird der Rivale aus dem Verkehr gezogen. Bei einem Besuch auf Glamis Castle, dem schottischen Familiensitz der Strathmores, kommt es, verbunden mit einer unbedachten zärtlichen Geste, zum ersten Heiratsantrag – der prompt abgelehnt wird. Ebenso der zweite. Doch Albert lässt nicht locker, sendet Briefe und kleine Nachrichten, veranstaltet rauschende Feste und Bälle, und nach Monaten des hartnäckigen Umwerbens verändert sich Elizabeths Blick auf den verletzlichen Herzog; der dritte Antrag wird schließlich erhört, und so kommt es am 15. Januar 1923 zur Verlobung. Von dem Tag an richtet sich eine geradezu krankhafte Aufmerksamkeit auf die zukünftige Braut, die Presse giert nach Details und Indiskretionen. Die Vorstellung, sich der Neugier der Öffentlichkeit stellen zu müssen, ärgert Elizabeth maßlos, Reporter und Fotografen sind für sie die pure Pest – hoffentlich werden sie bald gelangweilt von ihr ablassen!
Doch das bleibt ein frommer Wunsch, und nur wenige Jahre später wird sich die Herzogin von York derselben Reporter und Fotografen bedienen – zu ihrem eigenen Vorteil und dem der Monarchie.
Am 26. April 1923 heiraten Elizabeth und Albert in Westminster Abbey. Nach kurzen Flitterwochen im Herrenhaus Polesden Lacey in der Grafschaft Surrey südwestlich von London ziehen sie in die ruhige Bruton Street, wo aus Elizabeth schnell eine aufmerksame Ehefrau wird, die den Wunsch ihres Mannes nach einem Familienleben fernab der höfischen Ränke wirkungsvoll unterstützt.
Ganz dem viktorianischen Geist ergeben, passt sich die Herzogin fraglos dem königlichen Protokoll an. Sie weiß, dass so gut wie nichts ohne die Einwilligung des Schwiegervaters geschieht, der nun sogar das Recht und das Privileg hat, über den Namen seiner Enkelin zu entscheiden: Der elterliche Vorschlag Elizabeth Mary Alexandra (zu Ehren von Mutter, Großmutter und Urgroßmutter, allesamt Königsgattinen oder -witwen) findet seine Zustimmung, und am 29. Mai 1926 wird die Kleine durch den Erzbischof von York, Cosmo Lang, in der Familienkapelle von Buckingham Palace getauft – mit Wasser aus dem Jordan.
Sie weint die ganze Zeremonie lang.
Die Briten feiern ihre Little Princess wie keine Zweite, innerhalb weniger Monate schmückt sie die Titelseiten aller Zeitungen und wird zum »bekanntesten Kind der Welt«, nicht zuletzt dank der Fotos von Marcus Adams.
»Three Photographers«
Kinder sind für Bertram Park schwierige Kunden, weil sie sich vor der Linse kaum bändigen lassen. Wie viel einfacher verdient man da sein Geld mit Theaterstars oder den eitlen Damen reiferen Alters, die nach Porträts für die heimische Ahnengalerie verlangen. Doch als aus dem Palast wiederholt Anfragen kommen, wittert Park ein gutes Geschäft und gründet mit seiner talentierten Frau Yvonne Gregory und dem lebenslustigen Marcus Adams das Studio »Three Photographers«, wo die drei sich Druckherstellung, Nachbearbeitung und Dunkelkammer teilen. Doch nur Adams obliegt die lästige Pflicht, die zappeligen Kinder der »Von und zu« abzulichten.
Wir schreiben den Herbst 1920, und die Dover Street 43 wird sich in kürzester Zeit zum Mekka der neuen Generation reicher Bürgerlicher und Adliger entwickeln – unter ihnen die nicht besonders hübsche Rosalind Hicks, einzige Tochter der Schriftstellerin Agatha Christie, und der kleine, traurige Christopher Robin Milne, dessen Stofftier das Vorbild für Pu der Bär war, die von seinem Vater Alan Alexandre Milne erdachte Kinderbuchfigur. Im Portfolio der »Three Photographers«, quasi ein Who’s who der künftigen britischen Elite, dürfen der Herzog und die Herzogin von York nicht fehlen, an denen sich die Zeitschriftenverleger eine goldene Nase verdienen; nicht zuletzt seit der Geburt der Prinzessin mit den Goldlöckchen, die zu einem der beliebtesten Fotomotive geworden ist.
Seit ihrem Debüt am 2. Dezember 1926 hält das Automobil der Yorks mit erfreulicher Regelmäßigkeit in der Dover Street, wo Adams sie mit Krawatte und Blüte im Knopfloch in einem gut sitzenden grauen Jackett empfängt, darüber den weißen Arbeitskittel. Nach dem obligatorischen Bückling vor Ihren Königlichen Hoheiten geht es gleich in den großzügigen, mattgelben Aufnahmeraum, wo auf einem großen Tisch Puppen und Spielzeug warten. Adams hat schon eine Bleistiftskizze der jungen »Kundin« angefertigt und einen Fotoapparat mithilfe von Gummischienen so präpariert, dass er das Kind nicht mit dem metallischen Rattern der Fotoplatten verschreckt.
Adams fotografiert mit dem weichen Licht verdeckter Lampen, seine bedächtigen Bewegungen wecken die Aufmerksamkeit des Kindes, es »posiert« unter den wachsamen Blicken der hinter einer Stellwand aus Glas stehenden Eltern, während der Fotograf es mit kleinen Kunststücken unterhält. Ein kurzes Video im Internet zeigt, wie gebannt und interessiert ihm die zu diesem Zeitpunkt vierjährige Elizabeth folgt, als wäre er ihr Lieblingsonkel.[6]
Für fünfzig gelungene Fotos schießt er mindestens zweihundert, anschließend arbeitet er für den von ihm angestrebten Effekt mit Kreiden und Bleistiftminen einen weichen Hintergrund auf die gläsernen Fotoplatten, eine für damalige Zeiten sehr fortschrittliche Postproduktion. Einige Tage später gibt er die Porträts im Palast ab. Viele davon wandern als Erinnerung in das Familienalbum, andere werden in Zeitschriften veröffentlicht, auf Keksdosen gedruckt, für Postkarten, Briefmarken, Kalender und Porzellantassen verwendet.
Schließlich kommt Elizabeth sogar noch dem amerikanischen Kinderstar Shirley Temple zuvor, als das Wochenmagazin Time der gerade drei Jahre alt gewordenen Prinzessin mit der Ausgabe vom 29. April 1929 einen engelsgleichen Auftritt auf der Titelseite schenkt.
Lilibet
Anfangs gelingt es den Yorks ganz gut, sich dem engen Korsett des Hofes so weit zu entziehen, dass sie genügend Raum für ein Privatleben haben. Doch die gewünschte Privacy wird empfindlich gestört, als Albert während eines Staatsbesuchs in Kanada, Südafrika und Australien am 9. Mai 1927 mit einer Rede das neue Parlamentsgebäude in der australischen Hauptstadt Canberra eröffnen soll.
Berties Gesundheit ist labil – und er stottert stark. Die Aussicht, in der Öffentlichkeit auftreten oder gar reden zu müssen, verursacht ihm unerträgliche Angst bis hin zu Nervenzusammenbrüchen. Er braucht dringend Hilfe. Unter dem sanften Druck seiner Frau sucht er immer häufiger die Praxis des australischen Logopäden Lionel Logue in der Harley Street in Kensington auf, der in ganz London dafür bekannt ist, traumatisierte und psychisch kranke Weltkriegsveteranen wieder zum Sprechen zu bringen.
Am 6. Januar 1927, Elizabeth ist gerade mal neun Monate alt, kommt es zur ersten schmerzlichen Trennung zwischen Eltern und Kind. Der Herzog und die Herzogin von York besteigen das ehemalige Kriegsschiff Renown, das zu einem luxuriösen Kreuzfahrtdampfer umgebaut wurde. Betrübt lassen sie ihre Tochter in der Obhut zweier Kindermädchen zurück, Clara »Allah« Knight, die schon die Herzogin selbst hat aufwachsen sehen, und Margaret »Bobo« MacDonald, die fast siebzig Jahre lang an Elizabeths Seite bleiben wird, die einzige Person, der sie sich anvertraut und von der sie sich auch noch als Queen beraten und kritisieren lässt.
Auch die wohlmeinenden und großzügigen Großeltern bemühen sich um ihre Enkelin. Gemeinsam mit ihrem Gemahl empfängt die Königin sie in Buckingham Palace (manchmal auch in Abendrobe und mit Krone). In den Augen des Königs – der übrigens 1917 den Namen Windsor für seine Dynastie frei erfunden hat, da seine deutschen Wurzeln im Hause Sachsen-Coburg und Gotha in jener Zeit wenig geeignet schienen, die Sympathien der Engländer zu gewinnen – sind Kinder reine Nervensägen. Er lehnt Ehescheidungen ebenso ab wie Cocktails und Frauen, die rauchen, und seine Freizeit widmet er ganz allein seiner Briefmarkensammlung. Mit Elizabeth aber, und nur mit ihr, legt er seine streng konservativen Prinzipien ab und verwandelt sich in einen Bilderbuchopa, der seine Enkelin nach Strich und Faden verwöhnt.
Eine echte Ausnahme in diesem Palast, in dem Glück und Zufriedenheit Fremdwörter sind.
Als Vater ist George V. weniger liebevoll und drangsaliert seine Söhne wie auch seine einzige Tochter. Es herrscht ein Klima der Angst, kein Wunder, dass ihm bis zum heutigen Tag diese Aussage anhängt: »Mein Vater hatte Angst vor seiner Mutter, ich hatte Angst vor meinem Vater, und ich werde verflucht noch mal alles tun, damit meine Kinder auch Angst vor mir haben.«[7] Besonders hart trifft die königliche Heimtücke den ältesten Sohn Edward. Doch auch Albert, der als Linkshänder dazu gezwungen wird, mit rechts zu schreiben, muss sich aufgrund seines Stotterns Sprüche wie »Jetzt spuck die Kröte endlich aus!« und Schlimmeres anhören. Vom fünften Sohn spricht der König nie. John leidet an einer schweren Form der Epilepsie und anderen neurologischen Erkrankungen und verbringt sein kurzes Leben auf dem in der Grafschaft Norfolk unweit der Nordseeküste gelegenen königlichen Landsitz Sandringham House unter der Aufsicht eines Kindermädchens. Er stirbt 1919 als Teenager und wird nie mehr erwähnt – ein Phantom bei Hofe und im ganzen Land.
Nur Elizabeth gelingt es also, die harte Schale des Königs zu durchbrechen. Für seine Enkelin tut er alles, für sie geht er sogar auf die Knie (bevor er ihr später das Pony Peggy schenkt), damit sie im Thronsaal von Buckingham Palace auf ihm reiten kann – und das in Anwesenheit des Erzbischofs von Canterbury.
Mittwoch ist Fototag.
Marcus Adams betritt mit seinen Gerätschaften Buckingham Palace, verbeugt sich und macht Dutzende Fotos von Elizabeth, mal mit einer Zeitschrift in der Hand und einer keck abstehenden Locke, mal beim Spiel mit der Perlenkette ihrer Großmutter. Die Abzüge werden in elfenbeinfarbene Umschläge gesteckt und als königliche Depeschen mit Imperial Airways in die verschiedenen Häfen geflogen, wo die Renown anlegt. Sie sind das einzige Bindeglied zwischen Kleinkind und Eltern. Dank Adams Kunstfertigkeit können diese neun Monate lang die Fortschritte ihrer Tochter mitverfolgen, den ersten Zahn und schließlich sogar, wie die kleine Elizabeth mit dem Händchen winkt – was zum Lieblingsmotiv der australischen Presse wird und das Kleinkind auch in Down Under berühmt macht.
Einige Wochen nach ihrer Rückkehr nach London beziehen die Yorks den prächtigen neoklassizistischen Palast in Piccadilly Nummer 145, der früher dem Herzog von Wellington gehörte: fünfundzwanzig Schlafgemächer, drei Wohnzimmer, die Bibliothek, zwei große, komplett ausgestattete Küchen, ein Ballsaal, ein Aufzug und ein Privatzugang zum Green Park auf der Höhe von Hyde Park Corner.
Um ihre Prinzessin erstmals »live« zu sehen, müssen die Fans bis zum 27. Juni 1927 warten, als Elizabeth sich auf dem Arm ihrer Mutter auf dem Balkon von Buckingham Palace zeigt. Sie kann schon lächeln und brabbelt als eines der ersten Wörter ihren eigenen Namen. Auf die Frage: »Wie heißt du?«, antwortet sie: »Tillibet«, und den daraus abgeleiteten Spitznamen Lilibet wird sie ihr Leben lang behalten.
Am 21. August 1930 wird den Yorks auf Glamis Castle Margaret Rose geboren. Mit ihr ist das Familienquartett komplett, das Bertie stolz us four nennt. Nach einer Kindheit, die von Demütigung und Einsamkeit geprägt war, findet er nun in seiner eigenen kleinen Familie die Wärme und Geborgenheit, die er sich immer gewünscht hat.
»Die Crawfie machen«
Dass wir so viel über Lilibets Kindheit und Jugend wissen, verdanken wir einer mehr als fünfhundert Seiten langen Indiskretion des Kindermädchens Marion Crawford, genannt Crawfie. Die liebevolle und fortschrittliche Gouvernante entstammte dem schottischen presbyterianischen Kleinbürgertum und war eine der Ersten, die begriff, wie hungrig die Buchindustrie auf das Faszinosum der mittlerweile zur Königsfamilie gewordenen Yorks war. Nachdem sie mit Elizabeths Hochzeit nach siebzehn Jahren ihren Dienst für die Familie beendet hatte, hatte sie den (für uns) glücklichen Einfall, in einem vom Hof nicht autorisierten Bericht von ihren Erlebnissen und Erfahrungen zu erzählen – mit allem Respekt natürlich, sodass es fast an Langeweile grenzt. Das Buch The Little Princesses findet bei seinem Erscheinen 1950 reißenden Absatz und beschert seiner Verfasserin die bemerkenswerte Summe von 75 000 Pfund. Von diesem Tag an wird der Ausdruck »die Crawfie machen« im Englischen zum Synonym für Verrat, aber sei’s drum: Den Fans gewährte sie zum ersten Mal private Einblicke in die Gemächer des Hofes. Für die Royals ein unverzeihliches Vergehen! Wie kann es sein, dass ihr Vertrauen derart missbraucht wird und Intima aus ihrem Alltag, ihren Gewohnheiten und ihren Erziehungsmethoden öffentlich werden?
Die undankbare ehemalige Nanny fällt in Ungnade und zieht sich in ihre Heimat zurück, wo sie mit einer eigenen Kolumne im Magazin Woman’s Own eine Karriere als Journalistin beginnt. Im Juni 1955 stolpert sie jedoch ein weiteres Mal über einen Artikel, in dem sie die junge Queen Elizabeth bei einem Pferderennen in Ascot in »ihrem kanariengelben Kleid« beschreibt. Dass sie ihn weit im Voraus im stillen Kämmerlein geschrieben hat, kommt heraus, als wegen eines Eisenbahnerstreiks alle Ascot-Rennen abgesagt werden. Die gute alte Crawfie verliert auch noch das letzte Ansehen, die Karriere der Schottin vom Lande, die der künftigen Königin jahrelang die Grundzüge der Weltgeschichte beigebracht hat, ist endgültig zu Ende. Seit 1977 lebt die Witwe zurückgezogen in ihrem Haus an der Straße zwischen Aberdeen und Balmoral und beobachtet von dort den königlichen Wagentross auf dem Weg in den Sommerurlaub. 1988 stirbt sie im Alter von achtundsiebzig Jahren; kein Mitglied der Royals nimmt an ihrem Begräbnis teil. Obwohl sie an dem Verkauf von Erinnerungsstücken nicht schlecht verdient hätte, vermacht sie ihr bescheidenes Hab und Gut lieber der englischen Krone, vielleicht aus Reue, die Privatangelegenheiten ihrer heiß geliebten Royals für den eigenen Ruhm ausgenutzt zu haben.
Marion Crawford wird der Herzogin von York von Freunden empfohlen, als »Mädchen vom Lande und exzellente Lehrerin in allen Fächern außer Mathematik«.[8] Ihren Dienst tritt sie im Herbst 1930 als Verstärkung der bereits so bewährten und von den Yorks hocherfreut übernommenen Nanny Clara »Allah« Knight an. Albert hat die emotionale Kälte seiner Kindheit nie verwunden, ebenso wenig die strengen Gouvernanten, die sich um seine Erziehung kümmerten. Und obwohl George V. Marion Crawford aufgetragen hat, »den Mädchen das Schönschreiben und wenigstens ein bisschen Geschichte« beizubringen, interessieren sich die Yorks wenig für Lehrpläne, sondern wünschen sich für ihre Töchter – neben perfekten Tischmanieren, Leibesübungen an der frischen Luft und der Fähigkeit, eine anständige Konversation zu führen – eine glückliche Kindheit.
Abgesehen von kleineren Freiräumen, etwa einem Spaziergang durch den Green Park, wo sie mit Gleichaltrigen aus der englischen Nobility spielen können, sind Elizabeths und Margarets Tage einem strengen Zeitplan unterworfen. »Die Nursery«, die Crawford in ihrem Bestseller beschreibt, »ist eine Welt en miniature, ein Staat im Staat, an dessen Spitze die Nanny oder Nana Allah steht«[9], die mit Bobo MacDonald über Lilibets Alltag wacht. Deren Tagesablauf ist typisch für eine Tochter des englischen Hochadels: am Morgen die erste Begegnung mit den Eltern (manchmal darf sie sogar der Mutter Gesellschaft leisten, während diese im Bett ihr Frühstück einnimmt, ein Privileg der verheirateten Frauen), zwischen 9:30 und 11 Uhr Unterrichtsstunden in Arithmetik, Geschichte, Geografie, Tanz und Musik, dann das Mittagessen in der Nursery, eineinhalb Stunden Mittagsruhe, Spaziergang und Spiel an der frischen Luft bis zur Teatime. Um 17 Uhr darf sie erneut zu ihren Eltern und isst zu Abend, um dann nach einem warmen Bad ins Bett zu gehen.
Die Abende der Yorks verstreichen in klaustrophobisch anmutendem Glück vor dem heimischen Kamin, man liest, unterhält sich oder spielt Scharaden. Wieder einmal bewährt sich, was Albert an seiner Frau Elizabeth am meisten schätzt – die im Grunde eine Großgrundbesitzerin mit Bauern und Schäfern im Stammbaum ist: ihre Freiheit von aller Förmlichkeit, die ihm sorglose Tage fernab der strengen Hofetikette schenkt, unter der er selbst so gelitten hat.
Elizabeth und Margaret werden identisch angezogen, gesmokte Kleidchen, Mäntel mit Samtkragen, weiße Strümpfe und Lackschühchen mit Schnürsenkeln. Die Presse reißt sich um die »kleinen York-Schwestern«, die sich zwar äußerlich ähneln, charakterlich aber völlig verschieden sind. Angefangen bei der Art und Weise, mit der sie Kandiszucker verzehren und die Marion Crawford in ihrem Buch ebenfalls beschreibt: »Margaret nimmt alle Zuckerstückchen auf einmal in die Hand und stopft sie sich in den Mund, während Lilibet sie der Größe nach ordnet und dann vornehm eines nach dem anderen aufisst, das kleinste zuerst.«[10]
Neuerungen und Veränderungen verstören die kleine Lilibet, die schon als Kind gerne alles unter Kontrolle hat. So kann sie abends zum Beispiel nicht einschlafen, ohne bestimmte Rituale ausgeführt zu haben: Sie nimmt ihre gut dreißig Spielzeugpferde, füttert und tränkt sie und stellt sie nebeneinander auf; und sie faltet ihre Kleidungsstücke und legt sie ordentlich auf den Stuhl, unter dem bündig ihre Schuhe stehen wie auf einem Stillleben. Dieser Ordnungsdrang erreicht seinen Höhepunkt, als Elizabeth am 16. März 1932 zu ihrem Geburtstag vom walisischen Volk ein Spielhaus in Lebensgröße geschenkt bekommt (Little House oder Y Bwthyn Bach auf Walisisch), ein Miniaturcottage, das der Architekt Edmund Willmott entworfen hat: vier Zimmer mit Kamin, fließend Wasser und Elektrizität, ein reetgedecktes Dach, weiße Mauern, blaue Fensterläden. Das Kindercottage ist groß genug für tea parties, zu denen Erwachsene keinen Zutritt haben, wie auf einer Reihe Fotos zu sehen ist, die um die Welt gingen. Es hat weiße Chintzvorhänge, Blumensofas, ein Radio, eine Küche mit Kühlschrank, Warmhalteplatte und Geschirrschrank samt Töpfen und Gläsern, ein Bücherregal mit den gesammelten Werken von Beatrix Potter, selbst ein Telefon gibt es.[11] Das Little House findet seinen Platz in der Royal Lodge im Windsor Great Park und wird zu Lilibets sommerlichem Rückzugsort; mit fast eigensinniger Hingabe widmet sie sich dort der Kunst des Saubermachens, was sich in Zukunft als durchaus nützlich erweisen wird.
Thronerbin
(1934 – 1940)
Windsor Castle, 1942. Prinzessin Elizabeth neben ihrem Vater, König George VI. Links die zwölfjährige Prinzessin Margaret. [3]
Royale Fotoreportagen
Prinzessin Elizabeth von York, die Enkelin König Georges V., im Park von Schloss Windsor mit ihrem Corgi, einem walisischen Hirtenhund.
Daily Mail, Februar 1934
Als Lisa Sheridan am Morgen des 7. Februar 1934 die Zeitungen aufschlägt, trifft sie fast der Schlag: Nicht nur die Daily Mail, auch der Daily Express, der Mirror, der Evening Standard und die Zeitschrift House Beautiful füllen ganze Seiten mit Bilderstrecken und Ratschlägen zur Aufzucht und Pflege von Hunden.
Mit ihren Fotos!
Die Aufnahmen sind als Auftragsarbeit für das Buch Our Princesses and their Dogs von Michael Chance entstanden, das die beiden Prinzessinnen »allen Kindern« widmen, »die Hunde lieben«. Und nun hat der wortbrüchige Verleger tatsächlich die Frechheit besessen, die Bilder weiterzuverkaufen, ohne im Besitz der Rechte zu sein! Dahin all ihre schönen Erinnerungen an die Nachmittage in Piccadilly und der Royal Lodge, der Residenz der Yorks in Windsor. Als die Prinzessinnen mit ihren Labradorhunden Mimsy, Stiffy und Scrummy posierten, mit dem Cockerspaniel Ben, dem Golden Retriever Judy und immer wieder mit Jane und Dookie, ihren Corgis mit den spitzen Mäulern und den fledermausgroßen Ohren. Ohne lange nachzudenken oder auch nur mit dem treulosen Verleger gesprochen zu haben, verfasst Lisa einen Brief an den Herzog und die Herzogin von York. Eine spontane Reaktion, von der sie sich allerdings nicht viel verspricht: Die königliche Familie kommuniziert nicht mit Untertanen, schon gar nicht mit einer Fotografin, und sei sie noch so ehrgeizig und erfolgreich.
Doch nach einigen Tagen erhält Sheridan zu ihrer großen Überraschung eine Einladung zu den Yorks. Also steht sie zwei Wochen später mit Stativ, Rolleiflex und anderen sperrigen Geräten in Piccadilly 145. Sie ist nicht zum ersten Mal hier, schon 1927 traf sie bei einer Teatime bei ihrer Freundin Bobo MacDonald auf die kleine Lilibet, die bei ihrem Anblick sofort ihr Spiel unterbrach, sich an einem Sofa hochzog und das Händchen zum würdevollen Königsgruß hob.
Lisa Sheridans Bilder machen die Engländer auch mit den Corgis bekannt. Seit 1933 sind sie Elizabeths Lieblingshunde, als sie sich beim Spielen im Garden Park in einen Welpen des Viscount Weymouth verliebt, des zukünftigen Marquis von Bath. Auf ihr Bitten beauftragt der Herzog von York die Züchterin Thelma Gray, für die Mädchen zwei Corgiwelpen zu besorgen, eben Jane und Dookie. Innerhalb weniger Monate mausern sich die Corgis zu der beliebtesten Hunderasse Großbritanniens und verhelfen der »Königsfotografin« zu einer steilen Karriere.
Lisa Sheridan macht viel mehr als nur Bilder: Sie verwandelt das Image der Yorks von Grund auf, indem sie die Herzogin und den Herzog aus den Hinterzimmern der Fotostudios herausholt und erste Fotoreportagen von ihnen macht. Sheridan organisiert einstudierte, aber spontan wirkende Szenen, inszeniert ausgefeilte Alltagsbilder, fotografiert die Kinder während des Unterrichts oder beim Spiel mit den Pferden und anderen Spielsachen, sie lichtet Lilibet (ohne Sattel und ohne Helm) auf dem Rücken von Pony Peggy im Park ab oder wenn sie ein bisschen im Garten arbeitet und mit den Hunden spielt. Noch nie haben die Leser die Königsfamilie so privat gesehen, wie eine ganz normale Familie und ohne die gewohnte aristokratische Distanz. Und die Vertrautheit, die aus den Bildern spricht, erobert das ganze Land.
Erfolg ist kein Zufall
Lisa Sheridan ist auf dem Olymp der Fotografie angekommen. Ihren Erfolg verdankt sie der Begegnung mit Jimmy Sheridan und dem sicheren Gespür für eine neue Form der Werbesprache. Geboren 1893 in London wächst sie in St. Petersburg auf, wo die Familie eine Baumwollspinnerei besitzt. Als sie vor der Revolution aus Russland flieht, trifft sie auf der Reise James »Jimmy« Sheridan, einen alten Kindheitsfreund, der ihr Ehemann und über vier Jahrzehnte lang ihr Geschäftspartner wird. Jimmy meldet sich in Paris zum Militärdienst, muss aber seine Karriere bei der Armee aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Beide sind mittellos und ohne Arbeit, als sie auf einem Trödelmarkt eine funktionstüchtige Kamera erstehen und zu fotografieren anfangen. Und sie entdecken ein unerwartetes gemeinsames Talent: Während Jimmys technisches Verständnis weit über das Normale hinausgeht, entwirft Lisa immer neue Settings und hat ein ausgeprägtes Gespür für die Wirkung von Licht. Sie ziehen nach London und gründen nach den ersten kleineren Werbeaufträgen das »Studio Lisa« in Welwyn Garden, einem Städtchen nördlich der Hauptstadt in der Grafschaft Hertfordshire. Ihr Erfolg basiert auf einer neuen Art der Werbung: Für Plakate und Zeitungsanzeigen greifen Lisa und Jimmy nicht auf professionelle Models zurück, sondern fotografieren lieber ihre eigenen Nachbarn, perfekt gelangweilte Hausfrauen mit Einkaufstaschen und karierten Kleidern: Sie machen die Middle-Class-Familien aus den Vororten zu ihrem Markenzeichen.
Die informellen Nachbarschaftsporträts öffnen Lisa die Tür zur Verlagswelt, sodass sie schließlich das Buch von Michael Chance illustriert – und dann den wutentbrannten Brief schreibt, der ihre Eintrittskarte in die Adelswelt wird.
Auch als die Yorks den Thron besteigen, bleibt Lisa ihre Hausfotografin und wird von der frischgebackenen Königin engagiert, um das Image der Royals als fast »normale« Familie zu pflegen.
Der König ist tot. Lang lebe der König!
Mit einem Schlag ändert sich die Szenerie.
»Dass es ernst wird, begriff ich, als es im Radio hieß, das Leben des Königs neige sich dem Ende zu, und ich zeitgleich ein Telegramm erhielt, ich solle mich unverzüglich in Windsor einfinden. Der Herzog und die Herzogin waren in der Stadt und hatten eine Nachricht für mich hinterlassen: ›Sagen Sie es ihnen so, dass sie nicht traurig werden, Crawfie, sie sind ja noch so klein …‹ Ich behielt Lilibet und Margaret bis kurz vor der Beerdigung bei mir in Windsor und fuhr dann mit ihnen nach London. Margaret staunte, dass Allah immer wieder in Tränen ausbrach; Lilibet mit ihrer hohen Sensibilität fühlte bei allen mit und versuchte zu tun, was von ihr erwartet wurde.«[12]
Am 20. Januar 1936 stirbt George V., König von Großbritannien, Irland und den britischen Überseegebieten und Kaiser von Indien, in Sandringham House. Kurz davor vertraute er sich noch einem Mitglied des Hofes an: »Ich flehe zu Gott, dass mein ältester Sohn Edward niemals heiraten und Kinder haben wird und dass sich nichts zwischen Bertie und Lilibet und den Thron stellt.«[13] Zwei Tage später erweist die Lieblingsenkelin dem »Großvater Englands« in schwarzem Mäntelchen und mit schwarzem Hut die letzte Ehre in der Westminster Hall, wo seine Söhne David, Albert, Henry und George am Sarg des Vaters die Totenwache halten. Wieder zu Hause erzählt Lilibet ihrer lieben Nanny, dass trotz der vielen Tausend Trauergäste absolute Stille und Ruhe geherrscht und vor allem Onkel David sie tief beeindruckt habe: »Er hat sich kein bisschen gerührt, Crawfie. Nicht einmal geblinzelt.«[14] Dann erkundigt sie sich schüchtern, wie nun mit dem Onkel umzugehen sei und ob es ihr und Margaret überhaupt noch gestattet sei zu spielen.
Onkel David, mit vollem Namen Edward Albert Christian George Andrew Patrick David, der verwöhnte Erstgeborene und streitsüchtige Kronerbe, ist gut aussehend, blond, elegant und absolut stilsicher, verweigert sich aber hartnäckig einer offiziellen Beziehung und bietet immer wieder Anlass zu Skandalen, indem er sich mit verheirateten Frauen einlässt: Nun ist er König Edward VIII. Die aktuelle Geliebte heißt Wallis Simpson, wie ihre Freundin Thelma zu berichten weiß, die Gattin des Viscount von Furness. Edward steht ganz im Bann der Bürgerlichen, einer »abenteuerlustigen Amerikanerin ohne jede Ausstrahlung, die unermüdlich und mit extremer Wendigkeit in immer neue Betten springt, solange die Männer nur prominent genug sind«.[15] Zwei Ehen hat sie schon hinter sich, die erste, als Zwanzigjährige geschlossen, mit dem gewalttätigen und alkoholabhängigen Marinepiloten Win Spencer, die 1927 geschieden wurde; die zweite mit dem Reeder Ernest Aldrich Simpson.
Schon seit 1935 sind Edward und Wallis unzertrennlich, zeigen sich gerne auf ihren langen Reisen quer durch Europa, nehmen an offiziellen Veranstaltungen teil und werden wegen ihres in Adelskreisen rufschädigenden Verhaltens von der britischen Polizei überwacht. Als er es wagt, sie nach Buckingham Palace mitzubringen, lehnen George V. und Königin Mary ein Treffen ab.
»Der Junge wird sich nach meinem Tod innerhalb von zwölf Monaten ruinieren«,[16] lautete die Prophezeiung des Königs. Tatsächlich dauert die Regentschaft Edwards VIII. nur elf Monate oder, um genau zu sein, 326 Tage. Er ist ein unduldsamer Charakter, vernachlässigt die formalen Pflichten seines Amtes, lässt offizielle Briefe ungelesen und verletzt das Protokoll, indem er die Proklamation seiner Thronbesteigung durch das Fenster in Begleitung seiner Freundin Wallis Simpson verfolgt. Wie sein Privatsekretär Alan Frederick Lascelles, genannt Tommy, feststellt: »Pflicht, Würde und Selbstaufopferung hatten für ihn keinerlei Bedeutung.«[17] Umso begeisterter und dankbarer jagen ihn die Reporter: Ob als Prince of Wales oder als König – Edward ist die meistfotografierte Persönlichkeit seiner Zeit. Wallis wiederum gefällt sich in der Rolle der First Lady und präsentiert sich bereitwillig den Objektiven der Reporter – womit sie inoffiziell das Zeitalter jener Spezies einläutet, die Jahrzehnte später in aller Welt als Paparazzi verschrien sein wird. Die Skandalbeziehung spricht sich im Ausland herum, und als am 4. Januar 1937 Wallis’ von der Fotografin Maryon Parham aufgenommenes Porträt auf der Titelseite der Time erscheint und sie zur »Frau des Jahres« gekürt wird, kann auch die amerikanische Klatschpresse sie sich allmählich als Königin vorstellen.
Wenige Monate zuvor ist Wallis geschieden worden, und Edward VIII. plant, sie zu ehelichen, obwohl die Church of England, deren Oberhaupt er als König ist, die Möglichkeit der Wiederverheiratung für Geschiedene ausschließt, solange der ehemalige Partner noch lebt.
Das bringt das Fass zum Überlaufen.
Premierminister Stanley Baldwin schiebt der Hochzeit den Riegel vor. In einer hochemotionalen Unterredung in Buckingham Palace teilt er dem König mit, die Regierung werde geschlossen zurücktreten, sollte er seine Heiratspläne nicht aufgeben. Auch der Herzog und die Herzogin von York, die Wallis verabscheuen, sind wutentbrannt und sorgen sich um die Zukunft. Nur die Untertanen haben nicht die leiseste Ahnung, in welcher tiefen Krise die Monarchie steckt. Eine Glocke des Schweigens hängt über der Fleet Street: In unausgesprochener Übereinkunft mit der Regierung entscheiden sich die englischen Zeitungen, zu leugnen, abzuwiegeln oder einfach gar nichts zu schreiben. Bis es am 3. Dezember zur Enthüllung kommt, die Presse eine Kehrtwende macht und die Einzelheiten einer Liebe offenbart, die im Ausland seit Monaten bekannt ist. Alle wichtigen Tageszeitungen titeln:
Der König und seine Minister. Schwere Verfassungskrise.
Nun, da er die politischen Konsequenzen seines unbedachten Handelns zu spüren bekommt, seine Beziehung aber nicht beenden will, beschließt der König, den Lauf der Geschichte zu ändern, und dankt ab.
Bertie wird von einer schrecklichen Angst erfasst, doch aller Widerstand ist zwecklos: Nun ist die Reihe an ihm, den Thron zu besteigen, den er mehr fürchtet als alles andere. Als die Mutter ihn zu sich ruft, bricht er vor ihr in Tränen aus, was zu jener Zeit und in dieser Familie fast unvorstellbar ist. Auch seinem wertvollen Ratgeber Louis »Dickie« Mountbatten schüttet er sein Herz aus, dem Großneffen von Königin Viktoria: Noch nie hat Bertie irgendwelche Staatspapiere in den Händen gehalten und fühlt sich für die Rolle als König alles andere als vorbereitet. Außerdem quält ihn die Vorstellung, der Öffentlichkeit sein wirres Stottern offenbaren zu müssen. Der Historiker Andrew Roberts erinnert sich an diese schwierigen Stunden und wie unbegründet die Befürchtungen zumindest in Teilen waren: »Wenn er nicht unter Druck steht, ist Albert sehr wohl in der Lage, ohne das mindeste Stottern eine private Unterhaltung zu führen.«[18]
Aber reicht das für einen zukünftigen König?
Und Lilibet? Sie liebt Onkel David, ihre gemeinsamen Spiele in der Nursery und die Bücher, die sie lesen (einer ihrer Lieblingstitel ist Pu der Bär), und doch muss sie nun mit dem Staunen des Kindes beobachten, wie sich alles um sie herum verändert.
Der sichere Hort Piccadilly hat Risse bekommen.
Der Hofknicks
Es dunkelt bereits, als Edward VIII. in Anwesenheit der Brüder Albert, Henry und George am Mahagonischreibtisch seiner Residenz Fort Belvedere im Park von Windsor seine Unterschrift unter den ersten freiwilligen Thronverzicht in der über tausendjährigen Geschichte der britischen Monarchie setzt.
Im Raum herrschen weder Trauer noch Zorn.
Die Sache braucht eine zügige Lösung.
Hätte man noch zwei Wochen gewartet, wäre die Weihnachtsansprache umso überraschender ausgefallen, mit besten Festtagswünschen und einer Abdankung inklusive. Doch als der BBC-Generaldirektor John Reith am Abend des 11. Dezember 1936, einem Freitag, die Sendungen für eine Rede »Seiner Königlichen Hoheit Prinz Edward« unterbricht, versammeln sich die Völker Großbritanniens, Irlands und der britischen Dominien in Übersee vor den Radiogeräten. In den Stuben der Bauernhöfe stellen die Landwirte ihre Bierkrüge auf den Tisch, in den Restaurants der Londoner City legen die Banker das Besteck beiseite, die Hausfrauen in Norfolk halten inne, die Kinder müssen still sein. Für die australischen Farmer in Alice Springs ist es 7:30 Uhr morgens, für die Studenten in Toronto fünf Uhr nachmittags, die Einwohner Vancouvers essen gerade zu Mittag, und die Angestellten in Sydney schalten in ihren Büros das Radio ein.
Sieben endlose Minuten.
Kein Stocken.
Kein Wort zu viel.
Der mittlerweile ehemalige König holt tief Luft, sucht einen würdevollen Tonfall und legt der Welt die Gründe dar, die ihn zu seiner unumkehrbaren Entscheidung bewogen haben:
»(…) ich möchte, dass Sie verstehen, dass ich bei meiner Entscheidung weder das Land noch das Empire vergessen habe, denen ich als Prince of Wales und zuletzt als König fünfundzwanzig Jahre lang zu dienen versuchte. Doch Sie müssen mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass es mir unmöglich erschien, die schwere Last der Verantwortung zu tragen und meine Pflichten als König in der von mir gewünschten Form zu erfüllen ohne die Hilfe und die Unterstützung der Frau, die ich liebe.«[19]
Während er weiterspricht, sitzt Wallis mit eingefrorenem Lächeln hinter ihm.
Das Parlament stimmt für den His Majesty’s Declaration of Abdication Act, alle Parlamente des Commonwealth ratifizieren das Abdankungsgesetz, und Albert verleiht als König George VI. seinem Bruder den Titel »Seine Königliche Hoheit Herzog von Windsor«.
Lilibet schläft selig in der Nursery in Piccadilly. Sie ist nicht länger die Little Princess und auch nicht Elizabeth von York, sondern die heiress presumptive, die mutmaßliche Thronerbin Englands und des größten Reiches der Welt. Allein die Geburt eines Bruders könnte sie in den glücklichen Zustand der Anonymität zurückversetzen, in dem sich der Lauf der Dinge noch stoppen ließe.
Am nächsten Morgen steht sie an dem Fenster, das auf die hellen Flächen des Green Park hinausgeht, ihren Lieblingsort, wo ein Zauber über der Landschaft zu liegen scheint. Zusammen mit Crawfie beobachtet sie das Kommen und Gehen der Minister, Würdenträger, Bischöfe, Erzbischöfe und Politiker, die ihren Antrittsbesuch beim Vater machen. Ihre Mutter hütet mit einer schweren Grippe das Bett, und so ist es an Marion Crawford, ihr die bevorstehende Veränderung mitzuteilen: den Umzug nach Buckingham Palace.
Es fängt an zu regnen. Eine leichte Brise weht den Duft von Nässe durch das gekippte Fenster, und es scheint, als würden die Regentropfen nach und nach Lilibets Kindheit mit sich nehmen.
»Wie bitte?«, fragt sie kleinlaut nach.
»Meinst du, für immer?«, jammert die kleine Margaret.
Es bedeutet nicht das Ende der Welt, nur das Ende ihrer Welt.
Der Regen trommelt nun an die Scheibe.
Elizabeth geht hinunter zum Vater, um ihn zu verabschieden. Er umarmt sie ungelenk in seiner steifen Admiralsuniform. Die Gouvernante erklärt den Mädchen, dass sie ihn nach seiner Krönung anreden müssen wie früher den Großvater.
»Müssen wir auch einen Hofknicks machen?«
»Und später wirst du dann Königin?«
»Ich nehme es an«, antwortet Elizabeth ihrer Schwester mit leiser Stimme.
Worauf Margaret ein wenig altklug seufzt: »Du Ärmste.«
Einige Stunden später werden die Mädchen zu den Eltern geführt. Elizabeth und Margaret knicksen vor dem König und der Königin. Etwas Neues, Endgültiges liegt in dem nach Puder duftenden Kuss der Mutter und der Umarmung des Vaters, als er den Mädchen aufträgt, sich fertig zu machen, damit sie sofort nach Windsor aufbrechen können, wo kein Butler, zumindest fast keiner, das letzte Wochenende von us four stören wird.
Ende der Leseprobe