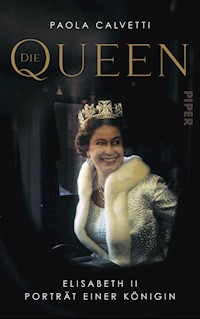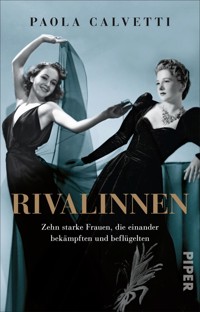
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Einige der außergewöhnlichsten Leistungen des letzten Jahrhunderts wurden von Frauen erbracht, die danach strebten, sich gegenseitig zu übertreffen. Sie waren Pionierinnen auf ihrem Gebiet, die nicht nur gegen gesellschaftliche Normen, sondern auch gegeneinander kämpften, um sich durchzusetzen. Auf diese Weise haben sie die Industrie, die Mode, die Unterhaltung und den Journalismus maßgeblich mitgeprägt. Dieses Buch versammelt zehn außergewöhnliche Frauen mit starker Persönlichkeit, Tatkraft und visionärem Gespür – inspirierend und unterhaltsam. Sarah Bernhardt - Eleonora Duse, Theaterschauspielerinnen Helena Rubinstein - Elizabeth Arden, Unternehmerinnen Gabrielle Chanel - Elsa Schiapparelli, Modeschöpferinnen Louella Parsons - Hedda Hopper, Klatschkolumnistinnen Olivia de Havilland - Joan Fontaine, Filmstars
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Le Rivali« bei Mondadori, Mailand
© Mondadori Libri S.p.A., Milano, 2021
Für die deutsche Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München 2022Covergestaltung: Cornelia Niere nach einem Entwurf von mara scanavino project
Covermotiv: vorne: George Hurrell / Kontributor / Getty Images (Olivia de Havilland); Bridgeman Images (Joan Fontaine)
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen ohne Alternativtexte:
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Sarah Bernhardt | Eleonora Duse
Gegenseitige Verehrung
Die Offenbarung
Eine gestohlene Kindheit
Lieber Schauspielerin als Ehefrau
Primadonnen im Spiegel
Mütter
Ein Theater für sich allein
Diva gegen Diva
Autoren liegen ihnen zu Füßen
Alles ist erlaubt, Hauptsache, es wird (über mich) geredet
Eine Schauspielerin verschwindet
High Infidelity
Pas d’oubli dans mon cœur
Endspiel
Göttlich für immer
Coco Chanel | Elsa Schiaparelli
Innen/Nacht
Einsame Seelen
Gefühlsgespinste
Kämpferinnen
Was vom Traume übrig blieb
Der Duft der Frauen
Armenischer Schatz
Verliebt in Tweed
Kriegserklärung
Schneiderinnen, Künstlerinnen, Rivalinnen
Stardust
Rosa im Quadrat
Sitzkrieg
Lügen und Geheimnisse
Innen/Tag
Die letzte Modenschau
Innen/Nacht
Helena Rubinstein | Elizabeth Arden
Suffragetten
Eine heiratsfähige junge Frau
Ein geheimnisvolles Datum
Auf jedes Ende folgt ein neuer Anfang
Es gibt keine hässlichen Frauen, nur faule
Die rot lackierte Tür
Europa: einmal hin und zurück
Häuserkampf
Geliebte Feindin
Jahrmarkt der Eitelkeiten
Wer hat mir den Mann weggenommen?
Achtung, es wird gedreht … und gestritten
Wartime
Leidenschaften
Die Kunstliebhaberin
Die Blumenliebhaberin
Prinzessinnen
Abenddämmerung
Hedda Hopper | Louella Parsons
Ein brüchiger Frieden
Sob sisters
One-Way-Ticket
Die schönsten Beine des Broadway
New Yorker Geschichten
Monster zum Verlieben
Die lustigen Weiber von Hollywood
Liebe und andere Katastrophen
Scoop – Der Knüller!!!
Her Master’s Voice
Moralapostelinnen
Gefallen und Gunstbeweise
Boulevard der Dämmerung
Joan Fontaine | Olivia de Havilland
Lady Oscar
Süße Rache, kalt serviert
Im Namen der Mutter
Wir waren uns so verhasst
Absagen, Proben und Triumphe
Ein historisches Urteil
Herzblatt
Meine liebe Rabenmutter
Von wegen auf Rosen gebettet!
Die drei L
Dank
Bildteil
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Alessandra Ferri gewidmet,
ihrer außergewöhnlichen künstlerischen Begabung
und unserer unverbrüchlichen Freundschaft.
Die keine Rivalinnen kennt.
Sarah Bernhardt | Eleonora Duse
Eleonora Duse zieht die Handschuhe der anderen an, nur dass sie sie verkehrt angezogen hat. Und all das hat sie mit einer unendlichen Grazie und einer unbekümmerten Unbewusstheit getan. Sie ist also eine große Schauspielerin, sogar eine sehr große Schauspielerin, aber sie ist keine Künstlerin.
SARAH BERNHARDT
Sarah, ich kann das Urteil, das Sie über meine Kunst gefällt haben, nicht ignorieren – ich kann es weder ignorieren noch akzeptieren, noch vergessen.
ELEONORA DUSE
Gegenseitige Verehrung
Paris, 1. Juni 1897
Im Saal des Théâtre de la Renaissance hält man den Atem an. Es ist ein erhabener Moment. Mit der Anmut eilfertiger Dienerinnen huschen die Lichter Richtung Dunkelheit. Eine einzige Loge beleuchtet: Der Auftritt der divine scandaleuse, der als göttlich gefeierten und skandalös verrufenen Berühmtheit des französischen Theaters, ist nicht zu übersehen. Ein Auftritt, der demjenigen, der in wenigen Minuten auf der Bühne erwartet wird, in nichts nachstehen darf.
Sarah Bernhardt – ihr legendäres rotes Haar ist mit Rosen bekränzt, sie trägt ein Kleid aus Seidendamast und eine Kette mit einer auffälligen schwarzen Perle – kommt leichtfüßig einhergeschritten. Ihre hypnotisierenden grünen Augen strahlen die Zuschauer an. Das Licht hebt deutlich scharlachrote, zu einem maliziösen Lächeln verzogene Lippen hervor. Mit einem Nicken bedeutet sie ihrem Sohn Maurice und dessen Frau, Prinzessin Maria Teresa Wirginia Klotylda Jablonowska, neben ihr Platz zu nehmen. In der Nebenloge erkennt das Publikum die Schauspielerinnen Réjane und Julia Bartet, Prinz und Prinzessin Murat und in der Loge darüber Prinzessin Mathilde Bonaparte, eine leidenschaftliche Kunstmäzenin. Im Parkett, neben den stocksteifen französischen Kritikern und den aus Wien, London und Berlin angereisten Journalisten, sitzt ein Haufen bis gerade eben noch lebhaft schwatzender Italiener. Nicht anwesend ist der italienische Dichter Gabriele D’Annunzio, und das ist kein Zufall.
Das jetzt in Schweigen gehüllte Publikum wagt es nicht, die Erhabenheit dieses Moments auch nur durch einen schüchternen Applaus zu stören. Alle wissen, dass dieses Theater Sarahs Zuhause ist, dass sie es ersteigert hat und seit dem 25. Mai 1893 regiert wie die Zarin eines kleinen Imperiums. Alle haben gelesen, dass sie ein Vermögen für den Umbau ausgegeben und die Zuschauergewohnheiten auf den Kopf gestellt hat, denn gekaufter Applaus beziehungsweise ebensolche Buhrufe und turmhohe Frisuren, die den Blick verstellen könnten, sind nun verboten. Selbst wenn es für die Pariser, die sich nur bedingt für das Stück und dafür umso mehr für Skandale interessieren, in erster Linie ein gesellschaftliches Ereignis ist, bei dem Kunst mit Klatsch und Tratsch Hand in Hand geht, ist niemandem entgangen, dass diese Uraufführung anders ist als alle davor. Die neunhundert Plätze waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft.
Schon in den letzten Tagen ließ die von krankhafter Neugier getriebene Pressemeute nichts unversucht, um an Sarahs Gast heranzukommen, über den die Zeitungen schon seit Wochen berichteten. Um diese Dame aus nächster Nähe sehen zu können, gaben sich Reporter als Kutscher aus und fuhren sie zum Hotel, servierten ihr in Kellnerschürze das Frühstück oder ließen sich als Bühnenarbeiter am Théâtre de la Renaissance anstellen.
Der berühmten italienischen Schauspielerin haben die höheren Weihen von Paris bisher noch gefehlt.
Und da ist sie auch schon, dank der erstaunlichen Großzügigkeit Sarah Bernhardts, die, nachdem sie vom Impresario Joseph Schürmann erfahren hatte, dass »die Kollegin« nach einem Theater für ihr Frankreich-Debüt sucht, keine Sekunde zögerte, ihr ein Gastspiel anzubieten: um sie zu vernichten? Oder um ihr ihre Überlegenheit zu beweisen?[1] Es ist bestimmt ein Versehen, dass man ihr eine ebenso unpraktische wie schmucklose Garderobe zugewiesen hat, die sie zwingt, die Bühne über eine Feuertreppe zu betreten. Die Garderobe Sarahs steht nicht zur Verfügung, vollgestopft, wie sie ist, mit ihren Kostümen, die selbstverständlich nicht weggeräumt werden können.
Doch Eleonora Duse ist derjenigen dankbar, die sich als »größte Schauspielerin aller Zeiten« feiern lässt, und bereit, sich dem anstrengenden vierwöchigen Probemarathon zu stellen, sich jeden Abend in einem anderen Stück mit ihr zu messen: Heimat von Hermann Sudermann, Mirandolina von Carlo Goldoni, Claudes Gattin von Alexandre Dumas dem Jüngeren, Cavalleria rusticana von Giovanni Verga und dann noch der Einakter, den Gabriele D’Annunzio widerwillig für sie geschrieben hat: Traum eines Frühlingsmorgens. Denjenigen, die ihr rieten, auf Französisch zu spielen, sagte sie mit patriotischem Stolz, dass »im Théâtre de la Renaissance bis zum 30. Juni Italienisch gesprochen wird«.
Unter Vermittlung von Graf Giuseppe Primoli und dem Dandy Graf Robert de Montesquiou, Marcel Prousts Mentor und Freund von allen, die in Paris Rang und Namen haben, umarmten sich die beiden Primadonnen vor wenigen Stunden in Sarahs Atelier wie zwei alte Freundinnen. Wer das Glück hatte, bei dieser Schmierenkomödie dabei zu sein, berichtete, das Treffen sei wie ein schwindelerregender elektrischer Kurzschluss gewesen, »ein Aufeinanderprallen«, wobei sich die beiden Bühnendamen »so fest umarmt haben, dass es so aussah, als würden sie miteinander ringen«.[2]
Ah, das Theater, eine einzige Kunst der Verstellung!
In ihrer Loge lässt sich Sarah nun von ganz Paris für ihre uneigennützige, großzügige Geste bewundern. Sie wird während der gesamten Vorstellung fast völlig regungslos verharren, nur an normalerweise wenig beachteten Stellen applaudieren. Und diese von den meisten ignorierten Momente werden ausschließlich ihr gehören. Auch wird sie sich Zeit nehmen, um ihre Gäste und diejenigen, die sie in den Pausen zwischen den Akten besuchen, zu unterhalten.
Im Grunde tut sie einfach nur einen Gefallen.
Es war der 14. April, als die hochelegant in einen Mantel von Paul Poiret gekleidete Eleonora Edmond Rostands Weib von Samaria in der Ehrenloge sah, die zu diesem Anlass mit weißen Orchideen geschmückt war. Als der Vorhang aufging, warf ihr die Französin einen Luftkuss zu, den die Italienerin leise seufzend erwiderte.
Wie ein Engel in Gestalt einer ernsten Puppe blieb sie während der gesamten Aufführung in ehrfürchtigem Respekt stehen.
Heute Abend ist die ätherische Duse an der Reihe, sich dem Urteil der Bernhardt zu stellen, und zwar im Meisterwerk von Dumas dem Jüngeren, der Kameliendame – nicht zufällig die Titelrolle, mit der sich Sarah in die Herzen der Welt spielte. Sei es nun dreiste Frechheit oder schlichte Provokation – nach Jahren des indirekten Wettbewerbs bekommt das Publikum die Animositäten zwischen den beiden Primadonnen jetzt wie auf dem Silbertablett serviert.
Denn da gab es schon den Winter 1893 in Neapel, als die Duse im Teatro Sannazaro auftrat und die Bernhardt im Bellini: Der Adel in den Logen und vorderen Parkettreihen begeistert sich ganz snobistisch für die Französin, während die Kritiker, auch wenn sie sich von der exotischen Anziehungskraft der Ausländerin durchaus verführen lassen, von der Landsmännin aus der Lombardei erobert werden. Von einer Garderobe zur anderen werden Blumensträuße geschickt: gespielte Höflichkeit. Besuche? Kein einziger. Auch wenn anonyme Zeugen berichten werden, Eleonora habe einen ihr treu ergebenen Freund gebeten, ihr einen Platz in Galerienähe zu besorgen, und sei heimlich vollständig vermummt ins Bellini gegangen.[3]
In London wird das Duell im Frühling 1895 keinen Kilometer voneinander entfernt ausgetragen: Sarah tritt im Daly’s Theatre am Leicester Square auf, Eleonora im Drury Lane Theatre, sie spielen im selben Stück: Heimat von Sudermann.
»Die Rivalität zwischen den beiden ist mit Händen zu greifen«[4] – zur großen Freude der Kritiker und Journalisten, die zwischen den Theatern pendeln und ebenso hin- und hergerissen sind zwischen den manierierten Posen der Bernhardt und der sanften Natürlichkeit der Duse. Darunter auch George Bernard Shaw, damals Theaterkritiker bei der Saturday Review. »Ganz aufgeregt, weil er die Duse als Gerte benutzen kann, um die Bernhardt auszupeitschen«,[5] wohnt er mehreren Aufführungen bei und analysiert die jeweiligen Interpretationen, ohne sich vollständig entscheiden zu können – so hält er fest, dass »Sarah Bernhardt den Zauber einer noch frischen, aber etwas verwöhnten, mutwilligen Reife besitzt, dafür aber stets ein die Wolken durchbrechendes Sonnenscheinlächeln zur Hand hat, sobald man nur genug Wesens aus ihr macht (…) Sie dringt nicht in den Charakter ein, den sie darstellt, sie setzt sich an seine Stelle«, während der Duse »fünf Minuten auf der Bühne genügen, und sie ist der schönsten Frau der Welt um ein Vierteljahrhundert voraus. Im Vergleich zu ihr kann nur das Wort ›Vernichtung‹ der Niederlage der französischen Tragödin gerecht werden«.[6]
Bereits im Vorjahr erhielt ausschließlich die Italienerin das Privileg, in Schloss Windsor vor Queen Victoria aufzutreten – die dem »Bastard« einer Prostituierten eine solche Ehre niemals gewähren würde –, wie die bigotte Königin am Abend des 18. Mai 1894 ihrem Tagebuch anvertraut: »Um Viertel vor zehn haben wir uns alle in den Weißen Salon begeben, in dem eine kleine Bühne aufgebaut wurde, und die berühmte Italienerin, Signora Duse, hat uns etwas aus einem Stück namens Mirandolina vorgespielt. Sie ist anmutig und hat eine sehr attraktive Stimme und Ausdrucksweise. Außerdem spielt sie wunderbar.«
Die Bernhardt sieht das anders. Nachdem sie das Drury Lane heimlich über einen Privateingang betreten hat, fällt sie ihr Urteil, verpackt in ein Wortspiel: »Elle n’est pas une actrice, elle est une femme divigne«. – »Sie ist keine Schauspielerin, sie ist ein ganz gewöhnliches Weib.« Keine »Göttliche« (divine) wie sie selbst also, sondern eine »Gastwirtin« (divigne).
Im Jahr darauf setzt sich die Rivalität jenseits des Ozeans fort, als beide wieder mit denselben Stücken, Die Kameliendame und Heimat, durch die Vereinigten Staaten touren und das Interesse der Klatschpresse auf sich ziehen: Am 17. Februar 1896 tritt die Duse im Lafayette Square Opera House in Washington auf und wird von Präsident Grover Cleveland zum Tee ins Weiße Haus eingeladen. Eine Ehre, die der Bernhardt nicht zuteilwird, die im selben Zeitraum auf den New Yorker Bühnen triumphiert, während sie sich über die demonstrative Straßenbahnwerbung ärgert, die die unmittelbar bevorstehende Ankunft von »Eleonora Duse – The Passing Star« verkündet. Die Journalisten, die ihre Extravaganzen lieben, halten zu Sarah, mit Ausnahme des Kritikers des New York Dramatic Mirror, der betont, dass die Ausstrahlung der Duse die der Bernhardt übersteige, weil sie wahrhaftig sei, die Bernhardt dagegen theatralisch.[7]
Und das Ergebnis? Unentschieden.
Auch weil noch Russland, Österreich und Deutschland beteiligt waren, die beide bejubelten. Wie an dem Abend zu Ehren von Dumas dem Jüngeren mit der Bernhardt in Die Kameliendame und der Duse im zweiten Akt von Claudes Gattin, als sich die beiden Schauspielerinnen zum ersten und einzigen Mal Hand in Hand vor dem Publikum verbeugen.
Aber an diesem Abend in Paris, bei einem Treffen, das eher aus mondänen als aus kulturellen Gründen in Erinnerung bleiben wird, droht die Überlegenheit der Bernhardt von ihrer Rivalin untergraben zu werden, die, auch wenn sie es nicht ausspricht, danach strebt, ihr den Beinamen »Die Göttliche« zu entreißen. Und sich vielleicht dafür zu rächen, dass ausgerechnet die Französin, die sie selbst einst rückhaltlos bewunderte, ihr erst vor wenigen Monaten Die tote Stadt weggeschnappt hat, ein Stück, das ursprünglich von »ihrem« D’Annunzio extra für sie geschrieben wurde.
Was sie an diesem Abend miteinander verbindet, ist ein Name: Marguérite Gauthier – die Kameliendame.
Und was sie von allen anderen unterscheidet, ist das rätselhafte Phänomen Talent.
Nervös, aufgeregt und voller Angst steht die Duse hinter den Kulissen, »blasser als sonst, wie ihre Feinde beim Aufgehen des Vorhangs nicht unerwähnt lassen, ungewöhnlich elegant«.[8] Trotz der Anmut, mit der sie Einzug hält, bekommt die Bernhardt Gänsehaut – oder ist sie verärgert? Vor Sarahs smaragdgrünen Augen entbrennt und verzehrt sich da eine Frau nach Armando … in Unterwäsche! Wo ist der Faltenwurf prächtiger Kostüme, wo die glühende, verwegene Leidenschaft »ihrer« Marguérite?
Hat diese Italienerin etwa vergessen, dass die Figur eine Prostituierte ist?
Von der Perlenkette des Couturiers Jean-Philippe Worth einmal abgesehen keinerlei Schmuck, kein Ring an den feingliedrigen Fingern, die die Duse in die Luft streckt, als wollte sie nach den Wolken greifen. Keine Spur von Schminke in ihrem Gesicht, und im Bühnenlicht kann man die ersten vorzeitig ergrauten Strähnen in ihrem schönen dunklen Haar erkennen.
Sarah ist dreiundfünfzig.
Eleonora ist vierzehn Jahre jünger.
Dem Publikum, das die Bernhardt gewöhnt ist, kommt die Duse vor wie eine harmlose weiße Kamelie. Sie erobert es ganz ohne Schreie, Tränen oder Schluchzer; es wirkt fast so, als spielte sie gar nicht, und dennoch erzählt sie mit den Händen viel mehr als nur das, was Dumas’ Verse heraufbeschwören, um das Schicksal einer Frau begreiflich zu machen, die geliebt, erniedrigt und am Ende besiegt werden wird. Sie streckt sich auf einem Sofa aus und reckt die Arme. Als ihr Armandos Vater angekündigt wird, damit die Zuschauer das Drama erahnen, das sich in Kürze abspielen wird, braucht sie nur zwei Schritte, um zurückzuweichen, und als sie den Brief schreibt, in dem sie ihrer Liebe entsagt, ist sie vollkommen beherrscht, wie distanziert, ja fast schon geistesabwesend.
Doch es ist der letzte Akt, in dem Eleonora ihrer Rivalin das Messer ins Herz rammt.
Die Bernhardt hat das Publikum an wildes Zucken und Stöhnen gewöhnt; die Duse liegt ausgestreckt da, den Kopf in den Kissen wie eine verwelkte Kamelie. Den Nacken des Geliebten umschlungen wartet sie auf den Tod. Stumm lässt sie erst den rechten und dann den linken Arm von seiner Schulter rutschen. Als auch der inzwischen kraftlose Kopf zur Seite fällt, ist sie tatsächlich ein lebloses Geschöpf.
Der Vorhang fällt. Der gesamte Saal ist in Tränen aufgelöst.
Auf der Bühne regnet es Blumen.
Nach einem zwanzigminütigen Applaus, befeuert durch die übertriebene Begeisterung der Italiener, steht die Duse allein in der Bühnenmitte, den Oberkörper leicht vorgebeugt. Sie sammelt sich, findet wieder zu sich selbst. Sie streicht eine ihr in die Stirn fallende Strähne zurück. Sie lächelt nicht, in ihren Augen ist keine Freude zu erkennen, sondern die Bescheidenheit derjenigen, die sich ihrer Rolle ganz untergeordnet hat und das Schicksal ihrer Figur annimmt.
Die Kritiker können gar nicht anders, als eine mit der anderen zu vergleichen.
Allerdings eher zugunsten von Sarah.
Während Jules Lemaître schreibt, die beiden Bühnengenies hätten keinerlei Gemeinsamkeiten, »die Unsrige« verfüge eher über das, was »wir« Stil nennen würden, während die Italienerin als sanfter und geheimnisvoller in Erinnerung bleibe[9], bemerkt der mächtige Altmeister der Theaterkritik Francisque Sarcey, »dass uns die Duse – sei es, weil sie die Figur so angelegt hat, sei es, weil sie sie gar nicht anders spielen kann – ein braves, alles andere als temperamentvolles Seelchen zeigt …«.[10] Der Schauspieler und Regisseur André Antoine hingegen ist begeistert: »Die Duse bleibt ganz sie selbst, ein Geschöpf von einer ganz wunderbaren Empfindsamkeit und Zartheit, zu keinem Zeitpunkt auf der Bühne sieht man die Kurtisane in ihr. Während Sarah sie mit Haut und Haaren ist.«
So oder so ähnlich äußern sich viele weitere Kritiker.
Sie alle werden gegen Ende der Tournee noch Abbitte leisten, einschließlich Sarcey, der, nachdem er Claudes Gattin und andere Stücke gesehen hat, seinen Artikel in Le Temps mit den eindeutigen Worten beschließt: »Die Duse geht siegreich aus der Auseinandersetzung hervor; sie hat uns etwas gezeigt, von dem wir alle lernen sollten … uns mit der schieren Kraft der Wahrhaftigkeit in den Bann geschlagen.«
Und als die Truppe der Comédie-Française, seit Jahren Sarahs Zuhause, eine Art Abschiedspicknick im Bois du Boulogne für Eleonora gibt und Schauspieler wie Schauspielerinnen ein Loblied auf sie singen, erspart eine aufgebrachte Bernhardt der Duse keine noch so beleidigenden Vorwürfe: »Die wollen mich zu Grabe tragen«, beschwert sie sich in einem Brief an Montesquiou, »all das ist niederträchtig, einschließlich der Duse, die ein falsches Spiel spielt … Die italienische Künstlerin ist ein scheinheiliges, verwerfliches Geschöpf. Sie hat mir nicht mal geschrieben, um sich zu bedanken oder sich zu verabschieden.«[11]
Gut möglich, dass sie im gedämpften Licht ihrer Loge erstmals die Gefahr einer tatsächlichen Widersacherin gewittert hat. Bei Sarah bleibt das Gefühl zurück, veraltet zu sein. Sie hat das moderne Theater »gesehen« und weiß, dass das nichts für sie ist. Sie ahnt nicht, dass ausgerechnet sie es war, die Eleonoras schlummerndes Talent einst geweckt hat. Die ließ, bevor sie sich in die enge Garderobe zurückzog und zur Loge der großen Tragödin hinüberschaute, einen Abend vor fünfzehn Jahren Revue passieren. Nachdem sie gehört hatte, die berühmte Sarah Bernhardt werde in die Hauptstadt des Piemonts kommen, wohnte sie einer ihrer Aufführungen bei.
An jenem Abend, im Dunkel des Saals, wurde der Grundstein zu ihrer Rivalität gelegt.
Die Offenbarung
Am 25. Februar 1882 spielt Sarah Bernhardt in Turin Die Kameliendame. Vor ihrem Eintreffen gab es einen Riesenhype – »alles redet nur noch von ihr … in der Stadt und im Theater«.[12] Begleitet wird sie von einer Entourage aus getreuen Anhängern, von einem angeleinten Löwenwelpen und von ihrem unbedeutenden Ehemann Aristides Damala. Im Teatro Carignano summen die Logen wie Bienenstöcke, überall Schemen, die sich wie Geister zwischen verblichenem Samt und lackiertem Dekor verbergen. In einem Sessel im Parkett kauert Eleonora, die der Aufführung fiebernd und geschwächt beiwohnt.
Als die Bernhardt die Bühne betritt, wirft sie dem Publikum Küsse zu. Sie verneigt sich tief, um den Zuschauern anschließend den Rücken zuzukehren und langsam, katzengleich, in die Mitte der Bühne zu schreiten. Getröstet von der Dunkelheit im Saal lässt sich Eleonora von ihrer Magie verzaubern, die das Theater für sie in ein Reich der Träume verwandelt. Doch nur wenige Verse, und solche Klischees lösen sich in Luft auf: Schon bei den ersten Sätzen erfasst die »goldene Stimme« Logen und Parkett wie Lava. Sarah ist Marguérite, auf eine einzigartige Weise, sie ist schön und deklamiert virtuos, mit jeder Faser ihres Körpers. Während sie Armando schreibt, kaut sie am Federkiel, zerreißt ein Blatt nach dem anderen, lässt ihre Stimme erzittern: Jede Geste ist meisterlich einstudiert. Als der Vorhang aufgeht, nimmt eine mondäne Geschichte ihren Lauf, die zu einer langen Agonie wird und mit der kalten Einsamkeit des Todes endet. Während sie als Marguérite in den Armen des Geliebten dahingerafft wird, steht die Bernhardt bis zum letzten Moment und sinkt ihm dann mit einer schwindelerregenden Drehung an die Brust: ihre »Spezialität«. Als sie die Bühne nach den Ovationen eines elektrisierten Publikums verlässt, hat Eleonora das Gefühl, dass sogar ihr Abgang mit skandalöser Meisterschaft einstudiert ist. Manche finden ihr Spiel »hysterisch«, aber »keine schluchzt, verzweifelt und stirbt so schön wie die Bernhardt«.[13]
Auch wenn Marguérite eine Vulgarität besitzt, die so ganz anders ist als die Unschuld, an die Eleonora glaubt, hat sie es dieser Begegnung aus der Ferne zu verdanken – »ich bin jeden Abend hin, um sie zu erleben und zu weinen!« –, dass sie spürt: Jetzt ist der Moment gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. »Als Reaktion darauf fühlte auch ich mich wie befreit, glaubte, das Recht zu haben, alles zu tun, was ich will, statt das, was mir auferlegt wird.«[14] Die Französin wird zu einer Quelle der Inspiration und Genugtuung, zu einem Vorbild in Sachen Unabhängigkeit und Autonomie. Mit siebenunddreißig und genug Geld, um auf eigenen Beinen zu stehen, ist Sarah ein »one woman dramatic enterprise«; in einer Welt – dem Theater –, in der Frauen noch nicht das Recht haben, sich frei zu bewegen, hat die Bernhardt die kreative und finanzielle Kontrolle über ihre Produktionen: Sie mietet die Theater an, sie engagiert die Schauspieler, sie wählt die Stücke aus, die sie auf den Spielplan setzt, sowie die Rollen, die sie interpretiert. Sie gibt das Bühnenbild und die Kostüme in Auftrag, sie kann damit rechnen, dass die Autoren ihr die Stücke auf den Leib schreiben.
»All das hat eine Frau geschafft!«, ruft Eleonora. In Turin hat man ihr einen lukrativen Vertrag angeboten, aber die Stücke sind mittelmäßig und die Einnahmen gering. Als Primadonna muss sie jeden Abend in eine andere Rolle schlüpfen, sei sie nun komisch oder tragisch, genial oder sentimental, heldenhaft oder albern – oft ohne wirklich davon überzeugt zu sein. Routine.
Sie steht am Rande eines Nervenzusammenbruchs, aber das, was da nach diesen Auftritten in ihr vorgeht, ist eine »Offenbarung«: Sie möchte ihr Repertoire ändern und sich und ihre Kunst überall auf der Welt zeigen. Sie strebt nicht danach, genauso zu spielen wie die Bernhardt, sondern danach, genauso unabhängig zu sein wie sie, um das Theater, das sie von klein auf kennt, für immer hinter sich lassen zu können.
Eine gestohlene Kindheit
Geborene Vagabundinnen oder Frauen, die vor etwas fliehen, mit dem sie gezeichnet sind? Was die beiden zukünftigen Primadonnen miteinander verbindet, ist der fieberhafte Drang, niemals innezuhalten, und zwar schon seit sie das Licht der Welt erblickten: Henriette Rosine Bernard am 22. Oktober 1844 in einer schönen Wohnung in der Rue de l’École-de-Médecine in Paris (oder am 23. in der Rue de La Michodière? Vielleicht auch einen Monat früher, so genau weiß man das nicht, weil die Heiratsregister und ihre Geburtsurkunde 1871 bei einem von den Kommunarden im Hôtel de Ville von Paris gelegten Brand restlos zerstört wurden); am frühen Morgen des 3. Oktober 1858 in einem bescheidenen Zimmer im Hotel »Al Cannon d’Oro« von Vigevano Eleonora Giulia Amalia Duse.
Tochter der sechzehnjährigen Judith von Hart, genannt Youle, und eines unbekannten Vaters die Französin. Erstgeborene des Vincenzo Duse, Künstlername Alessandro, und der auf einer Tournee im Zug von den Wehen überraschten Angelica Cappelletto die Italienerin. Zwei Geburten, die in Memoiren und Autobiografien durch Unmengen von falschen Erinnerungen, Verschleierungsversuchen und Auslassungen süßlich verbrämt werden, um die Spuren zu verwischen … auch wenn es natürlich schön und schrecklich romantisch ist, die Einzigartigkeit ihrer Kunst auf ihren ersten Auftritt auf der Bühne des Lebens zurückzuführen.
Eleonora ist die Tochter fahrender Komödianten, die sehr prekär leben: seltene Mahlzeiten, häufiges Frieren. Und »wie die Mannschaften der Chioggioter Segler durch die Meere, zieht nun die Truppe durch Venetien, die Lombardei, Piemont, die Romagna, geht bis nach Istrien und Dalmatien – die Häfen sind das Theaterspielen«.[15] Eleonora ist vier Jahre alt, als ihr Name das erste Mal auf einem Plakat der väterlichen Theaterkompanie für das Teatro di Chioggia auftaucht, und dort, auf diesen Brettern, die die Welt bedeuten, gibt sie die Cosette in einer Bearbeitung von Victor Hugos DieElenden, bei der ihr Onkel Enrico, der große Bruder des Vaters und ebenfalls Schauspieler, gemeinsam mit Giuseppe Lagunaz Regie führt.
Während Eleonora sich mit der Armut, in der die Familie lebt, abfindet, begehrt die kleine Sarah, in deren Adern das jüdisch-holländische Blut der Mutter fließt, schon bald gegen die Regeln auf. Der Vater? Wie gesagt unbekannt. Die Biografen schwanken zwischen einem gewissen Morel – Student aus dem Le Havrer Großbürgertum, einer der zahlreichen Liebhaber der Mutter – und dem Adligen Edouard de Thérard, der unter dem falschen Namen Bernhardt in den »mondänen Salons« (sprich Bordellen) ein und aus geht. Wer auch immer es ist: Dieses Phantom von einem Vater, den sie in ihrer Autobiografie Mein Doppelleben idealisiert, hat nicht die geringste Absicht, die Tochter anzuerkennen, und beschränkt sich darauf, seiner jungen Geliebten Alimente zu zahlen.
Youle möchte sie allerdings nicht um sich haben; das Neugeborene behindert ihre Karriere als Kurtisane. Sarah ist nur wenige Wochen alt, als ihre Mutter sie in die Obhut einer Amme gibt[16] und sie aufs Land schickt, in die raue Gegend um Quimperlé, wo ihre erste Sprache nicht Französisch, sondern Bretonisch sein wird. Mit drei Jahren der erste Sturz (ins Feuer, als sie sich von ihrer Amme losreißt – ein wichtiger Hinweis auf ihre Zukunft), monatelange häusliche Pflege mit Butter- und Milchbädern, dann in Paris, wo die inzwischen verwitwete Amme den Hausmeister eines feuchten Herrenhauses in der Rue de Provence heiratet. Dort erkrankt Sarah im Nu an Tuberkulose.
Das Leben ist von Anfang an ein Drama für dieses unruhige Kind, das die anderen gerne verblüfft, indem es vor aller Augen seinen zweiten spektakulären Sturz aufführt: In einer kindlich-heroischen Geste und in der Hoffnung, mit Mutter und Schwester wiedervereint zu werden, stürzt es sich bei dem Versuch, einer Tante zu folgen, die zu Besuch war, aus dem Fenster. Die Provokation funktioniert, und mit einem gebrochenen Arm und einer gebrochenen Kniescheibe wird Sarah in einem chaotischen Frauenhaushalt aufwachsen.
Die Tage verbringt die kleine Eleonora in verwirrendem Schweigen, die Nächte allein und in traurige Gedanken versunken in heruntergekommenen Pensionen. Dem stillen, heimatlosen Mädchen kappt das Wanderleben von einer Bühne zur nächsten – seien es nun Freiluft- oder winzige Provinztheater – sämtliche Wurzeln und verstärkt seine Ausgrenzung. Nicht einmal die Schule, die sie nur jeden zweiten Tag in immer wieder neuen Städten besucht, kann dem etwas entgegensetzen. Sie ist so »anders«, so einsam und noch dazu … das Kind von Komödianten, sodass die Mitschüler sie auf Distanz halten. Eleonora wächst ohne richtige Erziehung auf, ist im Grunde Autodidaktin, sie spielt aus Pflichtgefühl ebenfalls Theater, auch wenn sie vom Vater und der immer kränkeren Mutter sehr geliebt wird. Von ihr hat sie die anfällige Lunge geerbt, die ihr zeitlebens Probleme machen wird.
Mit sieben kann Sarah weder lesen noch schreiben. Als am 22. März 1851 ihre Schwester Jeanne geboren wird, ist das Mädchen mit den grünen Augen, dem roten Band im Haar und dem ebenso stolzen wie ängstlichen Blick erneut eine Last. Auf Rat eines Liebhabers schickt Youle sie nach Auteuil, wo sie im Pensionat von Mademoiselle Frassard lesen, schreiben und sticken lernen kann. Mit dem Theater kommt sie dank der Schauspielerin Stella Colas in Berührung, die bei einem Besuch vor den Schülerinnen und Lehrerinnen aus Athalie spielt. Diese Verse von Racine beeindrucken Sarah sehr, und einige Monate später debütiert sie vor den Mitschülerinnen in dem Stück Clothilde, das die erste »Sterbeszene« enthält, die von der Kleinen nach einem heftigen Todeskampf gespielt wird. Doch die künstlerischen Neigungen werden rasch erstickt: Sarah kommt auf die Klosterschule Grand-Champs in Versailles – auf Veranlassung ihres Vaters, wie sie erzählt. Die Einsamkeitsgefühle eines Mädchens, das nie ein Zuhause gekannt hat, ja sich nirgendwo zu Hause fühlen durfte, sind deutlich spürbar: »Meine Mutter liebte das Reisen: Sie fuhr von Spanien nach England, von London nach Paris, von Paris nach Berlin, von dort nach Christiania (Oslo), dann kehrte sie zurück, küsste mich und reiste weiter.«[17]
Da meldet sich erneut das Theater in ihrem Leben, ja mehr noch: Als der Erzbischof von Paris das Pensionat besucht, verkörpert Sarah den Erzengel Raphael, und ihr Glaube entflammt wie eine heftige Verliebtheit. Sarah begeistert sich für Heiligenlegenden, Hymnen und Gebete. Ihre religiöse Leidenschaft wird zu ihrem Ein und Alles. Sie lässt sich taufen, wird Katholikin (im Rahmen der sogenannten Dreyfus-Affäre macht sie allerdings ab Mitte der 1890er-Jahre ihre jüdische Herkunft geltend, als sie sich für den jüdischen französischen Heeresoffizier Alfred Dreyfus einsetzt, der in einem antisemitisch geprägten Umfeld von einem Kriegsgericht zu Unrecht wegen Landesverrats verurteilt wurde). Sie ist fest entschlossen, Nonne zu werden – auch um gegen die Geburt ihrer Schwester Régine zu rebellieren. Aber die kleine, überempfindliche Egozentrikerin bekommt eine Lungenentzündung, und nach Wochen, in denen sie zwischen Leben und Tod schwebte, schickt man sie im Juni 1859 wieder zur Mutter nach Paris in die Rue Saint-Honoré 265.
Ein nur scheinbarer, brüchiger Waffenstillstand.
Das rebellische Geschöpf ist vierzehn Jahre alt, voller Wut und Lebenshunger.
Der Herbst des Jahres 1873 kommt früh, das Wetter ist trüb.
Eleonora, die Primadonna aus Notwendigkeit, ist vierzehn, als sie die Mutter ersetzt und Frauen spielt, die so viel reifer sind als sie, und Verse aufsagt, ohne sie überhaupt richtig zu verstehen. Angelica Cappelletto bleibt der Bühne immer öfter fern, als Tuberkulosekranke muss sie stets aufs Neue ins Krankenhaus. Am 15. September wird sie in Ancona eingewiesen, während Eleonora in Verona auftritt. Der zweite Akt ist gerade vorbei, als man ihr mit der nötigen Behutsamkeit, die so eine Nachricht erfordert, ein Telegramm in die Hand drückt. Zwei Worte werden ihr Leben für immer verändern.
MAMAGESTORBEN.
Am Morgen des endgültigen Abschieds zittert Eleonora vor Erschütterung. Völlig neben sich, die Beine taub vor Müdigkeit schlingt sie die Arme um den Oberkörper. Sie trägt ein zerlumptes Kleid, das einzige, das sie besitzt, was die Umstehenden zu gehässigen Kommentaren veranlasst: »Wie herzlos dieses Mädchen ist: Es trägt nicht mal Trauer – auf der Beerdigung der eigenen Mutter!«[18] Eleonoras Wangen sind tränenüberströmt, aber niemand merkt, dass sich das junge Mädchen in seinem heftigen Schmerz an sein Leid klammert, ja dass in dieser herzzerreißenden Gedankenhölle das Mitgefühl für alle Leidenden angelegt wird.
Daraus wird sich alles Weitere entwickeln.
Sie kann sich an niemandem festhalten, nur an sich selbst.
Es ist erst wenige Monate her, dass sie in der Bühne, auf die sie sich eher aus Pflichtgefühl gestellt sah, einen Lebensmittelpunkt gefunden hat.
In Verona hat Eleonora den Tod kennengelernt.
In Verona breitet sich das Theater in ihr aus wie der Trunk, der Julia Capulet retten soll: »Dann an einem Sonntag in der ungeheuren Arena, dem alten Amphitheater unter freiem Himmel, vor einer Menge Volkes, das schon mit der Atemluft die Legende von Liebe und Tod eingesogen hatte, war ich die Julia. Kein erregtes Beben, kein rauschender Erfolg, kein Triumph ist für mich je wieder der Trunkenheit jener großen Stunde gleichgekommen.«[19]
Julia ist laut Shakespeare ein junges Mädchen. Und genauso liebt und stirbt auch Eleonora Abend für Abend auf der Bühne neben ihrem Romeo, dem Schauspieler Carlo Rosaspina. Mit dunkel umrandeten Augen und einem gequälten Blick, der direkt in einen Abgrund zu schauen scheint, erlebt Eleonora ihre erste, visionäre Einfühlung in die Rolle. Und als sie nach der Vorstellung spätabends durch die Gassen der Stadt läuft, entdeckt sie »den Trost, die Zuflucht«, die sie Jahre später, als sie bereits eine berühmte Schauspielerin ist, als »Zustand der Gnade« bezeichnen wird.
Lieber Schauspielerin als Ehefrau
Familienrat: Es wird Zeit zu entscheiden, was einmal aus der egozentrischen, nervösen jungen Frau werden soll. Sarah ist fünfzehn, ein Alter, in dem man verheiratet wird. Die »Familie« hat die Wahl, sie ins Gewerbe einzuführen oder aber nach einer guten Partie für sie zu suchen. Letzteres entspricht dem Wunsch des vermuteten Vaters, der ihr eine Mitgift von hunderttausend Francs in Aussicht gestellt hat, wenn sie sich einen Mann nimmt. Um sie hingegen ins Gewerbe einzuführen, macht Youle, in deren Salon Stammgäste wie Alexandre Dumas der Ältere und Gioachino Rossini ein und aus gehen, die Probe aufs Exempel: Sie lässt die Kutsche eines ihrer vermögenden Freunde vorfahren. In dieser Zeit ist es legitim, dass sich Männer außerhalb der Ehe vergnügen, ihre Frauen drücken ein Auge zu, und Sarah spielt lieber mit, als sich einer Ehe mit einem alten oder von anderen ausgesuchten fremden Mann zu fügen. Sie hat keinerlei Bedürfnis, unter die Haube zu kommen oder, schlimmer noch, eine Trophäe zu werden, mit der man sich schmückt. Ihr einziger Traum ist der, eine freie Frau zu sein, auch wenn die Geborgenheit einer Familie ihre größte Sehnsucht bleiben wird. Ohne je erfüllt zu werden.
Die Lösung kommt in Gestalt des großzügigen Herzogs Charles de Morny, einer von Youles Liebhabern (oder einer der Tante, was letztlich einerlei ist). Er nimmt am Familienrat teil und findet, dass Sarah zu schön ist, um in einem Kloster begraben zu werden. So wird er ihr eine Ausbildung angedeihen lassen – und ihr seinen Bruder vorstellen,[20] besser gesagt den unehelichen Stiefbruder, den zukünftigen Napoleon III. Die vom Herzog vorgeschlagene Lösung ist das Schauspielgewerbe, auch wenn einem das Theaterspielen einen Ruf einbringt, der genauso wenig respektabel ist wie der einer Kurtisane. De Morny verschafft Sarah ein Vorsprechen am Conservatoire national supérieur d’art dramatique, der besten Schauspielschule von ganz Paris.
Klein, »mager wie ein abgenagter Knochen«, mit krausem Haar und einer »jüdischen Nase« sieht Sarah so anders aus als die drallen Fräulein, die auf der Bühne (oder jenseits davon) Erfolg haben. In dieser Epoche ist Molligkeit eine Art Vorzug. Auf die Frage der Aufnahmekommission, welches Stück sie sich ausgesucht habe, erwidert Sarah provozierend: »Fédora,III. Akt, 2. Aufzug, die Rolle der Aricia.«
Verblüfft über so viel Arroganz erwidern die Prüfer: »Und wer gibt Ihnen das Stichwort, Mademoiselle?«
Sarah schaut ihnen direkt in die Augen und lächelt, begreift aber, dass sie einen Weg gewählt hat, der ihren Traum vereiteln kann. Selbstsicher schlägt sie einen anderen Ton an und beginnt, die Prüfer mit einem Auszug aus La Fontaines Fabel Die zwei Tauben zu verzaubern. Aber bei einer späteren Prüfung funktioniert nichts, das Urteil der Kommission ist gnadenlos.
»Du bist mager, klein … und dein Gesicht, das in der Nähe ganz hübsch aussieht, ist von Weitem hässlich, dazu kommt, dass deine Stimme nicht trägt! Du wirst niemals etwas beim Theater erreichen! Verheirate dich!«,[21] schlägt ein Liebhaber der Mutter vor, der bei der Prüfung dabei ist.
Was für eine Schmach!
Sie mag zwar nicht schön sein, aber dafür besonders. Sie ist extrem zierlich, hat riesengroße grüne Augen und wird ihr »seltsames« Gesicht und ihre markante Nase zu einem unwiderstehlichen Trumpf machen. Der einflussreiche de Morny kann erwirken, dass sie trotzdem zugelassen wird.
»Ich beschloss nicht, Schauspielerin zu werden, ich entdeckte, dass ich es war. Alle begabten oder genialen Menschen werden Ihnen bestätigen, dass es sich so und nicht anders abspielt«,[22] wird Françoise Sagan schreiben, während sie sich ausmalt, Sarah zu sein.
Die Mutter hätte es vorgezogen, von der versprochenen Apanage des Vaters zu profitieren, aber Sarah beweist unter offener Missachtung der Ewiggestrigen vom Konservatorium einen eisernen Willen. Obwohl Disziplin etwas für introvertierte Perfektionisten ist, stürzt sich die anarchische, dreiste Sarah in die Ausbildung: Diktion, Gesang, Fechten: Sie erlernt das Alphabet der Gesten, studiert eine Rolle nach der anderen ein – mit derselben hartnäckigen Inbrunst, wie sie damals die Gebete lernte, die sie als Kind so faszinierten. Sie seufzt, wie sie soll, mit einer ihr angeborenen Musikalität, über die Victor Hugo eines Tages sagen wird: »Wir erleben eine goldene Stimme.« Frech, zickig, und undiszipliniert ist sie der Schrecken aller Lehrer, von Voltaire springt sie zu Racine, von der Zaïre zur Iphigénie, von komödiantischem Geschäker in nur einer Unterrichtsstunde zu tragischen Gesten. Keinerlei Improvisation, sondern eiserne Disziplin – mit dem einzigen Ziel, »die berühmteste Schauspielerin der Welt zu werden«.
Sie neigt nicht nur zu Provokationen und Doppeldeutigkeiten, sondern auch zu Übertreibungen, und als sie beim Endexamen hinter einer gewissen Marie Lloyd Zweitbeste wird, ist das eigentlich nur ein kleiner Kratzer auf ihrer alabasterweißen Haut. Doch diese Schmach genügt, damit sie das Konservatorium verlässt. Und dank de Morny in die Comédie-Française aufgenommen wird.
Mit achtzehn sucht die unbekannte, vorwitzige Schauspielschülerin den Boulevard des Capucines 36 auf, das Atelier des größten Porträtfotografen der damaligen Zeit, Gaspard-Félix Tournachon, Künstlername Nadar. Von ihm lässt sie sich in der Pose der schmachtenden Primadonna verewigen, »in der Hoffnung, damit für sich werben zu können. Die damaligen Kritiker und Impresarios sind begeistert von diesen Aufnahmen, die so effektiv sind, dass sie eine künstlerische Allianz zwischen der Schauspielerin und dem Fotografen schmieden, der sie zu einem Mythos machen wird«.[23] Die fantastischen Porträts gehen weg wie nichts, und in Paris beginnt man, von ihr zu sprechen. Sarah spürt, dass die Fotografie zu ihrer größten Verbündeten werden kann. Nachdem Nadar sie groß herausgebracht hat, fährt sie auch weiterhin damit fort, ihr öffentliches Bild zu pflegen. Sie hängt sich an sämtliche Fotografen von Paris – wobei es ihr nur darum geht, auf den Titelseiten der Zeitschriften zu landen.
Am 11. August 1862 debütiert Sarah in Iphigénie von Racine. Der junge, doch bereits strenge Francisque Sarcey (der zum mächtigsten Theaterkritiker von Le Temps aufsteigen wird) äußert sich herablassend über den ersten Auftritt der Schauspielerin, die nur aus Haut, Knochen und Augen zu bestehen scheint: »Eine zierliche junge Frau, schön, vor allem, was die obere Gesichtshälfte betrifft, mit perfekter Diktion. Mehr lässt sich bislang nicht über sie sagen.«
Und Sarahs Reaktion? Ein stolzes Achselzucken und die beiden Worte, die sie für den Rest ihres Lebens begleiten werden, quand même, »trotz alledem«, als wollte sie sagen: Mich hält so schnell nichts auf. Das wird zu ihrem Motto, zum Trost in schwierigen Phasen, zum Markenzeichen, das sie in ihre Wäsche einsticken und in Tassen, Teller und Besteck eingravieren lässt.
Was den Vorwurf, sie sei zu mager, betrifft, sagt man ihr den genialen Spruch nach: »Dünne junge Frauen können zwischen den Regentropfen hindurchlaufen, ohne dabei nass zu werden.«
Und Sarcey? Sie schafft es, ihn zu treffen und rasch von ihrem Talent zu überzeugen.
Primadonnen im Spiegel
Nach der Kameliendame im Turiner Teatro Carignano ist Eleonora fest entschlossen, in Sarahs Fußstapfen zu treten. Eine gewagte Wette auf die Zukunft, ein entscheidender Bruch in ihrem bisherigen Leben.
Sie hat keine Zeit zu verlieren, einfach keine Zeit zu verlieren.
»Ich möchte die Leonetta in Die Prinzessin von Bagdad spielen!«
»Nach Sarah? Du spinnst ja wohl!«
»Von wegen.«
Ein starker Charakter, eine starke Persönlichkeit. Oder aber der Drang nachzuahmen?
Der Impresario Cesare Rossi, der Eleonora unter Vertrag hat, behindert ihr Streben nach Erneuerung, wo er nur kann. Unterstützt und für ihren Mut bewundert wird sie jedoch von ihrem aufmerksamen Kollegen Tebaldo Checchi. Er tröstet sie mit seiner Zuneigung, ja vielleicht liebt er sie bereits. Eleonora droht damit, zu gehen, sie weiß zwar nicht, wohin oder mit wem, trotzdem gelingt es ihr, den unwilligen Impresario umzustimmen. Die Prinzessin von Bagdad von Alexandre Dumas dem Jüngeren wird endlich aufgeführt und bedeutet eine entscheidende Wende in ihrer Karriere. Bei der Comédie-Française war dieses Stück ein Fiasko, in Turin feiert es Triumphe, und Dumas schreibt Eleonora persönlich einen Dankesbrief.
1878 spielt sie im Teatro dei Fiorentini in Neapel unter den Fittichen der Primadonna Giacinta Pezzana, und ein Jahr später sind alle von der Grausamkeit hingerissen, mit der sie die Thérèse Raquin von Émile Zola gibt, auch wenn die Pezzana sie dem Autor mit lauwarmen Lobesworten vorstellt: »Ich habe die Rolle der Thérèse an eine blasse, große und dünne junge Frau mit schwarzen Augen und schwarzen Haaren abgegeben.«[24] Mehr sagt sie nicht dazu.
Obwohl Eleonora mit dreiundzwanzig Jahren zur Hauptdarstellerin der gesamten Truppe wurde, kleidet sie sich wie eine Bohemienne mit Schlabbermänteln über kurzen Kleidchen, dazu ein Filzhut, was ihr wenig schmeichelhafte Kommentare einbringt, so etwa: »Diese Schauspielerin ist ärmlich und bescheiden. Sie läuft in einem kurzen schwarzen Rock herum, in einer eng um den Körper geschlungenen grauen Stola und mit einem ausgeblichenen schwarzen Strohhut, der an den Rändern schon ganz zerfranst ist«,[25] oder »mit schräg sitzenden Hüten, weiten Mänteln, losen Schleiern, falsch zugeknöpften Blusen, schlecht geschlossenen Röcken, eine Hand behandschuht, die andere nicht«.[26]
Die von einer Primadonna geforderte Eleganz ist ihr egal. Eleonora, die sich stets weiter von ihren familiären Wurzeln entfernt, hat ihren eigenen Kopf. Sie lebt ihre Rollen – echte Frauen und keine dick geschminkten Larven –, wobei sie die Grenze zwischen ihrem wahren Ich und den von ihr gespielten Figuren verschwimmen lässt. Sie »ist« die Figur, das ist typisch Duse: Sie spielt mit dem ganzen Körper und mit gesenktem Kopf, sie scheut jede bühnenreife Geste, kauert sich in einen Sessel, nutzt die Pausen genauso wie das gesprochene Wort. Überall, wo sie auftritt, verstreut sie Blumen auf der Bühne, trägt sie an der Kleidung oder hält sie in der Hand, wobei sie gedankenverloren damit spielt. Blumen wie Kinder, Frauen wie Schwestern: »Diese armen Frauen in meinen Stücken sind dermaßen in meinem Herzen und in meinem Kopf, dass sie – während ich mich bemühe, sie meinen Zuschauern nahezubringen, als wollte ich sie trösten – langsam, aber sicher auch mich trösten!«[27]
Bei ihrer hartnäckigen Suche nach der Wahrheit der jeweiligen Figur bricht sie alle Regeln: Sie geht ungeschminkt auf die Bühne, zeigt dem Publikum rote Flecken, Schweißperlen, Makel. Sie skandiert die Worte, dehnt die Vokale, betont die Konsonanten, lächelt fast schon entschuldigend. Auch ihre Haltung, die im Stehen schlaff herabhängenden Arme oder die auf die Oberschenkel gestützten Ellbogen, während sie breitbeinig dasitzt, ist höchst ungewöhnlich, genauso wie ihr Gang aus mühsamen oder dahinhuschenden Schritten, bei denen sie kaum die Füße hebt. Sie ist ruhig, bedächtig, fast schon distanziert. Seltsam distanziert.
Die Duse ist einmalig. Ein Rätsel.
Woraus besteht ihr Talent? Aus nichts, was sich konkret fassen ließe. Aber es ist unbestreitbar vorhanden.
Sarahs Abenteuer bei der Comédie ist nur von kurzer Dauer und endet aufgrund einer Begebenheit, die alles über die Dreistigkeit der schwierigen Debütantin aussagt.
Jeden 15. Januar organisiert die Comédie anlässlich von Molières Geburtstag eine verdiente Huldigung in seinem einstigen Haus. Dabei treten die Schauspieler der Kompanie in Zweierreihen vor die Büste des Dramatikers und senken den Kopf. Sarah nimmt ihre Schwester Régine mit, aber als die Kleine aus Versehen über die Schleppe der stattlichen Madame Nathalie, einer Sociétaire de la Comédie, stolpert, reagiert diese, indem sie das Mädchen brutal gegen eine Säule stößt. Sarah, die sich vom Status der Aktrice kein bisschen einschüchtern lässt, geht auf sie los und beschimpft sie als »großes Rindvieh«. Die Schauspieler, die ohnehin Schwierigkeiten mit Sarahs Dreistigkeit haben, sind entsetzt; der Theaterdirektor, der ihr noch kein Jahr zuvor einen Vertrag angeboten hat, ruft sie in sein Büro und verlangt, dass sie sich entschuldigt. Sarah weigert sich und schickt ihn zur Hölle. Ganz Paris redet darüber, und in den Zeitungen erscheinen bissige Karikaturen von der »fetten Kuh« und der »klapperdürren Sarah«.
Mit diesem PR-Coup wird Sarah, die tatsächliche Primadonna, zu einer kleinen Berühmtheit.
Dennoch ist sie nun arbeitslos und hat keine Alternative – außer in die Fußstapfen der Mutter zu treten. Zwei Jahre lang wird sie männliche Gönner amüsieren und den Schmeicheleien eines Liebhabers nachgeben: des ersten von vielen, Baron Émile de Kératry.
Wie sehr ihr das Theater fehlt! Ihm fernbleiben zu müssen ist eine Qual, aber eine unverhoffte, schicksalhafte Reise lenkt sie von ihrem Kummer ab … und wird nicht ohne Folgen bleiben.
Mütter
Wir schreiben das Jahr 1864, Sarah ist in Brüssel.
Hier, auf einem Maskenball, auf dem sie sich als die englische Königin Elisabeth I. verkleidet hat, lernt sie den belgischen Adligen Charles-Joseph Eugène Henri Georges Lamoral de Ligne kennen, den Sohn des Staatsministers Eugène, 8. Fürst von Ligne. Er ist als Hamlet kostümiert und bittet sie zum Tanz. Und dann?
Dann kehrt Sarah schwanger nach Paris zurück.
Schenkt man ihr Glauben, erinnert das Ganze sehr an die Kameliendame: Der junge de Ligne ist bereit, sie zu heiraten, vorausgesetzt, sie kehrt dem Theater den Rücken, aber seine Familie sträubt sich. Die weniger geschönte Version lautet, dass Sarah von ihm die Tür gewiesen bekommt, als sie bei den de Lignes auftaucht und verkündet, dass sie ein Kind erwartet. Er entlässt sie mit dem Bonmot: »Chère amie, quand on s’est assis sur un buisson d’épines, on se demande pas celle qui vous a piqué« – »Meine Liebe, wenn man sich in einen Dornenstrauch setzt, sucht man auch nicht nach dem Dorn, der einen gestochen hat.« Ob das nun wahr ist oder nicht – für Sarah ist ein Leben jenseits der Bühne genauso undenkbar wie ein Kind für diesen blasierten jungen Mann. Er hat nicht vor, es anzuerkennen.
»Quand même!«
Maurice Bernhardt kommt am 20. Dezember 1864 in Paris zur Welt, Vater »unbekannt«. Der Enkel wird von Youle, die ihre Hoffnungen auf einen Schwiegersohn comme il faut wegen dieses »Hindernisses« in Rauch aufgehen sieht, nicht sehr geschätzt.
Die selbst unehelich geborene Sarah kümmert sich nicht um den Skandal, um Vorurteile und Konventionen. Sie zögert nicht, allein für ihr uneheliches Kind zu sorgen. Da die Mutter sie gnadenlos rauswirft, ist sie trotz der kleinen Apanage, die ihr die de Lignes großzügigerweise gewähren, gezwungen, zusammen mit dem Sohn, ihrer Schwester Régine und der Großmutter in einer kleinen Wohnung in der Rue Duphot zu leben. Dort gründet sie ihren eigenen »Salon«: Sie möchte Maurice um jeden Preis wie den Prinzen aufwachsen lassen, der er hätte sein können – ja müssen!
Kein Theater mehr, dafür Treffen mit Männern in und außerhalb der Wohnung zu gesalzenen Preisen: Eine »intime Bewunderung« kostet zwischen 1000 und 1500 Francs. Es ist ihr egal, dass sie bei der Polizei registriert wird, zusammen mit einem ausführlichen Verzeichnis ihrer Freier – »der Salon der Bernhardt wird von Politikern und Generälen besucht« –, ihres Mobiliars und ihrer Marotten: »Sarah Bernhardt hat ziemlich makabre Ideen: Sie legt sich gern in einen gefütterten Holzsarg, und in ihrem Salon steht ein Totenschädel auf einem Silberteller.«[28]
Es ist eine stürmische Zeit, aber das Theaterfieber brennt nach wie vor in ihr. Und dank des stets verständnisvollen de Morny und einer Begegnung mit Félix Duquesnel, Vizedirektor des Odéon, der sich ihrem Charme nicht entziehen kann (»Sie ist nicht hübsch, das macht es noch schlimmer«, wird er seine Schwäche später gestehen),[29] erhält Sarah im zweitbesten Theater von Paris eine Anstellung für 150 Francs im Monat. Das ist ungefähr die Hälfte dessen, was ein Kleid kostet. Auf ein langweiliges Debüt folgen Wochen, in denen der Name Sarah Bernhardt auch in anderen Rollen auftaucht, die ihr eine Lohnerhöhung auf 500 Francs im Monat einbringen. Das genügt, um nicht länger gezwungen zu sein, mit zig reichen und häufig alten Liebhabern ins Bett steigen zu müssen. Maurice ist zwei Jahre alt und begleitet die Mutter auf Theaterproben, Abendessen und Feste, wo er auf Chaiselongues und Sofas schläft.
Im Jahr 1878 ist Neapel nicht nur die Stadt, in der die triumphale Tournee der jungen Primadonna gastiert, sondern auch Kulisse für eine leidenschaftliche Begegnung. Der Mann heißt Martino Cafiero, ist Gründer und Direktor des Corriere del Mattino. Der unverbesserliche Verführer erobert Eleonora, indem er ihr Kunst in Museen und Kirchen zeigt, sie in seiner Kutsche auf die Hügel Posillipo und Vomero mitnimmt, auf Terrassen mit Meerblick.
Salons, neue Freunde, Schmeicheleien.
Körperliches Verlangen.
Eleonora gibt sich diesem Mann und dem allumfassenden Gefühl hin, das sie als unschuldige Zwanzigjährige empfindet. So sieht wahre Liebe aus, da ist sie sich sicher, als sie bald darauf wieder mit Rossis Kompanie nach Turin zurückkehren muss und Cafiero um ein Abschiedstreffen bittet.
Doch zum Gleis kommt nur die Journalistin und Freundin Matilde Serao.
Wenige Wochen später stellt Eleonora fest, dass sie schwanger ist. Als sie den Geliebten in einem Hotelzimmer im Zentrum von Rom aufsucht, ist sie voller Hoffnung. Doch Cafiero ist abweisend, reagiert gereizt auf jedes romantische Gefühl vonseiten der jungen Frau, die ihm etwas von Kindern und einer gemeinsamen Zukunft erzählt. Er bleibt sitzen und schaut sie nur an, als müsste er überlegen, wie er reagieren, was er sagen soll, schafft es aber auch nicht, sie wirklich zu belügen. Er liebt sie nicht und tritt feige den Rückzug an, ohne ihr eine wirkliche Erklärung zu geben. Den Mund zu einem angestrengten Lächeln verzogen, der Rücken krumm und die Glieder bleischwer, spürt Eleonora, wie der unterdrückte, heftige Schmerz aus ihrer Kindheit wieder hochkommt.
Die Verzweiflung darüber, im Stich gelassen zu werden, geht ihr durch Mark und Bein.
An Matilde Serao, die ihr die Treue hält, schreibt Eleonora sinngemäß: In diesem Alter liebe man weniger den Mann, sondern vielleicht eher die Liebe. Wenn man sich umdrehe, was bleibe dann von ihm? Nichts. Und von eigener Erfahrung? Alles.
Unter solchen Umständen ein Kind zur Welt zu bringen gilt in Italien als Verbrechen. Italien ist nicht Frankreich, wo die Bernhardt ungeachtet des Klatsches ihren Maurice alleine großzieht.
Nach dem Ende der Aufführungen im Carignano verlässt Eleonora Turin und fährt nach Marina di Pisa auf einen Bauernhof, wo sie ein Kind gebiert und sich zwingt, nicht einzuschlafen – wohl wissend, dass man ihr das Neugeborene wegnehmen wird, sobald sie die Augen schließt. Doch dazu kommt es erst gar nicht. Dario, das »Kind der Schande«, stirbt wenige Tage später. Eleonora trägt den gleichsam federleichten Sarg selbst zum Friedhof. In diesen Wochen schreckt der unverschämte Cafiero nicht davor zurück, in seiner Zeitung einen Fortsetzungsroman zu veröffentlichen, der von der Liebesgeschichte einer Schauspielerin und eines Journalisten sowie der Geburt ihres gemeinsamen Kindes erzählt.
Was, wenn er doch noch schwach wird?
Aber dem ist nicht so. Und Eleonora ist nicht mehr dieselbe, als sie nach Turin zurückkehrt, wo nichts als die Stille ihrer Wohnung auf sie wartet, wo ihr alles ganz weit weg, verblasst und unerreichbar vorkommt und sie sich fühlt wie eine leere Hülle. Dieser durch eine toxische Liebe bedingte Kummer nagt an ihr und macht sie noch empfindsamer. Die brennende Enttäuschung im ersten Akt mit Cafiero und die Katastrophe des gestorbenen Kindes bringen die geschwächte, verletzte und schmollende Eleonora dazu, sich in die Arme von Tebaldo Checchi zu flüchten, einem nicht gerade herausragenden Schauspieler, der bereit ist, im Schatten seiner zukünftigen Frau zu leben. Sie heiraten am 7. September 1881. Die nach dem Bühnenabschied der Pezzana inzwischen einzige Primadonna der Turiner Truppe ist erneut schwanger, diesmal mit dem Rückhalt der Ehe und der bis dahin fehlenden »bürgerlichen« Sicherheit. Am 7. Januar 1882 kommt die Tochter Enrichetta zur Welt.
Nach der Geburt, nur wenige Wochen nach der alles verändernden Begegnung mit der Kunst Sarah Bernhardts, erkrankt Eleonora.
Versorgt von einem Bauernehepaar aus dem unweit von Turin gelegenen Leini, wird das Mädchen die Mutter bis zu seinem fünften Lebensjahr begleiten, doch Eleonora möchte ihm unbedingt ein anderes Leben bieten und hält es strikt von der Bühne und ihrem Vagabundenleben fern. Sie wünscht sich für ihre Tochter die Sicherheit, die sie selbst nie gehabt hat. Doch Enrichetta leidet darunter, sie lauscht auf die Schritte ihrer Mutter wie ein Arzt auf eine Krankheit, »während sie elegant-beschwingt über die Allee flaniert und wieder aus meinem Gesichtsfeld verschwindet«.
»Enrichetta, die Mama muss los … fort, aufbrechen …«