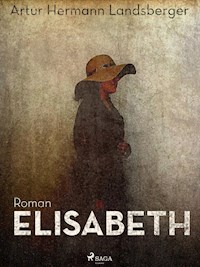Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Baron von Rosen-Geldberg schaut auf ein gesegnetes Leben zurück. Aber seine drei Söhne!!! Adolf, Ernst und Richard leben das sorglose Leben der Erbengeneration, denen der schöne Schein wichtiger ist, als etwas zu sein. Baron Leo, der die lieblose Besuchsankündigung seiner Kinder samt Ehefrauen zu seinem Fünfundsiebzigsten mit trockenem Humor zur Kenntnis nimmt, nutzt die Gelegenheit der seltenen Zusammenkunft und erklärt: Es erbt nur die Ehefrau des Tüchtigsten, dem es gelingt, eine Leistung zu erbringen, die dem Namen der Familie zu Ehren gereicht. Ansonsten verfällt das Erbe! Lähmung breitet sich unter den verwöhnten Brüdern aus, aber Adele, Elisabeth und Resi sind voller Elan und es beginnt ein charmanter Wettstreit der drei Ehefrauen, in dem keine Idee verrückt genug sein kann auf dem Weg zum Sieg. Ein Roman voller Witz und Temperament, der an Situationskomik nicht spart. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Artur Hermann Landsberger
Die Reichen
Burlesker Roman
Saga
I.
Adolf Freiherr v. Rosen-Geldberg und Frau Adele, seine Gemahlin, saßen auf der Veranda beim Tee. Ihr Haus war eins der bestgeführten Berlins. Berühmt war die Küche, der zwei Chefs vorstanden. Eine Seltenheit in der Nachkriegszeit für einen Hausstand, der außer dem Personal nur aus zwei Personen bestand.
Frau Adele, bildhübsch, mit einem Teint, der Schminke und Puder verschmähte, hielt in ihren Händen einen Brief sonderbaren Formats.
Adolf, gut angezogen und gepflegt, hatte eine illustrierte Zeitschrift vor sich.
„Gräßlich!“ sagte Adele.
„Was ist?“ fragte Adolf — ohne von seinem Blatt aufzusehen.
„Ich hatte Gerda gebeten, mir für Biarritz von Paris aus ein paar Winke zu geben. Aber sie schreibt, weder bei Paquin, Patou noch Jean sähe man etwas, was man nicht genau so gut — wenn auch billiger — bei den großen Schneidern in Berlin fände.“
„Paris bleibt Paris“, erwiderte Adolf.
„Das war einmal. — Gerda rät zu einem Beigerose-Complet aus feinem Zibelinetuch mit breitem Pelzkragen, der vorn bis in die Taille läuft, schmalem Gürtel und einem üppigen Besatz aus schwarzem Gaillac.“
„Was ist das?“
„Beschämen Sie meinen Mann!“ erwiderte Adele und wandte sich an ihre Zofe, die eben eintrat, um der Baronin ihr Spitzentuch zu reichen.
„Aber das weiß doch der Herr Baron“, erwiderte die Zofe und schien für ihn beschämt — „daß Gaillac chinesischer dünner Breitschwanz ist. — Wenn das das Neueste sein soll, Frau Baronin, hinkt Paris aber wieder einmal nach.“
„Woher wissen Sie denn das?“ fragte Adolf ärgerlich.
„Eine Zofe, die nicht weiß, was in der Mode vorgeht, ist heute so hilflos wie ein Chauffeur, der keine Sprachen spricht. — Aber wenn ich der Frau Baronin raten darf ...“
„Was fällt Ihnen ein?“ unterbrach sie Adolf. Aber Adele winkte ab und sagte:
„Laß sie nur“ — wandte sich an die Zofe und fragte: „Also, was wollten Sie sagen?“
„Daß die gnädige Frau sich für Biarritz weiße Atlaskleider und einen weißen Mantel mit dickem Damassé machen lassen sollte.“
„Vielleicht verlegt ihr das auf eine andere Zeit“, erwiderte Adolf — worauf die Zofe pikiert das Zimmer verließ und Frau Adele zu ihrem Mann sagte:
„Von morgen ab trinke deinen Tee bitte woanders.“
Adolf stand auf, ergriff Frau Adeles Hand, küßte sie und sagte:
„Verzeih! — Aber ich möchte nicht, daß wir uns auseinanderleben wie mein Bruder Richard und seine Frau.“
„Haben die je zusammengelebt?“
„Wir wollen lieber versuchen, uns die Ehe meines Bruders Ernst zum Vorbild zu nehmen.“
„Was hast du mit einemmal mit deinen Brüdern? Soviel sprichst du ja sonst in einem Jahr nicht von deiner Familie.“
„Ich lese hier eben im ‚Querschnitt‘ zum zehnten Male ...“
„Was liest du? Hat Resi wieder mal ihre Frühlingswehen zu Papier gebracht? Um die Jahreszeit pflegt sie ja immer Artikel zu schreiben.“
„Hier steht: Am 20. Juli feiert der Freiherr Benno Leo v. Rosen-Geldberg in Frankfurt a. M. in völliger geistiger und körperlicher Frische seinen fünfundsiebzigsten Geburtstag.“
„Dein Papa?“
Adolf las weiter: „Er hat seine Jugend mit so viel Grazie und Esprit verlebt, daß wir uns auf die Arabesken seiner Vieillesse verte freuen.“
„Stimmt es denn?“
„Daß Papa am 20. Juli geboren ist, weiß ich — daß er aber schon so alt — ja, wie lange ist es denn her, daß er seinen siebzigsten Geburtstag gefeiert hat?“
„Vermutlich fünf Jahre.“
„Dann kann es stimmen.“
„Sorge vor allem dafür, daß dein Bruder Ernst seine Frau schonend darauf vorbereitet.“
„Es ist doch kein Todesfall.“
„Wenn es das wäre!“
„Ich verstehe dich nicht.“
„Du verstehst doch nie. — Aber das siehst du wohl ein: wenn dein Vater fünfundsiebzig Jahre alt wird, dann werden seine drei Söhne mit ihren Frauen ja wohl nach Frankfurt fahren und ihm gratulieren müssen.“
„Meinst du?“ sagte Adolf — und fragte zaghaft: „Willst du es nicht Ernst und Elisabeth sagen?“
„Aha!“
„Ich tue es genau so gern.“
Aber Frau Adele war schon am Apparat und ließ sich mit der Baronin Elisabeth v. Rosen-Geldberg, geborenen Komteß Königsmarck, verbinden.
„Du?“ fragte Elisabeth erstaunt.
„Ja. — Wie geht es dir?“
„Ich bin rasend beschäftigt.“
Jetzt war das Erstaunen auf Frau Adeles Seite.
„Du — beschäftigt? — ja, womit?“
„Ich lese.“
„Du liest? — Seit wann?“
„Schon seit einer Stunde! — Mein Bruder hat mir da ein Buch aus London mitgebracht — denke dir über zweitausend Seiten stark.“
„Entsetzlich! Das ist ja noch schlimmer als ‚Der Fall Mauritius‘.“
„Kenn’ ich nicht.“
„Wie heißt es denn?“
„Debrett’s Peerage.“
„Ach, das Adelshandbuch! Der englische Gotha!“
„Ja — ich bin begeistert.“
„Bist du vielen Bekannten begegnet?“
„Denk dir! Schon elf — dabei bin ich erst auf Seite dreihundertachtzehn.“
„Es tut mir leid, Elisabeth, aber du wirst die Lektüre wohl unterbrechen müssen.“
„Ist jemand gestorben?“
„Im Gegenteil!“
„Du hast ein Kind? — Adele! Von wem? — Was sagt dein Mann dazu? — Daher sahst du in letzter Zeit so — üppig aus — besonders an den Hüften.“
„Wenn ich auch nicht so schlank bin wie du — ein Kind bekomme ich darum noch lange nicht.“
„Etwa Resi? — Der gönn’ ich’s. — Es gilt in Paris ja wieder für schick, Kinder zu haben.“
„So sag ihr doch endlich, um was es sich handelt“, drängte Adolf — und Adele rief in den Apparat:
„Papa wird fünfundsiebzig Jahre alt.“
„Was für ’n Papa?“
„Unser!“
„Eurer?“
„Der unserer Männer. Dein und mein und Resis Schwiegervater.“
„In Frankfurt der?“
„Ich wüßte nicht, wo wir sonst noch einen hätten.“
„Der jüdische alte Herr? — Ja, da wird man etwas schenken und telegraphieren müssen.“
„Man wird mehr tun müssen.“
„Doch nicht etwa ...?“
„Allerdings! Wir müssen nach Frankfurt — alle sechs.“
„Ich nicht.“
„Willst du als einzige dich ausschließen?“
„Ernst hat mir, als wir uns heirateten, versprechen müssen ...“
„... daß du außer mit seinen beiden Brüdern mit seiner Verwandtschaft nicht zu verkehren brauchst.“
„Nun also.“
„Einen Schwiegervater, der fünfundsiebzig wird, umgeht man trotzdem nicht — wenn man klug ist.“
„Hm — du hast recht. — Aber ich kenne den Ritus nicht.“
„Was für einen Ritus?“
„Ich war noch nie in einer Synagoge.“
„Seit wann feiert man Geburtstage in der Kirche?“
„Wenn du mir garantierst, daß wir uns drüben nicht öffentlich zu zeigen oder gar in einer jüdischen Prozession mitzuwirken brauchen, so bringe ich meinem Mann das Opfer.“
„Ich garantiere dir, daß das Ganze mit einer Familienfeier im engsten Kreise abgemacht ist.“
„Und man kann im Hotel wohnen?“
„Das würde der Alte wohl übelnehmen.“
„Vielleicht braucht man gar nicht zu übernachten.“
„Das wird man herausfühlen, wenn man drüben ist.“
„Also gut, wir kommen. — Aber was zieht man bei solcher Gelegenheit an?“
„Ruf bei Resi an, die wird es dir sagen.“
„Und sonstige Vorbereitungen sind nicht nötig?“
„Das englische Adelsbuch brauchst du für den Besuch jedenfalls nicht auswendig zu lernen.“
Elisabeth hing den Hörer an und schlug wütend Debrett’s Peerage zu. Zu ihrem Mann, der eben ins Zimmer trat, sagte sie:
„Ernst, ich möchte den Talmud lesen.“
Ernst Baron v. Rosen-Geldberg glaubte, ihn treffe der Schlag. Er trat an seine Frau, der man auf den ersten Blick die Aristokratin ansah, heran und fragte ängstlich:
„Was fehlt dir, Elisabeth?“
„Ich will mich vorbereiten.“
„Worauf?“
„Auf Frankfurt. — Dein Vater hat Geburtstag.“
„Den hat er jedes Jahr — und es ist dir bisher noch niemals eingefallen ...“
„Er wird fünfundsiebzig.“
„Ach herrje!“
„Da gehört es sich, daß seine drei Söhne mit ihren Frauen zu ihm fahren.“
Ernst, groß und schlank wie seine Frau und ohne den leisen orientalischen Einschlag seiner Brüder — doch wie diese die gute Herkunft verratend — Ernst Baron v. Rosen-Geldberg wußte noch immer nicht, ob es seiner Frau Ernst war mit dem, was sie sagte.
„Ich habe schon mit Adele telephoniert“, fuhr Elisabeth fort — „und werde mich jetzt mit Resi in Verbindung setzen.“
„Du willst wirklich ...?“
Die Verbindung war schon hergestellt. Als Resi v. Rosen-Geldberg sich meldete, sagte Elisabeth:
„Tag, Resi! Ich staune. Mal nicht in Paris?“
„Leider. Aber ich fahre morgen.“
„Über Frankfurt — wenn ich bitten darf.“
„Wieso?“
„Weil dein und mein Schwiegervater fünfundsiebzigsten Geburtstag hat.“
„Und da soll ich dich vertreten? — Ich denke nicht dran. Ich hasse Frankfurt.“
„Es handelt sich nicht um eine Vergnügungsreise. Es ist unsere Pflicht unseren Männern gegenüber ...“
„Ich entbinde meinen Mann von jeder Art Verpflichtung gegenüber meiner Mutter zu deren fünfundsiebzigstem Geburtstag.“
„Deine Mutter ist eben fünfzig und leberleidend.“
„Ihre Ärzte erhalten sie sich bis fünfundachtzig — verlaß dich drauf.“
„Ich wünsche es dir.“
„Das kann ich mir denken. — Aber du irrst! Ich liebe meine Mutter.“
„Ich habe es nicht bezweifelt.“
„Da fällt mir ein — das einzige, was ich von dem Alten in Frankfurt weiß, ist, daß er seit über fünfzig Jahren kostbare Gläser sammelt. Ich habe im Frühjahr in Venedig auf dem Biennale ein altes venezianisches Glas gekauft — ich sage dir — das wird dem Alten mehr Freude machen als meine Gegenwart.“
„Ich will dich nicht kränken, Resi, aber soviel ich weiß, sind deine Eltern doch früher einmal Israeliten gewesen.“
„Juden waren sie — das sieht man mir doch an — bis sie eines Tages katholisch wurden — das galt damals für schick — und der päpstliche Adel war leichter zu erreichen als der preußische.“
„Du solltest den Talmud lesen — besonders, was darin über das jüdische Familienleben steht.“
„Elisabeth! Bist du das wirklich?“
„Ich für meine Person nehme jedenfalls Rücksicht auf die Gefühle Andersgläubiger und fahre nach Frankfurt — Adele übrigens auch.“
„Dann schließe ich mich natürlich nicht aus.“
„Ich werde die Schlafwagen für morgen abend bestellen.“
„Wollen wir denn nicht in unseren Autos reisen?“
„Wie ich unseren Schwiegervater nach den Erzählungen meines Mannes einschätze, ist’s ihm lieber, wenn wir mit der Bahn fahren.“
„Du bist ja plötzlich von einer Liebe und Rücksichtnahme, die ich gar nicht an dir kenne.“
„Einmal in fünfundsiebzig Jahren kann man das ja wohl sein.“
„Gewiß! Aber bedenke, daß wir das dann in jedem Jahre wiederholen müssen.“
„Davon ist keine Rede. Sollte er aber achtzig werden, so rufe ich wieder bei dir an. Bis dahin auf Wiedersehen!“
Resi v. Rosen-Geldberg, eine kleine, nicht hübsche, aber pikante Frau mit intelligentem Gesicht, saß nach diesem Gespräch etwas ratlos vor dem Apparat. Von dieser Seite kannte sie ihre sonst so stolze Schwägerin nicht — kannte sie sie überhaupt? — Kannte sie ihre Schwägerin Adele, ihre Schwäger — ja, kannte sie ihren eigenen Mann?
„Lächerlich!“ sagte sie laut und machte mit der Hand eine Bewegung, als wenn sie unangenehme Gedanken verdrängen wollte. Weil der Herr Papa dieser drei Söhne, an denen wahrhaftig nichts zu kennen war, fünfundsiebzig wurde, lief sie Gefahr, sentimental zu werden.
Vom Talmud, vom jüdischen Familiensinn hatte die gräßliche Schwägerin gesprochen. Wo hatte sie das her? — Was bezweckte sie damit? War es Hohn oder flößte auch ihr der Fünfundsiebzigjährige plötzlich Gefühl und Achtung ein?
So nahe dem Tode! — Der Gedanke kam ihr, und der mochte es auch sein, der auf Elisabeth und auf Adele wirkte. Jedenfalls waren die Empfindungen, mit denen sie die Reise nach Frankfurt vorbereiteten, andere, als wenn sie zum Zeitvertreib — und welchen anderen Sinn hatte ihr Leben bisher, als sich möglichst angenehm die Zeit zu vertreiben? — nach Paris, London, Brioni, Cannes oder San Sebastian fuhren.
Ein neues Gefühl schwang mit, teils Scheu vor dem Unbekannten, teils die Folge einer Leere, die — so grotesk es klingt — ihr Leben bisher ausgefüllt hatte, sie nun aber für eine Zeit fürchten ließ, in der sie nach einem Inhalt suchen würden. So regte der Greis in Frankfurt Gedanken an und rief Gefühle wach, die ihnen, wäre er gestorben, und hätte ihre Reise seiner Beisetzung gegolten, nie gekommen wären.
Um so gleichgültiger und unbeschwerter traten die drei Brüder die Reise zu ihrem Vater an.
II.
Am Vorabend seines fünfundsiebzigsten Geburtstages saß Freiherr Leo Max v. Rosen-Geldberg im Herrenzimmer seiner Frankfurter Villa. Er hatte einen schweren Tag hinter sich. Vom frühen Morgen an waren alle möglichen Deputationen bei ihm erschienen, um — wie es immer wieder hieß — „dem großen Wohltäter, dessen Herz den Armen gehörte“, zu danken.
Tausende waren es, die die Güte dieses Mannes zu spüren bekamen. Außer den Armen der Stadt, in Verbänden und Vereinen zusammengeschlossen, unzählige Familien, für die er sorgte, ohne daß es nach außen in die Erscheinung trat. Die Villa glich einem Blumenhain. Riesenkörbe mit kostbaren Blumen standen neben armseligen Töpfen und bescheidenen Sträußen.
Der Alte hatte die Reden der Deputierten über sich ergehen lassen wie etwas, was nicht abzuwenden war. Er antwortete meist nur mit einem Händedruck. Ein einziges Mal, als ein armes Kind aus der Menge der Gratulanten ohne jede Scheu heraustrat, einen armseligen Tulpentopf überreichte und sagte:
„Mutti liegt zu Bett und läßt grüßen — der Topf braucht viel Wasser — er blüht schon das dritte Jahr bei uns“, traten dem Alten Tränen in die Augen. Er beugte sich zu dem Kinde herab, küßte es und sagte:
„Wenn mein Leben reich und gesegnet war, dann danke ich es dir und deiner Mutter und allen, denen ich helfen durfte.“
Als er dann am Abend an seinem Schreibtisch saß, sagte er zu Jacob, seinem Diener, der ihn weit über ein Menschenalter betreute:
„Das war ein schöner Tag.“
„Gewiß, Herr Baron“, erwiderte der und legte dem Alten einen Plaid über die Beine. „Aber wieso haben die alle heute schon gratuliert? Der Herr Baron haben doch erst morgen Geburtstag.“
„Der Tag morgen gehört meiner Familie.“
Der Diener, der noch auf der Erde kniete und eben die Füße des alten Herrn in die Decke wickelte, sah verdutzt auf und fragte:
„Die Herren Söhne — kommen aus Berlin?“
„Aber nein! Die Jungens haben zu tun. Und ich will auch nicht, daß sie meinetwegen eine so weite Reise machen. — Aber“ — und er wies auf eine schwere, alte Schatulle, die er nicht ohne Mühe aus dem Schreibtischfach genommen hatte — „hier bewahre ich mein Leben auf! — Und nun räumen Sie mal den Tisch ab — und dann wollen wir alles vorbereiten.“
„Wie im vorigen Jahr“, sagte der Diener.
„Sehen Sie, Jacob, Sie haben ein gutes Gedächtnis — genau wie im vorigen Jahr. Dieselben alten silbernen Leuchter — die schon die Großeltern gebrannt haben — und dann die Photographien.“
„Die der seligen Frau Baronin steht schon da.“
„Das genügt nicht! Da war sie eine alte Frau. Ein Jahr, bevor sie Gott zu sich nahm. — Nein, Jacob, da drüben die Bilder — als Braut — und als junge Mutter — und dann der strenge Herr Papa, der Hofbankier — und die gute, alte Mutter vor allem — alle müssen sie um mich sein, wenn ich die Jugend noch einmal durchlebe.“
Er öffnete, während Jacob die Bilder holte, die Schatulle und entnahm ihr ein Dutzend Päckchen mit Briefen, die mit seidenen Bändern zusammengehalten waren. Zärtlich fuhr er über jedes Päckchen mit der Hand und legte es dann vor sich auf den Tisch.
Jacob brachte die schweren alten Leuchter und sammelte die Bilder, die in verschiedenen Zimmern standen. Als er die Kerzen an den Leuchtern anzünden wollte, wehrte der Alte ab und sagte:
„Nein, das mache ich. — Die müssen die ganze Nacht brennen — bis morgen abend. — So, und nun, Jacob, gehen Sie — oder nein, den Topf mit den Tulpen, den das kleine Mädchen brachte, den stellen Sie mir noch auf den Tisch.“
Er ordnete die Bilder seiner Frau dem Alter nach — und vor jedes legte er ein Päckchen Briefe — rechts davon stellte er die Bilder der Eltern — das der Mutter nahm er immer wieder auf, führte es dicht an das Gesicht, schloß die Augen, lächelte und stellte es dann — nachdem er zögernd das Bild seiner Frau ein wenig zur Seite gerückt hatte — in die Mitte.
Als Jacob den Topf mit den Tulpen brachte, brannten die Kerzen — und der Alte saß an dem Tisch — über einen Brief gebeugt — sah und hörte ihn nicht.
Auf den Zehen ging Jacob hinaus — schloß die Tür nicht, sondern ließ sie angelehnt — setzte sich auf den Flur — mit dem Rücken zur Tür — verfolgte jedes Geräusch im Zimmer und hielt sich wach — ohne daß der Alte es wußte — um da zu sein, wenn man ihn brauchte. — —
III.
Es mochte Mitternacht sein, als in der Villa die Türglocke ging und ein Depeschenbote dem Hauswart ein dringendes Telegramm durch das Fenster reichte.
Der Hauswart, der nicht viel jünger war als der alte Herr und wie Jacob schon seit einem Menschenalter im Dienste des Barons stand, vermutete als Absender einen Gratulanten und wußte daher nicht recht, ob er das Telegramm nach oben bringen sollte. Aber der rote Streifen ließ es ihm so dringend erscheinen, daß er zur ersten Etage hinaufstieg, um es Jacob zu geben. Mochte der entscheiden.
Jacob, der noch immer vor der Tür des Herrenzimmers saß, sah den Hauswart schon kommen, als er noch auf der Treppe war. Er erhob sich behutsam, führte den Finger an den Mund und wies auf die handbreit offenstehende Tür. In gemeinsamem Dienst aufeinander eingestellt, waren sie daran gewöhnt, sich zu verständigen, ohne viel zu reden. — Jacob sagte sich: den Alten aus dem Schlaf zu wecken wäre unbedenklicher als ihn aus seiner andächtigen Stimmung zu reißen. Er hielt sich daher, trotz der Bedenken, die der Hauswart äußerte, für berechtigt, das Telegramm zu öffnen, um es auf seine Wichtigkeit hin zu prüfen. Sein Erstaunen war so groß, daß er, zitternd an Händen und Beinen, nach der Lehne eines Stuhles griff. Auch der Hauswart, der ihm das Telegramm aus der Hand nahm und es las, entfärbte sich. — Sie waren sich einig, daß der Alte es sofort lesen mußte. — Also schob jetzt Jacob behutsam die Tür ins Zimmer, ging auf den Zehen an den Tisch heran, legte das Telegramm vor den Alten hin und entfernte sich wieder, ohne ein Wort zu sprechen.
Der Alte nahm die Depesche auf und las:
„Eintreffen alle sechs morgen früh sechs Uhr dreißig Frankfurt. Stop. Beordere Autos an Bahn und richte es bitte ein, daß bei dir wohnen können. Stop. Adolf, Adele, Ernst, Elisabeth, Richard, Resi.“
Der Alte ahnte nicht, welche Mühe es die sechs gekostet hatte, sich über den Wortlaut dieses Telegramms zu einigen. Dutzende von Telephongesprächen waren erforderlich gewesen.
Das ist die neue Sachlichkeit, dachte er. So depeschieren Kinder an ihren Vater, der seinen fünfundsiebzigsten Geburtstag feiert. Und er suchte unter den Papieren, die vor ihm auf dem Tische lagen, ein Telegramm aus dem Jahre 1875 heraus, das er bei ähnlicher Gelegenheit von Gastein aus an seine Mutter gesandt hatte. Das lautete:
„Geliebtes Muttchen. Gib dir keine Mühe, mich hier zurückzuhalten. Ich bin zu Deinem Geburtstag in Frankfurt — mit oder ohne Rheuma. In inniger Liebe Dein Sohn.“
Der Alte zerknüllte das Telegramm — wollte es in den Papierkorb werfen — zögerte — überlegte — lächelte — nickte mit dem Kopf und sagte leise vor sich hin:
„Immerhin, sie kommen — ich hatte es nicht gedacht. — Die Mutter würde sich freuen, wenn sie es noch erlebte.“ — Er entfaltete das Telegramm wieder, legte es vor sich hin und strich es mit den Händen glatt. Er las noch einmal die Unterschriften: „Adolf — Adele — Ernst — Elisabeth! —“ Hier machte er eine Pause und wiederholte: „Elisabeth“ — schloß für einen Augenblick die Augen und wurde ernst. Dann fuhr er fort: „Richard — daß du kommen würdest, mein Junge, hatte ich im Gefühl“ — er nahm das Telegramm wieder auf und las zu Ende. — „Nun denn in Gottes Namen, so werde ich sie also alle zur gleichen Zeit bei mir haben.“
Er läutete — Jacob war im selben Augenblick zur Stelle.
„Ich breche ab“, sagte der Alte, „aber die Kerzen laß brennen — zu Ehren der Toten — die Jugend hat mich überrumpelt — hier, lies.“
„Ich habe bereits ...“
„Ah so — richtig! Das Telegramm war offen.“
„Ich dachte, für den Fall, daß es nichts Wichtiges war, daß ich dann den Herrn Baron nicht hätte zu stören brauchen.“
„Ich weiß“, sagte der Alte gütig, stand auf und stützte sich auf Jacobs Arm. — Und als sie in die obere Etage stiegen, in der die Schlafzimmer lagen, sagte er:
„Sie kommen alle sechs, — macht es nur recht fein. — Sie sind verwöhnt. — Sie kennen nichts anderes, als gut zu essen, zu trinken und sich gut anzuziehen, — die Ärmsten!“
Und als er gebetet hatte und in seinem Bett lag, faltete er noch einmal die Hände und sagte:
„Herr, laß den morgigen Tag gut vorübergehn!“ Dann schlief er ein.
IV.
Wenige Stunden zuvor hatte sich den um zehn Uhr vom Anhalter Bahnhof aus nach Frankfurt am Main Reisenden ein amüsantes Bild geboten. Sechs Schlafwagenabteile erster Klasse waren nebeneinander belegt. Die fünf Verbindungstüren standen offen. Je drei Zofen und Diener waren damit beschäftigt, aus kostbaren Reisetaschen Kopfkissen, Pyjamas, Schuhe und unzählige Toilettengegenstände für ihre Herrschaft auszupacken. In vier Abteilen breiteten sie über die Laken große, weiche Lederdecken. In einem Abteil ließ die Zofe sämtliche Bettwäsche entfernen und legte eigene Wäsche auf. Alle sechs Abteile wurden mit einer gelben Flüssigkeit desinfiziert, zwei überdies mit einem herb duftenden Parfüm besprengt. Auf die Waschtische stellte man Gummischüsseln und eigene Gläser. — Dann nahmen die Diener und Zofen paarweise voneinander Abschied. Nicht eben herzlich — so daß man sah, es handelte sich nur um eine kurze Trennung. Die Zofen reisten mit, während die Diener in Berlin blieben.
Als sie auf den Flur traten, kamen sie miteinander ins Gespräch.
„Das hat wohl keiner von uns geglaubt, daß die drei Brüder noch einmal mit ihren Frauen zusammen reisen würden.“
„Zu seiner Beerdigung schon — aber zu seinem Geburtstag!“
„Sind Ihre Herrschaften denn überhaupt schon mal zusammen gereist?“
„Einmal — nach ihrer Hochzeit — später nicht mehr.“
„Unsere Herrschaft wird immer verliebter ineinander.“
„Ein Jude und eine Gräfin — das hätte ich nie geglaubt.“
„Wo Geld ist, verwischen sich die Unterschiede — sogar äußerlich.“
„In einer alten Familie wie dieser schon — aber nicht bei Neureichen.“
„Bei uns verkehren jetzt Leute, die hätte unsere Gnädige früher nicht angesehen.“
„Von fünf Millionen aufwärts spielt die Herkunft keine Rolle mehr.“
„Und von zehn Millionen aufwärts ist auch die Herkunft des Geldes gleichgültig.“
„Platz nehmen!“ rief draußen eine Stimme.
Die drei Diener verließen den Wagen, vor dem — bestaunt von den Mitreisenden — eine Gruppe von drei auffallend eleganten Damen und drei Herren stand. — Es waren die Barone v. Rosen-Geldberg mit ihren in leichte Reisepelze gehüllten Frauen.
Zuerst stieg der große, schlanke Baron Ernst in den Wagen, blieb an der Tür stehen und half den drei Frauen hinauf. Dann folgte Adolf — und als letzter Richard.
Im selben Augenblick setzte sich der Zug in Bewegung. Die sechs suchten ihre Abteile auf, vor denen noch immer die Zofen standen.
„So dicht lagen wir noch nie zusammen“, sagte Frau Resi zu ihrem Gatten. — Der erwiderte:
„Du könntest es öfters haben, — wenn du Wert darauf legtest.“
„Du weißt doch, Richard, ich liebe die Abwechslung —“ Dabei sah sie so ungeniert in das Nebenabteil, daß Richard sagte:
„Schließe die Tür zu, Ernst!“
„Als wenn das eine Abwechslung wäre“, erwiderte Resi.
„Du tätest gut, mich nicht daran zu erinnern.“
„Dies Kapitel fällt in meine zweite Ehe, für die ich dir keine Verantwortung schulde.“
„Ich fürchte, deine dritte Ehe dürfte nicht deine letzte sein.“
„Ich hoffe es.“ —
Im Nebenabteil sagte Adele:
„Ich fühle mich nie so einsam wie im Schlafwagen.“
„Du kannst ja die Tür zu mir offen lassen“, erwiderte Adolf.
„Als wenn das nicht auf dasselbe herauskäme.“
„Übermorgen sind wir wieder in Berlin — und dann bist du dein eigner Herr.“
„Du bist so gut und nachsichtig“, sagte sie und hielt ihm die Hand hin, die er küßte. —
Im Mittelabteil umarmte Elisabeth ihren Mann und sagte zärtlich:
„Ich liebe den Schlafwagen — ich fühle mich da noch näher bei dir.“
„Als wenn wir uns nicht immer gleich nahe wären“, erwiderte Ernst und küßte Elisabeth auf den Mund.
„Das tut ihr nur, um uns zu ärgern“, sagte Adele.
„Das tun wir auch, wenn ihr nicht dabei seid“, erwiderte Elisabeth, — und Richard rief, um es zu keinem Streit kommen zu lassen, auf den Flur hinaus:
„Schaffner, wir möchten noch etwas trinken.“
Der Schlafwagenschaffner erschien.
„Haben Sie Schampus?“ fragte Richard.
„Deinhard und Matthäus Müller.“
„Nee, Sekt“, wiederholte Ernst.
„Das ist doch Sekt“, sagte der Schaffner.
Die sechs sahen sich erstaunt an.
„Sie können auch Heidsick haben.“
„Na also!“
„Jahrgang?“
Der Schaffner verstand nicht.
„Haben Sie 1921er oder 11er?“
„Eine Jahreszahl steht nicht drauf.“
„Also dann Fachinger“, entschied Adele — und Adolf sagte:
„Die armen Menschen, die gezwungen sind, immer mit der Eisenbahn zu fahren.“
„Die Masse empfindet das nicht“, belehrte ihn Ernst, „wo sollten die auch das Geld hernehmen, um im Auto oder gar im Flugzeug zu reisen.“
Adolf zog die Stirn in Falten und sagte:
„Der Volkswohlstand läßt doch noch viel zu wünschen übrig.“
„Du vergißt, wir haben einen Krieg verloren“, belehrte ihn Ernst.
Aber Adolf widersprach und erklärte:
„Auch in den Siegerstaaten ist die Eisenbahn noch das verbreitetste Beförderungsmittel.“
„Hört auf mit der dummen Politik. Entweder wir schlafen jetzt, oder wir spielen Bridge“, erklärte Adele.
In diesem Augenblick klopfte der Schaffner und brachte ein Tablett mit sieben Gläsern und zwei Flaschen 1905er Pommery Greno pur.
„Nanu?“ rief Adolf — „unser Schampus? Wo haben Sie den denn plötzlich her?“
Der Schaffner lächelte und wies geheimnisvoll auf den Flur.
Resi steckte als erste den Kopf hinaus und lachte laut auf.
„Natürlich!“ rief sie. „Wer sollte das sonst sein?“
In einem rosaseidenen Pyjama erschien frisch rasiert Iwan Tetenborn, grüßte mit rosigstem Lächeln und sagte:
„Guten n’Abend! — Wie geht’s?“
„Ja, wie kommen Sie denn plötzlich ...?“ fragten sechs Stimmen zur gleichen Zeit.
„Ich habe mir gesagt: der alte Herr Baron v. Rosen-Geldberg wird fünfundsiebzig Jahre alt.“
„Ja — und?“ fragte Resi.
„Da werden die drei Herren Söhne mit ihren Frauen vermutlich nach Frankfurt fahren.“
„Aber wieso gerade jetzt — mit diesem Zuge?“
„Ich war seit heute früh bereits achtmal an der Bahn, um die Züge zu beobachten, die nach Frankfurt fahren.“
„Und was haben Sie mit dem Geburtstag unseres Schwiegervaters zu tun?“ fragte Elisabeth.
„Le père de mes amis est mon ami.“
„Gott! Wie geistreich!“ sagte Resi spöttisch, — und Elisabeth erklärte:
„Die Feier findet im allerengsten Familienkreise statt.“
„Das alles wird sich morgen finden“, erwiderte Iwan Tetenborn, der klein, rund und etwa vierzig Jahre alt war. — „Zunächst einmal habe ich, da ich die Weinkarte der Mitropa kenne, dafür gesorgt, daß Sie auf Ihrer Expedition nicht verdursten.“
Er nahm dem Schaffner, der inzwischen eingeschenkt hatte, das Tablett aus der Hand und reichte es herum.
„Auf den alten Herrn Baron in Frankfurt!“ sagte er und stieß an. Und dann holte er aus seinem Abteil einen kleinen Klapptisch, den er mitgebracht hatte, und stellte ihn in Ernsts Kabine auf. Vier saßen auf Ernsts, drei auf Elisabeths Bett. Sie tranken und sprachen von den letzten gesellschaftlichen Ereignissen in Berlin. Als die Unterhaltung ins Stocken kam, kommandierte Adele:
„Bridge!“
Iwan Tetenborn griff in die Tasche und zog mehrere Spiele funkelnagelneuer Karten hervor, legte sie auf den Tisch und sagte:
„Bitte!“
Adele, die beste Spielerin, und Iwan Tetenborn, der in seinem Nebenberuf Bankier war, den eigentlichen Zweck seines Daseins aber darin sah, in der guten Gesellschaft geduldet zu werden, gewannen. Resi, die — nicht des Geldes wegen, vielmehr aus Ehrgeiz, überall die Erste zu sein, ungern verlor, wandte sich ärgerlich an Iwan und fuhr ihn an:
„Wie kommen Sie eigentlich dazu, in diesem Aufzug bei uns Besuch zu machen?“
Der kleine Herr Tetenborn berief sich auf ein paar englische Modeblätter, in denen das als besonders schick bezeichnet war — was zur Folge hatte, daß man das Spiel auf fünf Minuten unterbrach, um sich ebenfalls aus- und umzukleiden.
Sie spielten bis in den Morgen hinein. Als Iwans Diener nach der vierten Flasche meldete, daß der Pommery zu Ende sei, sagte Adolf vorwurfsvoll:
„Alles machen Sie halb, Tete!“
„Sie werden doch noch ein Bad nehmen wollen“, erwiderte Iwan. „In einer Stunde sind wir in Frankfurt.“
„Ein Bad? — Im Schlafwagen? — gibt es das endlich?“ fragte Adele.
„Im Schlafwagen nicht“, erwiderte Iwan stolz — „aber ich habe für Sie alle ein japanisches Trockenbad mitgebracht — in Europa noch völlig unbekannt — es ersetzt das Wannenbad vollkommen.“ — Er zog aus der Tasche sechs mit japanischen Schriftzeichen bemalte Tuben und gab jedem eine.
„Wie macht man das?“ fragte Resi.
„Ich habe es Ihren Zofen schon beigebracht — warten Sie einen Augenblick — ich rufe sie.“
Iwan lief den Gang entlang.
„Ein aufmerksamer Mensch“, sagte Elisabeth.
„Etwas schautig“, erwiderte Adolf — doch Frau Adele meinte — ohne daß sie dabei jemanden besonders ansah:
„Eine Schaute ist noch immer mehr als eine Null.“
V.
Als der Zug in die Halle des Frankfurter Bahnhofs lief, sagte Frau Resi:
„Das erste, was ich jetzt tue, ich lege mich bis mittags ins Bett.“
Frau Adele erwiderte gähnend:
„Ich kann mich auch kaum auf den Beinen halten.“
Aber die rassige, überschlanke Elisabeth reckte sich und rief:
„Ihr reist nicht zu eurem Vergnügen! Also nehmt euch zusammen.“
Der Zug hielt.
„Wer wird wohl zu unserem Empfang an der Bahn sein?“ fragte Adolf.
„Die liebe Familie“, erwiderte Resi — „die mich nicht riechen kann.“
„Was denn?“ fragte Elisabeth — „existieren außer dem Papa etwa noch Onkel und Tanten?“
„Du wirst staunen“, erwiderte Resi, „was du heute alles zu sehen und — zu küssen bekommst!“
„Ich denke nicht daran .....“
„Aber die anderen denken daran — und die sind in der Überzahl.“
Wirklich standen da zwei feine, alte jüdische Damen, von denen eine den Arm erhob, als sie die Barone v. Rosen-Geldberg mit ihren Frauen am Fenster sah.
„Die Tanten!“ rief Resi spöttisch — und Elisabeth meinte:
„Die sehen gar nicht so übel aus.“
„Ihre Familie ist älter als deine“, erklärte Richard.
„Inwiefern?“ fragte Elisabeth erstaunt — und er erwiderte, während er zu den alten Damen hinüberwinkte:
„Insofern es auch einen jüdischen Adel gibt.“
„Mach keine Witze, mir ist nicht danach zumute.“
„Der sich“, fuhr Richard fort, während er seiner Schwägerin aus dem Wagen half, „im Lauf der Jahrhunderte freilich mehr mit Pflege der Kultur als mit Raubbau beschäftigt hat.“
„Im Ghetto?“ erwiderte Elisabeth spöttisch.
„Vielleicht beschäftigt ihr euch jetzt statt mit jüdischer Kulturgeschichte mit euern Tanten“, erklärte Resi und wies auf die beiden alten Damen, die nicht, wie Elisabeth erwartet hatte, die Arme ausstreckten, um ihre Neffen zärtlich an sich zu ziehen, sondern sehr reserviert dastanden und ihnen nur kühl die Hände reichten.
Da sie Elisabeth nicht kannten, so stellte Richard sie vor. Er nannte zwei Namen — wohl absichtlich so leise, daß man sie nicht verstehen konnte. — Die Damen reichten Elisabeth die Hand — und eine von ihnen sagte:
„Mein Bruder freut sich sehr, daß Sie kommen. Ich habe den Auftrag, Sie alle in seinem Namen zu begrüßen.“
„Wie geht’s Papa?“ fragte Richard.
„Er ist von einer geistigen Frische, die man selbst bei jüngeren Menschen selten findet.“
Die drei Neffen fühlten sich getroffen und sahen ängstlich ihre Frauen an, während die Dame fortfuhr:
„Er arbeitet noch täglich vier bis fünf Stunden — liest Bücher und sammelt kostbare Gläser — mit derselben Liebe wie vor dreißig Jahren.“
„Bewundernswert ist das“, sagte Elisabeth — während Resi erklärte:
„Ich verstehe nicht, wie man in dem Alter noch Gefallen daran haben kann, zu sammeln. Man erschwert sich doch damit nur den Abschied.“
„Daran denkt er nicht“, sagte die Tante mit dem jüdischen Namen, den Elisabeth nicht verstanden hatte. Und sie wollte hinzufügen: das überläßt er Gott — unterdrückte es aber mit Rücksicht auf Elisabeth, obschon Gott ja eigentlich neutral war.
Den kleinen Iwan Tetenborn, der in einiger Entfernung stand, übersah sie absichtlich. Denn da er sich jedesmal verbeugte, wenn ihn zufällig ihr Blick traf, so wußte sie, daß er zu ihnen gehörte. Aber sie hatte zuviel Seltsames über die modernen Ehen in Berlin, vornehmlich über die ihrer Neffen, gehört, um nicht zu fürchten, daß der Herr in irgendeiner Form in eine der drei Ehen hineinspielte. Damit aber wollte sie nichts zu tun haben. Sie warf ihm daher einen Blick zu, der ihn veranlaßte, den Abstand zwischen sich und der Gruppe noch um ein paar Schritte zu vergrößern.
Vor dem Bahnhof standen drei Autos. Zwei davon waren für die Rosen-Geldbergs bestimmt, während das dritte den beiden Damen gehörte.
„Wohnen wir zu Haus?“ fragte Ernst, — und dies „zu Haus“ wirkte auf Elisabeth so fremd, daß sie zum ersten Male seit ihrer Ehe eine Distanz zwischen sich und ihrem Manne fühlte.
„Euer Vater dachte, für eine Nacht sei es bequemer, vor allem für euch, im Hotel zu wohnen.“ — Elisabeth atmete auf. — „Er hat daher Appartements für euch im Frankfurter Hof bestellt.“
„Ausgezeichnet“, sagte Resi. — Und da die Tante eben dicht bei den Autos wieder den kleinen Herrn auftauchen sah, so fragte sie:
„Wieviel seid ihr denn?“
„Wir sechs und dann drei Zofen“, erwiderte Richard.
„Und der Herr da?“
„Richtig, Tete!“ rief Resi — „der ist uns unterwegs zugelaufen.“
Iwan Tetenborn war herangetreten und verbeugte sich. Richard stellte ihn vor. Die beiden Damen bewegten nur leicht die Köpfe.
„Sie sind mit meinem Bruder, dem alten Baron, befreundet?“ fragte die Tante.
„Ich habe leider nicht den Vorzug, ihn persönlich zu kennen.“
Die Dame wandte sich an ihre Neffen und sagte:
„Euer Vater hat den Wunsch, den heutigen Abend allein mit euch zu verbringen — auch wir werden daher an der Feier, die übrigens nur in einem kleinen Essen besteht, nicht teilnehmen.“
Die drei Schwägerinnen lächelten sich zu — Iwan Tetenborn, der noch immer den Hut in der Hand hielt, wandte sich an die alten Tanten und sagte:
„Vielleicht, daß die Damen mir dann die Ehre erweisen .....?“
„Was für eine Ehre?“ fragte die Tante, die stets auch für ihre Schwester sprach, beinahe ängstlich.
„Als meine Gäste bei einem kleinen Essen im Frankfurter Hof den Geburtstag ihres Herrn Bruders zu feiern.“
Die Tanten waren sprachlos — die Schwägerinnen lachten laut — Richard sagte:
„Ich glaube, Tete, Sie haben die Namen meiner Tanten nicht verstanden: die eine heißt Fuld und die andere Cohnheim — ohne das leiseste ‚von‘ davor.“
„Aber“, wehrte der kleine Herr, dessen jüdische Herkunft unverkennbar war, ab und verbarg nur schlecht seine Enttäuschung — „als wenn ich auf derartige Äußerlichkeiten Wert legte!“
„Ich kenn’ Sie doch, Tete“, sagte Frau Resi ganz ungeniert, — und daß sie ihn richtig einschätzte, verriet er, indem er erwiderte:
„Als ob nicht jeder Kellner und Gast im Frankfurter Hof weiß, daß die Damen die Schwestern des alten Barons v. Rosen-Geldberg sind.“
Die Tante, die immer auch für die andere sprach, verabschiedete sich sehr unvermittelt von ihren Neffen und deren Gattinnen, indem sie sagte:
„Ich schlage vor, ihr sagt alle erst schnell einmal meinem Bruder guten Morgen — Sie natürlich nicht, Herr Tetenborn! — und fahrt dann ins Hotel. Mein Bruder hat das Diner für fünf Uhr festgesetzt, damit ihr den 10-Uhr-Zug nach Berlin noch erreicht.“
Elisabeth fing bereits an, den alten Herrn gern zu haben. Auch Resi, die in Frankfurt weitreichende Beziehungen hatte, dachte:
„Fein! da brauche ich nirgends Besuche zu machen.“
Sie verabschiedeten sich und verteilten sich in die Autos. — Die Zofen standen hilflos herum. — Die beiden Tanten fuhren als erste davon.
„Tete!“ rief Ernst dem kleinen Herrn zu: „Besorge unser Gepäck ins Hotel und kümmere dich um die Zofen!“
„Mit Vergnügen“, rief der zurück und sah etwas enttäuscht den drei Autos nach, die im Schneckentempo davonfuhren.
VI.
Als die beiden Autos vor der Villa des alten Barons v. Rosen-Geldberg hielten, gab der Hauswart dem Diener Jacob nach oben ein Klingelzeichen. — Jacob ging und meldete es seinem Herrn, der auf der Veranda seines Gartens beim ersten Frühstück saß.
„Die jungen Herrn Barone mit ihren Gattinnen fahren eben vor.“
Der Alte setzte die Tasse auf den Tisch und stand auf.
Unten in der Halle gab es eine kleine Verzögerung. Die Türen zu den Wohnzimmern standen offen und waren mit Blumen und anderen Geschenken angefüllt.