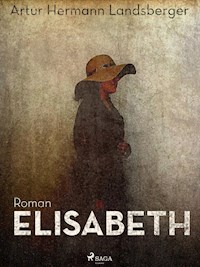Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor, hier gleichzeitig der Erzähler der Geschichte, erhält von der Lloyd Triestino das Angebot, mit einem ihrer Passagierschiffe nach China und Japan zu reisen. Ein Jahr, ein großartiges Angebot! Auf seine Anfrage beim Lloyd in Triest, ob er für eine "angesichts der langen Reise zweckdienlich erscheinende Begleitung" auf Fahrpreisermäßigung rechnen könne, bekommt er die Antwort: "Falls die …. Begleitung Ihre Gattin ist, die Hälfte; andernfalls - !!!" Da ihm selbst für eine solche Reise die Ehe als zu hoher Preis erscheint, entscheidet er sich für "andernfalls". "Andernfalls" verliert er aber auf dem Indischen Ozean an einen siamesischen Grafen, von dem er aber die bezaubernde Ehefrau Beatrice übernimmt, der es zu schaffen macht, nur eine von zwölf Ehefrauen des Prinzen zu sein. Also reist er mit Beatrice weiter durch China und nach Japan, wo er aber mit der Geisha Hana die unvergesslichsten Tage seines Lebens verbringt. Ein Buch voller Begegnungen, herrlicher Dialoge, Länderkunde und erotischem Amüsement.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Artur Hermann Landsberger
Lachendes Asien!
Fahrt nach dem Osten
Saga
Erstes Kapitel
Ehemals kam einem, wenn man in Berlin nach einem guten Frühstück auf die kalte Straße trat, der Gedanke: »wie schön muß es jetzt in Nizza sein!« — und am Abend desselben Tages schlief man dann statt zu Hause im Süd-Expreß, der einen ohne Paß und Zollschwierigkeiten nach dem Süden brachte.
Heute beginnt man im März zu kalkulieren, ob man es ermöglichen wird, im August nach dem Schwarzwald zu fahren, gibt bereits im Juni »unüberwindlicher Schwierigkeiten wegen« die Reise auf und — ärgert sich zu Hause weiter.
Ein guter Freund, der durchaus kein Materialist ist und dem ich erzählte, daß ich als Gast des Lloyd Triestino nach China und Japan fahre, erwiderte, statt von Chinas Göttern und Japans Kunst zu schwärmen: »Sie Glücklicher! auf ein Jahr dem Wohnungsamt und Finanzamt entrückt zu sein!«
Diese unfreie Einstellung ist eine bitterernste Angelegenheit. Sie nimmt den Schwung, ohne den der Mensch des Lebens und der Arbeit nicht froh werden und daher nicht vorwärtskommen kann.
Als die Einladung des Lloyd Triestino kam, rüstete ich gerade nach Massa bei Carrara, um dem Mißvergnügen dieses Winters ein künstliches Ende zu bereiten. Die Umstellung fiel nicht schwer. Wenigstens die innerliche. Man hatte von Japan geträumt. Jahrzehntelang. Als der Krieg kam — nicht erst, als man ihn verlor — begrub man die Hoffnung, daß dieser Traum je Wirklichkeit würde. Rom erschien wieder als Grenze des Erreichbaren. Und nun sollte das Unzulängliche doch Ereignis werden! Halleluja!
Hinsichtlich der äußeren Einstellung gab es zweierlei zu bedenken: Ausrüstung und Begleitung. — Mein Freund, ein alter Afrikaner, in glücklicheren Zeiten Bezirksamtmann in Duala, schleifte mich zu einem Spezialisten, der, glücklich, endlich wieder einen Tropenreisenden einzukleiden, von Kopf bis zu den Zehen meine Maße nahm. Qualvolle Anproben folgten und eine Woche später stand ich vor einem Berg von weißen Anzügen. — »Was ist das?« fragte ich angesichts zweier operettenhaft wirkender Kleidungsstücke und erfuhr, daß es ein weißer Frack und ein weißer Smoking waren. Meine Absicht, einen schwarzen Frack mitzunehmen, begegnete mitleidigem Lächeln, und der Spezialist meinte: »Dann können Sie auch gleich den Fisch mit dem Messer essen!« —
Die zweite Einstellung: die Begleitung. Auf meine Anfrage bei der Generaldirektion des Lloyd in Triest, ob ich für eine »angesichts der langen Reise zweckdienlich erscheinende Begleitung« auf Fahrtermäßigung rechnen könne, bekam ich die etwas undeutliche Antwort: »Falls die Ihnen zweckdienlich erscheinende Begleitung Ihre Gattin ist, die Hälfte; andernfalls —!!!«
Da mir selbst für eine Reise nach China und Japan die Ehe als zu hoher Preis erschien, so entschied ich mich für »andernfalls«.
»Andernfalls« singt heute zum einundsechzigsten Male die Hauptpartie in einer Fallschen Operette. Die Premiere hatte ich über mich ergehen lassen. Ihr Gesang, Tanz und Spiel hatten durchaus auf dem Niveau gestanden, das sich für eine erste Berliner Soubrette gehört. Dementsprechend war auch der Applaus und der Berg von Blumen gewesen, der nach dem zweiten Akt »Andernfalls« für Stunden glauben ließ, eine Künstlerin von Gottes Gnaden zu sein. Jedenfalls sagte sie, als wir später bei Austern und einer Flasche sehr altem Château Olivier dry saßen, mit noch erhitzten Wangen und einem Blick, den ich noch deutlich vor mir sehe:
»Wenn du mich jetzt nicht zur Oper bringst, betrüge ich dich mit einem Konfektionär.«
Mit dieser Drohung glaubte sie, alles bei mir erreichen zu können. Ich erwiderte trocken:
»Gut! Es paßt in mein Programm.«
»Was?« fragte sie erregt. »Der Konfektionär oder die Oper?«
»Beides.«
»Artur!« schrie sie und sprang auf.
Ich reichte ihr die Einladung des Lloyd Triestino.
»Ja — hast du denn den Leuten nicht geschrieben, daß ich ...«
»Welches Interesse hätten sie, zu erfahren, daß ich mit einer Operettendiva ...«
»Ich pfeif’ auf die Operette!« unterbrach sie. Aber ich fuhr unbeirrt fort:
»... die jetzt zur Oper will ...«
»Ich pfeif’ auf die Oper!« brüllte Andernfalls, und, gerührt von soviel Liebe, lenkte ich ein und sagte:
»Du würdest also wirklich, nur um mit mir ...«
Abermals unterbrach sie mich und rief:
»Für Indien opfre ich alles!«
Ernüchtert zog ich die Hand, mit der ich sie eben zu mir ziehen wollte, zurück und sagte:
»Was weißt du denn von Indien?«
Verächtlich sah sie mich an und zählte auf:
»Indische Schals! Indische Seide! Perlen! Smaragde! Rubine! Halbedelsteine! Weiße Elefanten! Maharadschahs! Bonsels ...«
»Was ist denn das?« fragte ich.
»Ich weiß nicht. Aber jedenfalls auch etwas, was mit Indien zusammenhängt. Und da ich mir schon längst in den Kopf gesetzt habe, alles das endlich einmal mit eignen Augen zu sehen, so fahre ich mit! — Ueberhaupt« — und jetzt trat sie nahe an mich heran und legte ihre Hände auf meine Schulter: »wo wir uns doch so lieb haben!«
Sie umschlang mich, und ein paar Minuten später baten wir ihren Direktor telephonisch, doch an unserer intimen Siegesfeier teilzunehmen. Nach der dritten Flasche Olivier eröffnete ich ihm, daß ich in wichtigen Staatsgeschäften nach Japan müsse, ohne »Andernfalls« aber außerstande sei, einen vernünftigen Gedanken zu fassen. Daß das Interesse des Vaterlandes also von ihr die Selbstentäußerung verlange, auf ihre allabendlichen Triumphe zu verzichten und mich zu begleiten — und von ihm, als strammen Republikaner, das Opfer, sie freizugeben und für einen Ersatz zu sorgen.
Ein schwacher Widerstand wurde gebrochen, und so wurde die Premierenfeier zugleich das Abschiedsessen, zu dem wir immer neue Freunde aus ihren Stammlokalen herbeiriefen.
Als ich Andernfalls gegen Morgen nach Hause fuhr, lag sie im Halbschlaf und träumte von Indien:
»Berge so hoch wie in der Schweiz,« phantasierte sie. »Von unten bis oben besetzt mit Edelsteinen. Maharadschahs mit Augen, die schimmern wie Smaragde, reiten auf weißen Elefanten zum Gipfel, auf dem die Nautschgirls, nur in weiße Seidenschals gehüllt, tanzen.«
»Und wo bleibt Bonsels?« fragte ich.
»Der träumt,« hauchte Andernfalls und schlief ein. — Aber am nächsten Tage!
Am nächsten Tage begann Andernfalls »sich für die Reise vorzubereiten«. — So nannte sie’s. Und ich war arglos genug und dachte, sie würde die kurze Zeit nutzen, sich in der englischen Sprache zu vervollkommnen.
»Zu wem gehst du?« fragte ich.
Andernfalls zog einen Zettel aus der Tasche, auf dem die Namen von fünf Modesalons, vier Wäschemagazinen, drei Strumpf- und Handschuhläden, zwei Maßschustern, einer Korsettiere und drei Parfümerien standen.
»Dein Scheckbuch, bitte!« sagte sie.
»Aber Kind,« erwiderte ich, »alles das kaufst du in Asien doch für die Hälfte.«
»Soll ich bis dahin nackend gehen?«
»Gehst du hier nackend?« fragte ich.
»Du bist stillos!« schalt sie. »Berlin ist nicht Italien. Italien nicht Afrika. Afrika nicht Asien. Und auf dem Schiff läuft man auch nicht wie auf dem Kurfürstendamm herum.«
Wo hatte Andernfalls sich in so kurzer Zeit orientiert? Sie, die nicht wußte, ob Moskau nördlich oder südlich von Berlin lag und noch vor ein paar Monaten zu einem Operettengastspiel nach Amsterdam auf dem nächsten Wege über Paris fahren wollte, kannte plötzlich den Seeweg nach Indien!
Der Wahrheit die Ehre! Bei einem Vergleich meiner Reisevorbereitungen mit denen von Andernfalls, der nach Verlauf von vierzehn Tagen erfolgte, schnitt ich, war ich ehrlich gegen mich selbst, miserabel ab.
Die Modenschau, verbunden mit dem endgültigen Abschiedssouper, die Andernfalls in engstem Kreise bei sich veranstaltete, war so einzigartig und verblüffend, daß Selbstvorwürfe und letzte Reue über meinen Entschluß, sie mitzunehmen, schwanden. Wieviel Geschmack, Takt, Phantasie, Sinn für Farben, Empfindsamkeit und Instinkt für Milieus, die sie doch nur ahnte, kam hier ans Licht! Wieviel Schöpferisches war hier geleistet! — Ich hingegen hatte die Zeit damit verbracht, aus unzähligen Werken den Weg zu Chinas Göttern und Japans Kunst zu finden, sowie mir im Verkehr mit Chinesen und Japanern die notwendigen Verbindungen nach Asien zu schaffen.
Etwa ein Dutzend Visa benötigten wir. Als Grund meiner Reise gab ich an: Studienzwecke. »Und die Dame?« fragten eifrige Konsulatsbeamte. »Begleitet mich!« gab ich zur Antwort, die meist genügte. Nur der österreichische Beamte, obschon es nur ein Transitvisum für die Eisenbahnfahrt von ein paar Stunden war, schürfte weiter: »Zu welchem Zweck?« — Andernfalls zeigte ihren photographischen Apparat, und als er weiter fragte: »Was ist das?« erwiderte sie: »Eine Schreibmaschine; und wenn es Sie beruhigt, setze ich mir auch noch eine Brille auf.« Daraufhin fragte er nichts mehr.
Am Vorabend unserer Abreise kam Andernfalls plötzlich auf den Gedanken, ihre Dreizimmer-Wohnung für die Dauer ihrer Abwesenheit zu vermieten. Es war als Ueberraschung für mich gedacht.
»Denn«, sagte sie, »gern tue ich es nicht. Aber da du doch soviel Anschaffungen für die Reise machen mußtest, so wollte ich dich ein wenig entlasten.«
»Kind,« beruhigte ich sie und wies auf ihren Berg von Koffern, »damit holen wir noch nicht die Kosten für die Fracht bis Triest heraus.«
»Siehst du!« rief sie freudig, »das habe ich mir auch gesagt. Und da die Emmy doch für mich in der Operette einspringt ...«
»Zu so einer Rolle wäre sie sonst nie gekommen.«
»Gewiß! aber mein Gewissen beruhigt es doch, daß ...« — sie zögerte.
»Nun?« sagte ich, und sie fuhr fort:
»Sieh mal, wenn eine einspränge, die mehr kann als ich.«
»Darum also das Gefühl der Dankbarkeit.«
»Es hätte meine Reisefreude zum mindesten nicht erhöht.«
»Sie wird also bei dir wohnen?«
»Ja! — Besser, man weiß, wen man bei sich hat, und zahlt die paar Mark Miete weiter.«
»Das also ist deine Ueberraschung?«
»Du hast doch selbst eben gesagt, es käme noch nicht einmal die Fracht für die Koffer dabei heraus.«
»Gewiß! das habe ich gesagt. Nur hätte man dann am Ende besser getan, die Wohnung abzuschließen ...«
»Du machst es einem wirklich schwer. Will man dir schon mal eine Freude machen ...«
»Du hast recht, ich bin undankbar. Hast du sonst noch irgendeinen Wunsch?«
»In einem Fenster in der Budapesterstraße steht ein Hut — ich glaube, wenn du den siehst ...«
Ich sah nach der Uhr und sagte:
»Schade! Fünf vor sieben. Vor einer Viertelstunde können wir nicht da sein.«
Andernfalls setzte ihr allerliebstes Lächeln auf:
»Ich habe, kurz ehe du kamst, telephoniert,« sagte sie verschmitzt. »Sie schließen nicht — es sei denn, ich telephoniere ab.«
»Wie konntest du wissen, daß ich ...?«
»Aber!« sagte sie zärtlich. »Ich wußte doch, wenn ich dir die Geschichte von der Wohnung erzähle, daß ich die Absicht hatte, dir zuliebe ...«
Als wir den Modesalon betraten, kam uns die Inhaberin des Salons mit je einem Hut in der Hand entgegen:
»Gut, daß Sie da sind!« rief sie erregt. »Sie glauben gar nicht, was für Mühe ich hatte, die beiden Hüte für Sie aufzubewahren. Ein halbes Dutzend Damen, darunter zwei Ihrer Kolleginnen, wollten sie mir förmlich aus dem Fenster reißen.«
»Hörst du?« wandte sich Andernfalls an mich.
»Aber da es eine Ueberraschung für den Herrn Doktor sein sollte ...«
»Ich muß dir sagen, die ist gelungen,« erwiderte ich.
Andernfalls probierte auf.
»Es ist ein Pech für dich, daß mir jeder Hut steht,« sagte sie. »Aber entscheide selbst.«
Ich entschied mich für den, den sie grade auf dem Kopf hatte.
»Aber!« widersprach die Dame des Salons. »Sie werden doch nicht wollen, daß eine Kollegin ...«
»Fräulein Andernfalls wird sich nach unserer Rückkehr der Oper zuwenden,« parierte ich.
»Da werden Herr Doktor künftighin soviel für Toiletten sparen, daß Sie diesen Hut noch auf das Konto Operette buchen können.«
»Gib schon nach!« vermittelte Andernfalls. »Denk doch, was das Auto kostet, wenn wir uns so lange hier aufhalten.«
»Immer aufs Sparen bedacht!« sagte die Dame des Salons, während Andernfalls mir eine Huttüte in den Arm schob und mit der andern hastig in das Auto eilte.
Am Abend des nächsten Tages standen wir an dem Fenster unseres Schlafwagens und erwiderten die Grüße guter Freunde und Freundinnen, die teils gern, teils weniger gern auf einige Monate von uns Abschied nahmen. Und als der Vorsteher endlich das Zeichen zur Abfahrt gab — es wird auch von klugen Leuten nie dümmeres Zeug gesprochen als während der letzten Minuten vor Abfahrt eines Zuges — atmete ich auf und sagte:
»Gott sei Dank!«
»Es ist nicht einer darunter, der uns diese Reise gönnt,« erwiderte Andernfalls.
Als gleich darauf der Zug sich in Bewegung setzte, waren wir innerlich schon ganz von denen da draußen abgerückt. Mechanisch winkten wir noch Abschied, bis der Zug aus der Halle war. Dann aber, als Berlin hinter uns lag, ergriff uns das Gefühl, auf Monate losgelöst von allen Pflichten und Gebundenheiten, frei, ganz frei zu sein, so stark, daß wir uns schluchzend in die Arme fielen, um gleich darauf laut aufzulachen wie die Kinder.
Am nächsten Morgen: München, in dem ich, der ewige Student seit 1896, jährlich ein paar Wochen der Erinnerung lebte; ohne den sachlichen Ernst des Nordens schon mit leisem Anflug südlicher Fröhlichkeit — München, diesmal ohne Wärme, sachlich, stur. Die Studenten, einst beschwingt von Bacchus, ganz den süßen Mädeln hingegeben, diesmal erdenschwer, wichtig, feierlich, das Hakenkreuz im Knopfloch. — Detlev! Otto Erich! Otto Julius! wohl euch, daß ihr dies München nicht erlebtet!! Arme, süße Mädel! bedauernswerter Bacchus!
In aller Frühe südwärts. Ueber Salzburg und das verschneite Gastein nach Triest. Sonne! liebe Sonne! Lachende Menschen! Zwei glückliche Tage! Mascagni dirigiert in der Opera Verdi. Tausend Herzen schwingen mit. Man spricht italienisch und der Italiener antwortet auf deutsch und lächelt freundlich. Man wird von einem alten Freund bewirtet. Bei Grancevola — wie lange hat man sie entbehrt! — und Lacrimae Christi spricht man von allem — nur vom Kriege nicht. Der Polizeikommissar prüft die Pässe. Nach Japan. Sein Interesse erwacht. Die Unterhaltung ist im Gange. Er geleitet uns hinaus, drückt uns die Hand und gibt gute Wünsche für die Reise mit. Der Polizeikommissar! Halleluja!
Am Spätnachmittag steigen wir auf das Schiff. Zwecks Besichtigung. Man will doch sehen, wie man die nächsten Wochen über untergebracht ist. Andernfalls erwartete ein Hotel. So wie sie es von den Prospekten der großen Schifffahrtslinien her kannte. Salondampfer, die von Hamburg und Bremen nach New York fahren. Eine große Halle, Schwimmbassin, Lift und was ihre Bühnenphantasie sonst hinzudichtete. Was sie fand, war ein Sechstausend-Tons-Dampfer, auf dem die Ladung eine sehr viel wichtigere Rolle spielt als der Passagier. Ihre Kabine, als Unterstellraum für ihre Koffer, wenn auch zu klein, so doch diskutabel. Als Schlaf- und Wohnraum eine Angelegenheit, über die sie so herzlich lachte, daß der Obersteward, um sie zu beruhigen, meinte:
»Ich werde mein Möglichstes tun, daß die gnädige Frau allein in der Kabine bleiben.«
Da warf sich Andernfalls mir an den Hals und rief, während ihr vor Lachen dicke Tränen über die Wangen liefen:
»Halt mich. Ich kann nicht mehr! — Wenn ich gewußt hätte, daß man auf einer Reise nach Asien so viel lacht.«
»Wärst du dann zu Haus geblieben?« fragte ich.
»Aber nein!« widersprach sie lebhaft. »Wenn die Portionen bei den Mahlzeiten dementsprechend sind, komme ich wie eine Lilie nach Hause.«
Und als sie sich ein wenig beruhigt hatte, fragte sie noch immer lachend den Maestro:
»Sagen Sie, wieviel Passagiere kann man in so eine Kiste verpacken, ohne daß sie ersticken?«
»Das kommt auf die Temperatur an, die wir in den Tropen haben,« erwiderte der. »Gnädige Frau können Hitze gut vertragen?«
»Was nennen Sie Hitze?«
»Etwa 35—40 Grad.«
»In der Sonne natürlich?«
»In der Nacht.«
»Wie denn ...? — Ja, womit messen Sie?«
»Nach Celsius.«
»Allmächtiger!«
»Ziehst du es nicht doch vor, in Europa zu bleiben?« fragte ich.
»Wo wir in Deutschland seit Jahren um den Sommer betrogen werden? Und ich Wäsche und Kleider habe, in denen man überhaupt nicht spürt, daß man etwas anhat.«
Andernfalls tastete die Wände vergebens nach einem Schrank ab, in dem sie wenigstens die empfindlichsten Kleider unterzubringen gedachte, sie suchte für Schuhe und Wäsche vergebens nach einer Kommode, stellte fest, daß die Tür der Kabine zu schmal war, um den Schrankkoffer, der bei diesen Versuchen immer wieder von oben nach unten gekehrt wurde, hineinzuschaffen, und fragte schließlich den Maestro, ob es nicht möglich sei, bis zur Abfahrt am nächsten Abend noch bauliche Veränderungen auf dem Schiffe vorzunehmen.
Der erste Offizier und der Commissario des Schiffes wurden hinzugezogen. Im Speisezimmer fanden gleich darauf Verhandlungen statt. Ein ausgezeichneter Chianti und Andernfalls’ gute Laune erzeugten bald eine Fröhlichkeit, in der Offizier, Commissario und Maestro wetteiferten, ihre Kabinen für Andernfalls’ Reisebedarf zur Verfügung zu stellen.
Andernfalls akzeptierte sie sämtlich. Sie verteilte auch gleich die Rollen. Der erste Offizier wurde im Nebenamt Kleiderverweser, der Commissario hatte für die Unterbringung der Hüte und Wäsche, der Maestro für die tausendundein »petit riens« zu sorgen. Sie erhielten genaue Instruktionen, um während der Fahrt der Stewardesse die richtigen Gegenstände auszuhändigen.
Meinen Einwand: »Wenn jeder weibliche Passagier soviel Umstände machte«, ergänzte Andernfalls:
»So würde man sehr bald bessere Schiffe bauen,« während der Hut- und Wäscheverweser, der von nun ab nur noch im Nebenamte Commissario war, meinte: »Ich wünschte, wir hätten öfter Passagiere, für die wir so gern wie in diesem Falle ein kleines Opfer bringen.« — Und während der Maestro und die Stewardesse bis tief in die Nacht hinein Andernfalls’ Sachen unterbrachten, feierten wir mit dem Offizier und dem Commissario in der Stadt den Abschied von Europa.
Vierundzwanzig Stunden später sticht das Schiff in See. An Bord außer uns ein Auslandsdeutscher aus China und ein junger Russe, der in Chemnitz mit einem Deutschen assoziiert ist und nun nach Ceylon und Bombay fährt, um — hört zu! — in Chemnitz fabrizierte seidene Schals an indische Handelshäuser zu verkaufen! Andernfalls ist entsetzt. Der indische Seidenschal, dem sie mit derselben Ungeduld entgegenzitterte wie ich der Bodhisattva, ist entthront.
Der nächste Morgen Venedig! In Sonne getaucht. Wir halten einen Tag. Auf dem Markusplatz — in den Augen der südlichen Friedrichstadt Berlins »eine bessere Filmangelegenheit« — wimmelt’s von den vom Publikum heilig gehaltenen Tauben und den weniger heiligen Täubchen, die, auf der Hochzeitsreise, noch girren und nicht ahnen lassen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist.
Zweites Kapitel
In Brindisi, das im Regen hingeklatscht wie ein großer Klecks dalag, füllte sich am übernächsten Tag das Schiff. Ein italienischer Hauptmann, der nach Massaua in Afrika versetzt ist — Neugier, die an Bord neben der Langeweile Triumphe feiert, sucht die Ursache zu ergründen —, sieben junge Nonnen aus Neapel, ein Franziskanerpater mit schwarzem Vollbart, ein belgischer Priester und Arzt, der schon fünfzehn Jahre als Missionar in China wirkt und Chinesisch wie seine Muttersprache spricht, ein Engländer und ein Amerikaner, die wir ebenfalls für Missionare halten, und außerdem ein paar indifferente Menschen, an denen einem höchstens auffällt, daß sie auffallen möchten. Sie sind auf ein falsches Schiff, in falsche Gesellschaft geraten. Was können sie hier erleben? Die Nonnen beten und lernen Chinesisch. Sie sind dabei lustig und überhören sich gegenseitig. Sie singen — nicht nur geistliche Lieder —, aber an Toiletten, auf die es den Indifferenten ankommt — ach, du lieber Gott — bieten sie nichts. Man hat ja wohl den Wunsch, diese feinen schmalen Gesichter auch einmal in anderer Umrahmung zu sehen. Aber zu Himmel und Meer paßt diese schlichte Natürlichkeit doch wohl besser als die raffinierten Dekolletées, mit denen die Indifferenten sich überbieten. Das empfindet auch Andernfalls. Obschon der erste Offizier ihr versichert, daß ihre Kleider nach Mitternacht Tänze in seiner Kabine aufführen und ihm unruhige Nächte bereiten — ich glaube das —, hält doch Scheu vor der Wucht, mit der Himmel und Meer sich ihr erschließen, und natürlicher Takt gegenüber den Schwestern sie zurück, sich zu putzen. Ja, ich stelle mit Vergnügen fest: die Dekolletees gehen ihr auf die Nerven. Begreiflich. Sie sprechen jetzt nicht nur über Mode und Margueritte, den sie »mondäner« als Maupassant finden (man sieht, auch das weibliche Gehirn der Sieger hat unter dem Kriege gelitten), sie machen — Allmächtiger! — auch in Politik und schwärmen — diese indifferenten Dekolletées aus New York, Chicago, Philadelphia, Budapest, Rom und Paris — für Lenin! — »Ein Mann endlich!« phantasieren sie. »Alle unsere Politiker sind ja nur Puppen.« — Und die perlenübersäte Amerikanerin fügt hinzu: »Und vor allem ein Herz für die Armen! Sehen Sie nur, wie entsetzlich!« — Während sie das sagt, beäugt sie durch die goldene Lorgnette ungeniert die armseligen Passagiere im Zwischendeck. Zusammengepfercht wie das Vieh Männer, Frauen, Kinder, die ohne ein Zelt über dem Kopf im Freien nächtigen. Ein unterhaltsames Schauspiel während des Desserts. Sie löst behutsam, um sich die gepflegten Finger nicht zu beschmutzen, von einer schweren blauen Traube Beere um Beere. Angestoßene oder nicht ganz reife wirft sie denen da unten zu und lacht hellauf, wenn Männer, Frauen und Kinder die Arme strecken, danach greifen, stürzen und sich wie ein zusammengeballtes Knäuel am Boden winden. Der Herr Gemahl, die schwarze Sumatra zwischen den Goldzähnen, überbietet die Gattin und wirft italienisches Kupfer. — Andernfalls steht abseits; mit geröteten Wangen; empört über diese Amerikaner, deren Beispiel Landsleute aus Chicago und Philadelphia folgen. Ich trete an Andernfalls heran und nehme ihre Hand.
»Pack!« sagt sie, und ich habe Mühe, sie zurückzuhalten.
Schon an diesem Abend scheiden sich die Welten. Die Schiffsoffiziere, Prachtkerls, die sich lieber den Seewind ins Gesicht schlagen lassen als Paquerettes und Coty, halten zu den Nonnen. Auch der China-Deutsche, der junge Russe und ein paar Holländer. Die Engländer sitzen im Salon und spielen Bridge. Die drei Missionare stehen am Vorderdeck und verständigen sich auf lateinisch. Sie streiten sich über die Methoden, auf die man aus den Chinesen Christen macht. Der Amerikaner meint, man müßte erst einmal Menschen aus ihnen machen und ihnen dann — dabei faltet er die Hände — die Segnungen der amerikanischen Kultur zuteil werden lassen. Der Engländer lächelt und fragt: »Worin besteht denn die?« — »Herr!« erwidert der Amerikaner, »in den Vereinigten Staaten ist mehr Geld als in allen Staaten Europas zusammen.« — »Macht man aus Geld Menschen?« fragt der Belgier. — »Es erleichtert die Arbeit,« erwidert der. — »Sie kaufen Seelen,« erklärt der Engländer und gibt damit zugleich dem Gefühl der Anderen Ausdruck. — Der Amerikaner erwidert: »Es kommt darauf an, Christen aus ihnen zu machen. Wie ist Nebensache.« — »Nicht aber Nebensache ist, was für Christen man aus ihnen macht,« erwidert der Belgier. — »Gibt es verschiedene?« fragt der Amerikaner mit verzücktem Augenaufschlag. — »Yes,« erwidert der Engländer. »Christen im Sinne der Bergpredigt und solche wie Sie!« — und kehrt ihm den Rücken.
Andernfalls hat das Gespräch an meiner Seite mitangehört; begünstigt von dem Wind, der von Osten kommt. Sie lädt den Engländer zu einem Glas Whisky ein. Der sagt aus lauter Verdutztheit: »Ja!« —, folgt aber gern, nachdem ich ihm verraten habe, welch innerlicher Bewegtheit Andernfalls’ Aufforderung entsprang.
Er erzählt von China und der Psyche der Chinesen:
»Weich wie die Kinder; grausam wie die Kinder. Ich kenne einen chinesischen Diener, der seinen Herrn, einen Europäer, dreißig Jahre lang wie ein Hund betreut und mit eigner Lebensgefahr vom Tode errettet hat, ihn dann aber eines Tages, als er die Gelegenheit für günstig und die Entdeckung für ausgeschlossen hielt, umbrachte.«
»Läßt sich das aus der Psyche des Chinesen erklären?« fragte ich, und er erwiderte:
»Durchaus! — Das Primäre in ihm ist der Haß des Fremden. Der kann im Dienste eines guten Europäers verdrängt sein, schlummern. Eines Tages bricht er durch. Beim Einzelnen, wie bei Allen. Der neue Boxeraufstand kommt — kommt bald. So überraschend er Europa treffen wird, wir, die wir in China leben, wissen es; wissen auch, was seinen Ausbruch beschleunigen und seine Grausamkeit verdoppeln wird.«
Andernfalls wies zu dem amerikanischen Missionar, der noch immer im Gespräch mit den Andern stand. Der Engländer tat, als sähe er es nicht. Aber Andernfalls fragte:
»Stimmt’s?«
»Danach müssen Sie Ihren Landsmann fragen,« erwiderte er, und der um vieles robustere China-Deutsche stimmte einen Haßgesang auf die amerikanischen Missionare an, der den Engländer veranlaßte, aufzustehen.
»Ein böses Gesicht machen Sie jedenfalls nicht,« rief ihm Andernfalls nach, und der China-Deutsche fuhr in seiner Erzählung fort, aus der hervorging, daß China seine zweite Heimat wurde. Wie das geschah, verlohnt der Wiedergabe:
Jahr der Handlung: 1886. Ort der Handlung: Berlin N, Gartenstraße (mit gleichem Recht könnte das Mittelmeer Akazienallee heißen). Der Vater schickt den Zehnjährigen hinunter. Er soll für einen Taler hundert Zigarren holen. Jungens auf der Straße erzählen ihm, wie man, ohne Eintritt zu zahlen, in die Flora kommt. Da gibt’s Indianer zu sehen. Er geht mit. Die Indianer imponieren ihm gewaltig. Er tauscht die drei Mark gegen ein Fell ein. Da er sich ohne den Taler und ohne die Zigarren nicht nach Hause traut, so übernachtet er in einem Zelte. Am nächsten Tage hilft er und bleibt. Schon nach wenigen Tagen wirkt er bei den Vorstellungen mit. Er darf hinten auf der Kutsche sitzen, die von den Indianern überfallen wird. Sein Hinterteil ist zwar dreifach ausgepolstert. Aber die Peitschenhiebe der die Kutsche verfolgenden Indianer sind nicht von Pappe. — Nach drei Wochen wandert die Expedition, die inzwischen in anderen deutschen Städten war, nach Oesterreich. Grenzkontrolle. Drei überzählige Knaben. Darunter er. Sie werden zurückgehalten. Auf der Liste der von ihren Eltern Vermißten steht er nicht. Also zum Generalsammelplatz nach Berlin. Alexanderplatz. Drei Tage bleibt er da mit einer Reihe anderer Ausreißer eingesperrt. Am vierten Tage: Vorführung. Es erscheinen ein Kriminaloberwachtmeister und vermißte Kinder suchende Eltern. Voran sein Vater. Der besichtigt eingehend. Einen nach dem andern. Unser Freund, verlaust, verdreckt, eine Art mexikanischen Dreimaster auf dem Kopf, verstellt die Züge. Er spricht kein Wort Deutsch. Antwortet auf alles mit ein paar Brocken Englisch, deren Sinn er selbst nicht kennt. Das Auge des Vaters bleibt an ihm haften. Unser Freund verzieht das von Schmutz strotzende Gesicht zur Grimasse. »Komm mal her, mein Junge!« sagt der Vater. Der tut, als verstände er nicht. Aber ein Griff am Kragen — und er steht neben dem Alten. »Und nun nach Haus! Zwei Schritte hinter mir! Mit sowas zeigt man sich nicht. Und ich rat’ dir, lauf nicht davon! Dreckskerl!« — Auf der Straße bleiben die Leute stehen. Auch die Mutter erkennt ihn zunächst nicht. Badewanne. Schwarze Seife. Friseur. Keile, nochmals Keile und zum drittenmal Keile! Bei der ersten Gelegenheit gegen Abend wieder aus dem Haus. Schräg gegenüber gibt’s ein Theater. Hinein! Sitzen kann man nicht. Jeder Knochen schmerzt. Um halb zwölf nach Haus. In Vaters Zimmer Licht. Rauf auf den Boden. Da findet ihn am nächsten Morgen die Mutter. »Komm nicht! Vater schlägt dich tot! Da sind drei Mark! Fahr zur Großmutter nach Prenzlau.« — Und statt nach Prenzlau fuhr er nach Hamburg. Von dort mit einem Segler nach Südamerika. Kalt war’s, und Keile gab’s mehr als zu Haus. Und aus diesem Berliner Buffalo Bill, den wir aus tausend erlogenen Schwarten kennen, nun aber zum ersten Male in Wirklichkeit vor uns sehen, wurde einer der reichsten Deutsch-Chinesen, dessen Erlebnisse wert sind, in einem besonderen Buch geschildert zu werden. —
Ein vorzüglicher Steward und eine ebenso vorzügliche Stewardesse sorgen vom ersten Tage an geradezu rührend für unsere Behaglichkeit. Um halb sieben nehmen wir das erste Frühstück in der Kabine, um sieben das Bad und bereits gegen acht Uhr treten wir zum Nichtstun an Bord an. Der Triumph der Faulheit setzt ein. Man wehrt sich anfangs. Moralischer Widerstand? Ich glaube, es ist mehr die Gewohnheit, die sich gegen das Nichtstun sträubt. Man hat die Kunst des Nichtstuns verlernt, die größer ist als die Kunst der Arbeit. In jedem Menschen steckt ein Stück Philister, das es ihm erschwert, den Alltag zu überwinden. Und nichts — sagt Goethe — ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Das empfindet selbst Andernfalls; während wir an der Küste Griechenlands — also noch immer Europa! — entlangfahren, vertreibt sie sich die Zeit dadurch, den frommen Schwestern, die zu schwerem Dienst nach China fahren, Gesangstunden zu geben. Sie, die noch vor einer Woche von der Bühne herab: »Muß es denn, muß es denn gleich die große Liebe sein?« sang und tanzte, singt nun, wie mir scheint mit der gleichen Aufrichtigkeit und Innerlichkeit, katholische Kirchenlieder. — Abends zur Unterhaltung der Smokings und Dekolletées zu singen, lehnt sie ab. Auch sonst übt sie keinerlei Verstellung. Als der amerikanische Missionar sie heute früh mit den Worten begrüßt:
»Well! Have you found Jésus?« erwidert sie:
»Is that beggar lost again?«
Ich versuche den Eindruck zu dämpfen und sage:
»Es macht ihr Freude, zu scherzen,« aber der gekränkte Amerikaner ist für keine Vermittlung. Beinahe herausfordernd sagt er:
»Wie gehören Sie eigentlich zusammen?«
Andernfalls erwidert:
»Gefühlsmäßig.«
Darauf er:
»Sie sind also nicht verheiratet?«
»Sonderbare Logik!« erwidere ich, während Andernfalls das Intermezzo sofort an eine neben uns stehende Gruppe von Passagieren weitergibt. Es löst große Heiterkeit aus, und auf den Zuruf eines englischen Regierungsmannes, der nach Hongkong fährt:
»Sie sind ein sonderbarer Heiliger!« zieht sich der Amerikaner zurück.
Am Abend, als wir an Kreta vorüberfahren, gibt’s eine Ueberraschung, die für uns Deutsche an Bord leicht hätte unangenehm werden können. Unser zweiter Telegraphist hört via Nauen ein Violinkonzert in Berlin. Man drängt sich. Kreißler ist es nicht. Und doch: die Damen sind begeistert. Der Lokalpatriotismus von Andernfalls und mir feiert Triumphe. Oder ...? die heruntergezogenen Mundwinkel der Amerikanerin veranlassen Andernfalls zu der Frage:
»Spielt er falsch?« — Und da das Gesicht immer länger wird, so fragt sie: »Oder gar Deutschland, Deutschland über alles?«
»Er spielt überhaupt nicht mehr,« erwidert sie wütend.
»Sondern ...?« fragte ich.
»Er redet!«
»Wer?«
»Das weiß ich nicht. Ludendorff vermutlich.«
»Allmächtiger!« ruft Andernfalls.
»Was hören Sie?« fragen die Andern, und der Telegraphist, der die Amerikanerin ablöst, verkündet:
»Eine politische Ansprache in Eberswalde.«
»Wo liegt das?«
»In Polen,« ruft Andernfalls. Aber der Telegraphist berichtigt:
»Bei Berlin« — und fährt fort: »Verband Stahlhelm oder so ähnlich — von Ermannung ist die Rede — und von Juden — Nieder! ruft jemand — Laute Heilrufe — Lu ...«
»Lassen Sie mich! Sie verstehen nicht Deutsch,« sagt Andernfalls und schiebt den Telegraphisten sanft zur Seite. Dem bleibt der Dame gegenüber keine Wahl. Er überläßt ihr die Hörer, und Andernfalls überträgt — wohl nicht ganz wortgetreu — die Ansprache Ludendorffs oder eines seiner Helfer ins Englische:
».... darum können wir nur auf dem Wege des Friedens wieder gesunden. Jeder, der zum Kriege hetzt, ist daher ein Verbrecher — was er weiter sagt, kann ich nicht verstehen.«
»Wieso nicht?«
»Der Beifall ist zu lärmend.«
Außer dem Commissario und mir hatte sie alle geblufft. Weniger durch das, was sie sagte, als durch die Art, in der sie es vorbrachte.
Als wir gleich darauf die Treppe hinunterstiegen, zur Linken Kreta, rechts die untergehende Sonne, sagte Andernfalls:
»Eine verheerende Erfindung, dies Radio!«
Und ich erwiderte:
»Ich sehe uns schon in Japan in einem Teehaus sitzen und mitanhören, wie deine Nachfolgerin in Berlin: ‚Muß es denn, muß es denn gleich die große Liebe sein‘ singt.«
»Dazu fährt man nun nach Japan!« stöhnte Andernfalls.
Drittes Kapitel
Port Said. Hier zeigt die Welt ein neues Gesicht. Endlich! Auch ehedem mag der Europäer, wenn er Port Said betrat, den Unterschied von Mensch zu Mensch empfunden haben. Die Erdenschwere, jenes wesentlichste Merkmal, das die sogenannte Kultur der Menschheit aufdrückte, fehlt diesen zum Teil noch unbewußten Menschen. Ein Gemisch von Arabern, Berbern und Negern. Freilich: noch drückt der Europäer dieser ägyptischen Stadt sein Merkmal auf. Doch nur für den Durchreisenden und oberflächlichen Beschauer. Das Boulevardtreiben, die dichtbesetzten Kaffeehäuser, die ihre Tische fast bis an den Bordrand des Fahrdamms schieben, die zahllosen Magazine, die flinken Fiaker mit geputzten Menschen — alles das wirkt puppenhaft wie eine Miniatur-Seinestadt.
Dieses Städtchen mit etwa 60 000 Menschen feiert von Mittag ab bis in die kühlende Nacht hinein im Freien und lebt — scheint mir — vom Export und den Fremden. Zwar die Hotels entsprechen kaum der Bedeutung der geographischen Lage am Ausgang des Suezkanals. Und die Nähe von Kairo und dem neuerdings lebhaft bereisten Jerusalem böten bei geschickter Regie dieser Stadt große Möglichkeiten — meint Andernfalls. Und ihr guter Instinkt trifft das Richtige.
»Du bist kein Geschäftsmann,« schilt sie. »Laß uns hier bleiben und telegraphiere an August, der finanziert das.«
Dabei erregt sie sich so lebhaft, daß der Kellner ihr den dritten Strohhalm für ihr Americano bringen muß. Ein Bild von einem Araberjungen hebt grinsend die beschädigten Halme auf.
»Was machst du damit?« fragt Andernfalls auf englisch — und statt einer Antwort zieht er behende unter seinem Rock ein Küken hervor, setzt es vor Andernfalls auf den Tisch, nimmt ihre Hand, streicht mit ihr über den Rücken des kleinen Federviehs und siehe da: aus einem Küken werden zwei, aus zweien drei — — bis schließlich unser Tisch ein Hof von Küken, der Teller mit Kuchen aber ihre Beute ist.
Andernfalls ist entzückt. Aber sie öffnet eben den Mund, da greift der Araber schon nach ihrer Nase, singt ein paar Töne und zaubert an diesem Kunstwerk göttlicher Schöpfung — wirklich! Andernfalls’ Nase ist klassisch schön! — ein Silberstück nach dem andern heraus.
Andernfalls ist entzückt. Entzückter noch, als er auf ein Silberstück, das ich ihm reiche, unaufgefordert eine Handvoll Kupfer herausgibt.
»Den sollten wir mitnehmen!« ruft sie begeistert. »Denke, was man mit dem an einem Abend im Zoo für Geld verdienen kann.«
Ich widerspreche. Sie ereifert sich.
»Du hast keinen Geschäftssinn,« schilt sie. Und ich erwidere:
»In einem halben Jahr. Auf der Rückreise. Was fangen wir mit dem Jungen in Japan an?«
Sie läßt sich Namen und Adresse geben. Zahlt an! Damit er sich nicht anderswohin verpflichtet. Er schwört. Gibt es schriftlich. In arabischen Schriftzeichen, da Andernfalls gründlich ist, auch auf englisch. Er macht ihr ein Küken zum Geschenk. Andernfalls nimmt es gerührt an. Aus Furcht, es werde die Seereise nicht vertragen, gibt sie es bei dem Araber in Pension und zahlt für die Verpflegung a conto ein Pfund.
»Wirst du es denn herausfinden nach so langer Zeit?« frage ich.
Andernfalls stutzt.
»Wenn ich ihm dies Platinkettchen umbinde,« fragt sie arglos. Der Araber ist von dem Gedanken entzückt. Ich erlaube mir zu bemerken:
»Ich fürchte, es wird heranwachsen und ihm die Kehle zuschnüren.«
»Es liegt ja dreifach und der Junge lockert es alle paar Tage.«
Heilig verspricht er’s.
»Einen Namen muß es haben,« meint Andernfalls. Der Junge findet es durchaus gehörig. — »Wie wäre Mohammed?« fragt sie.
»Aber Kind,« erwidere ich. »Es ist doch ein Huhn.«
»Du widersprichst immer.«
Unbeirrt fahre ich fort:
»Genau wie unsere Hühner!«
Andernfalls stutzt.
»Du nimmst einem jede Freude.«
»Wir werden Dinge finden, die es bei uns nicht gibt — in Hülle und Fülle.«
Andernfalls ist mißtrauisch geworden.
»Wie der indische Schal, nicht wahr?« sagt sie. Aber die Aehnlichkeit des Kükens mit europäischen scheint ihr einzuleuchten. Sie überlegt: »Du meinst, man sollte es lieber lassen?«
»Es wird zu spät sein,« erwidere ich und weise an die Straßenecke, um die eben der Araber im Laufschritt biegt.
Andernfalls ist platt.
»Und er hat das Küken mitgenommen?« fragt sie.
Ich sehe sie an und staune.
»Was ist?« fragt sie und fährt mit der Hand über ihre Taille, auf der mein Auge ruht.
»Meine Perlennadel!« ruft sie.
Ich springe auf und jage dem Jungen nach. Mir ist, als glotze er aus dem Fenster eines Hauses, das an der Ecke der Straße liegt. Aber nein, da steht er ja — mitten auf dem Damm — neben ihm drei andere Araberjungen — und ich stelle fest: jeder von ihnen kann es sein. Mit ihren dunklen Augen sehen sie mich treuherzig an und strecken die Hände aus. Andere kommen hinzu. Jetzt sind es zwölf. Ich werfe jedem ein Kupfer in die Hand. Sie heulen auf. Vor Freude. Und ich denke: ob er wohl darunter ist?
Ich eile zurück. Vor Andernfalls’ Tisch ein Auflauf. Laute Stimmen. Ein baumlanger Polizist, der die Taschen eines jungen Arabers durchsucht.
Andernfalls ruft in großer Erregung:
»Er ist’s!«
Europäer, die an Nebentischen saßen, beteuern, daß sie sich irrt. Sie bleibt dabei. Der Junge empört sich. Aus seinen Taschen zieht der Polizist Eidechsen, Zigaretten, Gummi, — nur das Huhn, die Platinkette und die Perle nicht.
Ich kläre Andernfalls auf, zeige ihr Araberjungen, die dem Gesuchten viel ähnlicher sehen. Sie wird unsicher. Gibt die Möglichkeit zu.
Lauter Lärm. Hunderte umlagern uns. Mit einem Schmerzensgeld von fünf Schilling kaufe ich uns los.
Auf dem Wege zum Schiff, verfolgt von einer Horde schwarzer und brauner Jungen, die hinter uns herschreien, sage ich zu Andernfalls:
»Nach dem Debüt werden wir uns, auch wenn August uns finanziert, hier kaum niederlassen können.«
Andernfalls erwidert:
»Die Reise fängt doch erst an.«
Und am Abend schreibt sie in ihr Reisetagebuch als Ueberschrift über das erste Kapitel:
»Das Küken von Port Said«.
Viertes Kapitel
Wieder an Bord im Hafen von Port Said. Was einem in der Stadt auffiel und einen beeindruckte: Engländer und wieder Engländer. Und auch draußen im Hafen nichts als englische Schiffe. Da kommt einem so recht zum Bewußtsein, daß Deutschland schlafen ging.
Freilich: Die Aegypter sehen es anders. Strahlend, wenn auch aus kluger Vorsicht nur flüsternd, erzählen sie, daß die Engländer und Franzosen bei ihnen nichts mehr zu sagen hätten, daß sie endlich Herren im eignen Lande wären. Tatsächlich ist kein englischer Soldat, kein englischer Offizier mehr in Port Said zu sehen — während man ihnen noch vor zwei Jahren auf Schritt und Tritt begegnete. Schon die Paßkontrolle läßt das erkennen. Streng wurde sie von ägyptischen Soldaten und Beamten, die direkt unter englischer Aufsicht standen, geübt. Englische Offiziere kamen an Bord und visitierten die Pässe. Die Abstemplung war die Voraussetzung für die Passage durch das Stadtgitter. Deutschen wurde sie noch im vorigen Jahre verwehrt. Heute gibt es keinen englischen Offizier mehr. Die unabhängigen Aegypter lassen jeden passieren. Freilich: im Hintergrunde wacht auch noch heute, nur scheinbar schlummernd, das Auge Englands, das die Lider wohl ein wenig gesenkt hält, um weitere Massaker zu verhüten und die erregte Volksseele Aegyptens zu beruhigen. Die neue englische Regierung wird zweifellos alles tun, um in diesem gläubigen Volke den Glauben an die Unabhängigkeit zu befestigen — ohne daß in Wirklichkeit die englische Machtsphäre dadurch die geringste Einbuße erleidet. Und schließlich ist es von größerer Bedeutung, daß die englische Regierung der ägyptischen ihren Anteil der Aktien am Suezkanal abkaufte, als daß das vom verstorbenen Prinzen Heinrich der Niederlande erbaute Etablissement im Bassin Cherif nicht mehr als eine englische Kaserne dient. —
Am Spätnachmittag treten wir die Fahrt durch den Suezkanal an. Tief dunkelrot geht an den Ufern des Menzale-Sees die Sonne unter. Unbeschreiblich die Farben, in denen am Abhang des Dschebel Dscheneffe und Dschebel Ahmed Taher das flache, pflanzenreiche Ufer schimmert. »Wie eine japanische Zeichnung«, meint der Commissario und erläutert in italienischem Redeschwall den Nonnen, was die viel tiefer mit Augen und Sinnen erfassen. Und der nicht nur geistig bewegliche Russe, der den halben Tag am Klavier sitzt, jubelt: »Die Landschaft möchte ich tanzen.« — Mich aber läßt letzte Erinnerung an die Heimat trotz allem noch immer nicht froh werden.
Schon auf der ersten Strecke des Kanals setzt mit Untergang der Sonne erhebliche Kühle ein. Der Menzale-See, umschwärmt von Silberreihern und Pelikanen, liegt hinter uns, am Ende des Sees durchschneidet der Kanal die Landenge el-Kantara, auf der seit Jahrhunderten die Karawanen von Syrien nach Aegypten ziehen. Die Versuche, das Rote Meer mit dem Nil zu verbinden, sind so alt wie die Menschheitsgeschichte und lassen sich bis in das sechste Jahrhundert vor Christi Geburt zurückführen. Aber ich will Leben und keine Geschichte schreiben.
Leben gab’s am nächsten Morgen in Port Tewfik hinter Suez nun zwar auch nicht gerade. Das Villenörtchen lag siedeheiß und schattenlos in der Morgensonne.
Aber Andernfalls, die weiß, wie gut sie der in Port Said erworbene Tropenhut kleidet, drängt, an Land zu gehen. Ich mache sie auf die unzähligen, durch die milchige Färbung des Wassers kenntlichen Korallenriffe aufmerksam. Es macht keinen Eindruck. Da sie für alles, was Tier heißt, eine sehr viel größere Vorliebe als für die Gattung Mensch hat — ein Geschmack, den ich teile —, so erkläre ich ihr, daß diese Korallenriffe durch die kalkige Ausscheidung von Milliarden kleiner, gesellig lebender Weichtiere herrühren, die es nur in den Tropenmeeren gibt. Sie sagt uninteressiert:
»Korallen stehen mir nicht — und außerdem sind sie unmodern.«
Also lassen wir uns von ein paar Arabern an Land rudern. Siedehitze, Staub, Menschenleere. Nackte Araber und Berber heben schwere Steine aus einer Grube und schleppen sie zu kleinen Wagen, die auf schmalspurigen Schienen laufen. Die dunkle Haut, meint Andernfalls, täuscht über die Nacktheit hinweg. Aber das gilt doch nur für uns Weiße. Und nicht für jene acht schöngebauten Araberinnen, da drüben, deren dunkle Augen hinter dem Jachmak, der das Gesicht verbirgt, glutvoll hervorleuchten. Muß ich sagen, daß sich Andernfalls sofort für nichts anderes mehr interessiert. Ihr erster Gedanke ist:
»Wie schrecklich muß das sein für eine Frau, die hübsch ist.« — Gleich darauf zieht sie verächtlich den Mund und meint: »Aber freilich, da die meisten Frauen es nicht sind, so ist das sogenannte Schamgefühl eine famose Ausrede, hinter der man die Häßlichkeit verbirgt.« — Dann wendet sie sich ängstlich an mich: »Sage, besteht etwa Aussicht, daß diese Mode auch zu uns kommt?«
Ich suche sie zu beruhigen. Aber sie meint:
»Wo wir neuerdings den Amerikanern alles nachäffen.«
»Was haben denn die damit zu tun?« frage ich.
»Warum sollen sie nach dem Alkoholverbot und wo sie jetzt doch sogar das Rauchen verbieten wollen, schließlich nicht auch auf den Gedanken kommen.«
»Das ist gar nicht ausgeschlossen,« erwidere ich. »Zumal die meisten von ihnen häßlich sind.«
Aber Andernfalls’ noch eben sorgenvolles Gesicht heitert sich auf.
»Ausgeschlossen!« ruft sie. »Jede Frau hält sich für hübsch. Also wird das nie kommen. Schon, weil hinter den Gardinen ...«
»Jachmak,« verbessere ich.
»Ich spreche deutsch,« erwidert sie und wiederholt: »Weil sich hinter den Gardinen die Schminke nicht hält.«