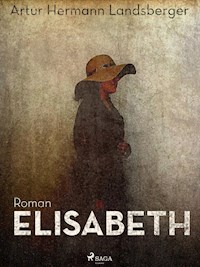Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Baronin von Waltner und ihre Tochter Ina haben einen perfiden Plan geschmiedet: Ina soll sich mit Graf Scheeler verloben, um die Familie in den adeligen Kreisen zu etablieren. Ina findet die Idee fantastisch, denn sie ist dem schönen Grafen seit ihrer ersten Begegnung verfallen. Leider haben die beiden Frauen ihre Rechnung ohne den raffgierigen und gerissenen "Ratz" gemacht. Bei ihm steht die Familie seit Jahren in der Schuld, denn er lässt ihnen regelmäßig enorme Geldsummen zukommen, mit denen sich die Damen ihr luxuriöses Leben finanzieren. Ina schwant schon Böses, als Ratz mit den Schuldscheinen vor der Tür steht. Verlangt er diesmal tatsächlich, dass sie mit ihm ins Bett geht? Noch schlimmer: Ihn gar heiraten möge? Doch Ratz hat eine ganz andere Idee, und Ina und die Baronin trauen ihren Ohren nicht ...Mit diesem Roman, den Landsberger 1919 verfasste, verschärfte sich sein gesellschaftskritischer Ton zusehends. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Artur Hermann Landsberger
Frau Dirne
Roman
Saga
Ebook-Kolophon
Artur Hermann Landsberger: Frau Dirne. © 1920 Artur Hermann Landsberger. Originaltitel: Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2015 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen 2015. All rights reserved.
ISBN: 9788711488379
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com.
Erstes Kapitel.
Eine gute, aber anrüchige Gesellschaft.
„Dieser Teetisch ist nicht zu überbieten,“ flüsterte Frau Olga Herzog dem Grafen Scheeler zu, an dessen Arm sie den Salon der Frau Baronin von Waltner betrat.
„Fabelhaft!“ näselte der und klemmte sich das Monocle fester ins Auge.
Frau Olga wandte sich um und rief — ihre Stimme war schrill und scharf —:
„Werner, so komm’ doch!“
„Schlagt den Juden tot!“ grellte die Stimme eines blaugelben Papageis, den Werner Herzog auf einer silbernen Stange trug.
„Wie reizend, dass Sie das entzückende Tier mitgebracht haben!“ sagte Frau von Waltner und warf dem blaugelben Papagei ein Petitfour aus Schokolade zu.
Der kreischte, flatterte auf, fing und frass. Die gelbe Creme, mit dem das Petitfour gefüllt war, glitt auf Werner Herzogs Cutaway.
Baronin von Waltner und Olga reichten sich die Hände.
„Sie kennen meine Tochter und meinen Schwiegersohn?“ fragte die Baronin und wies auf Heinz und Ina.
Rittmeister Mertens küsste Frau Herzog die Hand und sagte:
„Aber natürlich! Wir hatten ja im letzten Frühjahr das Vergnügen ...“
„... in Davos,“ ergänzte Frau Olga. „Ihrer Frau Tochter verdanke ich die Bekanntschaft mit dem Grafen Scheeler.“
„Ich habe zu danken,“ sagte der; und Ina Mertens, die gut gewachsen, schlank und, obgleich im Verblühen und beinahe zehn Jahre älter als ihr Mann, noch immer hübsch und von eigenem Reiz war, tat, als könne sie sich nicht daran erinnern und sagte:
„In diesem Sodom und Gomorrha lernt man so viele Menschen kennen ...“
„Aber Ina,“ parierte Heinz, „erinnerst du dich denn nicht mehr, dass du von Frau Herzog sagtest, sie habe ihren Mann noch besser dressiert als ihren Papagei?“
„Sei nicht so taktlos,“ flüsterte Frau von Waltner ihrem Schwiegersohne zu. Ina berührte leise ihre Mutter und dachte: „so ist er immer;“ warf ihrem Manne einen Blick zu, der ihn wie spitzige Nadeln traf, verzog den Mund und sagte lächelnd:
„Dass du doch immer spassen musst, Heinz.“
„Nun,“ erwiderte Professor Reger, ein ansehnlicher und soignierter Mann in der Mitte der fünfziger Jahre, und wies auf Werner Herzog, der mit dem blaugelben Papagei auf der silbernen Stange, ratlos und servil und mit nicht gerade klugem Gesichtsausdrucke da stand — „die Hauptsache ist, dass diese Tätigkeit ihren Herrn Gemahl ausfüllt und befriedigt.“
Frau Herzog, der man nachsagte, dass sie einst schön gewesen sei und in einer europäischen Hauptstadt ein grosses Haus ausgemacht habe, empfand den Spott, lächelte und sagte:
„Alles Gute, das man meinem Papagei erweist, erweist man mir. Und Sie werden nicht so unhöflich sein, zu bestreiten, dass selbst ein anspruchsvoller und kluger Mann darin seine Befriedigung finden kann.“
Das Erscheinen der hübschen Frau Mira und ihres Gatten Doktor Riesser ersparte dem Professor eine Antwort.
Frau Ina stellte vor und goss Tee ein; Schüsseln mit kleinen Kuchen, Torten und Sandwichs, silberne Schalen mit Früchten und Kompott gingen herum; ein Diener reichte Liköre und Heinz Mertens bot Zigarren, Zigaretten und Feuer an.
Frau Ina sass neben dem Grafen.
Als sie ihm mit der Gabel ein Sandvich mit Gänseleber reichte, zitterte ihre Hand. Er nahm das Brot von der Gabel und führte es, ohne es auf den Teller zu legen, in den Mund. Das geschah von ihm aus völlig unbewusst; sie aber empfand es wie eine zärtliche Berührung, hielt den Atem an und schloss für einen Augenblick die Augen. Tausend Fahre alt waren diese Scheelers!
„Ich muss es Ihnen immer wieder sagen,“ wandte sich Baronin Waltner an ihren Nachbarn, den Professor Reger, und lorgnettierte ihn mit Wohlgefallen, „wie sehr Sie mich in jeder Bewegung an den vorzüglichen Marquis d’Ormilly erinnern. Sie sollten doch einmal unter Ihren Ahnen nachforschen.“
„Aber gnädigste Baronin,“ erwiderte der Professor, „die Wiege meiner Vorfahren steht in Gleiwitz. Und wenn Sie mich französisch sprechen hörten, so würden Sie sich Antiphone in die Ohren stecken.“
„In meinem Hause verkehrte früher ein Chevalier de Pontignan, der im dritten Glieds mit den d’Ormilly’s verwandt war,“ sagte Irau Olga.
„Sie kennen ihn gewiss?“ wandte sich Ina, deren Augen strahlten, an den Grafen Scheeler.
„Im Stammbaum meiner Mutter kommt er irgend wo vor,“ erwiderte der Graf gleichgültig, und Inas Augen strahlten noch heller.
„Darf man wissen, für wen?“ fragte Frau Mira und wies auf drei leere Sessel, die zwischen dem Teetisch und einer schmalen Anrichte standen. Der Tonfall, der lebhafte Blick und die ganze Haltung verrieten, dass es mehr als eine konventionelle Frage war.
„Für Erdt-Brückner’s,“ erwiderte Frau Ina und freute sich, als sie Irau Miras enttäuschtes Gesicht sah.
„Die machen wie immer erst grosse Toilette,“ meinte Baronin Waltner, und Frau Olga spottete:
„Was die so grosse Toilette nennen. Hier ein Schleifchen, da ein Schleifchen; in jeder Farbe eins.“
„Und ein paar Ketten um den Hals, um die Taille und die Gelenke ...,“ „... die nicht einmal schön sind,“ fiel Frau Mira dem Professor ins Wort und schlug die Beine übereinander, so dass man mehr als nur die schlanken Gelenke sah; während Frau Ina, die fühlte, dass der Graf Frau Miras Bewegung folgte, die Füsse unter den Tisch schob.
„Wird Frau Brückner uns etwas vorsingen?“ fragte Professor Reger. „Für mich ist sie trotz ihres Alters noch heute in Deutschland die Erste.“
Es widersprach niemand. Nur Frau Mira sagte:
„Der Ansicht bin ich auch. Aber, dass sie uns etwas vorsingt, glaube ich nicht. Die Tochter liebt es nicht, dass sie sich vor ihren Mann stellt.“
„Sie meinen ihn verdunkelt?“ fragte Frau Olga.
“Ja!“ erwiderte statt Miras der Professor. „Er yat sich trotz seines starken Könnens noch immer nicht durchgesetzt. Und es mag für einen Mann auch nicht leicht sein, im Schatten seiner Frau zu stehen.“
„Ja aber,“ warf Frau Ina ein, „diese Nelly ist doch Hedwig Brückners Kind aus erster Ehe. Die Mutter müsste ihr demnach doch näher stehen als der Stiefvater.“
„Müsste,“ erwiderte Frau Mira. „Tut es aber nicht.“
Baronin Waltner wies zur Tür. Im selben Augenblick stockte das Gespräch. Frau Ina gab ihrem Manne ein Zeichen. Der sprang auf.
Erdt-Brückners hielten ihren Einzug. Wie ein nach qualvollen Versuchen von einem Photographen der siebziger Jahre gestelltes Bild. Vorn die allerliebste Frau Mathilde, eine Art Bovary, jenseits des gefährlichen Alters. Mit natürlicher Freundlichkeit nickte sie allen zu. Ein wenig zurück rechts daneben Nelly, ihre Tochter. Unscheinbar, aber mit einem hübschen Gesicht, das nicht erkennen liess, ob sie schon verblüht war oder erst zu blühen begann. Auch Nelly lächelte; aber teils aus gêne, teils um als freundlich zu gelten und zu gefallen. Mutter und Tochter übersät mit Ketten, Münzen, Troddeln und Schleifen. Links von Nelly die hohe Gestalt Wolfgang Erdts. Ein feiner Kopf mit hoher Stirn, starker Nase, gewölbten Lippen und ein Paar Augen, mit denen man nicht recht etwas anzufangen wusste. Frau Mathilde schienen sie tief und verträumt; den Kollegen, die seinen Aufstieg fürchteten, bös und verbittert, den Frauen, die er unbeachtet liess, herausfordernd und brutal, Nelly, die an ihn glaubte, durchgeistigt und genial, dem Unbeteiligten nichtssagend und dunkelbraun.
„Grade sprachen wir von Ihnen,“ sagte Baronin Waltner.
„Schlechtes natürlich,“ erwiderte Nelly.
„Das wird in unserem Hause niemand wagen,“ beteuerte Frau Ina. „Wir unterhielten uns von dem eigenen Geschmack Ihrer Toiletten“ — dabei nahm sie eine lila Kette, die Nelly um den Hals trug und die ihr bis auf die Knie herabhing, auf und sagte: „Wie apart. Diese Münze scheint die Imitation einer Reliquienkapsel aus dem fünfzehnten Jahrhundert, nur passt sie nicht recht an diese undefinierbare Kette.“
„Wenn Sie sie Ihrer Sammlung einverleiben wollen,“ sagte Nelly, die den Spott nicht spürte.
„Was denkst du!“ widersprach v. Erdt, Frau Mertens stellt sich doch keine Imitationen in die Schränke!“
„Mir wäre das gleich,“ erwiderte Nelly, „ich würde nur an hübschen Sachen Gefallen haben.“
„Jeder lebt seiner Kunst!“ meinte Baronin von Waltner. „Sie dem Gesang, der Professor seinem Horaz, meine Tochter dem Sammeln alten Schmucks...“
„... und der Graf den Pferden,“ ergänzte Frau Mira, die das Erscheinen Erdt-Brückners dazu benutzt hatte, ihren Platz mit einem neben dem Grafen zu vertauschen.
„Richtig!“ nutzte Frau Ina die Gelegenheit und wandte sich an den Grafen, der gelangweilt zwischen den beiden Frauen sass und ein eisgekühltes Glas 1911 er Menkow in den schmalen Händen hielt — „mein Mann hat morgen früh Dienst; wenn Sie also seinen Schimmel reiten wollen — bewegt werden muss er — ihm erweisen Sie damit einen Gefallen.“
Der Graf vermied es, den Rittmeister anzusehen, dessen Gesicht er von ähnlichen Fällen her kannte. Dagegen dachte Frau Ina, als sie den verdutzt verlegenen Ausdruck ihres Mannes sah: wie peinlich den Anderen gegenüber, er sollte sich an derartige Fälle doch nachgrade gewöhnt haben.
Frau Mira, die Knie an Knie mit dem Grafen Scheeler sass und der im übrigen Bein Bein war, gleichgültig, ob es einem Grafen oder einem Chauffeur gehörte, hatte denn auch eine bissige Bemerkung auf der Zunge. Aber die Baronin las sie ihr von den Lippen und kam ihr zuvor, in dem sie sich laut an Professor Reger wandte und fragte:
„Nun Marquis, wie steht’s mit der Theosophie? Werden wir Sie bald als den Unsern begrüssen können?“
„Ich bin ein Feind alles Halben,“ erwiderte der Professor. „Man kann nicht Diener der Wissenschaft sein und sich gleichzeitig in diesem Lustgarten der Halbgebildeten ergehen.“
Die Baronin war gekränkt. Aber sie verstellte sich, stöhnte und sagte:
„Ja! ja! Ihr Protestanten!“
„Da hat Mama recht,“ sprang ihr Frau Ina bei. „Die protestantischen Länder besitzen nicht die zum Glück eines wohlerzogenen Menschen unentbehrlichen Elemente: Galanterie und Frömmigkeit.“
„Dazu muss man an Gott glauben,“ sagte die Baronin.
Der Professor, der alles das herbeigeholt und nicht logisch fand, stutzte. Aber als Frau Ina ihrer Mutter mit einer Geste, die beinahe feierlich war, erwiderte:
„Selbst wenn es keinen Gott gäbe, wäre die Religion doch heilig und göttlich,“ da wusste er, dass man, wie so oft in diesem Hause, wieder einmal mit Bildung bluffte. Er kniff die Augen zusammen, zog die Zigarre in den rechten Mundwinkel, setzte sein sarkastisch-verbindliches Lächeln auf, sah die Baronin und Frau Ina scharf an und sagte:
„Gewiss! Gott ist das einzige Wesen, das zum Herrschen nicht einmal der Existenz bedarf.“
„Aber Sie werden doch zugeben,“ erwiderte Frau Ina und senkte den Blick — „dass das Höchste im Leben, die Liebe, ohne den Glauben profan ist.“
„Was ist überhaupt Liebe?“ stiess Frau Olga wie einen Seufzer hervor, und Frau Mira erwiderte prompt:
„Das Bedürfnis ...“
„... aus sich herausgehen,“ beendigte unnötigerweise Frau Ina den Satz.
Der Rittmeister sah strahlend zu seiner Frau auf, und die Baronin sagte zu ihrer Tochter:
„Du meinst, um sich mit ihrem Opfer zu vereinigen.“
„Gewiss!“ bestätigte die, „gewiss! Aber wie der Sieger mit dem Besiegten. Unter Wahrung der Vorrechte des Eroberers.“
„Siehst Du!“ rief Frau Olga so unmotiviert wie möglich ihrem Manne zu, und der Papagei, der auf ihrer Schulter sass und nach dem vierten Petitfour und einem Gläschen Chartreuse fest eingeschlummert war, fuhr auf und schrie:
„Schlagt den Juden tot!“
Max Herzog sah verständnislos erst den Papagei, dann seine Frau an und sagte:
„Ich bin mir gar nicht bewusst ...“
„Und doch,“ fuhr die Baronin, ohne auf Frau Olgas Bluff zu achten, fort, „als langweilig in der Liebe habe ich immer empfunden, dass sie ein Verbrechen ist, bei dem man einen Mitschuldigen nicht entbehren kann.“
„Glänzend!“ rief Frau Mira mit roten Wangen, und die Liebe, über deren Wesen und Betätigung sie Tage und oft auch die Nächte lang nicht nur nachsann, schien als Verbrechen ihr nun noch sonderbarer.
„Und wie stellt sich die Kirche zu dieser Liebe?“ fragte Frau Ina, worauf die Baronin zur Antwort gab:
„Da sie nicht die Möglichkeit sah, sie zu unterdrücken, so hat sie sie wenigstens desinfizieren wollen und die Ehe geschaffen.“
„Ausgezeichnet!“ rief Frau Mira. „Die Ehe als Desinfektionsanstalt. Sagen Sie,“ wandte sie sich an ihren Nachbarn, den Grafen, der gelangweilt da sass, „haben Sie sie je als etwas anderes betrachtet?“
„Und doch,“ beteuerte Ina und schlug die Augen zu dem Grafen auf, der indes keinerlei Notiz davon nahm, „ist die Liebe das Göttliche im Menschen.“
Der Rittmeister sah strahlend zu seiner Frau auf.
Die Baronin widersprach.
„Dadurch, dass man sie Gott entzieht und auf die Menschen überträgt, entheiligt man sie. Darum sollte man in dem Menschen, zu dem es einen hinzieht, immer nur Gott lieben.“
„Das kommt praktisch ja wohl auf dasselbe hinaus,“ sagte Nelly Brückner und sah verklärt Wolfgang v. Erdt an, der so gar nichts Göttliches hatte.
„Ein weites Feld, die Liebe,“ meinte Mathilde Brückner, und der Professor, dem die Zeit gekommen schien, sagte breit:
„Sehr richtig! Jedenfalls ist sie mit dem Studium Baudelaires nicht erschöpft.“
Frau Ina wurde um einen Atom blasser und, um ihre Verlegenheit zu verbergen, nahm sie die schwere silberne Kanne auf und goss dem Grafen Tee ein, obgleich seine Tasse noch beinahe voll war.
Die Baronin hingegen hielt den Blick des Professors aus:
„Sie haben sich demnach auch viel mit Baudelaire beschäftigt?“ fragte sie und tat unbefangen.
„Leider nicht mit dem gleichen Erfolge wie Sie,“ erwiderte der. „Aber man hört ihn doch immer wieder gern.“
Frau Olga sah mit triumphierendem Lächeln Frau Ina an und sagte:
„Ach so! — Bei uns in Berlin bringt man sich jetzt seine Butterbrote mit, wenn man eingeladen ist. Man kann, scheint’s, aber auch geistige Nahrungsmittel hamstern. Man steckt sie wie die Butterbrote zu sich und verzehrt sie in Gegenwart seiner Gäste, um die damit zu ärgern.
Mathilde Brückner sprang der Wirtin bei:
„Ich verstehe nicht,“ sagte sie, „wie eine geistvolle Unterhaltung, gleichviel ob sie aus Eigenem schöpft oder aus Fremdem, Sie ärgern kann. Schliesslich bleibt es doch interessanter, zu erfahren, wie ein grosser Mann über die Liebe dachte, als mit welchen hohen und höchsten Herrschaften Sie in gesellschaftlichem Verkehr stehen.“
Und Wolfgang v. Erdt, der wie alle wahren Künstler im Grunde seines Herzens materiell war — nur grosse Kinder sind es nicht! — setzte hinzu:
„Der Ärger, gnädige Frau, dürfte durch den Chartreuse und die Petitfour, die Ihr Liebling geschluckt hat, ausgeglichen sein.“ — Und da Max Herzog daraufhin ein Fruchttortelette, das er eben in den Mund schieben wollte, auf den Teller zurücklegte, so wies Wolfgang v. Erdt mit seiner Riesentatze auf den Papagei und sagte: „Ich meinte natürlich den andern Liebling.“
Alles lachte, nur der blaugelbe Papagei, der spürte, dass er im Mittelpunkte stand, setzte sich zur Wehr und kreischte:
„Schlagt den Juden tot!“
„Kann er denn gar nichts anderes?“ fragte die Baronin und glaubte damit Frau Herzog zu reizen.
Die aber hatte schon lange auf dies Stichwort gewartet.
„Reden Sie nur mit ihm!“ trieb sie sie an.
„Na, Dummchen,“ wandte sich die Baronin an den Papagei, „was sagst denn Du zu alledem?“
Der Papagei machte einen schiefen Kopf und beaugte misstrauisch die Baronin.
„Nicht wahr,“ fuhr die fort, „die Theosophie erschliesst der Menschheit neue Wege?“
Frau Olga machte mit der Schulter eine kurze Bewegung, die niemand sah, und der Papagei kreischte der Baronin ins Gesicht:
„Quatsch nicht!“
Damit war sein Repertoire erschöpft. Doch dem tiefsinnigen Beobachter wurde klar, dass dieser Sprachschatz für die Unterhaltung in einem sogenannten besseren Salon durchaus genügte.
Der Diener kam und reichte Frau Ina eine Karte.
„Haben Sie nicht gesagt, dass Besuch da ist?“
„Wenn gnädige Frau wenden wollen.“
Frau Ina wandte die Karte und las:
„Ich habe unbedingt und unaufschiebbar mit Ihnen zu sprechen.“
„Geh!“ trieb ihre Mutter, die über ihren Nachbar hinweg schneller als sie Name und Text der Karte entziffert hatte, sie an.
Ina stand auf, entschuldigte sich und ging. Als der Graf ihr lässig die Hand reichte, wurde sie rot und zitterte in den Knien; den fragenden Blick ihres Mannes liess sie unbeantwortet, zerknitterte die Karte und ging hinaus.
Der Diener hatte den alten Katz in den vorderen Salon geführt, der von dem erlesenen Geschmack Frau Inas und ihrer Mutter zeugte und auf Generationen alten Reichtum schliessen liess.
Katz zog den abgeschabten roten Glacéhandschuh von der rechten Hand, fuhr sich mit den ungepflegten Fingern durch das ergraute Haar, kaute an seinem Zigarrenstummel, musterte mit ein paar Blicken den Salon, ging auf ein kleines Schränkchen zu, in dem allerhand alter Schmuck aufgebaut war, schloss es auf, nahm einen breiten Platinring mit glitzernden Steinen heraus und steckte ihn sich in die Tasche. Dann zog er den abgeschabten roten Handschuh wieder auf.
Ungeduldig sah er zur Tür. Nebenan hörte man Schritte. Gleich darauf betrat Frau Ina den Salon.
Katz sagte ohne sich zu verbeugen:
„Guten Tag!“
Frau Ina bewegte leicht den Kopf, wies mit ihrer weissen schlanken Hand auf einen Stuhl und sagte:
„Bitte!“
Katz setzte sich, griff in die Tasche, legte ihr ein Papier vor und sagte:
„Unterschreiben Sie!“
Dabei schob er den abgekauten Zigarrenstummel, der nicht mehr brannte, in den anderen Mundwinkel, wobei die Asche auf den Tisch, dicht neben das Papier fiel.
Frau Ina, deren Gedanken noch bei dem Grafen und Miras schönen Beinen waren, überflog das Papier, verstand es nicht und sah Stanislaus Katz, der schmutzig und aus Lodz war, fragend an.
„Worauf warten Sie?“ fragte der und hielt ihr die Füllfeder hin.
„Auf das Geld“, erwiderte sie.
„Es sind die Zinsen für das schuldige Kapital.“
Er legte seine Füllfeder neben das Papier.
Frau Ina rührte sie nicht an. Sie stand auf, nahm das Papier, ging damit zum Schreibtisch, nahm ihren Halter und unterschrieb.
Katz zerbiss wütend seinen Stummel und steckte seine Füllfeder wieder ein.
„Es klebt kein Dreck dran“, sagte er.
Frau Ina erwiderte:
„Aber Sünde.“
„Mein Beruf und Frömmigkeit vertragen sich nicht miteinander.“
„Um so mehr Grund hätten Sie, zur Beichte zu gehen.“
Katz wehrte ab.
Mein Beruf fordert Diskretion. Oder wäre es Ihnen lieb, wenn ich dem Probst Weidner von Ihren Beziehungen zu dem Grafen ...“
Frau Ina wurde kreidebleich, richtete sich auf und fuhr ihn an:
„Schweigen Sie!“
„Wenn ich im Beichtstuhl sässe und er die Geldgeschäfte machte — vielleicht, dass Sie dann freundlicher zu mir wären.“
„Schweigen Sie!“ wiederholte Frau Ina, und ihre Stimme überschlug sich. „Sie mischen irdische und weltliche Dinge — Sie versündigen sich!“
„Wir sind allein, und ich konstatiere Tatsachen.“
„Das sind Dinge, die mit unseren Geschäften nichts zu tun haben. Wenn ich im Guten auf Sie einzuwirken versuche, so brauchen Sie nicht ausfallend zu werden.“
„Ich bin ein Mensch, der mit beiden Füssen fest auf der Erde steht und kein Ohr für das Paradiesgeklimper hat.“
„Schlimm für Sie!“
„Jedenfalls ist die Hilfe, die ich Ihnen hier auf Erden leiste, zuverlässiger als die Versprechungen, die er Ihnen auf das Jenseits macht.“
„Sie tun es nicht aus Liebe!“
„Und er nicht aus Religiosität.“
Katz war aufgestanden und lehnte sich an den Schreibtisch, der dicht neben dem Sessel stand, auf dem Frau Ina sass. Sie hielt noch immer den Halter in der Hand.
„Zerreissen Sie den Wisch“, sagte er und beugte sich zu ihr.
Sie warf den Halter hin und schob ihm das Blatt zu.
„Zerreissen Sie’s!“ wiederholte er mit belegter Stimme und griff nach ihrer Hand.
„Was fordern Sie?“ fragte sie leise.
„Nicht mehr als das letzte Mal.“
Sie beugte sich in den Sessel zurück und schloss die Augen. Katz nahm den Stummel aus dem Mund, schob sich zwischen Sessel und Schreibtisch, stemmte die Arme auf die Lehne und drückte seine Lippen auf Frau Inas Mund. — Zwei Sekunden lang — dann schob sie ihn zur Seite und sagte:
„Genug! Mein Mann ist da.“
Katz, der ausser Atem war, lächelte und meinte spöttisch:
„Der kommt — doch nicht — ohne dass — Sie ihn rufen.“
Dann trat er zur Seite, atmete auf, nahm das Papier, zerriss es, warf es in den Papierkorb und sagte:
„Man ist bescheiden“, und lachte laut auf. Dann fügte er leise hinzu: „und doch nicht dumm.“
Das klang so herausfordernd, dass sich Frau Ina, die noch immer ihr Spitzentuch vor den Mund hielt und sich damit die Lippen betupfte, in ihrem Sessel aufrichtete und zu ihm umwandte.
Katz zog den Mund breit, griente, wies auf den Papierkorb und fragte:
„Was war der Schein wert?“
Frau Ina fuhr auf:
„Sie haben mich betrogen!“
„I Gott bewahre!“ erwiderte er. „Höchstens Sie mich.“
„Was bedeutet das?“
„Der Schein war richtig ausgestellt über viertausendfünfhundert Mark Zinsen, die Sie mir schulden.“
„Nun also.“
„Aber, was war er wert? Wovon wollten Sie zahlen?“ — Er sah sich im Zimmer um. „Alles, was in der Wohnung steht, alles, was Sie am Leibe haben, gehört mir. — Nur Sie noch nicht.“
Frau Ina sprang auf.
„Ich rufe meinen Mann!“
Katz schüttelte in aller Ruhe den Kopf.
„Das tun Sie nicht. Denn Sie wissen genau, der kann’s nicht ändern. — Im übrigen: weiss er von alle dem was?“
„Nein.“
„Wovon glaubt er, dass das Geld für Ihren Luxus und Ihre Gesellschaften herrührt?“
„Er ist ein Kind, das nicht nachdenkt und mir blind vertraut.“
„Wollen Sie ihm nicht reinen Wein einschenken?“
„Sie sagten doch eben selbst, er kann’s nicht ändern.“
„Aber am Ende muss er seine Dispositionen treffen.“
„Er tut seinen Dienst — basta!“
„Wenn Sie fallieren, wird er den Dienst quittieren müssen.“
„Ich? — Wie meinen Sie das?“
„Dass ich einzutreiben und zu versteigern gedenke.“
Frau Ina fuhr auf:
„Sie wollen mich ruinieren?“
„Das haben Sie selbst getan. Für Ihre gesellschaftlichen Ambitionen hätten Sie eine Rente von hundertundfünfzigtausend Mark benötigt. Wenn ich nicht irre, beträgt das Gehalt eines Rittmeisters aber nur sechstausend Mark.“
„Damit hätte ich in einem Gartenhaus in einer Dreizimmerwohnung verkümmern können.“
„Ich gebe zu, dass das schade gewesen wäre. — Sie waren klug und haben wenigstens ein paar Jahre lang Ihr Leben genossen.“
Frau Ina wandte sich jetzt beinahe flehend zu ihm:
„Und nun wollen Sie mich untergehen lassen?“
„Ich habe Ihnen geholfen, solange Sie mir Sicherheit boten. Die aber ist erschöpft.“ — Er beugte sich wieder zu ihr und sagte flüsternd: „Sie kennen meine Liebhabereien.“
Frau Ina schloss die Augen.
„Sie sprachen mir davon“, hauchte sie.
„Ein reicher Amerikaner hat mir für die Mantelschliesse des heiligen Ludwig von Frankreich, die der Probst Weidner in Verwahrung hat, über eine Million geboten.“
„Ich sagte Ihnen doch schon, die Jahreszahl 1234 fehlt; das Email ist ersetzt.“
„Beidem liesse sich abhelfen.“
Frau Ina zitterte jetzt am ganzen Körper; mit ihren Händen machte sie Bewegungen, als wenn sie einen Rosenkranz zwischen den Fingern hielte.
„Wenn Sie sich aus religiösen Bedenken scheuen, es heimlich zu entwenden,“ drang Katz in sie, „mit dem Probst Weidner liesse sich schon ein Abkommen treffen.“ — Frau Ina zuckte zusammen. — „Schliesslich haben Sie ihn ja in der Hand. Ein Keuschheitsgelübde wiegt schwerer als ein Ehegelübde. Ihr Gatte verzeiht Ihnen; der Bischof ihm nicht. — Verschaffen Sie mir die Schliesse, so gebe ich Ihnen die Mittel für weitere fünf Jahre in diesem Stil. Sie hätten Ruhe vor mir! Bedenken Sie, was das heisst! — Und die Absolution von ihm haben Sie, wenn Sie wollen, im voraus.“
Frau Ina wurde schwarz vor den Augen. Sie konnte die Gegenstände nicht mehr unterscheiden. Nur die Hände mit den abgeschabten roten Handschuhen, mit denen er vor ihrem Gesicht herumgestikulierte, empfand sie wie zuckende Flammen, die drohend vor ihr auflohten und ihr den Atem nahmen. Wie um sich zu befreien, griff sie plötzlich nach diesen zuckenden Händen, riss sie nach unten, sprang auf und rief:
„Nein! nein!! — dann werde ich lieber Ihre Geliebte!“
Katz sah eine Weile in ihr erregtes Gesicht. Sie liess seine Hände los und stand ihm dicht gegenüber. Er kniff die Augen zusammen, schnalzte mit der Zunge und sagte:
„Ich möcht’ schon. Aber den Luxus kann ich mir nicht leisten.“ — Er sah sie frech an. — „Und dann: ich teil’ nicht gern. Das reizt zu Vergleichen. Und ich weiss, ich bin nicht schön.“
Frau Ina glitt auf den Sessel zurück und schloss die Augen.
„Dann geben Sie mir Gift!“ hauchte sie.
„Unsinn!“ erwiderte Katz. „Was hätte ich davon? Tun Sie mir die Liebe und werden Sie nicht sentimental. Das steht Ihnen nicht. Was mich an Ihnen so reizt, ist der Heiligenschein, mit dem Sie Ihre bewusste Gemeinheit verdecken. Sie haben Talent genug, um nicht unterzugehen.“
„Geben Sie mir Gelegenheit, es zu nutzen.“
Katz tat, als dächte er nach, dann schlug er mit der Hand auf den Tisch und sagte:
„Ich hab’ etwas! — Auf den ersten Blick werden Sie sagen: nein! Aber dann wird es Ihnen eingehen; ganz allmählich. Genau, wie es mir eingegangen ist. Denn Ihre Moral, von allem religiösen und gesellschaftlichen Nimbus entkleidet, bewerte ich ungefähr gleich hoch wie meine.“
„So sagen Sie schon!“ drängte Frau Ina.
Katz setzte sich, stützte den Arm auf den Schreibtisch und sagte:
„Diese Art Geldgeschäfte, wie ich sie nun schon seit zehn Jahren betreibe, ohne auf den grünen Zweig zu kommen, reiben mich auf. Ich habe daher beschlossen, mein Leben auf eine solide Basis zu stellen. Sie allein können mir dazu verhelfen.“
Irau Ina sah ihn erstaunt an.
„Ja, Sie wollen doch nicht etwa, dass ich mich scheiden lasse und Ihre Frau werde?“
„Das wäre nach allem, was ich über Sie weiss, unsittlich. Aber vor allem: ich sprach von einer soliden Basis.“
„Was wäre das?“
Katz beugte sich zu ihr, sah ihr fest in die Augen und sagte bestimmt:
„Sie müssen ein Bordell übernehmen.“
Frau Ina schnellte zurück und erwiderte laut:
„Sie sind verrückt!“
„Auf die Antwort war ich vorbereitet. Sie ist weder originell, noch schreckt sie mich. — Sie werden das Bordell übernehmen, so wahr ich Stanislaus Katz heisse. Schon, weil Ihnen gar keine Wahl bleibt.“
„Ja, sind Sie toll? Weil Sie mir mit ein paar Hunderttausend Mark ausgeholfen haben, glauben Sie ein Recht zu haben ...“
„Ich bin weder toll, noch masse ich mir irgendein Recht an. Ich weiss nur, dass Sie weder in ein Kloster, noch in ein Bureau mit Schreibmaschine und Registratur passen. Sie können auf Grund von Veranlagung und Erziehung auf das Leben nicht verzichten. Sie haben also die Wahl, sich eine Kugel in den Kopf zu jagen oder Grande Kokotte zu werden. Beides keine Annehmlichkeiten. Nun fügt es der Zufall, dass mir eins der ersten europäischen Bordells an die Hand gegeben ist, aus dem sich bei geschickter Leitung Millionen herauswirtschaften lassen. Es gibt neben der Post und Eisenbahn kein sichereres und lukrativeres Unternehmen.“
„Ich wünsche Ihnen Glück! Aber was soll ich dabei?“
„Ich habe mein Lebtag niemanden betrogen. Aber ich mache Geldgeschäfte; bin also eine anrüchige Person; bekomme daher nie die Konzession. Meinen Bekannten, die besser beleumdet sind, kann ich das Geschäft nicht vorschlagen, sonst machen sie’s selbst. Aber Ihr Ruf ist der denkbar beste. Bei Ihnen verkehrt die erste Gesellschaft. Und wenn man bei den Recherchen bis hinauf zum Probst Weidner gehen sollte — Ihnen sagt niemand etwas Schlechtes nach.“
„Es handelt sich demnach nur ...“
„... um Ihren Namen“, bestätigte Katz. „Aber ich erwarte, dass Neugier, Lust und vor allem die Chance, ein Vermögen zu erwerben,“ — in Frau Inas Augen blitzte es auf — „Sie weitertreiben.“
Frau Ina fieberte in der Aussicht, ein Vermögen zu erwerben, ohne das ihr der Graf ewig unerreichbar blieb. Aber dies Konventionelle sass in ihr so fest, dass sie ganz automatisch sagte:
„Davor schützt mich der gute Geschmack und die Kinderstube.“
„Darum gerade handelt es sich. Denn die möchte ich, um auf diesem Gebiete etwas Neues, Originelles und daher Konkurrenzloses zu bieten, dem Unternehmen dienstbar machen.“
„Und wie denken Sie sich daneben meine gesellschaftliche Position?“
„Darauf erwidere ich: das ist Ihre Sache! Denken Sie darüber nach, wie Sie es anstellen, dass Sie trotzdem Dame bleiben. In der internationalen Gesellschaft gibt es Frauen, die von Hand zu Hand gehen und doch fest im Sattel sitzen, wie es Frauen gibt, die sich durch einen einzigen Rülps Zeit ihres Lebens unmöglich machten.“
Und wie lange Zeit lassen Sie mir, über diesen grotesken Vorschlag nachzudenken?“
„Das hängt zunächst davon ab, wie lange Sie sich den Luxus gestatten können, ohne meine Zuschüsse zu leben.“
In diesem Augenblick trat die Baronin am Arme ihres Schwiegersohnes ins Zimmer.
„Du hast Gäste, Ina!“ sagte sie mit leichtem Vorwurf. Ina tat, als überhörte sie und stellte Katz vor.
Die Baronin zwang sich ein Lächeln ab und sagte:
Meine Tochter hat mir von Ihnen erzählt. Sie interessieren sich für alten Schmuck?“
„Oh, dann muss ich Ihnen unsere Sammlung zeigen“, erbot sich der Rittmeister eifrig. „Wir haben Stücke, die bis ins elfte Jahrhundert zurückgehen.“
„Herr Katz kennt sie“, sagte Frau Ina schneidend.
„Aber in welchem Zusammenhange sie mit unserer Familie stehen, wie wir mit jedem einzelnen Stücke sozusagen verwachsen sind, was uns den Besitz mit jeder Generation wertvoller macht, das wissen Sie nicht!“ ereiferte sich der Rittmeister.
„Herr Katz ist kein Genealog“, unterbrach ihn Frau Ina, „er ist Sammler.“
„Ich muss deinem Manne recht geben,“ sagte die alte Baronin; „ich werde nie begreifen, wie man Freude am Sammeln von Schmuck fremder Familien haben kann. Da lege ich mir denn doch lieber gleich eine Sammlung von Wertpapieren an; das ist doch wenigstens praktisch, und unpersönlich ist das eine genau so wie das andere.“
„Aber das Kennertum hat doch auch seine Berechtigung“, erwiderte Katz.
„Wenn man Geschäfte damit macht,“ sagte die Baronin, „gewiss! für Juweliere. Für uns aber kommt allein der Affektionswert in Frage.“ — Sie gab ihrem Schwiegersohn ein Zeichen; er trat eilfertig an sie heran und reichte ihr den Arm. „Hier zum Beispiel“, sagte sie und wies auf den Glasschrank, zu dem der Rittmeister sie führte, „sehen Sie diesen Kardinalsring, verliehen von Sixtus dem Vierten im Jahre 1475, hat ein ...“ Plötzlich ging ein Ruck durch ihren Körper und sie hielt sich am Arme ihres Schwiegersohnes fest; dann hob sie die weissgepuderte Hand und wies auf den leeren Platz im Schrank, auf dem die Mantelschliesse gelegen hatte, wurde kreidebleich und sagte: „Wo ... wo ... ist denn ... der ... Ring?“
Katz trat dicht an Frau Ina heran und wies unauffällig auf seine Tasche, in der das Schmuckstück war. Die begriff sogleich und sagte:
„Ich habe Herrn Katz gebeten, den einen der Steine auf seine Echtheit hin zu prüfen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass der eine Stein während unserer letzten Reise durch einen anderen ersetzt worden ist.“
„Zeigen Sie her!“ rief die Alte erregt und ging jetzt ohne Stütze auf Katz zu, der den Ring aus der Tasche zog, aber in der Hand behielt.
Die Frau Baronin prüfte genau mit der Lorgnette und erklärte:
„Ich lasse meinen weissen Kopf dafür: an diesem Stück ist alles genau so, wie es in meiner frühesten Kindheit war“ — und nun erzählte sie die Geschichte dieses Ringes, so wie sie von Mutter und Grossmutter ihr überkommen war.
Gerade, als sie den Ring wieder an ihre gewohnte Stelle legen wollte, meldete der Diener:
„Der Herr Graf v. Scheeler will sich verabschieden.“
Er trat zur Seite, und der Graf erschien auf der Schwelle. Er nahm von Katz keine Notiz, schritt auf die Baronin zu und ergriff ihre Hand, in der sie den Ring hielt. Er stutzte und sah Katz an.
Die Baronin erriet seine Gedanken.
„Wir waren in Sorge um die Echtheit eines Steines“, sagte sie. „Darum baten wir Herrn Katz“ sie stellte ihn dem Grafen vor — „der Kenner ist, ihn zu prüfen. — Gott Lob, er ist echt“ — und sie legte den Ring wieder in den Schrank.
Aber auch Katz wusste, was vorging. Der Glaube des Grafen, dass der Glanz dieses Hauses echt war, durfte nicht erschüttert werden. Er nutzte die Situation, gab Frau Ina ein Zeichen, zog ein Papier aus der Tasche, breitete es vor ihr aus, wies mit dem Zeigefinger auf eine bestimmte Stelle und flüsterte:
„Bitte!“
Mit zitternder Hand griff sie zur Feder und setzte ihren Namen unter das Papier. Sie sah nicht, was sie unterschrieb, aber die Hand in dem abgeschabten roten Glacé, die das Papier hielt, liess es sie fühlen.
Katz nahm hastig das Papier an sich und steckte es in die Tasche.
Der Graf war an Ina herangetreten, sie wagte nicht, ihn anzusehen.
„Also bis morgen“, sagte sie; ihre Stimme zitterte: „Wir reiten zusammen.“
Er nahm ihre Hand, die eben den Bordellvertrag gefertigt hatte, und küsste sie.
„Mit Vergnügen“, erwiderte er, verbeugte sich und ging. Und zu dem Rittmeister, der ihn hinausbegleiten wollte, sagte er in der Tür:
„Bitte, bleiben Sie!“
Als er draussen war, sank Frau Ina in den Sessel zurück und schloss die Augen.
„Ist dir etwas?“ fragte der Rittmeister besorgt.
Sie wies auf Katz und sagte schroff:
„Begleite den Herrn hinaus!“
Der war keineswegs gekränkt, überzeugte sich durch einen schnellen Griff in die Tasche, dass der Vertrag darin war, und ging.
Er war noch im Flur, da stürzte die Baronin auf ihre Tochter zu, riss sie aus dem Sessel, sperrte neugierig die Augen auf und fragte hastig:
„Nun, was ist? Was verlangt er? Zahlt er weiter oder weigert er sich? Was hast du da unterschrieben? Ich kann mir denken, es ist kein Glück, seine Geliebte zu sein. Aber, was willst du tun? Wir müssen leben! — Betrüg ihn! Schlag ihn! Bring ihn um! Aber handle vorsichtig und klug und mach mir keine Sorgen. — Wie ich ihm den Ring abgejagt habe! — Wer mir das gesagt hätte vor fünfzig Jahren, als ich in meiner Verliebtheit dem Herzog von Montfleury einen Korb gab, um deinen Vater zu heiraten.“
„Ach Mutter!“ seufzte Frau Ina.
„Was für ein Papier hast du da unterschrieben?“ drängte die Baronin.
„Ich weiss es nicht. Vermutlich einen Kontrakt.“
„Was für einen Kontrakt? — Um deinen Mann los und die Frau des Grafen Scheeler zu werden, musst du alles vermeiden, was dich nach aussen hin kompromittiert.“
Ina lachte spöttisch, sah die Baronin fest an und sagte:
„Ich werde ein Bordell übernehmen.“
„Ina!“ schrie die Baronin laut auf. „Hast du den Verstand verloren?“
„I Gott bewahre! Aber in dieser Form geht es nicht weiter. Statt zu Geld zu kommen, geraten wir nur immer tiefer in Schulden. Jetzt heisst es, endlich einmal Realpolitik treiben! Biegen oder brechen!“
Die Baronin sah entsetzt ihre Tochter an.
„Und ... auf ... die ... Art ... meinst ... du ...?“
„Ja, Mama!“ lautete die bestimmte Antwort. „Auf die Art; wenn in der Form auch etwas anders.“
„Und ... du ... glaubst ...?“
„Ich hoffe!“
Der Rittmeister kam wieder ins Zimmer.
„Ein sympathischer Mensch, dieser Katz“, sagte er. „Und auf dich, Ina, hält er grosse Stücke.“
Aus einem Nebenzimmer ertönte hell die Stimme Mathilde Brückners.
„Allmächtiger!“ rief Ina. „Wir haben ja Gäste!“
Sie trat an den Spiegel, legte Puder auf, befahl ihrem Manne, der Baronin den Arm zu reichen, und ging mit ihnen in den Salon zurück, der auf der andern Seite des Flurs lag.
Mathilde Brückner hatte ihr Lied gerade beendet, als die Drei den Salon wieder betraten.
„Ich habe versucht, Sie zu ersetzen,“ wandte sich Mathilde an die Baronin.
„Solchen Ersatz werden sich unsere Gäste gern gefallen lassen,“ erwiderte die, dankte Mathilde lebhaft und drückte ihr die Hand.
„Hoffentlich war die Abhaltung keine unangenehme,“ fragte Wolfgang v. Erdt.
„Ja und nein,“ erwiderte Frau Ina. „Es kommt, wie bei allem, darauf an, wie man es nimmt. Einer findet es katastrophal, der Andere sieht darin eine Wohltat.“
„Sehr richtig!“ stimmte der Professor zu. „Das gilt ganz allgemein und uneingeschränkt; nur merken es die Menschen in den seltensten Fällen. Alles ist letzten Endes auf Zerstörung gerichtet.“
„Jeder Aufbau trägt in sich schon den Keim späterer Vernichtung.“
„Dass wir ihn nicht erkennen,“ erwiderte Frau Ina, um dem Gespräch eine andere Richtung zu geben, „liegt daran, dass man uns schon als Kinder eine Brille auf die Nase stülpt, durch die wir dann zeitlebens alles wie durch einen Schleier sehen. Zu einer eigenen Wertung über Gut und Böse kommen wir dadurch überhaupt nicht. Das hat man uns schon vorweggenommen.“
„Und man sollte nicht imstande sein, sich diese Brille herunterzureissen und mit eigenen Augen zu sehen?“ fragte v. Erdt.
„Das Resultat wäre ein Mensch ohne Vorurteile,“ erwiderte der Professor. „Ich glaube nicht, dass es so etwas in unseren Kreisen gibt.“
„Und gäbe es das, was gewiss schon viel wäre,“ fuhr Frau Ina fort, „wem wäre damit gedient? Dieser Ausnahmemensch würde sich ja doch nur immer in seinen Kreisen bewegen. Das Leben da, wo es unverfälscht ist, würde er doch nicht kennen lernen.“
„Und wo, meinen Sie, lernt man das unverfälschte Leben am besten und am gründlichsten kennen?“ fragte Frau Mira.
„Unten im Volke natürlich,“ erwiderte der Professor, „wo die Instinkte frei und ohne gesellschaftliche Rücksichten zum Durchbruch kommen.“
Frau Olga führte ihr Spitzentuch vor den Mund und sagte:
„Danke ergebenst! Alle diese Menschen haben einen Odeur an sich, der mich umwirft.“
„Vor allem,“ meinte Frau Ina, „ist an dieser Art Menschen nichts zu studieren. Sie sind durch die Tretmühle des täglichen Lebens so abgestumpft, dass sie kaum noch Leidenschaften haben.“
„Aber man liest doch soviel in Romanen uud sieht soviel auf der Bühne ...“ brachte Frau Mira etwas zaghaft mit einem Blick auf Wolfgang v. Erdt vor.
„Das ist doch alles Phantasie,“ meinte die Baronin, worauf sie ein vernichtender Blick Nelly Brückners traf. „Oder irre ich mich da?“ fragte sie höflich.
„Aber sehr!“ erklärte Nelly überlegen und bestimmt, sah ängstlich zu ihrem Stiefvater auf, streichelte ihn mit einem zärtlichen Blick und sagte:
„Intuition ist es! Göttliche Intuition!“
„Jedenfalls, und darauf allein kommt es an,“ erwiderte Frau Ina, „weit ab von jeder Wirklichkeit. — Um die Wirklichkeit kennen zu lernen,“ fuhr sie mit Pathos fort, „dazu bedarf es schon einer gewissen Grösse, die von uns, die wir bis da hinauf in gesellschaftlichen Vorurteilen stecken, kaum einer aufbringt.“
„Ich schon!“ widersprach Frau Mira. „Wenn Sie mir nur zusichern, dass dies Studium mehr Abwechslung bietet und weniger formal ist als unser gesellschaftliches Leben, das mit der Präzision eines tausend Meter Films abrollt, ohne — genau wie der — je eine Überraschung zu bringen, dann stürze ich mich in dies Studium, selbst auf die Gefahr hin, mich und meinen Mann zu kompromittieren.“
„Es ist ja klar,“ sagte Frau Ina, „dass man den nackten Menschen — ich spreche natürlich bildlich — nur kennen lernen kann, wenn man ihn da aufsucht, wo seine Leidenschaften ungehemmt, zügellos, nackt — und jetzt meine ich es wörtlich — zum Ausdruck kommen.“
„Gibt es so einen Ort?“ fragte Frau Mira voll Interesse.
„Den gibt es!“ erwiderte Frau Ina.
„Nämlich?“ fragte Mathilde Brückner, und die gleiche Frage stand auf allen Gesichtern.
„Ich will es Ihnen sagen.“ — Sie wandte sich an ihren Mann: „Bitte, Heinz, giesse uns erst einmal allen von dem Chartreuse ein.“ — Frau Olga hielt ihre mit Brillanten besäte unschöne Hand über ihr Glas — „auch Ihnen, Frau Herzog — und zwar bis an den Rand.“
„Sie lenken ab,“ sagte Nelly, die vor Erregung leichenblass war und ihre Neugier nicht meistern konnte.
„O nein!“ erwiderte Frau Ina. „Ich beuge vor. — Also,“ fuhr sie fort und überzeugte sich, dass alle Gläser gefüllt waren, „der einzige Ort, an dem wir das nackte Leben, das heisst, die Menschen so, wie sie sind, kennen lernen können, ist“ — sie sah alle der Reihe nach an — „das Bordell!“
„Ina!“ rief die Baronin entsetzt und war in diesem Augenblicke seltsamer Weise die Einzige, die sich verstellte.
„Nein!“ schluchzte Nelly laut und griff wie zum Schutze nach der Hand ihrer Mutter.
„Sie scherzen natürlich,“ sagte lächelnd v. Erdt, worauf hin Inas Mann, wie immer, wenn jemand einen Witz erzählte, auch wenn er ihn nicht verstand oder längst kannte, anfing, laut zu lachen.
Nelly sah sich furchtsam nach ihm um, Frau Ina fuhr ihn grob an und sagte:
„Lass das!“
Mathilde Brückner machte ein nachdenkliches Gesicht, kniff die Lippen zusammen, nickte mit dem Kopf und sagte, ohne dass sie jemanden ansah:
„Gewiss! — ich begreife. — Man muss die Menschen aufsuchen, wo sie sich gehen lassen und unbeherrscht sind — und ich kann mir denken, dass sie sich da ihrem Naturzustande am weitesten nähern. — Denn schliesslich ist Moral, der zu Liebe sich der Mensch seit Jahrtausenden verstellt und der wir unsere sogenannte Kultur verdanken, ja letzten Endes nichts anderes als eine Vergewaltigung unserer Leidenschaften und somit ein menschlicher Eingriff in die Natur.“ — Sie nickte wieder mit dem Kopf und wandte sich dann an Frau Ina. „Ich glaube, Sie haben recht — da liesse sich vieles herausholen — meinst du nicht auch, Wolfgang, dass es sich lohnte, da einmal Studien zu machen.“
Nelly fuhr auf.
„Papa braucht das nicht!“ rief sie gekränkt. „Papa schafft von Innen.“
Wolfgang v. Erdt zog die Stirn in Falten und meinte:
„Darum kann man sich doch befruchten lassen.“
„Aber,“ wandte der Professor ein, „ist die Art der Betätigung in derartigen ... Instituten nicht ziemlich ungeistig und gleichartig?“
„O nein!“ widersprach Frau Mira, die mit leuchtenden Augen dasass und aufmerksam jedem Worte folgte: „Haben Sie denn nie etwas von dem Marquis de Sade und Retif de la Brétonne gehört?“
Der Professor lächelte und sagte:
„Gewiss! Aber wenn ich recht verstanden habe, so handelt es sich hier doch um seelische Konflikte und nicht um gymnastische Möglichkeiten.“
„Gerade die seelischen Konflikte,“ erwiderte Mathilde Brückner, in der Frau Ina ganz unerwartet einen leidenschaftlichen Helfer fand, „wird man nirgends besser als gerade dort studieren.“
„Doch aber nur die weiblichen,“ wandte der Professor ein.
„O nein!“ widersprach Mathilde. „Wenn man die Psyche des Mannes nur einigermassen versteht — nirgends wird er sich ungezwungener geben als hier. Und gerade weil er an solchem Ort am wenigsten Verständnis erwartet, wird er, in seiner Überrraschung, es zu finden, wie ein Kind sein.“
Der Professor nickte und sagte:
„Das leuchtet mir ein. Aber was ich noch nicht verstehe: als was dachten die Damen denn in dem ... Institut zu fungieren?“
„Das ist doch klar!“ platzte Frau Mira heraus.
Eine peinliche Pause entstand. Nach einer Weile sagte Frau Ina:
„Ihre Frage ist durchaus berechtigt, Herr Professor. Denn, geben wir wahrheitsgemäss Studium als Grund an, so laufen wir in dieser heuchlerischen Welt Gefahr, falsch verstanden und kritisiert zu werden.“
„Die Befürchtung habe auch ich,“ sagte Frau Olga. „Wie wäre es, wenn man ganz zeitgemäss mit diesem Studium eine soziale Absicht verbände?“