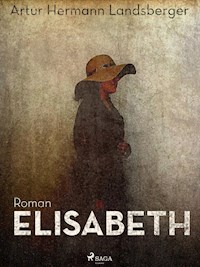Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der mittellose und verrufene Schriftsteller Peter erhält die Erlaubnis, die bestgelegene Villa Berlins im Tiergarten zu beziehen, um die sich seit einem Jahr mehr als dreißig Parteien einen erbitterten Kampf liefern. Doch die Behörde verfügt: "Sie erhalten die Wohnung. Da der Zahl der Zimmer entsprechend mindestens neun Personen darin unterzubringen sind, so haben Sie Einweisungen zu gewärtigen." Kurzerhand entschließt sich der neue Hausbesitzer, einfach acht Freunde bei sich einzuquartieren. Da wäre Töns, der seit zwölf Jahren im Esplanade-Hotel wohnt, Baron Etville samt Diener, Rolf, der eine abenteuerliche Liaison mit der Filmdiva Pola Negri hat, der Schriftsteller Karl Theodor Timm … Doch die Herren veranstalten einen ordentlichen Tumult und treiben Peters Haushälterin Fräulein Fleck schon am ersten Tag an den Rand des Wahnsinns. Schnell wird klar: Eine Frau muss her, die Ordnung in das Chaos der Junggesellen bringt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Artur Hermann Landsberger
Villa im Tiergarten
Saga
Erster teil
Erstes kapitel
Als ich durch Vorlegung von Dokumenten und alten Familienbildern den Nachweis erbracht hatte, daß meine Familie väterlicher- und mütterlicherseits seit sechs Generationen in Berlin lebt, daß während dieser zweihundertfünfzig Jahre keiner von ihnen das Armenrecht in Anspruch genommen, einen verbotenen Handel getrieben oder die bürgerlichen Ehrenrechte, wenn auch nur vorübergehend, verloren hatte, wurde ich am 1. April 1923 endlich in die Tiergartenvilla eingewiesen.
Um diese bestgelegene Villa Berlins war seit einem Jahre von etwa dreißig Parteien erbittert gekämpft worden. Sämtliche Architektenschieber Berlins nagten an diesem Objekt, auf das hin Nachkriegsreiche, denen es am Kurfürstendamm zu stark nach Kriegsgewinnlern roch, bereits Millionen geopfert hatten. Und nun wurde ich, der verrufene Schriftsteller, in dessen Büchern die Ueberklugen längst ein Haar gefunden hatten, Herr des Hauses — wenigstens dem Scheine nach.
Denn die Behörde verfügte: „Sie erhalten die Wohnung. Da der Zahl der Zimmer entsprechend mindestens neun Personen darin unterzubringen sind, so haben Sie Einweisungen zu gewärtigen.“
Teufel! Das war ein Danaergeschenk! — Ich besitze neun Tanten im Tiergarten, die meines Wissens nie in ihren Villen belästigt wurden. Ich suchte sie der Reihe nach auf. Der Reihe nach fällten sie das salomonische Urteil: „Du mußt dir ganz einfach sieben Dienstboten halten.“ — Und auf mein entsetztes Gesicht hin sagte die jüngste von ihnen, das dreiundsiebzigjährige Hannchen haut gout — so heißt sie ihrer modernen Lebensauffassung wegen in der Familie —: „Sie brauchen ja nicht alle sieben alt und häßlich zu sein.“
Sonderbare Vorstellungen hatten diese Tanten von den Einnahmen eines Schriftstellers! Die reichten gerade für die Friedensmiete. — Also träumte ich in der Nacht, wie eine Protzenfamilie mit einer Schar von Kindern und Dienstboten in meinen Möbeln hauste. Ich aber saß in einem Raume, den der zweite Diener wegen der Nähe der Toilette abgelehnt hatte, träumend von vergangener Zeit vor ein paar von Protzens Kindern ausgelutschten Riesen-Hummerbäuchen.
Ich nahm den Traum als Warnung und überlegte, wie ich mich vor Protzens retten könnte. Natürlich! ich mußte Bekannte hineinnehmen. Aber woher die so schnell bekommen? Und Gefahr war im Verzuge. Jeden Augenblick konnten Protzens eingewiesen werden. Solide Menschen sollten es sein. Und ich ging zu meinem Freunde Töns, der seit zwölf Jahren im Esplanade-Hotel wohnte, und sagte zu ihm:
„Ich verstehe gar nicht, wie man dies blöde Hotelleben so lange ertragen kann.“
„Blöde?“ rief er. „Ich kenne nichts Amüsanteres. Immer Abwechslung! Jeden Tag andere Menschen! Wenn du hier lebtest — du würdest weniger langweilige Bücher schreiben.“
„Du könntest dich ja trotzdem tagsüber so viel du willst hier aufhalten,“ erwiderte ich.
„Wann könnte ich das?“
„Wenn du bei mir wohntest!“
„Bei dir? Wie kommst du darauf?“
„Es sind nur ein paar Schritte von hier. Du zahlst nicht den zehnten Teil und bewahrst mich vor Protzens.“
„Man will dir Fremde hineinsetzen? In die Möbel deiner Eltern? — Du! Ich komme! Heute noch, wenn du willst.“
Und da ich wollte, so zog mein Freund Töns noch am Abend desselben Tages zu mir.
Es war elf vormittags, als ich ihn verließ. Am Potsdamer Platz grüßte aus einem Auto Baron Etville.
„Halt!“ schrie ich, ohne recht zu wissen, weshalb.
„Halt!“ schrie nun auch er — und sein Auto hielt. Wir gaben uns die Hand, und da ich sah, daß er im Frack war — vormittags um elf am Potsdamer Platz! — so sagte ich:
„Hals- und Beinbruch!“
„Wozu?“
Ich wies auf sein Aeußeres und sagte: „Vermutlich fährst du doch zum Examen.“
Er knöpfte den Rock hoch und erwiderte:
„I Gott bewahre! Von gestern abend. Ich fahre nach Hause.“
„Immer um die Zeit?“ fragte ich.
„Meistenteils — oder doch häufig!“
„Du müßtest bei mir wohnen!“ rief ich.
„Warum?“
„Zum Donnerwetter fahren Sie weiter!“ brüllte ein Sipomann. „Sie sperren ja den Verkehr!“
Ich sprang in das Auto.
„Du verfährst auf die Art ja ein Vermögen!“ sagte ich zu Etville, der am Ende des Kurfürstendammes wohnte. „Bei mir, unmittelbar am Potsdamer Platz, zehn Minuten von sämtlichen Nachtlokalen, sparst du Zeit, Geld und Nerven.“
„Keine schlechte Idee,“ sagte der Todmüde.
„Wenn du willst, liegst du in zwei Minuten im Bett und brauchst gar nicht erst nach Hause zu fahren.“
„Das wäre“ — die Augen fielen ihm zu — „herrlich.“ — Und fünf Minuten später lag Etville in tiefem Schlafe bei mir. Abends folgten sein Diener und seine Sachen nach.
Dummerweise mußte ich noch am selben Vormittag zur Aufnahme eines Films von mir nach Johannisthal. Die Filmregisseure sind nämlich reizende Leute. Wenn sie einen Film drehen, lieben sie es, den Verfasser zu den Aufnahmen hinzuzuziehen. Sie lassen dann ein paar Szenen kurbeln, und der Autor muß raten, welche Szenen es sind. Wenn der stutzt und sagt: „Keine Ahnung! Das ist doch nicht mein Manuskript!“ so strahlt der Regisseur und ruft: „Gott sei Dank, der Film wird gut! Jede Spur des Autors ist verwischt.“ Wird man dann zornig, so lächelt der Regisseur und sagt: „Lieber Doktor! Das sind mir die liebsten Manuskripte, in denen man jede Szene mit dem Rotstift streichen kann, ohne daß der Film darunter leidet.“ — „Ja, wozu dann erst das Manuskript?“ frage ich, und er erwidert: „Weil man durch den Blödsinn erst auf gute Gedanken kommt.“
Ich wollte gerade grob werden, da legte sich eine weiße Frauenhand besänftigend auf meine Schulter. Ich atmete den Duft von Guerlains Muschiko und wußte, daß es Po Gri war. Denn das Parfüm ist das einzige, worin Filmdivas sich voneinander unterscheiden. Im Ausdruck ihrer Leidenschaft gleichen sie sich wie — seien wir höflich — eine Rose der anderen — aber im Duft sind sie verschieden.
Po zog mich zur Seite, schlug die Augen auf und sagte:
„Nun, Peter? Was sagst du?“
„Ich bin empört!“
„Wieso du? Waren es deine Perlen?“
„Perlen? — Ach so! Richtig! Ich denke, du hast sie wieder?“
„Ja doch! Das ist ja das Unglück!“
Ich faßte mich an den Kopf.
„Du scheinst nicht zu wissen,“ sagte sie, „daß Rolf eine Belohnung von zehn Millionen auf die Wiederbeschaffung ausgesetzt hat!“
„Gewiß weiß ich das!“
„Nun soll er sie zahlen.“
„Selbstredend!“
„Mach ihm das klar! Er weigert sich.“
„Aus welchem Grunde?“
„Weil die Perlen nicht echt sind.“
Ich lachte laut auf:
„Wußte er das?“ fragte ich.
„I Gott bewahre! Aber der sogenannte ehrliche Finder, der meinem Gefühl nach niemand anderes als der Dieb selbst ist, weiß es.“
„Ich verstehe.“
„Ich schäme mich tot. Entweder er zahlt, oder wir sind blamiert.“
„Wieso wir? Höchstens doch du? Wenn Rolf nichts wußte ...?“
„Das glaubt ihm kein Mensch. Ich bleibe jedenfalls keinen Tag länger im Esplanade wohnen.“
„Und er?“
„Er kann von mir aus wohnen bleiben.“
„Das kann er nicht,“ widersprach ich lebhaft. „Er muß noch heute zu mir ziehen.“
„Zu dir?“
Ich ließ sie stehen, raste ins Esplanade, stürmte in Rolfs Zimmer, flog ihm an den Hals und rief:
„Bedauernswerter! Hier im Hotel, wo dich jeder kennt, wächst sich die Sache zum Skandal aus!“
„Wo soll ich hin?“
„Zu mir! — Ich weiß, was ich einem Freunde schulde!“
Rolf war gerührt und nahm an.
Während sein Kammerdiener Nitter die Sachen packte, schleppte ich meinen erschöpften Körper in das nächste Kino. Man spielte irgendein Wild-West-Drama mit den so beliebten Müggelbergen im Hintergrunde. Vorn auf der Leinwand kämpfte ein blonder Held in Tropenkleidern siegreich gegen eine Horde von Sioux-Indianern, unter denen ich trotz des frischen Anstrichs einen fliegenden Wursthändler vom Bahnhof Friedrichstraße wiedererkannte. Der Held aber, der sich jedesmal, wenn er einen Gegner zur Strecke gebracht hatte, mit unnachahmlicher Geste durch das blonde Haupthaar fuhr, erinnerte mich an einen ehemaligen Bekannten, den Schriftsteller Karl Theodor Timm, den ich fast sieben Jahre lang nicht mehr gesehen hatte. Ich erinnerte mich, daß er sechs Monate im Jahr herumreiste und, sofern er nicht auf Reisen war, in einem Café am Kurfürstendamm saß! Das war mein Mann! Der nutzte die Möbel nicht ab und störte nicht! Ich fand ihn mit Hilfe seiner alten Wirtin schnell. Er war unverändert, nur daß er sich nicht mehr Schriftsteller, sondern Dichter nannte, und ich huldigte ihm dementsprechend und nahm wahr, daß es ihm wohltat.
„Heraus aus dieser Gegend!“ sagte ich. „Ein Dichter wie du hat im Tiergarten zu wohnen! Der Militarismus ist tot! Der Geist regiert die Stunde! Repräsentiere! Wirf dein Bohèmetum ab! Glänze! Scheine! Laß dich photographieren! Gebärde dich! Statt in den Cafés herumzusitzen, geh in die großen Hotels! Speak english! Lösch’ deine Zigaretten in altem Bordeaux! — Aber alles das hat nur Zweck, wenn du im Tiergarten wohnst.“
„Warum?“ fragte Timm nicht mit Unrecht, und ich erwiderte:
„Weil man es dann für echt und vornehm hält.“
Obgleich er den Unsinn nur halb verstand, willigte er ein, so daß am Abend das Haus vorschriftsmäßig besetzt war.
Als meine Haushälterin, Fräulein Fleck, abends auf dem Flur vier fremde Herrenmäntel hängen sah, stürmte sie zu mir und fragte ängstlich:
„Herr Doktor! Ist hier ein Spielklub oder ...?“
„Drei Spiegeleier mit Schinken, Kaffee, Weißbrot!“ ertönte auf dem Flur die Stimme von Etvilles Diener.
„... oder ein Restaurant?“ beendete Fräulein Fleck, die mich seit fünfzehn Jahren betreute, entsetzt ihre Rede.
„Herr von Etville, den Sie doch kennen, nimmt sein erstes Frühstück,“ erwiderte ich so harmlos wie irgend möglich.
„Was? — Abends um acht?“
„Liebes Fleckchen,“ suchte ich sie zu beruhigen, „das ist alles relativ. Die Begriffe von Zeit sind nach Einstein ...“
„Möglich! Aber wieso — frühstückt Herr von Etville bei uns?“
„Danach müssen Sie das Wohnungsamt fragen.“
Fräulein Fleck, das an sich nur ein Meter achtunddreißig maß, sank in sich zusammen und stöhnte:
„Dacht’ ich’s mir doch! — die große Wohnung!“
„Das muß eben ertragen werden!“
„Und die vier Mäntel und Hüte gehören sämtlich ...?“
Sie ahnte wohl Böses, denn sie führte den Satz nicht zu Ende.
„Ich verdopple Ihr Gehalt — was sagte ich?“ verbesserte ich schnell: „Ich vervierfache es.“
Fräulein Fleck senkte den Kopf und stöhnte:
„Also vier!“
Die Zimmerklingeln gingen unaufhörlich, und Frida, das an Ruhe gewöhnte Mädchen, lief im Trab den Korridor entlang, ohne ein Zimmer zu betreten, denn jedes Mal, wenn sie eine Tür öffnen wollte, ertönte ein neues Klingelzeichen, auf das hin sie zu dem elektrischen Melder in der Küche zurücklief.
Nitter mit der gebügelten Frackweste seines Herrn im Arm karambolierte mit Etvilles Diener, der eben die Spiegeleier mit Schinken servieren wollte. Die Eier glitten vom Teller auf die Weste, Frida, die außer Atem grade wieder den Korridor entlanglief, schlug die Hände vor dem Kopf zusammen und rief: „Ich werde verrückt!“
Als erste hatten sich Rolf und Etville miteinander verständigt. Da Po Gri aus Wut oder Eifersucht Rolfs Koffer mit der Abendgarderobe im Esplanade zurückhielt, so zog Rolf an, was Etville auszog.
„Ganz praktisch eigentlich!“ meinte Rolf. „Wenn du immer um diese Zeit nach Hause kommst, so könnten wir ...“
Jetzt erst sah er, daß Etville auf der Chaiselongue fest eingeschlafen war.
Sein Diener, der mit dem leeren Tablett ins Zimmer trat, meinte:
„Das trifft sich ganz gut, obschon der Arzt dem Herrn Baron dringend empfohlen hat, vor dem Schlafengehen zu frühstücken.“ Und während er seinen Herrn in derart technischer Vollendung ins Bett packte, daß er weiterschlief, brüllte Rolf:
„Wo bleibt denn Nitter mit der Kalbsmilch und meiner Weste?“
Fräulein Fleck war ratlos. Wo sollte sie um halb neun Uhr abends eine Kalbsmilch auftreiben? Frida stimmte ihr bei und sagte:
„Ja doch! Hier ist doch kein Viehhof!“
Vorn in der Halle standen inzwischen Chauffeure, Hotelpagen mit Briefen, Hausdiener mit Koffern, ein Friseur, eine Manikure, ein Sekretär — und da Frida meine Mitbewohner nicht einmal dem Namen nach kannte, so schickte sie mit ausgesuchtem Pech jeden von ihnen in das Zimmer, in das er nicht gehörte.
So saß der Sekretär, nach dem sich Karl Theodor Timm inzwischen tottelephonierte, ratlos vor Etvilles Bett, starrte auf dessen Hand, den einzigen Körperteil, der unter der Bettdecke hervorsah, und dachte:
„Sonderbar! Wie sich der Mensch im Schlaf verändert!“
Zu Töns schob Frida den Hotelpagen mit einem Brief, der für Rolf bestimmt war und auf dessen Umschlag Po Gri aus Gewohnheit nur die Nummer des Zimmers vermerkt hatte, das Rolf bisher im Esplanade bewohnte. Töns, der sich bereits nach einer Stunde nach der Ruhe des Esplanade zurücksehnte, lächelte, als er die Nummer 41 auf dem Kuvert las, und dachte:
„So ein Fuchs! der Peter! Also eine Art Privathotel ist das! Und ich bin Nummer 41! — Er öffnete den Brief und las:
„Scheusal! Wenn du bis morgen mittag nicht die zehn Millionen zahlst, so bin ich für dich gewesen!
Po.“
Töns stellte fest, daß sein Gedächtnis ebenso schwach wie sein Gewissen schlecht war, gab sich aber, da er entschlossen war, nicht zu zahlen, gar nicht erst die Mühe, darüber nachzudenken, wer Po war und worauf sie ihre Forderung stützte. Er schrieb einfach:
„Du bist gewesen!“
gab dem Pagen tausend Mark und dachte: „eine geringe Summe im Vergleich zu der, die sie fordert.“
Elly, die Manikure, hübsch und schick, die zu Töns wollte, schob Frida zu Karl Theodor Timm. Der sprang auf, begrüßte sie durch eine huldvolle Handbewegung, fuhr sich durch das blonde Haupthaar und sagte:
„Königin!“
Elly lächelte und sagte:
„Später!“
Frida, der sie schon draußen Anweisung gegeben hatte, kam mit einem Napf heißen Wassers. Timm kniff die Augen zusammen und sagte zu Frida:
„Wie, bitte?“
Die erwiderte:
„Ich weiß nicht“ und verschwand.
„Wird es am Schreibtisch gehen?“ fragte Elly.
Timm legte die Hand an die Stirn und sagte:
„Hier schreibe ich meine Romane!“
Elly steckte seine Hand in das heiße Wasser und holte ihre Instrumente heraus.
Karl Theodor schloß die Augen und begriff:
„Tiergarten!“
Nach einer Weile sagte Elly:
„Sie schreiben Romane?“ — Er sah sie verächtlich an und schwieg. — „Ich schreibe auch in meinen Mußestunden.“ — Timm erwiderte nichts. — „Ich erlebe so viel.“
Timm dachte: Peter hat recht. Ich muß mich häufiger photographieren lassen. — Als Elly ging, gab er ihr ein Buch und schrieb etwas hinein. Sie las:
„‚Die Gemarterten‘ von Karl Theodor Timm — Sind Sie das?“
Er nickte und wartete auf die Wirkung.
„Ich werde mir den Namen merken,“ sagte sie.
Karl Theodor sank auf seinen Stuhl und stöhnte:
„Das ist keine Gegend für mich! Am Kurfürstendamm zittert jeder Backfisch, wenn er meinen Namen hört.“
Um die gleiche Zeit etwa brachte mir Frida eine gebratene Kalbsmilch und eine Flasche 1917er Sauternes.
„Was bedeutet denn das?“ fragte ich.
Frida beschwor mich:
„Bitte, Herr Doktor, fragen Sie mich heute nichts mehr. Mir dreht sich alles im Kopf. Morgen ...“
Das Telephon läutete: — „29!“ rief sie entsetzt.
„Was heißt das?“ fragte ich.
„Ich zähle,“ erwiderte sie und stürzte hinaus.
Fräulein Fleck war schon am Apparat:
„Wen wünschen Sie? — Professor Bernhardi? — Keine Ahnung! — Aber es wird schon stimmen! — Hier sind so viele Menschen! Es ist sehr möglich, daß er darunter ist.“
Dann fiel sie erschöpft in Fridas Arme. Die brachte sie in ihr Zimmer und sagte:
„Gewiß, es ist ja schlimm. Aber wir sollen froh sein, daß es nur Männer sind! Stellen Sie sich vor, wenn es ...“
„Nicht auszudenken!“ stimmte Fräulein Fleck bei und schien zufrieden.
Zweites kapitel
Was sich in der ersten Nacht ereignet hat, weiß ich nicht. Ich ließ den letzten männlichen Repräsentanten Derer von Erdmannslust, meinen dreizehnjährigen Dackel Stilpe, ausnahmsweise auf dem Flur übernachten und zählte in wachen Momenten, daß er zu elf verschiedenen Malen laut anschlug. Daraus schloß ich, daß der rege Verkehr im Hause auch nachts über anhielt.
Ich ließ also am nächsten Morgen um neun Uhr sämtliche Herren zu einer Aussprache bitten. Das äußere Bild war erhebend. Rolf erschien in schwarzseidenem Pyjama, Etville, den es nachts wieder hinausgetrieben hatte, im Smoking, Töns im offenen Bademantel, unter dem nur er war, Timm gepudert, mit Monokel, in buntem Kimono, so daß ich mir in meinem einfachen Sakko vulgär und sachlich vorkam.
„Meine lieben Freunde,“ begann ich, „so geht es nicht weiter!“
„Es hat ja noch gar nicht angefangen,“ sagte Etville und hatte die Lacher auf seiner Seite. Ja, Rolf erklärte sogar:
„Du wirst dich wundern, wenn der Betrieb hier erst eröffnet ist.“
„Hier muß Ordnung hinein!“ erklärte ich.
„Als erstes beantrage ich, daß mindestens zwei neue Badezimmer gebaut werden,“ forderte Töns.
„Auch meine Ansicht,“ erklärte Rolf.
„Kostenpunkt?“ fragte ich und bekam von Töns zur Antwort:
„Sei doch nicht so entsetzlich kleinlich!“
Timm meinte:
„Viel wichtiger ist, daß jeder sein Telephon hat.“
„Und seine eigene Bedienung,“ ergänzte Rolf. „Denn diese Frida ist zwar ganz reizend ...“
„Nun also,“ erwiderte Töns. „Darum muß sie bleiben. Ich übernehme sie. Ihr habt ja Eure Diener.“
„Die tun doch nichts,“ erklärte Etville.
„Dann hast du deinen schlecht erzogen,“ widersprach Rolf. „Meiner hilft mir beim An- und Ausziehen und bügelt meine Hosen.“
„Während er seine eigenen vom Schneider bügeln läßt.“
„Man kann von ihm nicht verlangen, daß er die Hosen eines Dieners bügelt,“ verteidigte ihn Etville.
„Beide weigern sich jedenfalls, Euer Badewasser ein- oder auszulassen,“ erklärte ich.
„Das ist Fridas Sache!“ meinte Rolf.
„Ich habe Durst!“ sagte Etville und rief: „Frida, ein Pilsner!“
„Mir ein Whisky!“ brüllte Rolf. „Im übrigen: wie lange soll hier eigentlich verhandelt werden? Mein Auto steht seit acht Uhr vor der Tür.“
„Richtig!“ sagte Töns, „Frida hat mich gebeten, ob sie nicht mal in einem deiner Autos spazierenfahren dürfe.“
„Sonderbar! — Aber, meinetwegen.“
„Wo bleibt denn mein Pilsner?“ rief Etville — und sein Diener Burg erschien und meldete kleinlaut:
„Frida ist noch nicht fertig angezogen.“
„Wie? Was?“ sagte Rolf und sah nach der Uhr. „Es ist ja zehn Minuten nach neun.“
„Ja, vor halb neun steht sie prinzipiell nicht auf,“ erklärte ich. „Vierzig Minuten dauert ihre Frisur — denn man will doch, daß sie nett aussieht.“
„Selbstverständlich will man das,“ sagte Töns.
„Dafür aber ist sie grundehrlich. Und wo bei euch alles herumliegt ...“
„Dann holen Sie doch das Pilsner,“ bat ich Burg, der mich ganz entgeistert ansah und sagte:
„Ich werde den Portier schicken.“
„Sie wollen sich also wirklich bis zum Portier bemühen?“ fragte ich, und Burg, der den Spott nicht merkte, erwiderte:
„Gewiß! Für den Herrn Baron.“
Es klopfte und auf mein „Herein“ trat Nitter ins Zimmer und sagte:
„Darf ich fragen, wann hier im Hause zu Mittag gespeist wird?“
Ich machte eine kleine Verbeugung und erwiderte:
„Wünschen der Herr an der gemeinsamen Tafel oder à part zu dinieren?“
„Ich habe im Esplanade immer auf meinem Zimmer gegessen.“
„Gab es denn da keine Räume für gemeinsame Mahlzeiten?“
„Gewiß! mehrere. Aber die persönlichen Diener aßen für sich.“
„Und Sie? ...“ wandte ich mich an Burg, der noch immer keine Anstalt machte, sich zu dem Portier zu bemühen — „sind Sie auch ein persönlicher ...?“
Burg richtete sich auf und sagte:
„Selbstredend!“
„Nun, dann könnten Sie beide am Ende zusammen ...“ versuchte ich zu vermitteln.
„Bedauere!“ fiel mir Burg ins Wort. „Unsere politischen Meinungen gehen so weit auseinander ...“
„Oh, dann natürlich!“ lenkte ich ein, wandte mich an beide und bat:
„Dann rufen Sie doch bitte mal Fräulein Fleck.“
Burg und Nitter sahen sich an und schienen sich zu verständigen. Jedenfalls rührte sich Burg nicht vom Fleck, während Nitter zur Klingel ging und mich fragte:
„Wie oft, bitte?“
Ich verbeugte mich wieder leicht und sagte:
„Zweimal, wenn ich bitten darf und wenn es Ihnen keine Mühe macht.“
„Durchaus nicht,“ erwiderte er und drückte zweimal auf den Knopf.
„Mein Pilsner!“ rief Etville. „Ich verdurste.“
Burg schob den Kopf ruckartig nach vorn — meine kurze Verbeugung zuvor war also falsch gewesen — und sagte:
„Sofort, Herr Baron. Ich denke aber, daß wir zunächst einmal die häuslichen Fragen erledigen.“
„Meinetwegen.“
„Und da möchte ich fragen, ob ich nicht vielleicht mein Zimmer gegen eins mit Morgensonne vertauschen kann.“
„Hat Ihnen der Arzt das empfohlen?“ fragte ich.
„Der Arzt nicht, aber ich habe mich selbst studiert und gefunden, daß Morgensonne einen günstigen Einfluß auf meine Stimmung übt.“
„So! So! Das ist ja sehr interessant,“ erwiderte ich.
„Und da ja meine Stimmung letzten Endes dem Herrn Baron zugute kommt ...“
„Mir ist mein Pilsner viel wichtiger als Ihre Stimmung!“ unterbrach ihn Etville —
„Sag’ das nicht,“ widersprach ich, da ich längst merkte, bei wem bei Teilung der Gewalten in diesem Hause das Uebergewicht lag. Und zu Töns gewandt, sagte ich:
„Würdest du dann vielleicht dein Zimmer gegen das von — ja, wie nenne ich Sie eigentlich?“
„Mein Name ist Burg.“
„... also gegen das von Herrn Burg tauschen?“
Töns willigte ein, worauf Herr Burg den Kopf kurz nach vorn streckte und sagte:
„Sehr liebenswürdig. Ich werde Frida sofort anweisen, meine Sachen in das andere Zimmer zu tragen.“
Im selben Augenblick erschien Fräulein Fleck im Zimmer. Sie sah wie eine Leiche aus.
„Wir müssen versuchen, Ordnung in den Haushalt zu bringen,“ sagte ich.
„Dann werden Herr Doktor mindestens drei neue Dienstmädchen einstellen müssen. Eins für Herrn Burg, eins für Herrn Nitter und das dritte für die übrigen fünf Herren.“
„So habe ich es mir auch gedacht,“ erwiderte ich. „Sie nehmen dann allabendlich die Wünsche der einzelnen Herren für den nächsten Tag entgegen und versuchen, sie mit Hilfe des Personals auszuführen.“
„Das ist bereits geschehen,“ erwiderte Fräulein Fleck — „wenigstens das Entgegennehmen; die Ausführung freilich —“ Sie legte mir den Tageszettel vor.
Ich las und sank in meinem Sessel zurück.
Ich schob das Blatt beiseite. Aber Fräulein Fleck las es uns bis zu Ende vor. Es waren zweiunddreißig Positionen, wie sie sich ausdrückte. Um 5 Uhr nachmittags empfing Karl Theodor Timm Verehrer und Verehrerinnen zum Tee. „Dreimal wöchentlich“, wie daneben stand. Um 6 Uhr dinierte Baron Etville mit ein paar Freunden, obschon die Testout-Rosen, die Frida bei Rothe bestellen sollte, das Geschlecht dieser Freunde fraglich erscheinen ließen. Um 9 Uhr bestellte Rolf ein Abschiedssouper zu vier Gedecken, und Töns bat für 10½ Uhr, also nach dem Theater, um ein kaltes Büfett und Whisky und zwar, wenn möglich, Old Fitzgerald Private Stock.
„Ich muß mich dreiteilen,“ sagte Fräulein Fleck. Aber ich widersprach. Einmal, weil dann überhaupt nichts von ihr übrigblieb; vor allem aber, weil ich längst erkannte, daß ich für die Küche mindestens noch zwei Personen und abermals zwei, wenn nicht drei, für die Bedienung brauchte. Das machte alles in allem etwa zwanzig Personen — zwölf mehr, als das Wohnungsamt verlangt hatte. Und da gütigem Zureden keiner weichen wollte, so erklärte ich:
„Unter diesen Umständen muß ich mindestens einen Stock aufbauen.“
„Ausgezeichnet!“ rief Rolf.
„Nur etwas kostspielig,“ erlaubte ich mir zu bemerken, worauf Töns ärgerlich sagte:
„Sei doch nicht immer so kleinlich!“
Rolf war von der Idee ganz begeistert:
„Auf die Art bekommt jede Partei ihre eigene Küche, und die Dienerschaft wohnt von uns getrennt.“
„Vorausgesetzt, daß sich die Dienerschaft für die obere Etage entscheidet,“ warf ich ein.
„Selbstverständlich,“ erwiderte Burg. „Beim Aufbau dieser Etage würden ja wohl unsere Wünsche berücksichtigt werden.“
„Die wären?“ fragte ich, und Burg erwiderte:
„Ich erlaubte mir schon zu betonen, daß ich auf Licht und Sonne Wert lege. Und dann keine Rabitzwände! Ich hasse Geräusche! Mich hört niemand, und ich darf die Rücksicht, die ich übe, auch von anderen erwarten.“
Dabei sah er Karl Theodor Timm so ungeniert an, daß der arglos fragte:
„Habe ich Sie etwa gestört?“
Burg zog die Schultern hoch, sah uns der Reihe nach an und sagte:
„Ich weiß nicht, ob ich mich äußern darf.“
„Sie dürfen,“ rief ich.
„Nun,“ begann er zögernd, „das Wichtigste, was man von einem persönlichen Diener großen Stils verlangen muß, ist Takt. Unser Takt ist sozusagen der gute Geist des Hauses, in dem wir wirken.“
„Was hat das mit Karl Theodor Timm zu tun?“ fragte ich.
Burg wies auf Timm und lächelte:
„Was mein Takt verbietet, das fordert Ihr Beruf. Sie studieren die Menschen wie wir! Aber während Sie von der öffentlichen Ausbeutung Ihrer Studien leben und deren Objekte nach dem Gebrauch völlig lieblos beiseiteschieben, leben wir davon, daß wir unsere Studien denen zugute kommen lassen, an denen wir sie gemacht haben.“
„Einen Moment!“ rief ich. „Sagen Sie das bitte noch mal!“ Und während Burg es wiederholte, schrieb ich es mir auf, in der Hoffnung, es in meinem nächsten Roman zu verwerten.
„Jedenfalls ist es undurchführbar,“ erklärte ich, „in einem Haushalte zu zehn verschiedenen Zeiten die Mahlzeiten zu servieren. Wir müssen für jede Mahlzeit eine bestimmte Zeit festsetzen, und wer die nicht innehält, ißt auswärts.“
„Dazu wohne ich nicht privat, um in Restaurants zu laufen,“ erklärte Rolf — „und Häslein auch nicht.“
„Wer ist denn das?“ fragte ich. „Hast du etwa die Absicht, dir hier einen Wildpark anzulegen.“
„Häslein ist die anerkannt hübscheste Frau von ganz Berlin,“ beteuerte Rolf.
Burg wie Nitter gaben durch eine leichte Kopfbewegung zu erkennen, daß das auch ihre Meinung war, während Töns mit einem Blick auf Frida, die eben ins Zimmer trat, widersprach:
„Das sagst du! — Ich liebe ein anderes Genre.“
„Haben Sie schon gefrühstückt, Frida?“ fragte Fräulein Fleck, und die erwiderte:
„Nein! Das war ja ein Lärm heute nacht! Ich habe von acht Uhr früh an kein Auge mehr zugemacht!“
„Das geht natürlich nicht,“ erklärte Töns. „Wer für uns arbeitet, muß nachts seine Ruhe haben.“
„Um acht Uhr ist die Nacht vorbei,“ erklärte Rolf, aber Frida sagte:
„Der Schlaf in den Morgenstunden ist für junge Mädchen der gesündeste.“
„Wir brauchen vor allem einen tüchtigen Organisator,“ sagte Töns. „Ich werde meinem Vater nach Essen telegraphieren.“
Ich widersprach: „Warum nicht gleich einen Betriebsrat! Ihr vergeßt, daß es sich um eine Tiergartenvilla handelt, nicht um einen Fabrikbetrieb. Hier kann nur eine Frau Ordnung hineinbringen!“
„Das ist auch meine Meinung,“ sagte Burg.
Das Gefühl, ihn auf meiner Seite zu wissen, stärkte mein Rückgrat.
„Natürlich darf es nicht die erste beste sein,“ fuhr ich fort.
„Ich fühle mich dem nicht gewachsen,“ erklärte Fräulein Fleck.
„Vielleicht Frida,“ meinte Töns. Und die schlug ihre blauen Augen so weit auf, daß sie sofort ein paar Stimmen für sich hatte.
„Es muß natürlich eine Frau sein,“ sagte ich, „der wir uns alle, auch Sie, meine Herren,“ wandte ich mich an Burg und Nitter — „bedingungslos unterordnen.“
„Also eine Dame!“ sekundierte Burg, und ich, froh, wenigstens von einem verstanden zu werden, sagte und begrub damit Fridas Chancen:
„Das ist es! Eine vollendete Dame muß es sein! Eine, der wir alle mit Respekt begegnen.“
Töns, auf den Rolf leise eingeredet hatte, sagte halblaut:
„Damit fährt auch dein Häslein in die Grube!“
„Also, wer ist das?“ fragte ich.
„Die anerkannt hübscheste ...“
„Das sagtest du schon mal. Und das ist für diesen Posten gewiß kein Nachteil. Aber was kann sie sonst?“
„Repräsentieren,“ erwiderte Rolf.
„Und du glaubst, daß sie im Verkehr mit Männern ...“
„... Klasse für sich ist!“ fiel mir Rolf ins Wort. „Und zwar unter Garantie!“
„Dann könnte ich ebensogut Lola vorschlagen,“ erklärte Etville. „Die kennt sich noch besser unter Männern aus.“
„Herrschaften,“ sagte ich, „es handelt sich um die Hausdame einer Tiergartenvilla, nicht um die Attraktion eines Nachtbetriebes! Wer hier wohnt, muß sich primär auf den Tag einstellen, nicht wie ihr, auf die Nacht.“
„Da ich den Tag über arbeite,“ sagte Rolf, „und ich schlafe,“ fuhr Etville fort, „und ich dichte,“ beteuerte Timm, „so haben wir nur nachts Zeit, uns auszutoben.“
„Dies Recht tastet niemand an. Aber je mehr ihr bummelt, um so wohltuender muß es für euch sein, wenn in eurem Hause Ordnung und Sitte herrscht!“
„Ordnung schon,“ meinte Töns, „aber Sitte ist meist sehr langweilig.“ — Und Rolf meinte:
„Dann können wir ja lieber gleich in ein Hospiz ziehen.“
„Unser Haus soll weder ein Hospiz noch ein Bordell sein. Der Takt einer Dame muß eben das Richtige treffen. Diese Dame werde ich suchen. Und zwar heute noch.“
„Du hast mit jedem Wort recht,“ erklärte Töns. „Aber ich zweifle, daß du sie findest.“
Am nächsten Morgen stand in fünf großen Tageszeitungen folgendes Inserat:
Dame
aus guter Familie, die gut aussieht, Takt und Energie besitzt, wird zur Organisation und selbständigen Führung frauenlosen Haushalts von fünf Junggesellen und entsprechender Dienerschaft bei höchstem Gehalt zu sofortigem Antritt gesucht.
Wie zu erwarten war, schleppte der Briefträger mit jeder Post Stöße von schriftlichen Bewerbungen an. Die Fernsprecher waren ständig in Bewegung, und auf der Treppe drängten sich Mädchen und Damen jeden Standes und jeden Alters von früh ab bis in die Abendstunden. Frida und Fräulein Fleck, die am Vormittag zu verschiedenen Zeiten das Haus verlassen hatten, wurden von den Bewerberinnen, obgleich sie beteuerten, daß sie Angestellte seien, gezwungen, sich anzustellen, und erschienen erst wieder, als ich gegen acht Uhr abends auf den guten Gedanken kam, durch einen Telephontrichter zu brüllen: „Habemus dominam“, was zunächst zwar nur die Wirkung hatte, daß alle aufsahen, um sich dann aber auf meinen weiteren Ruf: „Der Posten ist besetzt“, ungläubig nur noch toller zu gebärden.
Gegen Mittag hatten Passanten, die dem merkwürdigen Schauspiel von der Straße aus erst neugierig und dann mißtrauisch zuschauten, die Polizei auf uns gehetzt, die in Gestalt eines hohen Beamten und zweier Assistenten erschien und uns einem peinlichen Verhör unterzog. Ich stellte vor: „Baron von Etville“ — Der eine Beamte lächelte ungläubig. Ich fuhr fort: „Herr Anton Töns aus Essen a. d. Ruhr“ — Jetzt grinsten alle drei und sahen sich an, als wollten sie sagen: „Verstehste, das sollen wir glauben.“ — Ich fuhr unbeirrt fort: „Der Ihnen sicherlich bekannte deutsche Dichter Karl Theodor Timm“. — Hier unterbrach mich der Beamte erregt und sagte:
„Es genügt. Wir sind im Bilde! Daß man im Tiergarten neuerdings wilde Spielklubs errichtet, ist uns bekannt. Daß man sich aber die Namen bekannter Persönlichkeiten zulegt und durch ein äußerst raffiniertes Inserat Mädchen anlockt, das ist in meinem Revier neu.“
„Sie zweifeln an der Richtigkeit meiner Angaben?“ fragte ich.
„Die polizeilichen Meldungen der Herren, wenn ich bitten darf.“
„Sie wohnen erst seit gestern bei mir und sind daher noch ...“
„... nicht gemeldet,“ fiel er mir ins Wort. „Ich bin im Bilde.“
„Und Sie? Wer sind Sie?“ fragte er mich.
„Ich bin der ebenfalls nicht ganz unbekannte Schriftsteller Peter Lenz.“
Die drei Beamten sahen sich an.
„Kenn’ ich nicht!“ sagte der Führer. „Was schreiben Sie denn?“
Auf dem Tisch lag unglücklicherweise ein Roman von mir: „Frau Dirne“. Der eine Beamte hatte ihn bereits in der Hand und reichte ihn seinem Vorgesetzten. Der warf einen Blick darauf und sagte:
„Stimmt alles genau! Das Buch wird beschlagnahmt. Es enthält sicherlich Material“ —
Dann wandte er sich wieder an mich und forderte ziemlich barsch:
„Ihre Geschäftsbücher!“
„Ich führe keine.“
„Ich verstehe, Sie wollen Ihre Abnehmer schützen. Nützt Ihnen nichts! Die Haussuchung wird sie schon zutage fördern.“
„Ja, für was halten Sie uns?“ fragte ich.
„Das ist doch klar!“ sagte Töns.
„Nämlich?“
„Für Mädchenhändler!“ — Wir lachten so laut und so ehrlich, daß die Beamten stutzig wurden.
„So weist euch doch aus!“ bat ich. Und Töns zeigte seinen Paß, bei dessen Lektüre das Gesicht des Beamten lang und länger wurde. Auch Etville wies ein paar Mitgliedskarten der ersten Klubs vor, Burg zeigte Zeugnisse aus fürstlichen Häusern, Timm begann seine Novelle: „Die Mücke“ aus dem Gedächtnis vorzutragen, und der Beamte machte, von alledem beeindruckt, eben Anstalten, sich zu berichtigen, als seine Untergebenen, die inzwischen ein paar Zimmer durchsucht hatten, mit Stößen von beschriebenem Papier und kostbaren Toilettengegenständen zurückkehrten.
„Hier sind die Geschäftspapiere,“ sagte der eine.
„Was steht drauf?“ fragte der Beamte unsicher, nahm ihm ein Blatt aus der Hand und las:
„Isis mit den weißen Büsten, den kastanienbraunen Augen, mit den blonden Hängezöpfen, die so gut für Liebe taugen ...“
„Das ist ja furchtbar,“ sagte der Beamte. „Aber das entlastet Sie — wenngleich diese Toilettengegenstände ...“ und er nahm seinem Kollegen ein paar kostbare Schildpattkämme, ein Haarnetz und einen goldenen Taschenspiegel, auf dessen Rückseite ein kleiner Hase aus Brillanten war, aus der Hand — „den Verdacht nahelegen, daß hier nicht nur gebetet und gedichtet wird.“
In dieser kritischen Phase begann auf der Treppe ein Schreien und Toben. Die starre Mauer der wartenden Frauen kam in Fluß.
„Platz für Po Gri!“
schrie kreischend eine Stimme, und eine elegante, schöne Frau kämpfte sich durch die Fäuste und Ellenbogen von Hunderten, die ihr den Weg versperrten, bis zur Flurtür durch, an der Nitter und Burg durch freundliche Ansprachen seit ein paar Stunden die neu Harrenden zur Geduld mahnten.
Im selben Augenblick stand Po Gri auch schon zwischen uns und den Beamten. Das kostbare Kleid hing in Fetzen, die Reiher waren ihr vom Hut gerissen, die langen, perlgrauen Schweden waren mit Blut gefärbt.
„Wo ist Rolf?“ brüllte sie, und wir alle wichen ein paar Schritte zurück. — Sie sah die Beamten: „O gut! gut! Sie werden mir helfen! Heute noch muß sie über die Grenze! diese ...“ Dabei riß sie dem Beamten den Haarkamm aus der Hand, führte ihn an die Nase und rief: „Ich habe sie! ...! Also hier hält sich die saubere Person versteckt!“ — Und zu mir gewandt, fuhr sie fort: „Dazu also haben Sie Rolf aus dem Hotel verschleppt“ — die Beamten horchten auf — „um ihn hier mit dieser ... Person zu verkuppeln.“ — Die Beamten betrachteten mich genauer. Ich versicherte, ohne gegen Po Gris Stimme durchzudringen, daß ich von diesen nächtlichen Rendezvous bis zur Entdeckung dieser untrüglichen Beweisstücke keine Ahnung hatte — Po Gri schwang schon den goldenen Spiegel und raste: „Eine Po Gri betrügt man nicht!“ — Und während sie weiter tobte, brachte sie sich vor dem goldenen Spiegel hastig in Ordnung, legte rot auf, puderte sich, riß dann einem der Beamten das Haarnetz aus der Hand und raste mit dem Ruf: „Ich werde sie finden!“ durch die Wohnung.
Vor dem Hause und auf den Treppen war die Stimmung umgeschlagen. Laute Hoch- und Bravorufe aus vielen hundert Frauenkehlen erweckten unsere Neugier. Töns ging ans Fenster. Unten war Rolf in seinem Auto vorgefahren. In dem hochgewachsenen, eleganten Rolf hatte man sofort „den Herrn, der die Dame suchte“, erkannt. Bei seinem Anblick wuchs der Wunsch, den Posten zu erringen, ins Ungemessene. Zarte Frauenhände hoben ihn, trugen ihn unter dem Beifallgeklatsche der anderen die Treppe hinauf und setzten ihn vor uns nieder. Rolf, gewöhnt, von Frauen verwöhnt zu werden, lächelte und grüßte nach allen Seiten. Als er wieder Boden unter den Füßen spürte, gab er mir die Hand und erklärte:
„Ich muß sagen, mir gefällt es sehr gut bei dir.“
„Tatsächlich!“ stimmte Töns ihm bei: „Hier ist noch mehr los als im Esplanade.“
Plötzlich schrie in der hinteren Wohnung eine Frau laut auf.
„War das nicht Häslein?“ fragte Rolf erschrocken. Gleich darauf hörte man ein schallendes Geräusch, das wie Ohrfeigen klang.
„Waren das nicht Po Gris angebetete Hände?“ fragte ich.
Rolf wankte.
„Sie ... ist ...?“
Ich wies zur Tür und sagte:
„Seit ein paar Minuten. Und obschon es ihr nicht leicht fiel, hinaufzukommen, so fürchte ich doch, daß es noch schwieriger sein wird, sie wieder hinauszubefördern.“
Die Beamten gingen dem Schrei der beiden Frauen nach, während Rolf die Damen, die ihn hinaufgetragen hatten, jetzt vergebens zu bestimmen suchte, daß sie ihn wieder hinunterbrachten.
Ich bat Timm, zur allgemeinen Beruhigung von der Flurtür aus ein paar Gedichte vorzutragen. Da er ablehnte, blieb mir nichts anderes übrig, als die Feuerwehr zu alarmieren. „Menschenleben in Gefahr!“ meldete ich. Nach etwa fünf Minuten fuhren drei Wagen vor, wurden die Spritzen angesetzt, ergoß sich ein Meer von Wasser durch die Haustür, über die Treppen, in die Zimmer — schwammen die Beamten mit Po Gri und Häslein um die Wette, während wir dank dem fürsorglichen Burg hinter festverschlossenen Türen und Fenstern diesem seltenen Schauspiel zusahen.
Nur die erschöpfte Stimme des höheren Beamten vernahm ich noch, der seinem Kollegen zuprustete:
„Dies Haus werden wir jedenfalls im Auge behalten.“
Nichts konnte mir in einer Zeit, in der Mord, Totschlag und Einbrechen an der Tagesordnung waren, willkommener sein.
Drittes kapitel
Am Abend dieses Tages glich meine Wohnung einem Zirkus unter Wasser, und ich, der beneidete Inhaber der vielumstrittenen Tiergartenvilla, hätte mit jeder trockenen Dreizimmerwohnung in einem Gartenhaus getauscht.
Ich rechnete damit, daß meine Freunde ein Einsehen und Verständnis für meine verzweifelte Lage haben würden.
„Drei von euch müssen hinaus,“ sagte ich, „und wenn ich einen Wunsch äußern darf, so wäre mir am liebsten, wenn Etville bleibt. Er ist der ruhigste und hat am wenigsten Anhang.“ Aber Rolf und Töns dachten gar nicht daran. Rolf meinte:
„Ich ärgere mich den ganzen Tag über so viel in meinem Beruf, daß ich diese Erholung des Abends geradezu nötig habe.“
„Erholung nennst du das?“ fragte ich empört.
„Gewiß! Ich habe mich den ganzen Winter über in keinem Theater und auf keiner Gesellschaft auch nur annähernd so gut unterhalten wie in den vierundzwanzig Stunden unter deinem Dach.“ Und Etville erklärte strahlend:
„Ich bin so gespannt, wie sich das hier weiter entwickelt, daß ich entschlossen bin, meine Reise nach Amerika aufzugeben. Nur, um hier nichts zu versäumen.“
Meine letzte Hoffnung war Timm. Ich trat an ihn heran und sagte:
„Aber du, Karl Theodor, du fühlst mit mir!“
„So sehr,“ erwiderte der, „daß es unfreundschaftlich von mir wäre, wenn ich dich in dieser Lage verlassen würde.“
Mithin blieb nichts anderes übrig, als die Versuche, Ordnung in dies Chaos zu bringen, fortzusetzen. Daß dazu nur eine Frau imstande war, stand für mich fest. Daß diese Frau unter den Unzähligen war, die sich anboten, war durchaus nicht sicher. Denn wie viele gab es denn, die all die Eigenschaften in sich vereinten, die dieser Posten erforderte? War aber wirklich eine darunter, so mußte man mit hellseherischer Kraft begabt sein, um sie aus diesen Bergen von Briefen herauszufinden.
Wir saßen ratlos vor einer unlösbaren Aufgabe. Die erste Hilfe leistete uns gesunder Fraueninstinkt. Frida erlaubte sich den Vorschlag, zunächst einmal alle die auszuscheiden, die an den Antritt die Bedingung knüpften, daß bei gegenseitigem Sichverstehen spätere Ehe nicht ausgeschlossen sei. Damit wanderte bereits mehr als ein Drittel in den Papierkorb. Auf Töns Rat hin schieden sodann alle die aus, die sich selbstgefällig anpriesen oder deren Bewerbungen nach schlechten Parfümen rochen. Damit war das zweite Drittel erledigt. — Ich führte den Gedankengang von Töns weiter und suchte aus dem Drittel, das übrigblieb, diejenigen heraus, die in irgendeiner Form Bedenken äußerten, ob sie dieser ungewöhnlichen Aufgabe auch wirklich gewachsen wären. Denn, sagte ich mir, wer ohne jede Hemmung nach diesem Posten, der auf alle Fälle ein Experiment blieb, greift, war ohne Verantwortungsgefühl oder litt an Größenwahn.
Diese von uns gestellten Forderungen erfüllten im Ganzen nur sechs Bewerberinnen, von denen wir uns schließlich für die folgende entschieden: Auf einem weißen, starken Kartenbrief mit Wappen stand in Schriftzügen, die Energie verrieten:
„Falls Ihr guter Wille so groß ist wie meine Entschlossenheit, habe ich den Mut, Posten zu übernehmen. Früher Tod der Eltern stellte mich unter jüngeren Geschwistern in unserem Majorat vor ähnlich schwierige Aufgabe, die ich einigermaßen zufriedenstellend gelöst zu haben glaube. Meine Jugend und mein Aeußeres sind nicht überwältigend.
Baronin Inge von Linggen,zur Zeit Schloß Berg am Anger, Steiermark.“
Diese Bewerbung, die durchaus nicht ungeteilten Beifall fand, war zugleich eine der kürzesten.
„Das wird eine nette Vogelscheuche sein!“ meinte Timm.
„Macht nichts! — für das Auge ist gesorgt,“ erwiderte Töns und sah dabei Frida an.
Ueber ihr vermutliches Alter entspann sich ein Streit. Am höchsten schätzte Rolf, der meinte, sie werde so um die Fünfzig herum sein, während Burg, in dem ich so eine Art Betriebsrat sah und dem ich daher den Brief zeigte — denn die Besetzung dieses Postens betraf die Dienerschaft mehr als uns — mit erstaunlicher Bestimmtheit erklärte:
„Höchstens achtundzwanzig.“
„Das ist zu jung!“ meinte Frida. „Wir müssen doch Respekt haben.“
Rolf schlug vor, telegraphisch ein Bild zu fordern, das die meisten eingelegt hatten, und nach dem Alter zu fragen.
„Dann lehnt sie ab,“ sagte ich und setzte durch, daß wir ihr telegraphierten:
„Erwarten Sie so bald als möglich.“
Wir hatten in diesem Augenblick wohl alle das Gefühl, daß Frau von Linggen als Persönlichkeit wichtiger war als jeder einzelne von uns. Denn mit diesen sechs Worten begaben wir uns, zum mindesten innerhalb unserer vier Wände, des Rechts, zu tun und zu lassen, was wir wollten. Jeder von uns hatte eingesehen, daß das Spiel des Lebens ohne die Hand eines Regisseurs in diesem Hause unmöglich war. Diese Erkenntnis und das vielleicht überhebliche Gefühl, dank Instinkt und Intelligenz von Tausenden die Vollkommenste gewählt zu haben, sicherte Frau von Linggen von vornherein ein Prestige, ohne das ihr Posten aussichtslos gewesen wäre. Und als nach Verlauf von zwei weiteren unruhigen Tagen und Nächten Burg mir eines Vormittags weit förmlicher als sonst meldete:
„Baronin von Linggen wünschen Herrn Doktor zu sprechen,“ da sah ich ihn nur an und las aus dem Ausdruck seines Gesichts und seiner Haltung, daß sie die Richtige war.
In einem langen Sealskinmantel, ebensolcher Mütze, elegantem Schleier, schwarzen Schweden, Lackschuhen und hohen Gamaschen trat eine schlanke Dame mit schmalem, blassem Gesicht, großen braunen Augen und dunkelblondem Haar ins Zimmer.
Ich hatte mir gedacht, wie schwer ihr wohl ums Herz sein würde, wenn sie zum ersten Male die Schwelle dieses Junggesellenheims betrat. Ich sah sofort, ich hatte mich geirrt. Sicher, als wenn sie seit Jahren hier ein- und ausginge, trat sie ein. — Mein zweiter Gedanke war: Sie ist reichlich hübsch und elegant. — Und als wir uns gegenüberstanden und ich ihr die Hand reichte, dachte ich: Sie weiß, was sie will.
Ich machte ein paar Redensarten, daß ich mich freue und hoffe und so weiter — und sah an dem Ausdruck ihres Gesichtes, daß sie, was ich sagte, nicht gerade besonders originell und klug fand.
Etville, der hinzukam, stutzte, als er sie sah, war aber im selben Augenblick auch schon Herr der Situation und sagte:
„Gnädigste sind hier in eine nette Räuberbande geraten.“
Sie erwiderte lächelnd:
„Ich fürchte mich nicht.“
Ich forderte sie auf, sich zu setzen und begann, ihr die Situation so schonend wie möglich zu schildern. Sie hörte gespannt zu. Als ich auf die Schwierigkeiten hinwies, die in der so verschiedenen Lebensführung der einzelnen Bewohner lag, meinte sie:
„Das ist Sache der Regie!“
Sonderbar! dachte ich. Ob sie wie ich das Leben als ein nicht eben kurzweiliges Theater faßt? — Als ich die Existenz von Po Gri, Häslein, Lola und die Möglichkeit, daß sie in die Erscheinung traten, streifte, verzog sie keine Miene. Ich suchte sie durch etwas weiteres Ausspinnen zu bewegen, Stellung zu nehmen, und sagte:
„Sie werden verstehen, Baronin, wie peinlich es mir ist, von diesen Dingen zu reden — aber sie müssen nun einmal besprochen werden.“
„Ich bin anderer Meinung,“ erwiderte sie. „Wenn man derartige Dinge taktvoll behandelt, braucht man kein Wort über sie zu verlieren. Läßt man es aber an dem nötigen Takt fehlen, so sind sie indiskutabel. Also schweigen wir.“
„Sehr richtig!“ stimmte Etville zu. „Mir ist ein Hochstapler mit guten Manieren lieber als ein Prolet mit Bomben-Charakter. Takt ist alles!“
„Wenigstens bei ungewöhnlichen Verhältnissen wie hier,“ erwiderte die Baronin. „Und darum ...“ Sie hielt inne und sah Etville und mich prüfend an.
„... möchten Sie wissen, ob wir Takt haben.“
„Ja!“ sagte sie glatt heraus. „An diese Bedingung möchte ich meinen Eintritt knüpfen.“
Etville, der in Gedanken schon Besitz von ihr ergriffen hatte, erschrak.
„Und in welcher Zeit“, fragte ich, „können Sie das feststellen? Dazu gehören vermutlich doch Wochen.“
„Augenblicklich,“ erwiderte sie. „Darf ich Sie bitten, mich den anderen Herren vorzustellen?“
Ich läutete. Wie stets, kam niemand.
„Viel Eindruck scheint es nicht zu machen,“ meinte Frau Inge.
„Was erwarten Sie, Baronin!“ erwiderte ich. „Beim erstenmal? — Das werden auch Sie nicht hineinbekommen —“ — Ich drückte ein zweites, ein drittes Mal auf den Knopf — und als ich eben, mehr aus Gene vor Frau Inge, die den Kopf senkte und zu lächeln schien, als aus Ueberzeugung, empört tat und hinausgehen wollte — da öffneten sich zu meinem Erstaunen alle vier Türen zugleich, und Burg, Fräulein Fleck, Nitter und Frida erschienen und fragten:
„Hat’s hier geklingelt?“
„Ja!“ erwiderte ich ... „Und zwar dreimal.“
„Ich dachte ...“ sagte jeder, und auf die Frage, was sie dachten, stellte sich heraus, daß sich wie üblich einer auf den anderen verlassen hatte.
„Sagen Sie den Herren, Frau Baronin von Linggen sei da! Sie möchten nach vorn kommen.“
Als erster erschien, eben dem Bad entstiegen, in langem, seidenem Schlafrock, Rolf. Er hatte die Klinke der Tür noch in der Hand, streifte Frau Inge nur mit einem Blick, fuhr ruckartig zurück, sagte:
„Verzeihung.“
und verschwand wieder.
„Gut!“ sagte Frau Inge, und ich erwiderte:
„Das fand ich auch.“
In der mittleren Tür, zu der wir mit dem Rücken saßen, erschien Töns und schob Frida, die sich eine Haushälterin ganz anders vorgestellt hatte und nun mit weitaufgerissenen Augen dastand und sie anstarrte, zur Seite, trat näher, lächelte verbindlich, sagte:
„Ah! die Baronin!“
beugte den Kopf und küßte ihr die Hand.
Ich stellte vor und fügte hinzu:
„Mit ihm werden Sie am wenigsten Mühe haben.“
„Ich hoffe, im Gegenteil, Baronin, Ihnen Mühen abnehmen zu können,“ erwiderte Töns und setzte sich mit einer kurzen Verbeugung zu Inge. Im selben Augenblick erschien Rolf, der sich mit Hilfe des Dieners schnell angezogen hatte.
„Ich hatte ja keine Ahnung ...“, sagte er und begrüßte sie in der gleichen Form wie Töns.
„Wovon hatten Sie keine Ahnung?“ fragte Frau Inge, obschon sie wie wir wußte, was gemeint war. Denn wenn er sich auch von Frau Inge ein anderes Bild als Frida gemacht hatte — so hatte er sie sich bestimmt nicht vorgestellt. Und daß ihn der Takt davon abhielt, ihr in dem kostbaren Seidenmantel gegenüberzutreten, dessen Zweck es grade war, auf Frauen zu wirken, zeigte deutlich seine Einstellung.
Rolfs nicht einfache Antwort auf Frau Inges Frage lautete:
„Daß Sie es sind.“
Sie lächelte und meinte:
„Das besagt nicht viel.“
Schließlich erschien auch Karl Theodor Timm. Er trug ein blauseidenes Hausjackett und die Scherbe im Auge.
„Schau an!“ sagte er, noch ehe ich ihn vorstellen konnte. „Sie also sind von Linggen?“ — Er besah sie etwa, wie man ein neues Stück Möbel betrachtet, von dem man weiß, daß man es täglich ein paarmal zu Gesicht bekommen wird.
Jetzt erst nannte ich seinen Namen.
„Ich weiß,“ sagte sie. „So ein Gesicht vergißt man nicht — zumal, wenn man ihm im Ausland begegnet. — War es nicht in Buenos Aires? — Oder ...? Halt! es kann auch zwei Jahre später in Yokohama gewesen sein.“
„Schon möglich!“ erwiderte Timm. „Was hatten Sie denn in Yokohama zu suchen?“
„Ich begleitete meinen Vater in einer diplomatischen Mission. Leider war ich noch ein halbes Kind und habe daher nicht viel davon gehabt.“
„Und nach Yokohama ausgerechnet zu uns?“ fragte Timm grinsend.
„Dazwischen liegt mancherlei,“ erwiderte Inge.
„Und nicht viel Angenehmes,“ ergänzte ich, in der Hoffnung, dem Gespräch eine andere Richtung zu geben. Aber Timm war wißbegierig:
„Immerhin von Yokohama bis zu uns ist ein weiter Weg.“
„Den ich Ihnen später vielleicht einmal erzählen werde,“ entgegnete Frau Inge. „Im Augenblick aber nicht.“
Ich erklärte, daß dazu auch keinerlei Veranlassung vorläge und daß für uns viel wichtiger wäre zu erfahren, ob sie nach nunmehriger Inaugenscheinnahme der fünf Junggesellen bereit sei, den ihr angetragenen Posten zu übernehmen.
Inge antwortete zunächst ausweichend:
„In einem Punkte will ich die Wißbegier Meister Timms befriedigen. Was allein im Leben für mich noch Reiz hat“, — wir horchten auf, Etville ganz besonders — „ist der Versuch oder der Sport — oder wie sonst Sie es nennen wollen — ungewöhnliche Situationen zu schaffen und ihrer Herr zu werden.“
„Dann sind Sie am richtigen Platz,“ sagte Rolf — weniger aus Ueberzeugung als aus dem Wunsch heraus, Frau Inge zu halten.
„Das Inserat hatte jedenfalls diese Wirkung. Nachdem ich nun das Vergnügen habe, Sie zu kennen“ — sie zögerte und fuhr dann fort und fragte: — „Darf ich offen sein?“
„Bitte!“ sagten wir.
„Nun, ein wenig an Reiz hat es für mich verloren.“
Wir machten alle fünf die denkbar dümmsten Gesichter, Karl Theodor Timm fiel sogar die Scherbe aus dem Auge. Nur Töns lachte laut und meinte:
„Sie haben uns aber schnell erkannt.“
„Das ist es!“ gab sie zu. „Viel zu schnell! Und das macht die Erfüllung meiner Erwartungen nicht grade wahrscheinlich.“
„So uninteressant sind wir Ihnen?“ fragte Timm.
„Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen,“ wich sie aus, „daß einer von Ihnen mich vor eine Situation stellt, die mir Kopfzerbrechen macht. — Wirklich nicht, Herr Timm! Selbst wenn Sie mich eines Tages bitten sollten, Ihnen bei der Zelebration der schwarzen Messe zu assistieren.“
Karl Theodor lächelte verächtlich und sagte:
„Ueber derart harmlose Vergnügungen bin ich längst hinaus.“
„Und doch bezweifle ich, daß Sie imstande sind, das einzige, wovor ich mich im Leben fürchte — und was ich oft schon glotzend wie ein Reptil heranschleichen sehe, von mir zu bannen: die Langeweile. Sobald die den Rachen aufreißt, um mich zu verschlingen, rette ich mich in ein besseres Jenseits.“
„Sie suchen also Sensationen?“ fragte Rolf.
Frau Inge sagte:
„Ja und nein! Es läßt sich schwer sagen! Denn es gibt kein Programm. Es sei denn, daß ich die Dummheit um jeden Preis fliehe, selbst da, wo sie mit Bergen Goldes und dem Paradies auf Erden lockt.“
„So dumm sind wir nicht, daß Sie vor uns zu fliehen brauchen,“ beteuerte ich.
„Jedenfalls möchte ich nicht, daß Sie mich falsch verstehen. Ein Gedicht wie ‚Weich küßt die Zweige der weiße Mond‘ oder ‚Ueber allen Gipfeln ist Ruh‘ bewegt mich viel stärker als Dantes ‚Hölle‘ oder Grünewalds ‚Kreuzabnahme‘.“
„Dann haben Sie keine Chancen, Timm!“ sagte Rolf, und der blonde Arier Karl Theodor fuhr sich mit der Hand durch das seidenweiche Haar, verzog den Mund und sagte:
„Nebbich!“
Ich fühlte, daß diese Zwiesprache Frau Inge in ihrer Absicht, zu bleiben, nicht grade bestärkte.
In diesem Augenblick erschien Burg und gab Etville durch ein kaum merkbares Zeichen zu erkennen, daß er ihn zu sprechen wünsche.
Etville wollte aufstehen, aber ich hielt ihn zurück und sagte:
„Warum? Es ist doch besser, daß die Baronin gleich die Gewohnheiten des Tags kennenlernt.“ —
„Auto oder Nachtlokal?“ fragte Töns.
Burg verzog keine Miene.
„Sag ihm doch, er soll reden!“ bat ich Etville. — Der wandte sich an Burg und sagte:
„Also!“
„Dreihundertachtundsechzigtausend Mark,“ las Burg von einem Zettel.
„Sie hatten schon teurere Nächte!“ sagte Timm und hätte noch mehr gesagt, wenn ihn nicht ein vernichtender Blick Burgs verblüfft hätte.
„Es handelt sich um Wäsche für Bister,“ fuhr Burg fort, ohne Timm eines Blickes zu würdigen, und während Etville den Scheck ausschrieb, sagte er: „Es tut mir leid, aber die Rechnung war quittiert.“ — Und dabei ließ er den Zettel, dem jeder von uns schon rein äußerlich das Nachtlokal ansah, in seiner Rocktasche verschwinden.
„Darf ich wissen, wer Sie sind?“ fragte Frau Inge.
Burg wartete einen Augenblick ab, ob Etville antworten würde, und da der schwieg, so sagte er:
„Ich bin der persönliche Diener des Baron Etville.“
Ich merkte, daß Burgs Takt manchen Fehler von uns ausglich, und schöpfte wieder Hoffnung, daß sie bleiben würde. Und in der Tat sagte sie, während sich Burg diskret zurückzog:
„Ja, meine Herren, Sie kennen mich nun, und ich kenne Sie. Falls Sie also glauben, daß ich hier am Platze bin ...“
„Sie wollen also?“ riefen wir gleichzeitig; nur Karl Theodor grinste und schwieg.
„Nun, Herr Timm?“ fragte Frau Inge, und er erwiderte:
„Ich bin mit allem einverstanden.“
„Sie bleiben!“ riefen wir und sprangen auf. Und einer nach dem andern drückte ihr die lange, schmale Hand, von der sie die schwarzen Schweden gezogen hatte. Auf dem dritten Finger trug sie einen in Platin gefaßten Smaragd von vollendeter Reinheit.
Während ich Champagner kommen ließ, lud Etville sie für den Abend in die Oper, Rolf in die Skala ein, während Töns erklärte:
„Die dummen Theater! Kommen Sie lieber mit mir was zu Pelzer.“
Frau Inge lachte und lehnte alles ab.
„Das ist ja ein Tempo, meine Herren! — Ich bleibe heute und morgen bei meiner Tante ...“
„Was für einer Tante?“ fragte Timm.
„Sie kennen sie vielleicht. Sie schreibt auch, Gräfin Benz.“
„Timm schreibt nicht,“ berichtigte Töns. „Karl Theodor dichtet.“
„Ich glaube doch, ich bin dem Posten nicht gewachsen,“ erwiderte Frau Inge.
„Was haben Sie nun mit uns vor?“ fragte Timm freundlich. „Zu was wollen Sie uns bekehren?“
„Zu Menschen!“ erwiderte Frau Inge.
„Gott! wie langweilig!“ rief Timm, und ich fragte:
„Für was halten Sie uns denn jetzt?“
„Für nichts dergleichen. Sie sind einfach Objekte derjenigen gesellschaftlichen Sphäre, in der Sie leben, wirken oder in irgendeiner Form eine Rolle spielen wollen. — Sehen Sie, Herr Timm, und das finde ich langweilig.“
„Und wenn diese Sphäre die Welt ist?“ fragte der.
„Dann müßten Sie ein Genie, also ein Goethe oder Napoleon sein.“
„Stimmt!“ sagte ich. „Für uns gewöhnliche Sterbliche ist Größe schon, jede Pose abzulegen und natürlich empfindende und natürlich sich gebende Menschen zu sein.“
„Die wir ausnahmslos nicht sind,“ beteuerte Töns, und ich sagte:
„Also wäre es eine Aufgabe!“
„Ein Versuch,“ verbesserte Frau Inge, und Töns fügte hinzu:
„Am untauglichen Objekt.“
„Nicht bei allen,“ meinte Frau Inge und sah uns der Reihe nach an, ohne daß wir errieten, wen sie meinte.
„Darf ich bitten, mit mir zu beginnen,“ sagte ich. — Die gleiche Forderung stellten die andern, und Frau Inge erwiderte:
„Das geschieht mit allen gleichzeitig, ohne daß Sie es merken —“
Timm fragte:
„Gedenken Sie uns als Hotel oder als Familie zu behandeln?“
„Ich sagte doch schon: ‚als Menschen‘,“ erwiderte sie, woraufhin er meinte:
„Na, das kann ja nett werden!“
In diesem Augenblick erschien wieder Burg; wenn möglich noch genierter als das erstemal. Diesmal fragte Frau Inge:
„Nun, was gibt’s?“
„Ich hätte gern einen der Herren ...“
„Das war einmal!“ erklärte Frau Inge. „Von heute ab wenden Sie sich mit allem, was dies Haus angeht, zuerst an mich.“
„Mit allem?“ fragte Burg und schien entsetzt, um so mehr als Frau Inge wiederholte:
„Ausnahmslos mit allem.“
„Ja ... aber ...“, warf ich ein — „es gibt doch Dinge ...“
„Und was für Dinge!“ versicherte Töns. „Ganz unmöglich!“
„Nein, meine Herren!“ erwiderte Frau Inge. „Es gibt nichts, was nicht durch taktvolle Behandlung einer Frau möglich wäre.“
„Na, Baronin, da werden Sie hier bald umlernen,“ erklärte Timm.
„Also!“ wandte sie sich energisch an Burg. „Was gibt’s?“
„Eine junge Dame ...“
„... wünscht wen zu sprechen?“ fragte Frau Inge, da Burg vor Scheu nicht weitersprach.
„Mich wahrscheinlich,“ sagte Etville.
„Es kann auch für mich sein,“ meinte ich kleinlaut. Rolf sah nach der Uhr und rief:
„Teufel ja! das ist am Ende schon Häslein.“