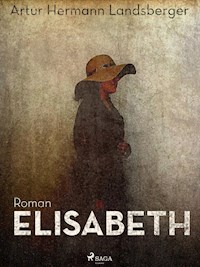Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schwer verstört kommt Peter Reinhart aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Eine neue Liebe würde ihn vielleicht von seinen anfallsartigen Erinnerungen befreien, rät der Arzt seiner Mutter, als sie ihren Sohn nach langen Jahren wiedersieht. Die Geheimrätin denkt an Margot, das etwas ungehobelte, vorlaute Mädchen, das einmal als Ersatzbraut für Peter gedacht war. Peters eigentliche große Liebe Aenne hatte sie nicht für standesgemäß gehalten und Peter weit weg nach Südafrika geschickt. Seit Aennes Tod fühlt sie sich schuldig. Margot, die damals gerne auf eine Fern-Verlobung per Foto einging, hat tatsächlich Jahre auf die gesellschaftlich lukrative Verbindung gewartet. Immer noch fegt ihr unkonventionelles Wesen über alle gesellschaftlichen Umgangsformen hinweg. Sie erobert Peter im Sturm. Doch wieder trennt die Geheimrätin die Liebenden, wenn auch diesmal aus Sorge um das junge Mädchen. In drei Teilen erzählt das bewegende Buch –eine Fortsetzung von Landsbergers Roman "Um den Sohn" – von einer unmenschlichen Gesellschaft und dem ungewöhnlichen Weg zweier Liebender zueinander.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Artur Hermann Landsberger
Wie Satan starb
Roman
Saga
Ebook Kolophon
Artur Hermann Landsberger: Wie Satan starb. © 1919 Artur Hermann Landsberger. Originaltitel: Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2015 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen 2015. All rights reserved.
ISBN: 9788711488393
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com.
Dem Andenken meines Vaters
Erster Teil
I
Johann, der bis zum August 1914, wie seine Vorgänger im Hause Reinhart zweihundert Jahre lang, Jean gerufen wurde, sass im Anrichteraum und putzte Silber.
„Das Telephon!“ rief er ins Nebenzimmer, und Lissi, die schmucke Kammerzofe, fuhr aus ihren Nachmittagsträumen auf und trippelte an den Apparat.
Sie nahm den Hörer ab, betrachtete sich im Spiegel, der gegenüber an der Wand hing, brachte mit der freien Hand ihr Haar in Ordnung und sagte verschlafen:
„Hier bei Frau von Reinhart!“
„Meine Schwester! Schnell meine Schwester!“ forderte die Stimme eines Mannes.
„Wen wünschen Sie zu sprechen?“ fragte Lissi gleichgültig und steckte sich ein Löckchen hoch.
„Zum Teufel ja! meine Schwester!!“ tönte es ungehalten in dem Apparat, und Lissi erwiderte, ohne den Tonfall zu ändern:
„Wen, bitte, darf ich melden?“
„Kreuz Himmel! sind Sie noch immer am Apparat? So laufen Sie doch!“
„Die Frau Geheimrat schläft um diese Zeit.“
Inzwischen war Johann, ohne dass Lissi es bemerkte, aufgestanden und öffnete schon die Tür zu dem Zimmer, in dem Frau von Reinhart schlief. Ganz leise trat er ein, beugte den steifen Rücken behutsam über die Chaiselongue und sagte mit gedämpfter Stimme:
„Gnädige Frau.“ — Frau von Reinhart schlug die Augen auf. — „Herr Generalarzt Wolf.“
Frau von Reinhart richtete sich auf.
„Wo?“ fragte sie lebhaft. „Um diese Zeit?“
Johann half ihr auf und sagte:
„Am Apparat.“
Und während die alte Dame sich in grosser Hast in Ordnung brachte, wiederholte sie:
„Um diese Zeit! — Da muss doch etwas passiert sein.“
„Frau Geheimrat müssen nicht immer gleich etwas Schlimmes denken.“
„Ich bitt’ Sie, Johann,“ erwiderte sie erregt, „das tut mein Bruder doch nie! wo er weiss, ich schlafe.“
„Er ist eben sehr beschäftigt.“
„Jean! Jean!!“ rief Frau von Reinhart plötzlich und sah ihn starr und erschreckt an.
„Was meinen Sie?“ fragte Johanns Blick, und Frau Julie von Reinhart entfärbte sich, beugte sich nach vorn und sagte:
„Am Ende gar ... mein Junge!“
Da erschrak auch Johann, reichte der alten Dame den Arm, riss die Türen auf und nahm dem schmucken Mädchen Lissi, das mit rotem Kopf eben wütend mit dem Fuss auftrat und in den Apparat rief:
„Nein! Ich wecke sie nicht!“ den Hörer ab und reichte ihn der Frau Geheimrat.
„Schnell einen Stuhl!“ rief er der verdutzten Lissi zu und stützte Frau Julie, die vor Zittern kaum den Hörer halten konnte.
Mit schwacher Stimme rief sie in den Apparat:
„Ja! ... Martin ... Ich bin’s!“
„Endlich!!“ klang es erlöst. Und gleich darauf trafen sie wie ein elektrischer Schlag, der ihr in alle Glieder fuhr, die Worte: „Freu dich!“
Frau Julie sank auf den Stuhl. Aber sie liess den Hörer nicht los, umpresste ihn fest und sagte:
„Was denn?“
„Er ist da!“
„Martin!!“ schrie Frau Julie laut und liess den Hörer fallen. Der ganze Körper zuckte krampfhaft, leise schluchzende Töne stiegen aus ihrem Inneren auf, sie lächelte eine Zeitlang vor sich hin, dann sagte sie, die Augen weit aufgerissen:
„Junge! — Peter! mein Junge!“ und verfiel, — sie, die sünfundsechzigjährige, beherrschte Frau, die in ihrem langen Leben niemals vor Dritten gezeigt hatte, was sie bewegte — schliesslich in ein langanhaltendes befreiendes Lachen.
Johann hatte in den Apparat gerufen:
„Frau Geheimrat ist so bewegt — Sie hören es wohl, Herr Generalarzt? Vielleicht, dass Sie doch lieber selber kommen — und sie beruhigen.“
Aber Frau Julie, dir noch immer hell wie ein junges Mädchen lachte, schüttelte den Kopf und sagte:
„Mich braucht niemand zu beruhigen und ich brauche keine Aerzte! — Nun nicht mehr!“ — Und dann liefen ihr die dicken Tränen über die Wangen und sie schluchzte selig: „Peterle! mein Peter! — Ach Gott! wie ist das Leben schön! — Josef, mein lieber guter Mann! du musst es wissen! ich bin nicht mehr allein! Er lebt! Unser Junge, unser Einziger! er lebt! er ist da! — Dir danke ich ja das grosse Glück, den Jungen! Guter, lieber Josef, dass du das nicht miterlebst, die Freude! — Zehnfach, hundertfach stärker als vor fünfundzwanzig Jahren, als ich ihn dir schenkte, bester Mann!“
Dann stand sie auf, lehnte sich an den alten siebzigjährigen Diener, der den Hörer noch immer in der Hand hielt und Frau Julie anstrahlte, und fragte:
„Was sagt er noch?“
„Er kommt. Er ist schon unterwegs.“
„Er kommt. Er ist schon unterwegs,“ wiederholte Frau Julie, die es auf ihren Sohn bezog. „Nach vier Jahren, Jean. Denken Sie! und unser guter Herr wird ihn nicht sehen. — Es ist zuviel Glück; zuviel Glück für eine alte Frau. — Jean, Jean, Sie guter Alter, was habe ich Sie gequält vier Jahre lang. Sie waren ja der Einzige, der wusste, wie mir ums Herz war. — Gewiss, auch meine Töchter haben mit mir gefühlt. Aber doch nicht so wie Sie! Die haben ihre Männer und ihre Kinder und ihre Pflichten. Und leben in einer Zeit, in der man anders denkt und fühlt. Aber ich und Sie, Jean, wir hatten ja nichts, seitdem der gute Herr tot ist, als nur ihn, den Einen. — Sagen Sie, Jean, haben Sie geglaubt, wenn Sie mich trösteten und mir immer wieder sagten: Sie werden sehen, Frau Geheimrat, der Peter kommt. Eines Tages, wenn Sie gar nicht daran denken, dann geht die Tür auf und er ist da — Hand aufs Herz, Jean, haben Sie das wirklich geglaubt?“
Jean schüttelte den Kopf.
„So recht geglaubt hab’ ich’s nicht. Aber ich hab’ mir gesagt: wie soll die Frau Geheimrat weiter leben ohne den Glauben?“
„Gut, dass Sie das taten. Wer weiss, was sonst aus mir geworden wäre! Denken Sie, er wäre zurückgekommen, und ich war nicht mehr am Leben. Wo der Junge so an mir hängt! Nun aber soll er eine lebensfrohe Mutter wiederfinden.“
„Herr Generalarzt Wolf,“ meldete der Diener.
„Willi!“ rief Frau Julie, streckte die Arme aus und erhob sich, während der Medizinalrat noch in der Halle stand und dem Mädchen Helm und Säbel reichte.
Der alte Medizinalrat lächelte, beeilte sich, nickte seiner Schwester zu und sagte schon in der Tür:
„Na also! Nun haben wir’n! endlich!“
Frau Julie schlang die Arme um seinen Hals und weinte. Der Alte drückte sie an sich.
„So Julie, Schwesterchen, da fühlt man mal wieder, wie man zusammengehört.“
Frau Julie drängten sich unzählige Fragen auf. Aber nach dem langen Leid wollte sie erst einmal ihr Glück geniessen. Und da fragte sie ihren Bruder zunächst nicht, in welcher Verfassung ihr Sohn sei und wann sie ihn wohl wiedersehen werde. Sie wiederholte nur immer:
„Also er lebt! — ist da!“
Und als der Medizinalrat sie fragte:
„Ja, willst du denn nicht mehr von ihm wissen?“ schüttelte sie den Kopf und sagte:
„Erst einmal lass mich das fassen, Martin.“
Und erst als sie eine Zeitlang ohne zu sprechen Hand in Hand neben ihrem Bruder, der wohl fühlte, was in ihr vorging, gesessen hatte, raffte sie sich plötzlich aus ihren glücklichen Gedanken auf, wandte sich zu ihm und sagte:
„So! und nun erzähle!“
Der Medizinalrat zog ein Telegramm hervor und sagte:
„Danach ist er morgen Nacht schon in Genf.“
„Dann war er womöglich schon jahrelang in Frankreich?“ fragte Frau Julie.
„Nein! Denn das hätten wir erfahren. Er ist vermutlich mit einem der letzten Afrikatransporte nach Europa gekommen und wird nun durch irgendeinen glücklichen Zufall ausgetauscht, noch ehe wir etwas dazu unternommen haben.“
„Und ...“ fragte Frau Julie zögernd — „darüber, wie es ihm geht, steht nichts in dem Telegramm?“
„Doch! wenigstens indirekt. Denn er kommt via Luzern nach Engelberg; und da nur Gesunde dort hinauf kommen ...“
„Martin!“ unterbrach ihn Frau Julie und drückte seine Hand. „Er ist da! er lebt! und ist gesund!“ — Wieder liefen ihre Tränen, und in ihrem Glück völlig unbeherrscht, stand sie auf, öffnete die Tür und rief strahlend: „Jean! so hören Sie doch!“ —
Aber durch die offne Tür trat ihr ihr Schwiegersohn, der Landrat Dr. Moll, entgegen.
„Anton!“ rief Frau Julie ihm zu. „Denk dir, er ist da! er lebt! und ist gesund!“
„Da siehst du, wie grundlos die ganzen Jahre über deine Sorgen waren,“ erwiderte der, nahm ihre Hand und küsste sie.
„Es hätte ja doch auch anders sein können,“ sagte Frau Julie.
„Gewiss! In solcher Zeit muss man aber auch dem Schlimmsten gefasst ins Auge schaun.“
„Bedenke doch, Anton, wenn er ums Leben gekommen wäre!“
„Dann hättest du es wie Millionen andere Mütter tragen müssen.“
„Nein!“ rief Frau Julie bestimmt. „Nie hätte ich das getragen.“
Der Landrat sah sie verdutzt an.
„Was willst du damit sagen?“ fragte er.
„Dass ich an meinem Glück jetzt erst ermessen kann, wie gross mein Schmerz gewesen wäre. Das Herz hätte ausgesetzt. Verlass dich drauf. Sein Tod wäre auch mein Tod gewesen.“
„Mama!“ schalt der Landrat und wies auf Johann, der auf Frau Julies Ruf hin soeben ins Zimmer trat. „Erstens sind wir nicht allein. Und dann überhaupt.“
„Du vergisst, dass es ihr Einziger ist,“ vermittelte der Medizinalrat.
„Und wenn ich sechs Söhne hätte! und ich stelle mir vor, ich verlöre einen: ich glaube, der Schmerz wäre der gleiche.“
„Wer fürs Vaterland stirbt, lebt ewig,“ erklärte der Landrat und sah triumphierend erst den Medizinalrat und dann Frau Julie an.
„Du hast demnach freiwillig auf das ewige Leben verzichtet?“ parierte der Medizinalrat.
„Ich habe einen Posten an der inneren Front, auf dem ich meinem König ebenso wertvolle Dienste leiste wie draussen.“
„Und wenn du nun deinen Sohn opfern solltest?“ fragte Frau Julie ... „Was dann?“
„Opfern?“ wiederholte der Landrat und liess sein Monokel, das er an einer dünnen Seidenschnur trug, aus dem Auge fallen.
„Nenne es, wie du willst: meinetwegen Pflicht.“
„Pflicht?“ wiederholte der Landrat.
„Heilige Pflicht,“ konzedierte ihm der Medizinalrat.
„Nun denn,“ erwiderte der Landrat, stand auf, schloss den Knopf seines eng anliegenden Cutaways, stellte sich dicht vor die beiden, klemmte das Monokel wieder ein und sagte: „Ich wäre stolz, wenn es meinem Sohne vergönnt wäre, auf dem Felde der Ehre zu fallen.“
„Anton!“ rief Frau Julie entsetzt und hob wie zur Abwehr die Arme. „Du versündigst dich.“
„Die Zahl der Jahre macht das Glück nicht aus. Schliesslich stirbt es sich zu achtzehn für seinen Kaiser leichter als zu siebzig an Arterienverkalkung.“
„Ja, setzen wir unsere Kinder denn in die Welt, damit sie sterben?“ rief Frau Julie.
„Wie Gott will,“ erwiderte der Landrat.
„Lass Gott aus dem Spiel!“ forderte Frau Julie. „Er steht mir näher als dir.“
„Erlaub mal!“ widersprach der Landrat gekränkt.
„Möglich, dass du ihn mehr im Munde führst. Das bringt dein Amt wohl mit sich. Jedenfalls: er hat nichts damit gemein, dass die Menschen sich umbringen, statt sich zu lieben.“
„Du vergisst, dass es für König und Vaterland geschieht,“ erwiderte der Landrat.
„Zugegeben!“ stimmte Frau Julie bei. „Jedenfalls aber nicht im Namen dessen, der die Liebe predigte.“
„In solchen Zeiten hat sich eben alles in den Dienst der Sache zu stellen.“
„Etwa auch die Religion?“ fragte Frau Julie.
„Gewiss! Ausnahmslos alles! — Wem das nicht im Blute sitzt, dem muss es der Verstand sagen.“
„Nur, dass der Glaube nicht Sache des Verstandes, sondern eine Angelegenheit des Herzens ist.“
„Mit dem Herzen macht man keine Politik.“
„Eben darum soll man die Religion, die eine Herzenssache ist, auch nicht zum Werkzeug des Krieges machen.“
„Das meine ich auch,“ stimmte der Medizinalrat seiner Schwester bei.
„All die spitzfindigen Definitionen“, fuhr Frau Julie fort, „durch die gar zu bereitwillige Geistliche zu beweisen suchen, dass Krieg und Religion wohl nebeneinander bestehen können, sind seelische Vergewaltigungen und Sünden wider den heiligen Geist. In Wahrheit kehren sie die Lehre Christi ins Gegenteil und besorgen die Geschäfte des Satan.“
„Das sind Schlagworte! Perversitäten,“ erwiderte der Landrat.
Der Medizinalrat unterdrückte ein Lachen, und Frau Julie sagte:
„Mir scheint, dass die Religion zu keiner Zeit eine grössere lohnendere Aufgabe zu erfüllen hatte als grade jetzt. Nicht als ein Werkzeug des Krieges, vielmehr neben dem Kriege, als die Trösterin! — Gelingt ihr das, vermag sie die Wunden zu schliessen, und siegt schliesslich über alle Schmerzen die grosse Liebe — dann hat sie die schwerste Prüfung bestanden, die ihr in all den Jahrhunderten auferlegt wurde. Dann hat sie das Böse endgültig besiegt.“
„Das sind alles Sentimentalitäten, mit denen man keine Kriege gewinnt,“ sagte der Landrat.
„Aber sie überwindet!“ belehrte ihn der Medizinalrat.
„Auf deutsch: Pazifismus,“ sagte der Landrat und lachte spinös.
„Das ist nun zwar nicht gerade deutsch,“ weinte Frau Julie. „Aber um über Krieg und Religion zu reden, steht mir heute nicht der Kopf.“
„Das will ich meinen!“ rief Ilse von Zobel, die in diesem Augenblick ins Zimmer stürzte, sich ihrer Mutter an den Hals warf, sie an sich drückte und rief:
„Ich gratuliere!“
Ihr Mann, Kurt Freiherr von Zobel, Hilde Moll, die Frau des Landrats, und der Justizrat Willi Wolf, ein jüngerer Bruder Frau von Reinharts, folgten ihr.
„Ja! woher wisst ihr denn alle schon?“ fragte Frau Julie, nickte allen zu und liess sich von ihnen die Hand küssen
„Du hast es uns doch mitteilen lassen,“ erwiderte der Justizrat.
„Ich?“ fragte Frau Julie erstaunt. „Ich war doch so benommen, dass ich gar keinen Gedanken hatte.“ — Im selben Augenblick aber hatte sie auch schon die Lösung: zweifellos! Johann hatte in seiner Freude, ohne sie zu fragen, alle benachrichtigt.
„Ich bin so, wie ich war, von den Kindern fort und zu dir!“ rief Hilde. Und der Landrat, der schon längst seine Frau scharf betrachtet hatte, sagte:
„Du siehst ja ganz zerzaust aus.“
„Das war unser Junge! Er hing sich an mich und wollte durchaus mit und Grossmutti gratulieren.“
„Der geliebte Junge!“ rief Frau Julie. „Er ähnelt dem Peter. Er hat soviel Gemüt.“
„Du solltest doch etwas mehr auf dein Aeusseres sehn,“ sagte der Landrat, der jetzt dicht neben seiner Frau stand. „Das bist du mir und meiner Stellung schuldig.“
Hilde stöhnte und sagte halblaut:
„Immer dasselbe.“
Und der Medizinalrat, der hinter dem Landrat stand, tat überrascht und sagte zu seinem Neffen:
„Schon offiziell?“
Der Landrat wandte sich zu ihm um, sah das spöttische Gesicht, verzog den Mund und sagte:
„Wozu?“
„Nun zum Staatsminister. Bei deinen Verbindungen! — Oder ist es etwa noch nicht so weit?“
„I was!“ wehrte der Landrat ab und machte ein so verdutztes Gesicht, dass der Medizinalrat lachen musste und sich abwandte.
„So lass ihn doch, Onkel!“ sagte Ilse leise, und der Medizinalrat erwiderte:
„Ich kann mir nicht helfen, liebe Ilse, aber dieser Landrat liegt mir nun mal nicht.“
Ein Diener brachte eine Magnumflasche Champagner. Johann folgte mit Tablett und Gläsern.
„Es ist seit fünf Jahren die erste Flasche, die in meinem Hause getrunken wird,“ sagte Frau Julie und ging auf Johann zu. Dann reichte sie jedem ein Glas.
„So habe ich dich seit Jahren nicht mehr gesehen,“ sagte Ilse freudig.
„So wohl wie heut war mir auch nicht mehr ums Herz, seitdem unser guter Vater von uns ging,“ erwiderte Frau Julie.
„Also denn“, sagte der Landrat, klemmte das Monokel fest und hob sein Glas — „ergreifen wir die Jelejenheit ...“
„Was denn? was denn?“ unterbrach ihn der Medizinalrat.
Der Landrat sah auf:
„Na, ich denke doch, es soll jefeiert werden.“
Hilde wies auf Frau Julie, die sich eben von dem Justizrat auf einen Stuhl helfen liess.
Der Landrat sah’s, war ganz verdutzt, sperrte den Mund auf und sagte:
„Nanu?“
Dann liess er den Arm sinken und schüttelte den Kopf. Im selben Augenblick stand Frau Julie, überstrahlt von Glück, auch schon auf dem Stuhl und begann:
„Kinder! geliebte Kinder! Also ihr wisst ja gar nicht, wie es in mir aussieht! Als junge Braut mag mir so ums Herz gewesen sein. Seitdem nie wieder. Und dabei hatte ich, solange euer Vater lebte, doch nur frohe Tage. — Aber heute, wo ich meinen Jungen wieder habe, da ist mir, als fühle ich, wie sich eures Vaters Arm um meine Schultern legt, wie er mich mit seinen guten blauen Augen anschaut, und, wie so oft früher, zu mir sagt: ‚Na, Liebling, ist das Leben nicht schön?‘ — Nie ist mein Ja aus vollerem Herzen gekommen als heut. Das Leben ist schön! Erst seine schwersten Prüfungen lassen uns seinen Sinn erkennen. — Kinder! wir haben ihn wieder, unsern Peter, unsern guten, dummen Jungen, den strahlenden Bengel!“
„Erlaub mal,“ fiel ihr der Landrat ins Wort, „dass ich dich unterbreche. Aber n’ Königlich Preussischer Regierungsassessor is doch schliesslich kein dummer Junge und strahlender Bengel!“
„Doch! doch! rief Frau Julie lebhaft. „So wie ich es meine, ist mein Peter ein strahlender Bengel und soll es bleiben! So ein echter deutscher Kindskopf! Ganz wie ihn sein Vater sich wünschte! Sonnig! offen und keines falschen Tones fähig! Gottlob, wir haben ihn wieder, unsern Peter. Lasst ihn leben, den Jungen! Hoch!“
„Hoch!“ riefen alle, und wiederholten es erst einmal, dann ein zweitesmal.
Baron Zobel und der Medizinalrat, die peinlich auf Frau Julie acht gegeben hatten, halfen ihr jetzt vom Stuhl herunter.
„Ich glaube, Mama,“ sagte Ilse, „wir bringen dich jetzt zu Bett, damit du erst einmal richtig zur Ruhe kommst.“
„Was für ein Gedanke!“ widersprach Frau Julie. „Ich werde doch die schönsten Stunden meines Lebens nicht verschlafen. In mir ist seit fünf Jahren zum ersten Male alles wieder ganz ruhig. Die ganze Nacht über werde ich mit offenen Augen daliegen und an mein Glück denken. Nun, wo ich meinen Jungen wieder habe, ist mir um meinen Schlaf nicht mehr bange.“
„Wer wird zu ihm fahren?“ fragte der Baron Zobel.
„Du meinst, wer mich begleiten wird,“ erwiderte Frau Julie.
„Aber Mama!“ widersprach Ilse, „du wirst doch bei den jetzigen Verhältnissen und um die Jahreszeit nicht in die Schweiz fahren?“
Auch Hilde und der Justizrat rieten ab.
Frau Julie lächelte:
„Und wenn es an das Ende der Welt ginge! Ihr würdet mich nicht zurückhalten.“
„Dann fahre ich mit dir!“ erklärten gleichzeitig Ilse, Hilde und der Medizinalrat.
„Das braucht am Ende doch nicht so überstürzt zu werden,“ meinte Baron Zobel; und der Justizrat stimmte ihm bei und sagte:
„Ich finde auch, darüber kann man doch in ein paar Tagen in aller Ruhe sprechen.“
„Wie denn?“ fragte Frau Julie und glaubte, sie habe ihren Bruder falsch verstanden. „In ein paar Tagen? Du sagtest doch, Peter sei morgen Nacht schon in Genf,“ wandte sie sich fragend an den Medizinalrat.
„Gewiss,“ sagte Zobel. „Das stimmt schon.“
„Nun also!“ erwiderte Frau Julie.
„Das bedingt doch aber nicht, dass ihr nun auch alle gleich am selben Tage dort sein müsst.“
„Bei einer fünfjährigen Trennung,“ stimmte der Justizrat seinem Neffen, dem Baron Zobel, bei, „spielen ein paar Wochen mehr am Ende auch keine Rolle.“
„Kinder! ich will euch mal was sagen,“ erklärte Frau Julie bestimmt. „Ich begreife durchaus euren Standpunkt, der auf den ersten Blick vielleicht sogar die Logik für sich hat. Aber, wo Gefühle sprechen, setzt bekanntlich die Logik aus. Ich fahre!! Und zwar so, dass ich möglichst noch vor Peter in Genf bin.“
„Das ist unmöglich,“ erwiderte der Medizinalrat. „Du könntest ihm schon rein zeitlich nur bis Luzern entgegenfahren. Aber auch das erreichst du kaum, da du zur Reise einen Pass benötigst.“
„Den ich mir innerhalb einer Stunde verschaffen kann,“ erwiderte Frau Julie. „Also nochmals, Kinder: ich reise! und von euch braucht mich niemand zu begleiten. Ich nehme mir meine Jungfer und meinen Diener mit. Ihr braucht meinetwegen also keinen Augenblick in Sorge zu sein.“
Hilde und Ilse suchten zu widersprechen. Aber Frau Julie liess keinen Einwand gelten, und als sie schliesslich sagte:
„Im übrigen ist es auch nur das Natürliche, dass Peter nach so langer Trennung zuerst einmal mit seiner Mutter allein ist,“ erwiderte der Landrat:
„Jewiss! An sich schon. Luzern ist ja schliesslich nicht Costarika. Man bleibt sich in erreichbarer Nähe. Und gegen das Tempo wäre auch nichts einzuwenden. Denn, dass wir den Jungen in die Finger bekommen ehe etwa fremde Einflüsse auf ihn einwirken, das scheint mir bei seiner Sensibilität ...“
„Wie bitte?“ unterbrach ihn frotzelnd der Medizinalrat. „Darf ein derart tollwütiger Vaterlandsparteiler ...“
„Erlaub’ mal!“ setzte sich der Landrat zur Wehr.
„Verzeih, lieber Neffe! wenn ich nicht fürchten müsste, dein patriotisches Gefühl zu verletzen, so hätte ich natürlich gesagt: darf ein so fanatischer Sprachreiniger wie du Worte wie Sensibilität gebrauchen?“
Der Landrat stutzte und verbesserte schnell:
„Ae ... ich ... e ... meine natürlich ... na, wie sagt man gleich?“
„Empfindsamkeit,“ sprang ihm seine Frau bei.
„Richtig!“ erwiderte der Landrat. „Ganz recht! das wollte ich natürlich sagen: Empfindsamkeit. Also bei seiner Empfindsamkeit — obgleich das Wort wohl doch nicht ganz das trifft, was ich eigentlich sagen wollte ...“
„Ah!“ rief lachend der Medizinalrat.
„Also jedenfalls bei seiner Veranlagung, die sich in den Jahren gewiss noch stärker ausjeprägt hat, halte ich es für durchaus notwendig, dass ihn gleich bei seiner Ankunft einer von uns in die Finger bekommt.“
„Nun also,“ sagte Frau Julie.
„Nur, ob du da die Geeignete bist — nimm’s mir nicht übel, Mama, — bei aller Hochachtung, aber das glaube ich nicht.“
„Wie? ich, seine Mutter, wäre nicht die Geeignete? — Ja, Anton, ist es denn möglich, dass du das im Ernste sagst?“ fragte Frau Julie entsetzt.
„Du befindest dich begreiflicherweise jetzt in einem — na, sagen wir mal Freudenrausch — das soll kein Vorwurf sein. Als Mutter, da ist das am Ende sogar natürlich — wennjleich ich offen sagen muss, dass du dich nach meinem Jefühl — und ich bin auch nicht von Stein — als deutsche Mutter dennoch etwas gar zu hemmungslos deiner Freude hingibst.“
„Soll ich in meinem Hause etwa mit meinen Gefühlen für mein Kind zurückhalten?“ fragte Frau Julie erregt.
„Verzeih!“ entschuldigte sich der Landrat und griff nach Frau Julies Hand, um sie zu küssen. Sie zog sie zurück.
„Er meint es ja nicht so,“ verteidigte ihn seine Frau.
„Ich fürchte einfach,“ fuhr der Landrat fort, „dass du zu weich ihm gegenüber sein wirst.“
„Kann man zu einem Kinde, das fünf, vielleicht grauenvolle Jahre von seiner Heimat, seiner Mutter, von allem, was es liebte, getrennt war, überhaupt weich genug sein?“ fragte Frau Julie.
„Es ist mir wahrhaftig äusserst peinlich, liebe Mama,“ sagte der Landrat, „dir deinen Freudenbecher sozusagen verwässern zu müssen. Aber ich sehe weiter. Und da Erfahrungen dazu da sind, dass man aus ihnen lernt, so meine ich: jetzt ist die Jelegenheit, wie vielleicht kein zweitesmal mehr da, um Peter mit fester Hand anzupacken und zu den Grundsätzen zu bekehren, die in unseren Familien Gott sei Dank seit Jahrhunderten bestanden haben.“
„Lass ihn doch erst einmal zur Besinnung kommen,“ fiel ihm der Medizinalrat ins Wort.
„Heute mehr denn je,“ fuhr der Landrat fort, „ist ein fester Zusammenschluss notwendig.“
„Worin hätte sich Peter denn jemals gegen die Traditionen der Familie vergangen?“ fragte Frau Julie erregt.
„Na, erlaub mal!“ wandte sich der Landrat gegen seine Schwiegermutter. „Das reizt denn doch beinahe zu der unhöflichen Frage: hat dein Gedächtnis in den paar Jahren denn derart gelitten? — Was mich betrifft, so ist die ganze Zeit über kein Tag vergangen, an dem ich nicht dankbar mir ins Jewissen jerufen habe, welcher Jefahr wir alle damals mit knapper Not entjangen sind.“
„Du übertreibst,“ rief Ilse; und Hilde, des Landrats Frau, stimmte ihrer Schwester bei und sagte:
„Masslos übertreibst du!“ — Und halblaut fügte sie hinzu: „Wie immer und in allem.“
„Das hängt von dem Mass des jesellschaftlichen Reinlichkeitsjefühls ab, mit dem man behaftet ist,“ erwiderte der Landrat. „Für eine Familie, die auf sich hält, jibt’s nach meinem Empfinden nichts Aergeres als eine Deklassierung.“
„Was ist das?“ fragte der Medizinalrat spöttisch, und zu seiner Schwester, die stark bewegt war, sagte er: „So rege dich doch darüber nicht auf, Julie!“
Der Landrat war sichtlich in Verlegenheit.
„Ah so!“ sagte er. „Ich meinte ... ä ... ja, wie sagt man da?“ — Er fuchtelte mit der Hand in der Luft herum — „Na! ... ä ... Abgrund ist wohl nicht das richtige Wort dafür. Aber ... ä ...“ — und dann stiess er mit grosser Bestimmtheit hervor: „Niederjang! das trifft’s! Also, ich meine, dass wir ganz einfach die Pflicht haben gegen uns selbst, und heute mehr denn je, uns davor zu schützen, dass nicht durch den Leichtsinn irgendeines von uns — und dieser Eine is in diesem Falle erfahrungsjemäss kein anderer als mein verehrter Schwager Peter — den Niederjang unserer Familie — das heisst: Niederjang is wohl doch nicht das richtige Wort — jedenfalls, ihr wisst, was ich meine — kurz und gut: ich für meine Person habe keine Lust, meinen Namen und meine Karriere und die meiner Kinder den Aventüren ...“
„Wie bitte?“ zog ihn der Medizinalrat auf. „Karriere, Aveutüren! Was sind das für Worte!“
„Ae,“ verbesserte sich der Landrat schnell. „Ich wollte sagen, den Abenteuern — das heisst, es ist wohl doch mehr. Denn, wenn es das nur wäre — Jedenfalls: jetzt ist Zeit und Jelegenheit, dem ein für alle Male einen Riegel vorzuschieben.“
„Was willst du eigentlich?“ fuhr ihn Frau Julie, die sich nicht länger beherrschen konnte, in einem Tone an, den niemand an ihr kannte.
„Sehr einfach!“ erwiderte der Landrat. „Ich will vermeiden, dass wir durch die Unbeherrschtheiten deines Sohnes noch einmal wie vor fünf Jahren in die Gefahr eines Skandals kommen, der mir heute noch in den Gliedern liegt.“
Frau Julie schwieg erst und sah den Landrat erstaunt an. Dann schüttelte sie den Kopf und sagte mit bewegter Stimme:
„Du nennst es einen Skandal, der dir heute noch in den Gliedern liegt! — Ich denke daran zurück als ein von uns begangenes Verbrechen, das mein Gewissen heute noch genau so quält wie vor fünf Jahren.“
„Wozu musstest du nur davon anfangen?“ schalt Hilde ihren Mann. „Und dann grad heut! wo wir die ganzen Jahre über mit Mama nicht davon gesprochen haben.“
„Hätten wir’s nur!“ erwiderte Baron Zobel. „Hätten wir nur davon gesprochen! und zwar so oft wie möglich, damit sich in Mama nicht so unsinnige Ideen festgesetzt hätten.“
„Ich muss auch sagen,“ stimmte der Justizrat bei, „dass das die Dinge denn doch etwas einseitig beurteilen heisst.“
„Sie auf den Kopf stellen heisst,“ fiel ihm Zobel ins Wort.
Der Landrat unterdrückte, was ihm schwer genug fiel, die Erwiderung, die ihm auf der Zunge lag, und beschränkte sich darauf, sich in den Sessel zurückzulehnen, die Beine übereinander zu schlagen und zu sagen:
„Na! Dann kann das Theater ja wieder losgehen! Aber ich spiele nicht mehr mit. Ich nicht! Und meine Frau und meine Kinder auch nicht!“
„Ich weiss gar nicht, was du eigentlich willst,“ sagte Hilde und wandte sich an ihren Mann. „Das liegt doch glücklich hinter uns.“
„Um morgen in neuer Auflage seine Wiederholung zu erleben.“
„Aber das ist ja doch gar nicht möglich,“ erklärte Ilse, „das Mädchen ist doch tot.“
„Auf das System kommt es an! auf den Geist! ob der tot ist. Davon hängt es ab. Aber er lebt, wie ihr aus Mamas Worten ja eben gehört habt.“
„Da hat er recht,“ bestätigte Zobel. „Was nützt es, dass diese Aenne starb, solange man befürchten muss, dass morgen eine Else oder Grete an ihre Stelle tritt. Vor allem, wo heutzutage eine derartige Hintertreppenchose unter Umständen keine interne Angelegenheit mehr bleibt, die man innerhalb seiner vier Wände mit ein paar braunen Lappen abmacht.“
„Aha!“ mischte sich der Medizinalrat jetzt laut in die Unterhaltung. „Du befürchtest, dass, wenn ihr euch im Interesse des sogenannten guten Rufes der Familie wieder einmal veranlasst sehen solltet, ein armes Mädchen in den Tod zu hetzen, dass das dann heute möglicherweise doch unangenehme Folgen für euch haben könnte.“
„Die Möglichkeit ist bei der heutigen Gefühlsrichtung durchaus nicht von der Hand zu weisen,“ erwiderte Baron Zobel.
„Im übrigen,“ stellte der Landrat seinen Onkel, „von uns hat sie meines Wissens keiner in den Tod gehetzt.“
„Sondern?“ fragte der Medizinalrat.
„Sie hat, was für ein Mädchen ihrer jesellschaftlichen Stellung — wenngleich jesellschaftlich für ein Mädel ihres Standes kaum die richtige Bezeichnung sein dürfte — jedenfalls: Ehre, wem Ehre jebührt! und da muss ich trotz aller Mühen, die sie uns gemacht hat, sagen: sie hat für eine Pedellstochter — zumal für gewöhnlich derartigen Mädchen jedes Jefühl dafür abjeht — den Takt jehabt und sich jesagt: es jeht nich! eine Schreibmaschinenmamsell und ein königlich preussischer Regierungsassessor sind von der Vorsehung nu mal nich füreinander bestimmt. Im Anfang natürlich, da war se, wie alle, bockbeinig und klammerte sich an Peter fest. Schliesslich dämmerte es ihr aber doch, sie lenkte ein, jab nach, entsagte freiwillig ...“
„... und brachte sich um,“ ergänzte der Medizinalrat.
„Allerdings,“ bestätigte der Landrat. „Sie sich. Nicht wir sie.“
Der Medizinalrat bekam einen roten Kopf, richtete sich auf und sagte laut:
„Erwürgt, erdrosselt, so zwischen euren Fingern, habt ihr sie freilich nicht.“
„Doch! doch!“ rief laut Frau Julie und sprang auf, „bedacht und bewusst erwürgt und erdrosselt, gerade so, wie du es zeigst, so zwischen euern Fingern, habt ihr sie.“
Der Landrat riss den Mund auf und rief:
„Wa?... Wa?...“ und vergass, ihn wieder zuzumachen.
„Wer? wir?“ rief Baron Zobel und trat vor Frau Julie hin. „Selbst bildlich gemeint ist dieser Vorwurf falsch und niederträchtig. Wir haben mit deinem Einverständnis Peters Abwesenheit in Südwest dazu benutzt, um ihn von seinem höchst sesshaften Verhältnis zu befreien, das er ohne uns vielleicht nie mehr losgeworden wäre.“
„Sehr richtig!“ stimmte der Landrat bei, der sich wieder in der Gewalt hatte. „Weiter nischt!“
„Aber wie? wie habt ihr das gemacht?“ rief Frau Julie.
„Zuerst auf deinen speziellen Wunsch mit Glacéhandschuhen,“ sagte Zobel, und der Landrat fügte hinzu:
„Die wir uns dabei jehörig bedreckt haben.“
„Das habt ihr,“ stimmte Frau Julie aus vollem Herzen bei.
„Ne, ne,“ winkte der Landrat ab. „So nich, anders, liebe Mama. „So ’ne Loseisung, so ’n letzter Akt einer Liaison is doch schliesslich kein Hofball! Das is für jewöhnlich ’n ziemlich schmieriger Handel, mit mehr oder wenijer rührselijem Einschlag.“
„Je kleiner die Abfindungssumme, um so grösser die Rührung,“ ergänzte Zobel.
„Sehr richtig,“ stimmte der Landrat bei. „Hauptsache is bei so ’ner Szene die Tonart. Wenn man se natürlich wie du von vornherein statt auf Dur auf Moll stimmt, darf man sich nicht wundern, wenn’s ’n Kladderadatsch jibt.“
„Jetzt bin am Ende noch ich daran schuld!“ rief Frau Julie.
„I Jott bewahre! Schuld is Peter. N’ Verhältnis — verzeiht, aber mir scheint, dass das doch ’mal jesagt werden muss — also so ’n Verhältnis is doch nichts weiter als ein auf materieller Verständijung beruhender körperlicher Zu sammenschluss auf Widerruf.“
„Lass das!“ befahl Frau Julie.
Aber dem Landrat gefiel die Formel.
„Wenn ein Teil widerruft, is es aus. Da jibt’s nichts! Und so wenig das Jesetz aus so ’ner Art Verbindung rechtliche Folgen herleitet, so wenig anerkennt der jesellschaftliche Kodex Pflichten moralischer Art — was ja auch sinnlos wäre, da das Janze ’ne höchst unmoralische Anjelejenheit is.“
„Ich bin auch der Ansicht,“ sagte der Justizrat, „dass es in unser aller Interesse und nicht zuletzt in dem Peters liegt, wenn wir diese unglückselige Angelegenheit endgültig ad acta legen.“
Frau Julie, deren Nerven seit einer Stunde übermässig angespannt waren, rückte ein wenig nach vorn, legte die weisse, gepflegte, noch immer schöne Hand auf den Tisch, sah ihre Schwiegersöhne an und sagte mit starker Betonung:
„Gut, es mag das letztemal sein! Aber entgegen dem Gesetz, dem gesellschaftlichen Kodex, und vor allem entgegen deinem Urteil, Anton, wonach ein derartiger Fall eine höchst unmoralische Angelegenheit ist, will ich, dass der armen Aenne wenigstens einmal ihr Recht wird. Dann mag der Fall zwischen euch und mir begraben sein.“
„So lass es doch ruhn, Mama,“ bat Ilse, „und reg’ dich nicht auf!“
„Nein! nein!“ wehrte Frau Julie heftig ab. „Ich dulde nicht, dass man sie noch über das Grab hinaus kränkt. Ganz kurz! Was war dann? Ist der Oberpedell eines Gymnasiums ein anständiger Mensch?“ fragte sie laut.
„An sich — warum nich,“ erwiderte der Landrat.
„Ja oder nein?“ fragte Frau Julie.
„Er kann es sein.“
„Genau so gut und so schlecht, wie es ein Landrat sein kann.“
„Erlaube! erlaube!“ widersprach Anton heftig. „Mir scheint doch, dass der Vergleich ...“
„... i Gott bewahre!“ fiel ihm Frau Julie ins Wort. „Ich erlaube gar nicht: es gibt anständige Pedells und unanständige, genau so wie es anständige und unanständige Landräte gibt.“
„... und — unanständige ... Land ... räte!“ wiederholte Anton. „Na, da muss ich doch sagen, dass man bei der Auswahl der Landräte denn wohl doch etwas sorgfältiger verfährt, als bei der Auswahl von Schuldienern. — Verzeih, Mama, aber der Vergleich ist grotesk.“
„Ist es durchaus nicht. Denn ich spreche nicht von der Herkunft, von der Kinderstube, von der Bildung, die neben verschiedenen andern weniger wichtigen, meist rein äussern Formen die Voraussetzung für die Ernennung eines Landrats sind: sondern ich spreche von der rein menschlich moralischen Seite, und da wirst du mir zugeben, dass ein Pedell ein ebenso anständiger Mensch wie ein Landrat sein kann.“
„Diese Nebeneinanderstellung!“ wehrte Anton verdriesslich ab. „Fühlst du denn jar nich, wie unanjenehm und kränkend das für mich is.“
„Ganz und gar nicht. Ich für meine Person wenigstens ziehe einen anständigen Schuldiener einem unanständigen Landrat vor.“
„Das sind doch rein jesellschaftlich jar nich miteinander komparable Begriffe.“
„Wir sprechen ja jetzt von höheren als gesellschaftlichen Werten,“ lenkte Frau Julie ein ohne es zu wollen, „nämlich von menschlichen. Jedenfalls, du gibst mir zu, ein Pedell kann bei allem, was ihn gesellschaftlich vom Landrat trennt, ein anständiger Mensch sein.“
„Jewiss!“
„War nun Oberpedell Hoffmann ein anständiger Mensch?“
„Das war er wohl.“
„Und seine Frau?“
„Die war es wohl auch.“
„Diese Aenne war demnach achtbarer Leute Kind.“
„Ja, ja, aber was soll das nur?“ fragte der Landrat ungeduldig.
„Diese Aenne besuchte eine höhere Schule, eine Handelsakademie, sprach mehrere Sprachen und bekleidete in einem der ersten Anwaltsbüros eine durchaus nicht untergeordnete Stellung.“
„Jewiss! jewiss! ’n Bürovorsteher oder ’n Volksschullehrer wäre wahrscheinlich sehr glücklich mit ihr jeworden.“
„Peter, der kurze Zeit bei demselben Anwalt arbeitete,“ fuhr Frau Julie fort, „erkannte ihre aussergewöhnlichen Qualitäten und die beiden Menschen verliebten sich ineinander.“
„Was man so lieben nennt,“ warf Baron Zobel ein.
„O nein!“ widersprach Frau Julie, „vielmehr eine Liebe, wie man sie heutigen Tages leider nur noch selten findet. Sie vertraute ihm und er hatte den ernsten Willen, sie zu seiner Frau zu machen.“
„Das is ja doch der Wahnsinn!“ erwiderte der Landrat. „Um es dazu nich kommen zu lassen, um diese Mesalliance zu verhindern, veranlassten wir seine Versetzung nach Südwest.“
„Weil wir keine Ahnung von der Tiefe des Gefühls hatten, das die beiden Menschen miteinander verband,“ sagte Frau Julie, und der Medizinalrat ergänzte:
„Weil wir uns einredeten, diese Trennung würde genügen, um sie auseinander zu bringen.“
„So hattet ihr es mir wenigstens dargestellt,“ sagte Frau Julie, „ich sehe euch beide“ — wandte sie sich an ihre Schwiegersöhne — „noch vor mir, als wenn es heute wäre. ‚Lass uns nur machen,‘ sagtet ihr, ‚das geht ganz schmerzlos. Man macht ihr klar, dass Peter für die nächsten Jahre fort ist, für ihre Zwecke also ausscheidet, legt auf die Wunde ein Pflaster und verabschiedet sie an den Nächsten, mit dem es ihr ein paar Monate später dann genau so geht.‘“
„Das ist ja doch so üblich,“ erwiderte Zobel, und Frau Julie sagte:
„Ich, die ich von den Dingen natürlich keine Ahnung hatte, war entsetzt und fragte: ist es denn möglich, hat so eine Frau denn kein Gefühl? worauf ihr nicht ohne Spott erwidertet: ‚Gewiss! das hat sie schon. Aber die Person spielt dabei keine so grosse Rolle. Wen sie hat, auf den konzentriert sie’s.‘“
„Tut se’ auch,“ bestätigte der Landrat, „wenigstens im allgemeinen.“
„Aber ihr nahmt euch nicht die Mühe, festzustellen, ob euer Wald- und Wiesenrezept auch auf diese Aenne zutraf. Bei ihr war die Liebe nicht das Primäre, für das sie nur einen Gegenstand der Betätigung suchte: gleichviel, wer es war. Peter war es, der jenes Gefühl in ihr zum Erwachen brachte, das eine Frau nur einmal und nur an einen zu vergeben hat. Für eine Frau von Wert wird das ihr Schicksal bedeuten. Aenne war so eine! Ihr kamt ihr erst in moralischer Pose und suchtet mit Geld und sachlichen Argumenten ein Gefühl, wie einen Vertrag oder eine Sache wegzudiskutieren. Und der Erfolg? Und das Ergebnis? Es stellte sich heraus, wieviel tiefer und moralischer ihr Gefühl war, als euer Zorn und eure Entrüstung. Ihrem einfachen und unverfälschten Wesen gegenüber, den schlichten Worten, die ihr Herz als Antwort auf alle eure spitzfindigen Reden fand, wirktet ihr in eurer Gespreiztheit und mit euren gesellschaftlichen Phrasen, verzeiht, possenhaft. Aller Schmutz, den ihr, da euer so erprobtes System bei Aenne nicht zum Ziele führte, in eurer gekränkten Eigenliebe auf sie abzuladen suchtet, glitt von diesem reinen Kinde, das nichts wusste und nichts wollte, das nur liebte und geliebt sein wollte, ab wie von einer Heiligen. Ich übertreibe nicht und die Zeit hat ihr Bild nicht verklärt — aber nie in meinem langen Leben habe ich die Gegensätze und gesellschaftliche Lüge stärker empfunden als in jenen peinlichen Stunden, da ihr über diese Aenne zu Gericht sasst, und ihre reine Liebe trotz aller Liebesnächte über eure anempfundene Moral und künstliche Erregung triumphierte.“
„Aber Mama,“ sagte Hilde mit einem ängstlichen Blick auf den Landrat.
„Lass nur, mein Kind,“ erwiderte Frau Julie, „wir alle spielen ja das ganze Leben über Komödie. Einmal dürft ihr euch von eurer alten Mutter schon die Wahrheit sagen lassen. Wenn der armen Aenne auch nicht mehr damit geholfen ist, so sollt ihr wenigstens mit Scham und Reue und Achtung an sie denken.“
Der Landrat verzog den Mund, glitt lässig in den ledernen Fauteuil zurück, zog mit grosser Nachlässigkeit erst sein goldenes Zigaretten-Etui, dann sein goldenes Gehänge aus der Tasche und zündete sich eine Zigarette an. Frau Julie aber sah an dem Ausdruck seines Gesichts, wie erkünstelt seine Ruhe war.
„Ihr empfandet es ja denn auch als das, was es war,“ fuhr Frau Julie fort, „als eine moralische Niederlage, die euch um so schwerer traf, als ihr auf seiten eures Gegners alles vorausgesetzt hattet, nur keine Moral. Auf Wut, Niedertracht, Geldgier, auf alles das wart ihr gefasst! Denn über diese Mittel verfügtet auch ihr und konntet sie daher mit der Art nach gleichen, an Wirkung aber zehnfach, hundertfach stärkeren Waffen niederkämpfen. Nur über Moral verfügtet ihr nicht! Ich will euch nicht zu nahe treten, gesellschaftliche Moral, gewiss, die besasset ihr! Darin übertrifft euch niemand! Aber die reine Moral, die unbewusste, die von Gott kommt, davon habt ihr in euren Kindertagen vielleicht einmal einen Hauch gespürt. Nun, da sie in dieser Aenne wieder vor euch hintrat, wart ihr entwaffnet. Und in dieser Bedrängnis — und darin liegt denn auch die einzige Entschuldigung für euch! — wuchs eure Wut ins Ungeheure und ihr verhundertfachtet eure Niedertracht, um das arme Geschöpf zu Tode zu hetzen. Ihr liesst ihr suggerieren, Peter sei ihr untreu geworden, habe sie aufgegeben. Ihr Glaube erwies sich stärker als eure Lüge! Ihr liesst ihr nachstellen, suchtet auf raffinierteste Weise sie zu Fall zu bringen. Auch das gelang nicht. Jetzt hetztet ihr den Vater gegen sein Kind. Damit hattet ihr mehr Glück. Dieser einfache Mann war leicht zu verwirren. Von dem Glauben an einen verbotenen Umgang mit Peter, den ihr ihm wie ein Gift beibrachtet, bis zu der falschen Vorstellung, dass sein Kind eine Dirne sei, war nur ein Schritt. Er warf Aenne aus dem Haus. Aber die Mutter, die zu ihrem Kinde hielt, ging mit. So war es für euch nur ein halber Triumph. Was tatet ihr nun? Ihr stecktet euch hinter die Mutter. Und als die, die das Herz ihrer Tochter kannte, sie zu keinem Verzicht auf Peter bringen wollte, da triebt ihr die Aenne auf infame Weise aus ihrer Stellung und sorgtet dafür, dass sie auch anderswo nirgends mehr ankam. Ihr glaubtet: was Gewalt nicht erreicht, erzwingt am Ende der Hunger. Aber mehr als der Hunger frassen an der Alten die Sorge um ihr Kind und die Sehnsucht nach ihrem Mann. Es dauerte nicht lange, da setzte eines Tages das gequälte Herz aus. Jetzt schwankte Aenne wohl, die sich für den Tod der Mutter mit verantwortlich fühlte. Aber schliesslich erwies sich doch wieder die Liebe zu Peter als stärker. Ein um das andere Mal wiederholte sie: ‚Ein Wort von Peter, dass sein Gefühl für mich die geringste Aenderung erfuhr — und ich trete zurück, ohne dass jemand ein Wort zu verlieren braucht‘. — Da setztet ihr die famose Verlobung mit Margot Rosen in Szene, und um sie dem standhaften Peter mundgerecht zu machen, verdächtigtet ihr Aenne. Margot Rosen sass in Berlin, Peter in Südwest: er kannte sie kaum. Und so sagte er nicht ja, nicht nein; und so verlockend nach der für seine Karriere ja nicht gleichgültigen materiellen Seite hin die Partie war — er machte seine Entscheidung von Aenne abhängig. Da wandtet ihr euch an den verkommenen Baron Seifert, um den ihr sonst in einem weiten Bogen herumgingt, und verspracht ihm Geld und hetztet ihn auf sie. Dieser Hund“ — Frau Julie zitterte am ganzen Körper — „nie, solange ich lebe, habe ich solch ein Wort für einen Menschen gebraucht, aber es ist zu gut für ihn, denn dieses verkommene Subjekt“ — Frau Julie senkte den Kopf, dämpfte die Stimme und sagte: „Es soll nicht über meine Lippen kommen, was er mit ihr tat. — Zu Tode gehetzt, in ihrer höchsten Not flüchtete sie zu dir, Martin,“ wandte sich Frau Julie an den Medizinalrat, „und du tatest, was als Mensch deine Pflicht war — du führtest sie zu mir! Und nun erst erfuhr ich all das, was ich eben geschildert habe. Aber darüber hinaus: ich lernte einen Engel kennen, gütig, klug — aber ohne Kraft mehr zum Leben. — Das hattet ihr aus ihr gemacht! Da schämte ich mich — zum erstenmal in meinem Leben. — Nie empfand ich mehr die Sinnlosigkeit aller gesellschaftlichen Vorurteile. Ich verglich Margot Rosen mit ihr und wusste, wo für meinen Jungen das Glück lag. Ich hatte nur noch ein Gefühl: sie ihm zu erhalten und dafür zu sorgen, dass er an ihr gutmachte, was ihr an ihr gesündigt hattet. Auch ich! Denn wenn ich eure Mittel auch nicht kannte, ich kannte euch! Ich hätte mich darum kümmern müssen. Aber mit soviel Liebe ich sie nun umgab, so heilig ich ihr auch versicherte, dass ich sie als Peters Braut und mein Kind betrachte — sie lächelte nur und schüttelte den Kopf. Und als ich hinausging, um Papier und Feder zu holen und an Peter zu telegraphieren, war sie fort. — Eine halbe Stunde später stand ich in einer kleinen, sauberen Stube vor einer Chaiselongue, fiel in die Knie und küsste die Lippen seiner toten Braut. Ich fühlte in dieser Stunde wie eine Mutter, die ihr Kind verliert. Und als ich ihr die Augen geschlossen hatte und aufstand — ihr wisst, ich bin nicht fromm — da faltete ich die Hände und sagte so laut, dass ich vor mir selbst erschrak: Gott gib, dass wir die Schande überleben.“
Alle starrten Frau Julie an und schwiegen. Sie richtete sich hoch auf und sagte:
„Nun, mein Gebet hat sich erfüllt! Wir haben die Schande überlebt! Aber wenn ihr euch noch so hochmütig gebärdet, vergesst nie, dass wir allesamt schuldig und Verbrecher sind.“
Sie winkte ihrem Bruder, dem Medizinalrat. Er ging auf sie zu und reichte ihr den Arm. An der Tür wandte sie sich um und sagte:
„Das also soll das letztemal gewesen sein! Und nun gute Nacht, Kinder! Ich bin müde.“ — Sie bewegte leicht den Kopf, sagte noch einmal „gute Nacht“ und ging aus dem Zimmer.
„Gute Nacht, Mama!“ sagten gedämpft ein paar Stimmen, als sie am Arme des Medizinalrates durch die Tür schritt.
II
Als Frau Julie draussen war, herrschte zunächst Totenstille. Der Landrat zündete sich wieder eine Zigarette an und sah, als er das Streichholz löschte und auf den Tisch legte, unabsichtlich seinem Onkel, dem Justizrat, ins Gesicht. Schnell zog er das Etui noch einmal aus der Tasche, reichte es über den Tisch und sagte:
„Bitte!“
Der Justizrat lehnte ab; der Landrat verzog das Gesicht und glitt in den Sessel zurück.
Nach einer Weile fragte Ilse von Zobel:
„Was soll nun werden?“
„Das hast du ja eben gehört,“ erwiderte der Landrat, und Baron Zobel bestätigte:
„Deutlich genug war ja eure Mama.“
„In manchem hat sie recht,“ erklärte Hilde, und Ilse nickte mit dem Kopf und sagte:
„Die arme Mama!“
Der Justizrat sah nach der Uhr und stellte fest:
„Es ist halb acht,“ worauf auch Zobel und der Landrat ihre Uhren zogen und sagten:
„Wahrhaftig!“
Der Justizrat stand auf, knöpfte seinen Rock zu, dachte einen Augenblick nach und sagte:
„Falls ihr mich braucht, ich bin zu Hause.“
Er gab allen die Hand und ging. Als er draussen war, sagte Zobel:
„Wollen wir nicht auch gehen?“
„Na und?“ fragte Ilse und sah ihn an.
„Das geht doch nicht,“ erklärte Hilde.
„Warum nicht?“ fragte der Landrat.
„Erstens haben wir Margot Rosen herbestellt.“
„Ach du lieber Gott,“ sagte Zobel, verzog das Gesicht und trat vor den Likörschrank.
„Und dann,“ fuhr Ilse fort, „wir müssen doch wissen, was wird.“
„Gar nichts wird,“ sagte Zobel und goss sich einen Likör ein. „Was soll denn werden?“
„Mir auch bitte,“ sagte der Landrat, trat an seinen Schwager heran, goss erst einen, dann einen zweiten uralten Meukow herunter, wischte sich mit seinem Batisttuch den Mund, klemmte das Monokel fest, stemmte die Arme in die Hüften, beugte sich ein wenig nach vorn und sagte:
„Diese verfluchte Rührseligkeit! Machen wir uns doch klar, was ist denn eijentlich jeschehen?“
„Nun fang nur du nicht auch noch an!“ wehrte Zobel ab und goss sich einen Chartreuse ein.
„Jott bewahre! Fällt mir nich ein. Mir steht’s bis da! Aber unter uns: Tatbestand? Tippmamsell — Regierungsassessor. Das landesübliche Verhältnis. Statt auf Schmuck und Sekt mehr auf Jefühl jestimmt. Schon faul. Die Sache vertieft sich. Familie jreift ein. Ihre verfluchte Pflicht und Schuldigkeit. Jeder, der auf sich jibt, hält seinen Stall rein. Und ’n Stammbaum ist schliesslich keine Hühnerleiter. Sondern eine verdammt ernst zu nehmende Sache. Die Karriere des Jungen stand auf dem Spiel. Bei seinen Verbindungen konnte er’s mal zum Staatssekretär oder Botschafter bringen. Wir haben’s in Jüte versucht, indem wir ’ne Abfindung boten. Wir waren wahrhaftig nich kleinlich. Aber nee! Nu jerade nich! — Was sollten wir tun? Sollten wir nachjeben und uns mit der Pedellstochter verschwägern? Mama war jlücklich so weit. Sie öffnete die Arme, die Mätresse verwandelte sich in eine Märtyrerin und flog ihr als Schwiejertochter in die Arme. Das reine Theater! Na, da mag se denn wohl selbst jefühlt haben, dass was nich stimmte. Als sie am Halse unserer lieben Schwiejermutter hing, jing ihr der Atem aus! Es is eben doch ’ne andere Luft als in der Pedellsstube. Jott sei Dank! — Wenn n’en Droschkenjaul sich plötzlich für’n Steepler hält und über Hürden jeht und sich dabei das Jenick bricht, so is das seine Sache.“
„Ausgezeichnet!“ stimmte Zobel bei: und der Medizinalrat, der eben ins Zimmer trat und die letzten Worte mit angehört hatte, sagte:
„Gewiss! nur ist dir nicht ganz der Nachweis gelungen, lieber Neffe, dass du dich als Mensch so hoch über diese Aenne erhebst, wie der Steepler als Pferd über einem Droschkengaul steht.“
„Na, erlaub mal,“ wehrte sich der Landrat gekränkt, „an Klasse doch nu mal sicher.“
„Was du unter Klasse verstehst, ist etwas rein Aeusserliches,“ erwiderte der Medizinalrat. „Etwa: wenn ein reicher Viehhändler auf der Eisenbahn erster Klasse und ein gottbegnadeter Dichter dritter Klasse fährt, so bleibt der eine darob doch ein Vieh und der andere ein höheres Wesen.“
„Erlaub mal,“ erwiderte der Landrat gereizt und trat fast drohend vor den Medizinalrat hin, „willft du damit etwa sagen ...“
„I Gott bewahre,“ fiel ihm der ins Wort. „Da du meines Wissens kein reicher Viehhändler bist und die arme Aenne kein gottbegnadeter Dichter, so trifft auch der Vergleich auf dich nicht zu.“
„Das wollte ich nur in aller Form festjestellt wissen,“ sagte der Landrat mit starker Betonung und wandte sich von dem Medizinalrat ab. Aber der Rittergutsbesitzer Kurt Freiherr von Zobel, dessen Güter einen besonders reichen Viehbestand hatten, setzte das Glas, das er eben zum Munde führen wollte, ab, wandte den Kopf zu dem Medizinalrat und sagte:
„Ich muss dich ebenfalls um eine Erklärung ersuchen, Onkel.“
„Aber ich sagte ja schon,“ erwiderte der Medizinalrat, „da die arme Aenne keine Dichterin war, so kannst du dich doch nur im Falle eines schlechten Gewissens betroffen fühlen.“
„Danke,“ erwiderte Zobel, „das genügt mir,“ setzte an und trank seinen dritten Likör.
Ilse, die schärfer sah, flüsterte dem Medizinalrat zu:
„Ich bitt’ dich, Onkel, lass das! Wir haben gerade Verdruss genug. Sag’ uns lieber, was nun werden soll.“
„Mir scheint, ihr werdet eure Mutter nicht zurückhalten können, zu Peter zu fahren.“
„Sie wird ihm doch nicht erzählen, dass Aenne Selbstmord beging?“ fragte Hilde.
„Nein,“ erwiderte der Medizinalrat, „ich habe ihr klar gemacht, wie das unter Umständen zeitlebens auf ihn wirken könnte. Sie sieht das ein und wird die Lüge, dass sie eines natürlichen Todes starb, aufrecht erhalten.“
„Gott sei Dank!“ sagte Ilse und atmete auf.
„Trotzdem halte ich es für notwendig,“ fuhr der Medizinalrat fort und wandte sich an die beiden Frauen, „dass eine von euch mit ihr fährt.“
„Ich bin bereit,“ erklärte Hilde.
Zobel wandte sich an seine Frau und sagte:
„Dann fahr’ auch du mit!“
„Fräulein Margot Rosen!“ meldete Johann.
Im selben Augenblick rauschte ein ungewöhnlich hübsches und geschmackvoll gekleidetes junges Mädchen ins Zimmer. Vielleicht, dass die ganze Art ihrer Haltung und Kleidung für ein Mädchen aus gutem Hause eine Nuance zu mondän und bewusst war. Dass sie zu unbefangen auftrat und jene reizvolle Schüchternheit vermissen liess, hinter der sich sonst die Scheu und die Neugier erwachter Sinnlichkeit verbergen. Aber ihr Scharme milderte, was sonst vielleicht aufdringlich gewirkt hätte.
Sie begrüsste höflich die beiden Damen, indem sie ihnen die Hand reichte, und grüsste dann zu den Herren hinüber, die an sie herangetreten waren und sich vor ihr verbeugten.
„Wir haben uns lange nicht gesehen,“ begann sie unbefangen.
„An uns lag es nicht,“ erwiderte Ilse, „Sie wissen, bass wir uns immer mit Ihnen freuen,“ — Margot machte ein verschmitztes Gesicht — „oder glauben Sie das etwa nicht?“
„Doch, doch — das heisst — teils — teils.“
„Ja, was heisst das?“ drängte Ilse. „Haben wir es Ihnen gegenüber jemals an der nötigen Achtung fehlen lassen? Bewusst jedenfalls nicht.“
„Aber nein, liebe Frau Baronin,“ erwiderte Margot und setzte wieder ihr allerliebstes Lächeln auf, „wirklich nicht. Ich wollte damit nur sagen: eine Komtesse wär Ihnen als Schwägerin jedenfalls lieber als Margot Rosen.“
Alle waren verdutzt, nur Hilde raffte sich auf und sagte:
„Wie können Sie glauben!“
„Ich nehme Ihnen das durchaus nicht übel. Mama auch nicht. Sie sagt: das Leben besteht aus Kompromissen. Alles Gute findet sich selten beieinander — na ja, da hat sie doch recht. Ueberhaupt, ich finde es so komisch, dass Mama alles ausspricht, was sie denkt. Sie glauben gar nicht, in welche komischen Situationen sie sich und uns alle dadurch oft bringt. — Na, Sie werden sie ja nun wohl endlich kennen lernen. Es tut mir leid ihretwegen — aber es wird sich nicht umgehen lassen. Ich liebe Mama und finde, es spricht durchaus nicht gegen sie, dass sie in all den Jahren sich den sogenannten gesellschaftlichen Schliff noch immer nicht angeeignet hat.“
„Ja, ich bejreife ja nich,“ sagte der Landrat, „warum Sie so aggressiv jejen uns vorjehn.“
Und Baron Zobel, der ganz in Margots Anblick vertieft war, und bald das hübsche Gesicht und die ebenmässigen Glieder, bald die weissen Hände und den kleinen Fuss anstaunte, schnalzte mit der Zunge und sagte:
„Ich muss auch sagen, Sie finden durchaus unsern Beifall. Sie gefallen uns sehr. Wenigstens mir. Na, und mit dem übrigen, vor allem mit der Frau Mama, da werden wir uns schon abfinden.“
Margot, die längst fühlte, mit welchem Behagen Zobels Augen auf ihr ruhten, schlug die Beine übereinander, lächelte und sagte:
„Es wird Ihnen auch gar nichts anderes übrig bleiben.“
„Aber im Gegenteil,“ parierte Ilse die Unart ihres Mannes, „wir hatten schon lange den Wunsch, Ihre Frau Mutter kennen zu lernen.“