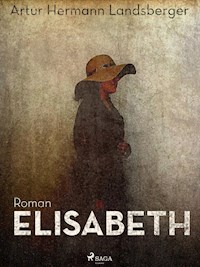Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Peter Reinhart hat in Schottland sein Examen bestanden, eine glänzende Zukunft steht dem fröhlichen jungen Mann bevor. Nur eine Sache könnte seiner Karriere schaden. Seine Mutter, die Geheimrätin Reinhart, nimmt die Dinge in die Hand und schreibt an Aenne Hoffmann: " Wertes Fräulein! Ich habe bisher stillschweigend die Beziehungen zwischen Ihnen und meinem Sohn geduldet. Indessen scheint es mir jetzt, wo mit bestandenem Referendarexamen die Studentenzeit hinter ihm liegt …, an der Zeit, dass sie sich trennen". Mit dem beigelegten Scheck glaubt sie, die nicht standesgemäße Beziehung beendet zu haben. Doch sie hat nicht mit der Standfestigkeit der Verliebten gerechnet. Selbst auf den nachdrücklichen Wunsch der Familie, sich für ein Jahr zu trennen und jeden Kontakt abzubrechen, lassen die beiden sich ein im Wissen, dass auch diese Prüfung ihre Liebe übersteht. Während Peter nach Südafrika geschickt wird, zerstören Intrigen der Reinhardts so nach und nach Aennes Leben – bis sie eines Tages vor der Geheimrätin steht … Das bewegende Buch findet in Landsbergers Roman "Wie Satan starb" seine Fortsetzung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Artur Hermann Landsberger
Um den Sohn
Mit einem Vorwort von Julius Hart
Saga
Zum Geleit
Berlin W.W. hat man es getauft. Man schaut dabei im Geiste überüppige oder überschlanke Weiber vor sich, mit halbentblössten Brüsten, protzenhaft-überreich beladen mit Diamanten und Brillanten, und Männer, die ihnen gleich sind und wie ein einziger Geldsack aussehen. Ein Berlin von Millionären, die gestern noch im Dorf hausieren gingen und heute ihre Häuser in den teuersten Strassen und ihre Villen mit einem echten Rembrandt schmücken können. Eine Gesellschaft und eine Grobkultur von Emporkömmlingen, — Kriegslieferanten sagt man augenblicklich, — skrupellosen Mammonskindern, die über Nacht ihre Vermögen sich anzuhäufen wussten. Im rasenden Reigen und Tanz um das goldene Kalb verschlungene Leiber huschen wie eine Vision am Auge vorüber.
Ein Berlin bei Nacht glüht auf in grellen Lichtern, frechen Farben. Bilder einer Walpurgisnacht und des Hexensabbaths, von Sektgelagen und üppigen Schlemmereien, spät nach Mitternacht, Bällen und Tänzen in den überladen geschmückten Sälen der flirrendsten und schillerndsten Prostitution.
Man denkt dabei aber auch an etwas, was beim ersten Anschein die gerade Gegensatzwelt dazu zu sein scheint. An kleine und intime Kreise von überverfeinerten Geschmackslüstlingen, Gourmets einer hypertrophen rein ästhetischen Kultur und Bildung, von Kindern eines fin de siècle, die sich selber wie Greise fühlen und empfinden, belastet und übersättigt von allen Weisheitsschätzen des Orients und Okzidents, müde, welt- und lebensflüchtig, von alt-buddhistischen und chinesischen Traumexistenzen verlockt in die Wälder von Uruvilva zurückziehen möchten und alles Dasein nur als Zuschauer von einer Theaterloge aus geniessen wollen. Die sich wohl wie Götter fühlen, welche, selber uninteressiert und teilnahmslos, irdisches Wandeln und Treiben nur als ein Schauspiel vorüberziehen lassen und des Lebens Tragödien und Komödien auch nur als blosse Komödien und Tragödien, als wollüstig schöne Nervensensationen schmecken und auskosten. Das Leben ein Traum, alle Welt und Wirklichkeit nur Schein. Ein Reich des l’art pour l’art, einer Kunst um der Kunst willen, sucht die Seele, das nur nicht vom Leben und der Natur befleckt sein soll, eine Insel Bimini und ein Schlaraffia, die nur in der heiligen Illusion leben und existieren. Alles ist aber Illusion, die reine Illusion unser höchstes Gut, der sublimste Wert, ein letzter Zweck, ein vollkommenstes Ziel des Daseins. Hier nur in der Phantasie ist das reine Land der Kunst, das Land ihrer absoluten Freiheit. Hier kann man auch wie ein Peter Hille leben, ohne einen Pfennig in der Tasche und doch als Millionär und Milliardär sich fühlen und wissen und lukullische Feste feiern, alle Genüsse des Berlin bei Nacht aus den flimmernden Sektschalen geniessen, die uns Mutter Einbildungskraft gütig lächelnd darbietet.
Gegensatzwelten sind es beim ersten Anblick. Die alten beliebten Antipole steigen in unserem Denken auf. Ein feineres tieferes Sehen aber wird gerade nur das eine als eine psychologische und eine kulturelle Erfahrung und Tatsache feststellen und es auch innerlich leicht erklärt und begründet finden, dass sie symbiotisch-organisch in allen Wurzeln miteinander verflochten und verwoben sind, sich gegenseitig notwendig bedingen und ergänzen, und die eine aus der anderen erwächst und heraufsteigt. Mit einem ironisch-satirischen Lächeln wird man in der Kultur des l’art pour l’art die Elemente einer blossen Parvenubildung und grobsinnlich-äusserlichen Parvenugeschmacks nachweisen. Gerade der Geist eines noch rohen plumpen derb materialistischen Emporkömmlingswesens, unreifen und unfertigen Könnens, einer Halbkunst ist es, welcher als Frucht die Kunst um ihrer selbst willen, die sich selber nur Zweck sein will, aus sich heraustreibt. „Lache, Bajazzo.“
Wenn man in voller Inbrunst und Hingabe an die Seele des Anderen, sich hineinversenkt in das still Verborgenste, Heimlichste und Allerheiligste der Produktion eines Artur Landsberger, und zu den „Müttern“ seines künstlerischen Schaffens, Sehens und Denkens, herabzusteigen sucht, dann wird man dort vielleicht am lautesten das ironische und spöttisch-humoristische, wie auch tragische Lachen Bajazzos hören, der diese inneren Zusammenhänge der beiden Berliner W. W.-Welten ergriffen und durchschaut hat, und es als die feinste und tiefste Quintessenz seiner Erzählungskunst geniessen. Eine Lebenskunst will sie sein, die Kunst um des Lebens willen suchen und betreiben, und protestiert als solche gegen das reine Aesthetentum, den ästhetischen Uebermenschen und seine Kritik, und wehrt sie von sich ab. Ganz offen und für alle sichtbar, auch für die oberflächlichste Betrachtung, treten die Bilder einer Berliner Parvenukultur in dem Sechsromanwerk Artur Landsbergers hervor. Tiefer versteckt sich der Lebenskenner und Lebensbekenner, und bleibt auch wohl ausserhalb, jenseits seines eigenen Werks stehen, der gerade mit diesem nur ästhetischen Menschen nichts zu tun haben will, und gegen diesen seine satirische Peitsche schwingt, wie gegen die Gesellschaft seiner Berliner Millionäre. Dieser geistige Protz und der Geldprotz sind schliesslich nur Zwillingsbrüder, Auswüchse derselben Kultur.
Der Wahnsinn, der augenblicklich als Krieg über die Erde tobt, hat wohl viele der Besten, Edelsten unter uns mit einem Abscheu erfüllt, dass sie nur nicht mehr das Wort Kultur mit einem guten Gewissen auszusprechen vermögen. Er kann uns allen wohl Binden von den Augen reissen. Die Kultur selber ist die Hexe, Megäre, — der apokalyptische Reiter, — der Mord, — der Todes- und Opferpriester, welcher heute wie ehedem seine Gehetzten und Sklaven geisselt und treibt, und die Mütter zu Heldenmüttern und Hebbelschen Judiths werden lässt, dass sie mit triumphierender Miene um Gottes willen, um der höchsten erhabensten Ideen willen, wie sie denken und wähnen, ihre eigenen Kinder in die glühenden Oefen ihres Baals werfen. Das Frank Wedekindsche Kunstwerk ist heute wohl das stärkste innerliche Werk der Anklage gegen diese ganze Kultur, ihre Lulu-Erdseele und ihr Oaha. Eine aufgehobene Hand, die sie völlig in Trümmer schlagen will. Aufbäumen der Anarchie, die alle Götter der Macht, Gewalt und Herrschaft zertrümmern möchte, die Geister des Vernunftdenkens vom Absoluten und ureinem göttlichen Wesen in allen Dingen, welche stets nur die Erde mit allen Blutströmen übergossen haben und die Menschen widereinander hetzten, dass sie als die schlimmsten der Bestien nur noch miteinander zu verkehren vermochten. Der Roman Artur Landsbergers steht nach meinem Empfinden geistig und stofflich der Wedekindschen Kunst nahe. Man begreift vollkommen, dass Wedekind ein herzlicher Freund, Verehrer und Leser der Landsbergerschen Romane war und sie mit seiner Kritik gesegnet hat. Eben dieses Wedekindsche Kunstwerk ist auch das widerästhetizistische Kunstwerk durch und durch in reinster Form und Ausprägung. Der höchste Gegensatz zu aller Kunst des l’art pour l’art. Hier tritt auch das Gemeinsame von Wedekind und Landsberger durchaus deutlich und auffällig in Erscheinung. Das Drama des Einen, der Roman des Andern sind innerlichst naive Produkte eines ausgeprägten künstlerischen Dilettantismus, einer ästhetischen Kulturlosigkeit, — und stehen so als Widerpartei gegen die raffinierte, überverfeinerte, technisch durchgeklügelte Spezialistenkunst für Kenner nur, für Kunstgelehrte, der Künstler für Künstler, für die engen und kleinen Gemeinden, die von Kunst nur leben wollen und dabei auch übersättigte Gourmets geworden. Aber dieser Dilettantismus ist gerade ein Panier, das die Landsberger, die Wedekind aufpflanzen. Er ist der feinste Duft und Geschmack, der elementare Vorzug ihrer Kunst, — eine Naivität und Primitivität, eine paradiesische Unschuld, — die Rückkehr zum Dilettantismus, Rückkehr zur Quelle der echtesten Kunst ...
Die allgemein moderne Klage- und Anklageliteratur äussert sich auch in dem Weinen und Lachen, in dem Stöhnen und in den Satiren und Ironien, — in den tragischen, komödischen und possierlich-possenhaften Zügen und Merkmalen der Berliner Romane Artur Landsbergers. Wie eine tolle, wirre, wüste und wilde Orgie, etwa wie eine Teufelsmesse rauscht und kreischt, lacht und fiebert in ihnen Berlin W. W. am Auge des Lesers vorüber: barbarisch-jung, protzig, mit erst noch hungrig-verlangenden Sinnen, groben Nerven und hysterisch, senil, übersättigt, verfaulend, geil. Mehr ein Berlin bei Nacht, — als ein Berlin bei Tag, mehr des Genusses, als der Arbeit. Es glüht in den Augen Hilde Simons und Lu, der Kokotten und bricht als Tingeltangeleuse Agnes in die Dichter- und Künstlerehen und Heime ein, schwebt als die Harpyie über allen Lebenstischen, sie beschmutzend und verpestend. Mit seinen erotisch-sexuellen, gierigen Krallen greift es schmeichelnd und streichelnd und vergiftend, syphilisierend an Seele und Leib. Es ist eine Atmosphäre, und man kann sich ihr nicht entziehen, wie man sich der Luft nicht entziehen kann. Es ist unsere Kultur, mit und in der wir, durch die wir sind. Selbstverständlich nicht nur die von Berlin. Allerweltskultur, Erdseele sogar für alle Wedekinder. Ebensosehr Pariser, Londoner, New-Yorker, Chikagoer und Budapester, Bukarester Kultur.
Zuletzt eine vieltausendjährige, deren letztes und innerstes Wesen nichts als eine allgemeine Prostitution ist. Ueber ihr schwebt als göttliche Dreieinigkeit die Einheit der Idee, — das Götzenidol einer Priester- und Gelehrtenkaste, — die Einheit des Schwertes, der Fetisch einer Kriegerkaste, und der Trug der Händler: die Einheit des Geldes. Eine heilige Dreifaltigkeit, auf der alle Staaten und Gemeinschaften begründet sind. Doch auch die ewige Bedingung allen Haders, aller Kriege, gegenseitiger Unterdrückungen, Ausbeutungen und Entwürdigungen, welche die Menschen notwendig wider einander aufbringen muss, so dass der gesellige Mensch zum ungeselligsten der Wesen wird und in seinen Staaten, wie Spinoza sagt, jeder des Anderen Feind ist. In den satirisch-tragischen Grotesken Landsbergers taumelt diese Kultur gegenseitiger geistiger und materieller Verelendigungen an unseren Augen vorüber.
Wie sehr sie mit ihren Dirnen- und Kokottenhänden auch in die Seele und das Leben eines Landsberger und eines Wedekind hineingegriffen haben, und dass sie an ihren Orgientischen wacker mitgezecht haben, das liegt ja auf der Hand. Selbstbekenntnis- und Selbstenthüllungsschriften, aus eigensten Erfahrungen und Erlebnissen geschrieben, ganz gewiss. Aus Lazaretten, aus Wunden, aus Kämpfen geboren sind ihr Roman, ihr Drama gewachsen. Prometheidenlos aller Künstler. Man kann sie nicht schildern, nicht gestalten, wenn man sie nicht mitgekostet und erfahren hat und ihre Geier an der eigenen Leber hat fressen lassen.
Bei Wedekind ist diese Kultur ganz auch zur Lebenstragödie geworden, dass er als ihr Opfer fiel und die Selbstmörderwaffe gegen sich erhob. Ein tiefst von ihr Verstrickter, ein tiefst Leidender, von ihren Furien Gehetzter. Da wird das Kunstwerk grösser, tiefer, schneidender. Die Tragik schreit heisser herauf, schriller, dämonischer gellt das Lachen, Hohn, Hass, Wut, Spott zucken in blutigeren Farben auf. Der bessere Lebenskünstler ist Artur Landsberger. So an Herzen und Nieren ist sie ihm nicht gegangen, wie dem Mitstreiter. Als Mensch hat er sie leichter überwunden und ist mit ihr fertiger geworden und von dem Joch und der Gewalt der Lulu-Erdseele hat er so sich nicht unterdrücken und unterwerfen lassen, wie Frank Wedekind, ein Belasteter von Anfang an, von Blut und Wiege her. Humaner, urbaner, fröhlicher, munterer geht er durch sie dahin, und will kein fanatischer Besserer und Bekehrer, Prophet und Erneuerer sein, mehr Schilderer und Darsteller, Beobachter nur und Historiograph. Er schreibt sie in seinen Romanen und Erzählungen sich auch von der Seele herunter, und was er persönlich-menschlich von ihr erlitten hat, die Wunden, die ihre Teufelshände ihm gekratzt haben, bringt er zum Verharschen. Aus den Tyranninnen, die ihm die Simsonlocken scheren wollten, werden Romanheldinnen, Erinnerungen, die nur noch als Phantasien und Illusionen an ihm vorüberziehen, aber er ist auch frei von ihnen geworden und wird nur nicht in die Versuchung kommen, ihren Schatten mit einer Selbstmordwaffe nachzuspringen. Sie haben ihm die Locken nicht scheren können. Als Mensch hat er das Psychopathisch-Unbelastete voraus, die gesündere Konstitution, und die ganze innere Erregung, der hochgradige leidenschaftliche Subjektivismus der Wedekindschen Kunst wird bei Artur Landsberger zur kühleren, überlegenen, uninteressierten, unbefangenen Objektivität. Wedekind, der Mitspieler, der Akteur in unserer Kulturtragödie, der sie ganz als eigenste Angelegenheit erlebt, als Krankheit und Wolf, die an ihm fressen, wird an ihr zum Dramatiker, der in die Abgründe, in die Motive und die Ursache herabsteigt, und sich selbst auf den Seziertisch legt. Landsberger kann ihr gegenüberstehen, als Erzähler mit allen dessen Drängen ins Weite und Breite, der sie als ein buntes äusseres Geschehen, als reiche Bilderwelt an sich vorüberziehen lässt, als eine Angelegenheit der anderen, mit um so grösserer Ruhe, um so besserer Heiterkeit auch, je weniger man sie mitmacht, je freier man von ihr wurde, je mehr man sie als Schauspiel und Komödie, als der Anderen Narrheit und Dummheit schauen, beklagen und belächeln und kritisieren kann.
Ein geborener Erzähler, der zu spannen weiss, mit all den naiven, elementaren Instinkten eines echten und rechten Fabulisten, der, den bunten Farbenteppich der Begebenheiten, Geschehnisse aufrollend, gerade das tut, was das allgemeinste, ursprünglichste allermenschlichste Kunstbedürfnis, der breitesten Volksmassen, jedermanns Bedürfnis ist. Plauder- und Unterhaltungslust, Hörfreude. Kunst dem Volke! Volkskunst! Als geborener Erzähler ist Landsberger auch der geborene Kunstpopulisator, dem alles darauf ankommt, ankommen muss, dem es schönster Sieg und Triumph ist, wenn er nicht eine stille kleine Gemeinde, sondern als epischer Dränger ins Weite und Breite auch weiteste und breiteste Volksmassen zu seinen Füssen sieht, ein einzig Volk von lauter Kunstdilettanten und Kunstlaien nur, zu denen man auch nur als Dilettant sprechen kann. Mit höchster und berechtigtster Genugtuung darf auch Landsberger darauf hinweisen, dass er erreicht hat, was eine Kunst, wie die seine, auch in erster Linie erreichen will, — gelesen zu werden, und freudig-fröhlich sich preisen, weil er ein gelesenster Autor ist, — Tatsachen, Ziffern reden lassen. Eine halbe Million Menschen haben seine Romane schon gekauft. Das ergibt Millionen Leser. Die künstlerischen Paradieseskinder aber sind daheim nur unter diesen Massen, den Laien, den Dilettanten, den rein nur Geniessenden, den Empfangenden, den völlig noch Empfänglichen. Den höchsten Kunstrausch, die seligsten künstlerischen Entzückungen und Ekstasen haben wir nur dann erfahren, als wir noch wie dieses Volk und wie diese Kinder waren, recht kritiklos die wunderbaren schönen Geschichten lasen und in die Welt der Kunst als in die süsseste Märchenwelt hineinsahen, die Finger in die Ohren gestopft, fiebernd und gierig die Seiten verschlangen und alles glaubten, alles für wahr hielten. Die Tore gerade dieser seligen, naiven Paradieseswelt, der Kunst Urland und Kinderreich schliessen sich, wenn man Kunstkenner und Wissender, Kunstgelehrter wird, und nicht mehr nur ein Kunstempfangender und Beschenkter, elementarer Geniesser ist, sondern auch Kunstproduzent und Kunstarbeiter selber, und dabei auch Schweiss schwitzen muss. Wenn man dann immer auch etwas zum Eduard Hanslick wird, der nur zu wahr, zu richtig von sich, von uns Kritikern sagt: Wir sitzen da, auch vor den höchsten Offenbarungen, und stochern uns mit dem Zahnstocher im Mund. Verwundert sehen wir die Naiven, die dabei so jubeln, so weinen und lachen können. Da aber wird es auch zur Aufgabe, dass wir nicht so verknöchern und nicht so Uebersättigte werden, uns trotzdem die frischen Sinne bewahren und uns immer wieder zu verjüngen suchen, und möglichst reiche Reste der Naivität, der Kindheit und Unschuld und der paradiesischen Lüste retten und bewahren, — einen Dilettantismus, der durch alle höchsten, tiefsten und echtesten Kunstwerke als verborgenster Unterstrom fliesst.
Die Fruchtbarkeit, die Leichtigkeit und Sorglosigkeit, mit der sich Artur Landsberger die Romane aus dem Aermel schüttelt, die reinen elementaren Fabulierfreuden seiner Kunst, sind Zeugen, dass er von dieser goldenen Naivität, Kindlichkeit, von diesem Dilettantismus weiss und damit die Elemente einer Popularitätskunst geschicktest verwerten kann. Auch als Produzent ist er mehr Geniesser, als Arbeiter. Das fühlt man aus seiner Kunst sehr unmittelbar heraus, wie ihm das Erzählen und Unterhalten und Plaudern, das Erfinden Bedürfnis, Lebensbedürfnis, Lebensfunktion ist, das ihm selber eine einzige Freude und Lust bereitet, ihm Spass macht und auch damit einen besten Zweck erfüllt, dass es ihm zur Quelle einer Daseinsfröhlichkeit wird. Nur durch dieses eigene innere Fabuliervergnügen steckt er seine Zuhörer an, erreicht er seine Wirkungen auf so weite und breite Massen. Seine Fruchtbarkeit ist auch ein Erbgeschenk all der Alexander-Dumas-Geister, der geborenen Erzählergenies, wie bei den Artisten und Aesthetizisten, den l’art pour l’art Bekennern, vielfachst eine Sparsamkeit der Produktion auffällig hervortritt. Und diese Kunstfleissigen werden immer über die Fruchtbarkeit, Leichtigkeit und Unbekümmertheit der Konkurrenten sich zornig ereifern, und höhnen und spotten und mit Platenschem Munde sagen:
Er schmierte wie man Stiefel schmiert, vergebt mir diese Trope,
Er war ein Held an Fruchtbarkeit, wie Calderon und Lope ...
Calderon und Lope aber können solche Kritik und diesen Hohn nur als ein höchstes Lob und eine Bewunderung aller Bewunderungen hören und fühlen.
Da legt sich auch das strahlendste Lächeln um Artur Landsbergers Mund, wenn jene und alle Geister einer Eduard-Hanslick-Kritik ihm, dem Kunstgenüssling, die Handwerker- und Arbeiterhand auf die Schulter legen und ihm sagen: Schreiben Sie weniger! Statt zwölf Bücher nur vier, nur ein Buch. In Ihnen lebt sehr viel mehr Kunst und Schöpferkraft, als Sie in Ihren Werken niederlegen und zum Ausdruck bringen. Wollen Sie doch nur unser Bester sein. Die Gaben dazu haben Sie in sich Aber Ihre Publikumserfolge sind Ihr Unglück und Ihre Verführung, dass Sie mit allem Ihrem Können und Ihren Kräften Schindluder treiben. Artur Landsberger steckt sich die Hände in die Hosentaschen und pfeift sich eins. Seht nur das eine, dass ich nicht will, nicht will. Nichts, gar nichts liegt mir an dem literarischen Ruhm und allen Euren Unsterblichkeitsgesängen. Als Lust- und Vergnügungsgarten, nicht als Arbeitsfeld, hege ich meine Kunst mir ein. Seid Ihr Artisten — aber lasst mich den Dilettantismus kosten als ein Seligstes und seine Unbefangenheiten, dass wir wieder sein Können, wie Lilien auf dem Felde, und singen wie der Vogel singt. Das schnelle Schreiben nur, das Improvisatorische, die gute Eingebung ist mein Vergnügen nur, mein Element, in dem ich mich wie ein Fisch tummle. Nur mich selber will ich dabei nicht quälen und Schweisstropfen vergiessen, — mich unterhalten, anregen und die anderen anregen und unterhalten Mir genügt es! Erzähler bin ich, Schilderer des Geschehens, sinnenfroher Seher des Jahrmarkttreibens, Spaziergänger im Haine der Kunst. All das innere, teils übersinnliche Erleben, das sich mir bei diesem spazierengehenden Schreiben aufdrängt, behalte ich recht für mich. Das sind tausenderlei Dinge subjektivster Empfindungen, heimlichster eigener Freuden, die nicht ins Buch kommen. Denn sie dort hineinzubringen, würde eben Schweiss kosten.
Da wird auch Artur Landsberger zum Bekenner des Lebens, das über aller Kunst ist, dem die Kunst nicht Selbstzweck, sondern des Lebens Dienerin ist. Auch etwas wie Surrogat und Ersatz nur. Wenn man es erlebt, ist noch besser, als wenn man es nur dichtet, — die Realität eleusinischen Daseins das noch Wertvollere, als auch die schönsten Stefan Georgeschen Gedichte und die Träume und Illusionen von ihm. Das noch höhere neue Ziel leuchtet da auf, — die Verwirklichung unserer Künstlerträume und Idealreiche. Da sagt auch Landsberger von sich selber und als besseren Gewinn betrachtet er es, wie Lassalle zu sein, der in seine Bücher und Werke nur sein Talent hineingibt und das Genie ins Leben hinein. Und ich höre im Geist das tiefste und goldenste Lachen meines toten Bruders von der Freiheit des Menschen über allem Ruhm und Eitelkeitsgierden: „Und fragt Ihr, was ich schaffe? Ich lebe!“ Der Kunstgeniessende hat vor dem Kunstschaffenden auch etwas voraus. Er Der Herr, sie seine Diener und Arbeiter. Diese die Köche, er der Speiser der leckeren Gerichte. Jedermann, jedermann kann da zum Sultan werden, und den unermesslichsten Staat von lauter Hofpoeten, Sängern und Tänzern, Sängerinnen und Tänzerinnen um sich scharen. Ihnen sieht und hört ein Sultan nichts ab, was nicht auch jedermanns, jedermanns Eigentum werden kann. Die Protzenkulturmenschen aber, die Landsberger in seinen Romanen geisselt, können sich alle ihre Wände mit Rembrandts und Goyas tapezieren, und sind dabei die ärmsten Schlukker und Kirchenmäuse. Sie können’s nicht geniessen. Für sie sind’s nur Schaugerichte, von denen sie aber nicht essen können.
Das künstlerische Paradieseskind in Artur Landsberger, das nur geniessen und nicht arbeiten und Schweiss vergiessen will, seine evangelische Lehre vom grössten Glück der Lilie auf dem Felde, ist ja ein bisschen Egoismus auch, Uebermenschliches in einer Welt, wo alle nur Menschen sein können. Für sein Kunstwerk wäre es gewiss vom Vorteil, wenn er sein bestes Menschliche, das Höchste und Stärkste seines Lebenswissens, den reinsten Gewinn aller Lebenskunst, nicht ausserhalb seiner Werke stehen liess, sondern dieses auch hineintrüge und hineinstellte, nicht die Trüffeln für sich behielte und nur die für die gebildete grosse Masse verdauliche Nahrung liefern wollte. Schade, dass er nicht will. Freund Merck wird ihm auch immer auf die Schulter klopfen und ihm zurufen, ihn peitschen: Will! Hier ist das Tor zu dem ganz Grossen, zu der neuen Kunst, dem neuen Leben, der neuen Organisation über all diese bisherige Sünden- und Lügenkultur, von der wir nur eines wünschen können, dass sie von der Sintflut dieses Krieges weggefegt wird und Platz wird für neue Noahskinder.
Und ich glaube auch, ich darf wohl sagen, ich weiss es, dass Artur Landsberger zuletzt mit besonderer Genugtuung, mit eigenen Zustimmungen den Berserkerkritiker lesen wird, der mit allen höchsten Forderungen über ihn herfällt. Es sind das immer auch beste Anerkennungen, eine Hochachtung: Du kannst mehr, als Du willst. Deine verdauliche Nahrung für die grossen Massen ist doch etwas anderes noch als die Milch- und Wassersuppen der eigentlichen Unterhaltungsfabrikanten, der Schönfärber, der verlogenen trüben Ideologen, der Publikumsschmeichler. Als alte hohe Ahnenbilder stehen am Eingang zur Kunst Landsbergers Petron und sein „Gastmahl des Trimalchio“ und des Apulejus Zaubermär von der Verwandelung des Dichters in den goldenen Mammonsesel, die grossen Kritiken der Mord- und Raubkultur, der Kulturprotzerei, zu der alle bisherige Kultur nur als zu ihrer Frucht gelangen konnte. Wenn die Sintflut, und dass die Sintflut über sie kommt, und das neue Chaos, aus dem doch endlich ein Besseres noch heraufsteigen kann, dessen sei Freude, da steigt Neuland, Fruchtbarkeitsland auf.
Und auch Artur Landsberger, der nicht nur unterhält, sondern Sittenschilderer, Sittenrichter, Kläger und Ankläger ist, weist und führt zu ihm hin. Aus dem Sturm und Drang seines ersten Romanes von der Hilde Simon steigt er herauf zu seiner Erzählung „Um den Sohn“, wo er am tiefsten geht und auch Trüffeln hineinsteckt, die er sonst für sich und seine Lebenskunst nur aufspart. Er ist noch jung und braucht sich nicht als Fertiger zu fühlen. Und will vielleicht doch auch einmal noch, um des Sohnes, um der Söhne willen, das Land unserer Söhne und Kinder, der Ueberwindung unserer Berliner W. W.- Kultur, alles dessen, was wir bisher Kultur nannten; der Kultur eines Menschen, der immerdar von sich als von einem Gottmensch sprach, und dessen Gott- und Uebermensch stets auch nur die wildeste böseste Bestie gewesen ist. Das innere, übersinnliche Erleben, das Artur Landsberger nicht in sein Werk hineingeben will, für seine Lebenskunst sich aufspart, spürt man doch als einen geheimsten, verborgensten Unterstrom, und auch für den Kritiker ist es wohl die schönste Aufgabe, wenn er, sich ganz in die Seele des Erzählers versenkend, bis dahin zu dringen sucht.
Julius Hart
Euch armen mädchen widme ich dies buch
Erster Teil
Frau Geheimrat Reinhart
an Aenne Hoffmann.
Wertes Fräulein!
Ich habe bisher stillschweigend die Beziehungen zwischen Ihnen und meinem Sohne geduldet. Indessen scheint es mir jetzt, wo mit bestandenem Referendarexamen die Studentenzeit hinter ihm liegt, — deren Freiheiten und Torheiten ich mehr wohl als sonst eine Mutter Rechnung getragen habe — an der Zeit, dass Sie sich trennen.
Aus eben diesem Grunde habe ich meinen Sohn gebeten, auf die in solchem Fall übliche Aussprache — die sogenannte letzte Begegnung — zu verzichten. Und zwar in Ihrem Namen.
Ich durfte das, da ich weiss, dass wir uns in dem Wunsche, ihm einen notwendigen Schritt nicht unnütz zu erschweren, begegnen.
Mit gleicher Post sende ich Ihnen einen Scheck über zehntausend Mark. — Wenn Sie früher oder später einmal vor eine für Ihr Leben wichtige Entscheidung gestellt sind: möglich, dass dieser Rückhalt Ihnen dann erlaubt, neben Ihrer Vernunft auch Ihr Herz zu befragen. Und gern will ich wünschen, dass Sie dann das Richtige treffen.
Mit bester Begrüssung
Frau Geheimrat Julie Reinhart.
Aenne Hoffmann
an Frau Geheimrat Reinhart.
Gnädige Frau!
Sie reissen mich aus allen Himmeln. Ich erhalte eben während meiner Tischzeit Ihre Zeilen, die alles in mir durcheinanderwerfen. Ich bin ganz ratlos, hilflos, verzweifelt. Ich weiss ja nichts, ich verstehe ja nichts; aber ich fühle, dass das nicht geht. Nicht heut und nicht morgen, und überhaupt nicht. Bei mir nicht und auch nicht bei ihm. Sie wissen ja nicht, wie lieb wir uns haben! Das kann ja nur so ein Gedanke von Ihnen sein. Denn unsere Liebe, die hat ja nichts mit der Studentenzeit und dem Examen zu tun und mit all dem, was Sie sonst noch schreiben. Die ist eben da! Gott weiss, wieso. Ich nicht. Und ich darf auch gar nicht daran denken, dass es jemals anders kommen könnte! Ich wüsste nicht, was sonst geschähe. Also bitte! Bitte! Nichts mehr von einer Trennung! Und den Scheck lege ich wieder bei. Ich denk mir, das war nur so eine Versuchung. Aber ich brauche kein Geld, solange ich gesund bin, solange ich arbeite und — das gehört natürlich dazu — solange der Peter mich lieb hat.
Hochachtungsvoll
Aenne Hoffmann.
Frau Geheimrat Reinhart
an Aenne Hoffmann.
Mein wertes Fräulein!
Wollte ich Ihnen die Gründe nennen, aus denen ich Ihrem: „es geht nicht!“ mit aller Bestimmtheit ein: „es muss gehen!“ entgegensetze, so hiesse das, Ihnen eine Schilderung von der Verschiedenheit der Welten geben, in der Sie und wir nun einmal leben.
Dass diese Verschiedenheit besteht, kann man bedauern, aber man kann es ebenso wenig leugnen wie ändern.
Die Welt geht ihren Gang — und wir müssen ihn mitgehen. Das mag manchmal nicht leicht sein. Aber sich widersetzen, heisst: zu Schaden kommen. Was Ihnen jetzt geschieht und was ich von Ihnen fordre, ist nichts Ungewöhnliches und nichts Unerhörtes, fast möchte ich sagen: es ist etwas Alltägliches.
Daran ändert nichts, dass es jeder, dem es just passiert, als ein grosses Unglück empfindet — und ein noch grösseres Unrecht.
Erfragen Sie unter Ihren Kolleginnen, soweit sie nicht gar zu jung oder gar zu hässlich sind, ob sie nicht alle einmal diesen ersten Schmerz ertragen mussten und — wie sie ihn ertragen haben. Denn so viel ersehe ich bereits aus Ihren wenigen Zeilen, dass Sie nicht weltfremd genug sind, um zu glauben, mein Sohn, dem bei seiner Begabung und seinem Namen, den ihm sein in Gott ruhender Vater hinterlassen hat, und den in Ehren zu halten seine erste Pflicht ist, die Welt offen steht, konnte jemals daran denken — ja, ich will nicht ein Gespenst an die Wand malen, dessen ganze Widersinnigkeit so augenfällig ist, dass sich bei dem blossen Gedanken meine Feder sträubt.
Also, mein liebes Fräulein, nehmen Sie Vernunft an, statt sich im Ueberschwange Ihrer Gefühle jeder verständigen Erwägung zu verschliessen. Was sich heute vielleicht in einem grossen Schmerze äussert, dann aber als liebe Erinnerung, die man nicht einmal missen möchte, fortlebt, würde in zwei Jahren wahrscheinlich Ihren Zusammenbruch bedeuten.
Mir liegt als Mutter vor allem daran, von meinem Sohne alles, was die Heiterkeit seines von Natur aus frohen Gemütes trüben könnte, so lange wie irgend möglich fern zu halten.
Sie haben es also in der Hand, ihm einen notwendigen Schritt zu erschweren oder zu erleichtern. Ich weiss, dass stumm entsagen, grosse Liebe voraussetzt. Aber da ich keinen Grund habe, an der Aufrichtigkeit Ihrer Gefühle zu zweifeln, so weiss ich auch, wie Sie sich nun entscheiden werden.
Ich versichere Sie meiner aufrichtigen und jederzeit bereitwilligen Gesinnung und bin mit freundlichen Grüssen Ihre ergebene
Julie Reinhart.
Aenne Hoffmann
an Frau Geheimrat Reinhart.
Gnädige Frau!
Ich sitze vor Ihrem Briefe und weiss mir nicht zu helfen. Ich möchte ja gewiss alles Gute tun, um ihm zu nützen. Aber was Sie wollen, das kann nicht gut sein. Ich will die Welt nicht ändern; und auch die Menschen nicht. Es soll nur alles so bleiben, wie es ist — und was weiter kommt, das wollen wir ruhig der Zukunft überlassen.
Ich habe die Sprache nicht in der Gewalt wie Sie, und mir fehlt ja auch die Erfahrung, aber das sagt mir doch mein Verstand: wenn Peter so dächte, wie Sie, dann wäre es gewiss nicht nötig, dass Sie mir viele gute Worte geben. — Aber Peter denkt anders! Das weiss ich! Peter denkt wie ich!
Also nochmals: ich kann nicht! Und bitte, quälen Sie mich nun nicht länger. Ich bin schon halbtot und kann meine Erregung vor meinen Eltern kaum noch verbergen.
Hochachtungsvoll
Aenne Hoffmann.
Frau Geheimrat Reinhart
an Aenne Hoffmann.
Wertes Fräulein!
Statt wie ein vernünftiger Mensch zu erwägen, zu prüfen und zu entscheiden, flattern Sie wie ein gescheuchter Schmetterling schreckhaft auf. Ich fürchte sehr, Sie werden sich, wenn Sie mir nun nicht bald folgen, die Flügel verbrennen!
Ich würde es sehr bedauern, wenn Sie mich durch weiteren Widerstand zwängen, die Vermittelung Ihrer gewiss ahnungslosen Eltern in Anspruch zu nehmen.
Dies ist mein letzter Versuch. Eine weitere Korrespondenz wäre zwecklos. Ich füge auch den Scheck wieder bei und begrüsse Sie bestens.
Frau Geheimrat Reinhart.
Telegramm Aenne Hoffmanns
an Peter Reinhart.
Dr. Peter Reinhart. 7 Montague Square. Edinburgh. Denke, Deine Mama schreibt mir, dass mich von Dir trennen soll. Bin völlig hilflos und verzweifelt; drahte, dass fühlst wie ich, dass Trennung unmöglich Ganz Deine Aenne.
Aenne Hoffmann
an Frau Geheimrat Reinhart.
Gnädige Frau!
Ich wusste mir in meiner grossen No nicht anders zu helfen und habe an Peter nach Schottland telegraphiert. Und Peter hat geantwortet: „Sei standhaft! Ich halte zu Dir!“
Sie sehen also, wie recht ich hatte! Ich wusste es ja! Es wäre auch furchtbar, wenn es anders wäre.
Darum dürfen Sie aber nicht etwa denken, dass Peter Sie nicht lieb hat. Ich weiss, wie er an Ihnen hängt. Und wenn er jetzt auch zu mir hält — lieb hat er Sie darum doch. Ich liebe ja meine Eltern auch und könnte doch ohne den Peter nicht leben.
Und nicht wahr, nun quälen Sie mich nicht mehr. Sie werden ja auch fühlen, dass es für Peter gut ist, wenn alles so bleibt, wie es ist.
Ich bin schon ganz krank von all den Aufregungen der letzten Tage. Wenn doch Peter erst wieder da wäre!
Hochachtungsvoll
Aenne Hoffmann.
In grosser Eile! Daher nur dies! Und dies so flüchtig! Es ist mittags, und ich muss ins Bureau!
Frau Geheimrat Reinhart
an Frau Hoffmann.
Werte Frau Hoffmann!
Es tut mir leid, Sie mit diesen Zeilen bekümmern zu müssen; aber meine Versuche, Ihnen den Kummer zu ersparen, sind an dem Eigensinn Ihrer Tochter gescheitert.
Ich weiss nicht, ob es Ihnen bekannt ist, dass Ihr Kind seit einer Reihe von Jahren zu meinem Sohne Beziehungen unterhält, deren Charakter mir natürlich unbekannt ist. Es liegt mir daher fern, etwa der Ehre Ihrer Tochter zu nahe zu treten.
Jedenfalls musste sie sich bei der Verschiedenheit ihres Bildungsgrades und ihrer sozialen Stellung von vornherein klar darüber sein, dass diese — nun, nennen wir es einmal Freundschaft, eines Tages ihr Ende finden würde. Wie derartige Beziehungen denn überhaupt wegen der Schwere der Trennung nicht über Jahre hinaus bestehen sollten.
Und da mein Sohn mit Bestehen der ersten staatlichen Prüfung — nicht mehr wie bisher entschuldigt durch seine Jugend — die volle Verantwortung für alle seine Handlungen trägt, so darf er auch nicht mehr in das Schicksal eines Menschen eingreifen, dessen Leben von Natur aus eine andere Richtung geht als das seine.
Aus diesem Grunde liegt es im Interesse unserer beiden Kinder, dass sie ihre Beziehungen, gleichviel welcher Art sie waren, abbrechen. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie in diesem Sinne auf Ihre Tochter einwirken; ihr jede weitere, auch schriftliche, Verbindung mit meinem Sohne verbieten und dafür sorgen, dass auch jeder Versuch meines Sohnes, sich ihr wieder zu nähern, an Ihrer strengen Aufsicht und dem festen Willen, einen Verkehr nicht mehr zu dulden, scheitert.
Die kleine Summe, die ich in einem Scheck beilege, ist dafür bestimmt, Ihrer Tochter, der wir alles Gute wünschen, das Fortkommen zu erleichtern.
Hochachtungsvoll
Frau Geheimrat Reinhart.
Frau Hoffmann
an Frau Geheimrat Reinhart.
Sehr gnädige Frau Geheimrat!