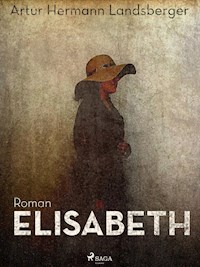Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Leser verfolgt die neureiche Familie Lesser bei ihren hochmotivierten Bemühungen, ihr Judentum abzuschütteln und den Habitus reicher Bildungsbürger zu erlangen.Während Leopold Lesser gesellschaftliche Anerkennung in allen möglichen Klubs sucht und sich unter die Großinvestoren mischt, versuchen auch seine Frau Emilie und seine Tochter Jette mithilfe des Barons von Prittwitz, Teil der entsprechenden Kreise zu werden. Einzig Leopolds Sohn Walter versucht beharrlich, seiner Familie die Zwecklosigkeit einer Konversion aufzuzeigen ... Landsberger karikiert in diesem Roman gekonnt und unterhaltsam die Verlogenheit und den Snobismus einer Familie, die exemplarisch steht für ein ganzes Milieu!Artur Landsberger (geboren am 26. 03. 1876 in Berlin; gestorben am 04. 10. 1933 in Berlin) war ein deutscher Schriftsteller, Publizist und Kritiker. Der aus einer zum Protestantismus übergetretenen jüdischen Kaufmannsfamilie stammende Autor studierte Jura. Nach der Promotion 1906 in Greifswald gründete er 1907 die Zeitschrift »Morgen«, an der Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss als Ressortleiter mitarbeiteten und für die u. a. Rainer Maria Rilke, Frank Wedekind, Gerhard Hauptmann und Thomas Mann schrieben. 1909 gab er die Schriftleitung ab und lebte fortan als Unterhaltungsschriftsteller und Kolumnist. Als scharfzüngiger Gesellschaftskritiker Landsberger von den Nationalsozialisten verfolgt, nahm sich Landsberger 1933 das Leben.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Artur Hermann Landsberger
Millionäre
Illustriert von R. L. Leonard
Saga
Millionäre
© 1913 Artur Hermann Landsberger
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711488430
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Im Mai 1913
Lieber Leser!
Du hast meine Bücher beschimpft – und das hat mich nicht bekümmert; du hast sie gepriesen und mir versichert, dass sie Gutes wirken könnten – und das hat mich nicht erfreut. Du hast meine Bücher gelesen und dich über sie erregt – für und wider – und das hat mir genügt.
Du hast mir zu jeder meiner Figuren Modelle genannt; zu mancher gleich ein halbes Dutzend – und das hat mich erheitert; du hast vieles, was vorging, Plagiat nach dem Leben gescholten – und das hat mich, da alle Begebenheiten frei von mir erfunden waren, beinahe an mich glauben gemacht.
Du wirst meine Neugier begreifen, auch die Modelle dieses Buches kennen zu lernen. Kannst du mir darüber glaubhafte Angaben machen und mir sagen, wo sich die von mir erfundenen Begebenheiten im Leben zugetragen haben, so will ich – gewiss ein Preis, für den es sich der Mühe lohnt – hiermit die Reihe meiner Berliner Bücher beschliessen.
Berlin W9.
Dr. Artur Landsberger
Erstes kapitel
Emilie Lesser entwirft ihr Wochenprogramm
Frau Emilie Lesser sass an einem Sonntag nachmittag mit ihrer Tochter Jette vor der zehnten Beilage des Berliner Tageblatts und strich mit einem roten Bleistift diejenigen Theater, Konzerte und Vergnügungen an, deren Besuch in dieser Woche in Frage kam.
Es ging etwas bunt durcheinander. Jette schlug vor, wovon sie sich Vergnügen versprach. Aber Emilie traf ihre Wahl nach Zweckmässigkeit. Dabei liefen Irrtümer aller Art mit unter.
Der Prophet wurde abgelehnt, weil der Name des Komponisten kein Vertrauen einflösste. Ja, Emilie konnte gar nicht fassen, was ein Mann namens Meyerbeer im Königlichen Opernhause zu suchen hatte – und entschied sich für die Quitzows, von denen ihr Bekannte schon in Neutomischel erzählt hatten.
„Donnerstag sind wir bei Sterns.“
„Bex!“ sagte Jette.
„Was heisst bex?“ fragte Emilie. „Die Leute sind zwar auch mir unausstehlich und haben keinen guten Namen; dafür aber eine grosse Zukunft. Also verhält man sich mit ihnen.“
Jette suchte zu widersprechen:
„Mit der grossen Zukunft braucht sich doch ihr Name nicht zu bessern,“ sagte sie.
Da legte Emilie die zehnte Beilage des Berliner Tageblatts beiseite und sagte in feierlichem Tone:
„Mein liebes Kind! Du bist im nächsten Jahre erwachsen. Merke dir als ersten Grundsatz allen gesellschaftlichen Lebens: Lediglich der Erfolg entscheidet. Bei einem Vermögen von einer Million aufwärts hört der Ruf auf, eine Rolle zu spielen. Nur Leuten in mittlerer Vermögenslage spürt man nach. Um Rothschilds Geschäfte kümmert sich niemand.“
Und als Jette ein ganz verdutztes Gesicht machte, lachte Emilie und klopfte ihr auf die Schultern:
„Du musst noch viel lernen, mein Aeffchen, ehe du auf die Gesellschaft losgelassen wirst. Aber nun weiter! Was ist Freitag, zeig’ mal!“ und sie beugte sich über das Blatt:
„Freitag abend ist Papa doch gern zu Hause,“ sagte Jette.
„Das muss doch mal ein Ende haben,“ erwiderte Emilie nervös, – „mit diesen Freitagabenden! – In Neutomischel – nu ja, da hab’ ich mir das gefallen lassen. Aber hier, in Berlin, macht man sich mit solchen Dingen lächerlich; schon vor den Leuten. Hier fällt Schabbis eben auf Sonntag. Und da er auf Sonntag fällt, können wir nicht Freitag anfangen, ihn zu feiern.“
„Ich habe mich die ganze Woche über immer auf den Freitagabend gefreut,“ sagte Jette.
„Ich werde für lohnendere Zerstreuungen sorgen, verlass’ dich drauf!“ erwiderte Emilie.
„Und Walter geht es genau so. Es ist doch kein Zufall, dass seine Briefe regelmässig am Sonnabendmorgen kommen. Solange er in München ist, hat er an jedem Freitagabend an uns geschrieben.“
„Mir wäre lieber, er suchte drüben in Kreise zu kommen, die ihm später einmal nützen können – statt die Gewohnheiten von früher beizubehalten, die ihm in seiner Karriere nur hinderlich sind.“
„Die Stimmung in seinen Briefen zeigt doch aber, wie sehr er daran hängt.“
„Leider!“ sagte Emilie; „wenn das nicht anders wird, dann muss er im nächsten Semester zurück.“
„Aber Mama!“ rief Jette, „wo er es drüben mit der Fakultät so gut getroffen hat.“
„I was!“ widersprach Emilie, „was heisst Fakultät! Darauf kommt es nicht an. Um Karriere zu machen, sind Verbindungen und Protektion wertvoller als wissenschaftliche Leistungen. Und die kann er hier leichter anknüpfen als in dem stupiden Biernest!“
„Na, Minister wird Walter ja nicht gleich werden wollen!“ sagte Jette.
„Warum nicht!“ erwiderte Emilie, „nichts ist unmöglich. Wenn es mir gelingt, unsere Vergangenheit auszulöschen, dann ist mir auch vor der Zukunft nicht bange.“
„Ist denn an unserer Vergangenheit etwas auszulöschen?“ fragte Jette.
„Wenn doch die anderen auch so schnell vergessen würden!“
„Was ist denn zu vergessen?“ fragte Jette ängstlich.
„Alles!“ rief Emilie. „Was war und was ist! Auch was morgen sein wird – das alles muss vergessen werden!“ Emilie erregte sich. „Dass wir je Lesser hiessen – meine Eltern gar Cohn – dass wir aus Neutomischel stammen, dass wir aus kleinen Verhältnissen kommen, einen Manufakturladen hatten, in dem ich, deine Mutter, mit diesen beiden Händen persönlich die Kunden bedient habe – ja!“ – schrie Emilie – „glaubst du denn, dass diese Schande von heut auf morgen auszulöschen geht!“
„Ich kann daran nichts Unanständiges finden!“ sagte Jette in aller Ruhe.
„Eine Schande ist es!“ erwiderte Emilie – „Und wenn wir von jetzt ab auch nur einen Abend in der Woche ausgehn, dann am Freitag.“
„Aber wohin?“ fragte Jette und beugte sich mit Emilie wieder über das Blatt.
„Das will ich dir sagen!“ rief Emilie triumphierend und unterstrich dreimal dick in der zehnten Beilage des Berliner Tageblatts:
Freitag, den 25. Januar, abends 8 Uhr, Königlicher Dom: Konzert der Königl. Hof- und Domkapelle, Sanctus und Benedictus. (Marcellus-Messe) – Leo: Psalm 50 (8stg) – Bach: 2 Motetten für 8stg – Verdi: Ave Maria.
Dann stand sie auf und stürzte, das Wochenprogramm in der Hand, die Treppen hinunter in die Parterreräume, in denen Leopold, ihr Gatte, seine Bureauräume hatte.
Zweites kapitel
Leopold Lesser zieht Bilanz
Während Emilie mit ihrer Tochter das Wochenprogramm entwarf, sass Leopold, ihr Gatte, mit seinem Freunde Adolf Jacoby in seinem Arbeitszimmer und zog Bilanz.
„So’n dicken Kopf haben wir in Neutomischel nie gehabt,“ sagte Leopold zu Iacoby.
„Andere Welt!“ erwiderte er.
„Sag’ lieber: andere Menschen!“
„Das mein’ ich natürlich; und das ist schliesslich dasselbe. Es passt sich eben jeder dem Milieu und den Verhältnissen an.“
„Ne!“ widersprach Lesser. „Wer sozusagen was Persönliches hat – er braucht darum nicht gleich ’en Genie zu sein –, der bleibt derselbe, – gleichgültig wo er ist. Denk’ nur einmal an meinen Schwiegervater – na, das ist doch gewiss kein bedeutender Mensch. Aber meinst du, der wär’ auch nur um soviel anders geworden – oder hätt’ auch nur eine seiner Gewohnheiten abgelegt, wenn er nach Berlin übergesiedelt wäre?“
„Ich bitt dich! in dem Alter!“ erwiderte Jacoby.
„Das kommt nicht auf die Jahre an! wenigstens nicht ausschliesslich. Das liegt tiefer – liegt im Blut! – oder sonstwo! Jedenfalls: meine Frau und ich sind anders!“
„Leider!“ stöhnte Jacoby.
„Wenn’s sich nicht in tausend anderen Dingen zeigte, dann genügten allein die Zahlen!“
„Was für Zahlen?“ fragte Emilie, die eben mit dem Wochenprogramm in der Hand hereingetreten war, ohne dass Leopold und Jacoby es bemerkt hatten.
„Ich bitte dich, Emilie gewöhn dich daran, anzuklopfen, bevor du reinkommst. Erstens bekommt man regelmässig einen Schreck; und dann – du bemühst dich doch sonst in allen Dingen so fein zu sein – es gehört sich nicht.“
„Und ich bitte dich,“ erwiderte Emilie, – „mich nicht in Gegenwart deines Personals zu massregeln.“
„Jacoby ist kein Personal“ erwiderte Leopold. – „Er ist Freund des Hauses! Seit fünfzehn Jahren.“
„Ich wüsste nicht, dass er deine Bücher aus Freundschaft führt. Ich dachte, dass du ihn dafür bezahlst.“
„Das tu ich auch! Das ist ganz selbstverständlich. Das hindert aber nicht, dass er ...“
„Jemanden, der für Geld Bücher führt,“ unterbrach sie ihn – „nennt man einen Buchhalter – und Buchhalter sind für gewöhnlich Angestellte.“
„Sie haben nicht immer so gedacht, Frau Emilie!“ erwiderte Jacoby verletzt; „und ich entsinne mich einer Zeit, zu der Ihnen meine Besuche sehr willkommen waren.“
„Möglich, dass das früher – in Neutomischel – einmal der Fall war. Wie gesagt: möglich! – Ich gebe mir Mühe, diese Zeit zu vergessen. Neutomischel – wenn ich dies Wort nur höre! – existiert für mich nicht mehr.“
Jacoby trat an sie heran:
„Ich kann das ja begreifen,“ – sagte er zärtlich – „aber ich bin doch mit Ihnen gegangen – so gut wie Leopold und Ihre Kinder – Sie können doch unmöglich von heute auf morgen vergessen, Emilie, was zwischen uns beiden ...“
„Werden Sie nicht unfein!“ unterbrach ihn Emilie, „und sprechen Sie laut! Es schickt sich nicht, in Gegenwart meines Mannes zu flüstern. Er kann alles hören, was Sie mir zu sagen haben – Herr Jacoby!“
„Ne Kinder,“ sagte Leopold, ohne von seinen Büchern aufzusehen – „es ist mir schon lieber, ihr sprecht leise – ich fange jetzt bereits zum dritten Male an, zu zählen. – Oder noch besser, ihr geht nach oben – in einer halben Stunde komme ich nach – ich will nur hier erst die Bilanz fertigmachen.“
„Ich wüsste nicht, worüber ich mich mit Herrn Jacoby unterhalten sollte ... etwa über die Propheten oder die Quitzow?“
„Wir haben uns früher verstanden, auch ohne dass wir über den Propheten oder die Quitzows miteinander gesprochen haben,“ sagte Jacoby.
„Ich wiederhole Ihnen,“ rief Emilie wütend, – „Sie erinnern mich mit jedem Blick und jeder Silbe an Neutomischel – mir steigt förmlich der Geruch dieser Stadt in die Nase, wenn ich Sie sehe. Wenn Sie also wirklich eine Spur von Anhänglichkeit haben, so sorgen Sie dafür, dass wir uns nicht mehr begegnen – ich bitte Sie darum.“
Jacoby liess den Kopf sinken:
„Also gehe ich!“ sagte er.
„Was soll das heissen?“ fuhr Leopold auf.
„Ich will niemandem im Wege sein. Am wenigsten Ihnen, Frau Emilie.“
„Ich brauch’ dich!“ brüllte Leopold.
Jacoby zog die Schultern in die Höhe.
„Tut mir leid!“ sagte er.
„Ich find’ mich ohne dich nicht aus in meinen Büchern!“
„Hab’ dich nicht so!“ schalt Emilie; ’n Buchhalter wird wohl noch zu ersetzen sein!“
„Nich so leicht wie’n Liebhaber!“ erwiderte Jacoby.
„Was soll das heissen? – was bedeutet das?“ schrien Emilie und Leopold gleichzeitig.
„Weshalb soll ich keine Vergleiche ziehen?“ erwiderte Jacoby in aller Ruhe. „Ein Liebhaber is wie der andre – – was da verlangt wird, du lieber Gott, das weiss am Ende jeder. Aber ein Hauptbuch gleicht nicht immer dem andern!“ – und er wies auf den Tisch, auf dem Leopolds Bücher lagen – „und ein Buchalter, der sich da herausfindet, den soll sich Leopold erst mal suchen.“
„Wem sagst du das?“ erwiderte Leopold. „Meinst du, ich weiss nicht, was ich an dir habe?“
Jacoby sah zu Emilie hinüber.
„Mir fällt es auch nicht leicht,“ sagte er – „und schliesslich ist man ja in den fünfzehn Jahren nicht nur unter sich, sondern auch mit den Büchern verwachsen.“
„Nu also!“ erwiderte Leopold.
„Trotzdem gehe ich – leb’ wohl!“ sagte er und wandte sich zur Tür.
„Jacoby!“ rief Leopold, „du bist wahnsinnig!“ und sprang auf.
Jacoby wies auf Emilie.
„Gib ihm ein gutes Wort!“ sagte Leopold zu seiner Frau.
„Ich bitte dich, lass mich aus deinen geschäftlichen Dingen heraus. Wenn du ihn brauchst, musst du ihn halten. Ich kann dazu nichts tun!“
„Ich brauche ihn!“
„Dann bist du ein Esel, wenn du ihn gehen lässt.“
„Du hörst doch, Jacoby,“ sagte Leopold – „sie will, dass du bleibst.“
Jacoby wandte sich von der Tür ab und trat wieder ins Zimmer.
„Is das wahr?“ fragte er zaghaft.
Emilie sah ihn gross an. Dann schüttelte sie den Kopf und sagte:
„Aussehn tun Sie wieder, Jacoby! Jedem Stück, das Sie auf dem Leibe haben, sieht man an, dass es aus Neutomischel stammt. Wenn Sie sich wenigstens einmal die Haare schneiden liessen und einen Scheitel trügen! Sehen Sie sich doch die Leute auf der Strasse an, ob Ihnen auch nur ein einziger begegnet, der aussieht wie Sie!“
„Nu,“ sagte Leopold, „nu bist de doch wohl zufrieden – denn wenn ne Frau erst anfängt, sich um die Toilette eines Mannes zu kümmern, denn is er ihr auch nicht mehr gleichgültig.“
„Einem Hausdiener, der aussähe wie er, würde ich auch Vorhaltungen machen.“
Da wandte sich Jacoby, ohne ein Wort zu sagen, zur Tür und ging. –
„Ich habe dir doch gesagt, dass ich ihn brauche!“ brüllte Leopold, als er draussen war.
„So ruf ihn zurück!“ erwiderte Emilie – „aber erst wenn ich draussen bin. Er fällt mir auf die Nerven.“
Dann trat sie an den Schreibtisch und reichte ihm den Vergnügungsanzeiger für die nächste Woche.
„Was ist das?“ fragte er.
„Vielleicht nimmst du dir die Mühe, es dir anzusehen.“
Leopold warf einen Blick auf den Zettel:
„Danach steht mir jetzt nicht der Kopf,“ sagte er und legte den Zettel beiseite.
„Ich verlange, dass du dich wenigstens fünf Minuten mal mit deiner Familie beschäftigst.“
„Keine Redensarten, liebe Emilie, wenn ich bitten darf.“
„Was soll das heissen?“ fragte sie.
„Du weisst so gut, wie ich, dass ich mich von früh bis spät mit euch beschäftige, indem ich für euch Geld verdiene. Leider – na, wozu soll ich dir auch noch den Kopf verdrehen?“
„Was ist? bitte, rede!“ drängte sie.
„Nun, wir haben Bilanz gemacht.“
„Ja, und? ...“
„Die Ausgaben übersteigen die Einnahmen im letzten Jahre um 8700 Mark.“
„Wennschon!“ erwiderte Emilie. „So wirst du im nächsten Jahre eben mehr verdienen müssen. Ich wollte sowieso mit dir darüber sprechen.“
„Worüber?“ fragte Leopold.
„Nun, dass es in dem Stile natürlich nicht weitergehen kann.“
„Was willst du damit sagen?“
„Dass wir dazu nicht nach Berlin gezogen sind, um hier unser Leben von Neutomischel weiterzuführen – dann hätten wir ebensogut bleiben können, wo wir waren!“
„Wer war denn der treibende Teil, der das Leben in Neutomischel nicht mehr ertrug?“
„Ich, ich!“ erwiderte Emilie gereizt – „ich geb’s ja zu; noch ein Jahr in dieser Enge und unter diesen Menschen und ich wäre verrückt geworden.“
„Und mir hast du immer erzählt, es geschähe nur der Kinder wegen.“
„Gewiss! auch! – aber in erster Linie hab’ ich natürlich an mich gedacht. Damit aber, dass wir uns nun hier von allem ausschliessen, habe ich freilich nicht gerechnet.“
„Was das nur heisst,“ erwiderte Leopold und schlug eins der grossen Bücher auf. – „Hier überzeug dich selbst. In Neutomischel haben wir im letzten Jahre Siebentausendvierhundert Mark gebraucht und in Berlin im ersten Jahre weit über Vierzigtausend. Das ist das sechsfache.“
„Im Verhältnis von Berlin zu Neutomischel ist es die Hälfte! verlass dich drauf!“
Leopold nahm den Zettel, den ihm Emilie gegeben hatte, vom Schreibtisch auf und sagte:
„Und dieses Wochenprogramm beweist auch nicht gerade, dass wir uns von allem ausschliessen – im Gegenteil! Vielmehr liegen die Dinge so, dass wir ruiniert sind, wenn wir weiterhin alles mitmachen, statt uns einzuschränken.
Emilie glitt auf den Sessel, der ihr am nächsten stand.
„Einschränken ...“ wiederholte sie tonlos: – „wo man eben anfangen wollte, zu leben.“
„Es tut niemandem mehr leid, als mir;“ lenkte Leopold ein. „Ich hatte es mir auch anders gedacht.“
„Mit deinem Mitleid änderst du nichts.“
„Gewiss nicht!“
„Also wirst du wohl andre Mittel suchen müssen, um zu Geld zu kommen.“
„Es gibt keine!“
„So reden Feiglinge und Krämer! Wenn es so nicht geht, so versuche es ... in Kupfer ... oder in Getreide ... oder an der Börse ... oder, was weiss ich – jedenfalls wird es doch noch etwas andres auf der Welt als Buckskin geben!“
„Und meine Bestände?“ fragte Leopold.
„Was für Bestände?“
„Nu, mein Lager, – allein in Kommissionswaren hab’ ich für über achtzigtausend Mark Ware liegen.“
„Such’ die an Papa in Neutomischel loszuwerden; darin hast du doch Uebung.“
„Meinst du, der hat nicht längst gemerkt, wie wir ihn bei der Separation übers Ohr gehauen haben?“
„Sag’ ruhig: betrogen haben!“ ergänzte Emilie. „Wir brauchen einander doch nichts vorzumachen.“
„Nenn’s, wie du willst; jedenfalls wird er ein zweites Mal vorsichtiger sein.“
„Nicht einmal soviel traust du dir zu, mit einem Manne von zweiundsiebzig Jahren, der noch dazu dein Schwiegervater ist, fertig zu werden?“
„Würde es dir etwa passen, wenn ich den alten Mann zugrunde richte?“
„Was das für Redensarten sind!“ erwiderte Emilie; „wer spricht denn von zugrunde richten? Es ist doch selbstverständlich, dass ein anderer verlieren muss, wenn du gewinnen willst. – Also mach was du willst; jedenfalls ist es deine Pflicht, für einen standesgemässen Unterhalt deiner Familie zu sorgen. Wie du das machst, ist deine Sache!“
Drittes kapitel
Die grosse Chance
„Grossvater kommt!“ stürzte Jette ins Wohnzimmer, in dem Leopold und Emilie beim Nachmittagskaffee sassen.
„Was für’n Grossvater?“ fragten beide.
„Unser! – unser – unser!“ rief Jette – und war auch schon wieder draussen, riss die Korridortür auf und lief dem alten Manne entgegen.
Leopold und Emilie sahen sich an.
Gleich darauf hörte man eine laute Männerstimme; – ganz deutlich, da Jette in ihrer Erregung sämtliche Türen offen gelassen hatte.
„Wahrhaftig!“ sagte Leopold, „er ist’s!“
„Sehr unnötig!“ erwiderte Emilie verstimmt.
„Immerhin ...,“ meinte Leopold.
„Was heisst das?“ fragte sie.
„Nun, immerhin ist es dein Vater.“
„Wenn schon! – aber willst du mir vielleicht sagen, was ich hier mit ihm anfangen soll?“
„Das möchte ich auch wissen!“ erwiderte Leopold. „Wenn du wenigstens den Jacoby nicht fortgeschickt hättest.“
„Ich habe fortgeschickt?“ fragte Leopold erstaunt.
„Etwa nich?“ erwiderte Emilie. „Sonst wäre er doch da! – Wenn du nur immer auf mich hören wolltest!“
Und als Leopold sie ganz erstaunt ansah, sagte sie:
„Ich erinnere mich genau, dass ich dir geraten habe, ihn zu halten, wenn du ’n brauchst.“
„Meinetwegen,“ lenkte Leopold ein, „es ist ja nun auch gleich, wer ihn fortgeschickt hat.“
Leopold sah zur Tür; draussen hörte man deutlich eine Männerstimme.
„Wenn er sich wenigstens angemeldet hätte!“ sagte Emilie. „Ich habe jedenfalls keine Zeit, mit ihm herumzulaufen.“
„Ich glaube“ – sagte Leopold und machte eine Bewegung, als wenn er aufstehen wollte – „wir müssen ....“
„Ja!“ erwiderte Emilie und erhob sich. „Was er nur will?“
Auch Leopold stand jetzt auf.
„Ich kann mir schon denken!“ sagte er.
In diesem Augenblick trat Cohn ins Zimmer.
„Da seid ihr ja, Kinder,“ begrüsste er sie; gab Emilien einen Kuss auf die Stirn und drückte Leopold die Hand.
„Nun, euch braucht man nicht zu fragen, wie’s euch geht!“ sagte er ... „Ihr seht ja glänzend aus.“
„Es ist der reine Zufall, dass du uns antriffst,“ sagte Emilie.
„Sooo? – Wolltet ihr fort?“ fragte Cohn. „Ich will euch nicht stören. Was ich habe, is in ’ner halben Stunde erledigt. ’S Geschäft geht vor.“
„Wir wollten mit einer befreundeten Kommerzienratsfamilie auf acht Tage ins Riesengebirge!“ protzte Emilie.
„Gott behüte!“ rief Cohn, „bei die Kälte.“
Emilie lachte verächtlich.
„Im August kann man nicht Ski laufen.“
„Was ist das?“ – fragte Cohn, „wozu tut man das?“
„Zum Vergnügen!“ erwiderte Emilie, „und um schlank zu bleiben.“
„Recht habt ihr,“ sagte Cohn. „Wenn ihr’s euch leisten könnt. – Nehmt ihr’n Jacoby natürlich mit?“
„Wen?“ fragte Emilie.
Cohn sah sie gross an, dann lachte er und sagte:
„Kennt ihr’n Jacoby nich?“
„Ach so – ja – Leopolds früheren Buchhalter.“
„Früheren? – was heisst das?“ fragte er ganz bestürzt.
Leopold hat ihn entlassen.
„Entlassen? – den Jacoby?“
„Seine Leistungen genügten ihm nicht mehr.“
„Ja, was, was fängt der Mensch nun an?“ – Cohn war ganz ausser sich.
„Unsre Sorge!“ sagte Emilie.
„Ihr habt’n doch mit euch nach Berlin genommen – von selbst wäre er nie von Hause fortgegangen.“
„Er ist ’n ausgewachsener Mensch, der wissen muss, was er tut – und sich nicht mitnehmen lässt,“ erwiderte Leopold.
„Oder sollten wir ihn etwa lebenslänglich durchfüttern?“
Cohn machte ein sehr verdriessliches Gesicht.
„Wie lange ist er fort von euch?“ fragte er.
„Seit ein paar Tagen,“ erwiderte Leopold.
„Wenn er nichts anderes findet – und er wird nichts finden, davon bin ich überzeugt, – dann werde ich ihn wieder zu mir nehmen.“
„Hast du denn Verwendung für ihn?“ fragte Leopold.
Cohn dachte nach.
„Nein,“ sagte er. „Verwendung habe ich nicht; im Gegenteil, ich muss mit jedem Groschen rechnen; – aber, was hilft’s, man kann ihn doch nicht hungern lassen, wo er fünfzehn Jahre lang bei einem war, – man kann überhaupt keinen Menschen hungern lassen!“ fügte er hinzu.
„Das sind rückständige Ansichten, Papa!“ sagte Emilie.
„Jedenfalls denkt hier kein Mensch so!“ stimmte Leopold bei.
„Ich leb’ ja nicht hier!“ erwiderte Cohn, – „möcht’ hier auch nicht leben, wenn so was möglich is.“ Dann wandte er sich an Emilie. „Und nun lass mich mal auf eine halbe Stunde mit deinem Mann allein. Ich habe was Geschäftliches mit ihm zu bereden.“
„Was Unangenehmes natürlich“, sagte Emilie.
„Wieso?“ – fragte Cohn; „im Gegenteil! Was äusserst Angenehmes; vorausgesetzt, dass es sich machen lässt! Aber es wird sich schon machen lassen!“
Emilie stand auf.
„Wie lange bleibst du?“ fragte sie ihren Vater.
„Bis zum Abend.“
„Willst du denn nicht wenigstens bei uns übernachten?“ fragte Leopold.
„Danke schön, mein Junge! Aber du weisst, ich muss morgen früh um acht Uhr wieder hinterm Ladentisch stehen.“
„Es is auch besser, Papa hat seine Ordnung“, sagte Emilie und ging hinaus.
„Ich seh dich noch, bevor ich gehe“, rief ihr Cohn nach, dann zog er einen Stoss Papiere aus der Tasche, legte sie vor sich auf den Tisch und begann.
„Mir geht’s schlecht, mein Junge. Ich weiss nich, ob ich die Firma werde halten können, – denk’ dir, hundertzwanzig Jahre sind’s im August, dass mein seliger Urgrossvater sie gegründet hat.“
„Ein richtiger Segen hing nie daran“, erwiderte Leopold.
„Was heisst das?“ widersprach Cohn. „Hat das Geschäft uns nicht alle immer redlich ernährt? Haben wir je fremde Hilfe gebraucht?“
„Ihr habt eben alle keine Ansprüche ans Leben gestellt.“
„Was heisst Ansprüche ans Leben?“ fragte Cohn. „Kann man grössere Ansprüche stellen, als heiter und gesund sein? Nu? – In ganz Neutomischel konntst du rumgehen, hundert Jahre lang, von ein Haus ins andere –. De hättest keine Familie gefunden, die zufriedener war. Aber was nutzt das heut?“
„Ich mein’ auch, fürs Gewesene gibt der Jud’ nichts!“
„Oh!“ widersprach Cohn lebhaft – „sag das nich! das wär’ schlimm, wenn ich darauf sollt verzichten – davon leb’ ich – von meine Erinnerungen.“
„Ich fürchte, du wirst davon nicht satt werden, Papa?“
„Es gibt noch was anderes, Leopold, was man braucht zum Leben als ’n vollen Magen: das Herz. Was hat man von all die Herrlichkeiten, wenn se nur aussen bleiben und man se nich da innen fühlt.“
Leopold dauerte das alles viel zu lange.
„Und was soll nun werden, Papa?“ fragte er.
„Ich will dich nich lange damit aufhalten, dass ich dir erzähle, wodurch die Schwierigkeiten entstanden sind. Du weisst es ja auch, ich will dir daraus keinen Vorwurf machen – Gott behüte! Dass die Bestände, die du bei deinem Austritt mit hundertfünfunddreissigtausend Mark angegeben hast – und du wirst ja wohl deine Gründe dafür gehabt haben – nicht mehr als sechzigtausend Mark wert waren – nu, und auch die reinzubringen is mir bis heut nicht gelungen.“
„Du hattest seinerzeit dieselbe Möglichkeit, nachzuprüfen wie ich.“
„Hab’ ich!“ erwiderte Cohn.
„Was!“ fragte Leopold ganz erstaunt – „Du hast ... du wusstest also – und hast trotzdem meine Abrechnung gebilligt?“
„Was wär’ geworden?“ erwiderte Cohn. „Sollt’ ich dem Manne meines einzigen Kindes sagen, dass er mich – nu zum mindesten übervorteilt hat? S’ hätt mich mit meinem Kinde auseinandergebracht. Das war’s! Darum hab’ ich geschwiegen! Und dann: ich hoffte immer – du bist ein tüchtiger Geschäftsmann, wenn auch anders – leider! – als dein Vater und Grossvater – Gott hab’ se selig – es waren – aber ich hab’ immer gedacht, wenn du erst festen Fuss hier hast, denn wirst de eines Tages zu mir kommen – du verstehst – und das alles ausgleichen.“
„Und da ich nich zu dir gekommen bin, so kommst du heute zu mir! – Hm! ich verstehe! Um mir die Pistole auf die Brust zu setzen: entweder ich zahl’ dir die Differenz oder ...“
„Gott behüte!“ rief Cohn. „Was sind das für furchtbare Gedanken.“
Leopold atmete auf.
„Sondern?“ fragte er.
„Ich hab’ mer gedacht, de wirst genug mit dir selbst zu tun haben.“
„Allerdings!“ bestätigte Leopold. – „Das hab’ ich.“
„Nu eben, es is doch keine Kleinigkeit, in ’ner fremden Stadt festen Fuss zu fassen – wenngleich du ja – das soll nicht etwa ’n Vorwurf sein! ich bin immer für freie Konkurrenz eingetreten – den besten Teil meiner Kunden mitgenommen hat – aber lassen wir das!“
„Ich mein’ auch!“ erwiderte Leopold – „das bringt uns nur aneinander.“
„Eben! Darum hab’ ich mich auch nich an dich gewandt, als ich für die Dreimonatsakzepte am ersten April keine Deckung hatte.“
„An wen denn?“ fragte Leopold erstaunt.
„Ich bin zum Stadtrat Marcuse gegangen – de kanst dir denken, mit was für Gefühlen! – Dreimal hab’ ich den Klingelzug von seiner Haustür in der Hand gehabt und wieder losgelassen und bin umgekehrt – aber schliesslich, was half’s? – nu, er hat mich – für den Augenblick wenigstens – vor dem Schlimmsten bewahrt.“
„Nu also!“
„Und mehr als das! Er hat sich von mir genau erzählen lassen ...“
„Natürlich“, unterbrach ihn Leopold erregt – „hast du mir an allem die Schuld gegeben – obgleich du weisst, dass Stadtrat Marcuse gerade in Berlin grosse Beziehungen hat und mir, wenn er will, überall Knüppel zwischen die Beine werfen kann.“
„Geschämt hätt’ ich mich, von dir zu erzählen“, erwiderte Cohn. „Ein guter Jude hungert lieber als dass er’s eigene Nest beschmutzt. – Na, kurz und gut, er hat mir ’n Geschäft an die Hand gegeben, durch das ich – und der Marcuse schwätzt nicht – Millionen verdienen kann.“
Leopold, der bisher in seiner Korrespondenz geblättert hatte, schob alles beiseite und richtete sich auf.
„Sieh mal an!“ sagte er interessiert – „und warum macht er es nicht, wenn’s so glänzend is?“
„Marcuse ist neunundsiebzig – is Junggeselle – hat sein gutes Auskommen – wozu soll er sich den Kopf verdrehen? – nu, ich versteh’ das und wär’ nich anders, wenn ich nich müsste.“
„Und das Geschäft?“ fragte Leopold.
„Deshalb eben bin ich gekommen – also hör’ zu: Du kennst die Gelände unten an der Döberitzer Heerstrasse ...“
„Wo jetzt die grossen Kasernen und Uebungsplätze hinkommen sollen?“
„Richtig! Denk’ dir, Marcuse hat auf einen Teil der Gelände eine Option gegen Zahlung von zweimalhunderttausend Mark.“
„Nicht möglich!“ rief Leopold. „Das ist ja ein Millionenobjekt!“
„Gewiss is es das!“ erwiderte Cohn. „Na und ich kann dir auch verraten, dass der Fiskus den Ankauf der Gelände zu einem exorbitant hohen Preise bereits beschlossen hat. – N’ Köppchen der Marcuse! Alles weiss er, überall is er dabei!“
„Und was hast du davon? Hat er dir etwa versprochen, dass er dich als Erben einsetzt?“ fragte Leopold.
„Er hat mir die Option an der Hand gelassen!“
„Was? is er verrückt?“
„Die zweimalhunderttausend Mark müssen aber spätestens bis zum ersten April, das heisst in knapp drei Monaten, bezahlt werden. Sonst verfällt die Option und, de kannst dir denken, der Vorbesitzer verwertet das Gelände selbständig.“
„Vater!“ rief Leopold und sprang auf – „das is ja ein Glücksfall sondergleichen, zu dem man dir gratulieren kann.“
„Wo hab’ ich schon bis zum ersten April die zweimalhunderttausend Mark her?“ sagte Cohn.
Leopold lief im Zimmer umher und überlegte.
„Zweihunderttausend Mark!“ brabbelte er vor sich hin – „das is freilich kein Pappenstiel.“
„Wem sagst du das?“ erwiderte Cohn.
„Hast du Unterlagen? – Sicherheiten?“
Cohn kramte in seinen Taschen und zog einen ganzen Stoss von Papieren hervor, die er Leopold reichte.
„Ich dachte“, sagte Cohn – „natürlich zuerst an dich, dass du mir vielleicht – auf irgendeine Art – die Summe verschaffst. Denn am Ende kommt es ja eines Tages doch euch zugute – und dann: es kann euch ja auch nicht gleich sein – menschlich wie geschäftlich – wenn ich auf meine alten Tage noch in Konkurs gehe.“
„Das würde natürlich auch auf mein Geschäft zurückwirken“, erwiderte Leopold.
„Das hättest du nur früher bedenken sollen“, sagte Cohn. „Aber, gottlob, es is ja noch immer Zeit.“
Leopold hatte sich inzwischen in die Schriftstücke, die ihm sein Schwiegervater gegeben hatte, vertieft.
„Ein aufgelegtes Geschäft!“ sagte er.
„Weiss Gott, das is es!“ bestätigte Cohn – „und du meinst: du kannst?“
„Ich muss!“ erwiderte Leopold.
Cohn stand auf und klopfte ihm auf die Schulter.
„Du bist doch ’n guter Kerl!“ sagte er – „und ersparst deinem alten Schwiegervater die Schande! – Ich würd’s auch nich überleben.“
Noch einmal überlegte Leopold.
„Hast du schon sonst mit jemandem über das Geschäft gesprochen?“ fragte er.
„Aber nein! ich bin doch kein Kind!“
„Wills du mir die Unterlagen hier lassen und mir versprechen, nichts, aber auch wirklich nichts, in dieser Sache ohne mich zu unternehmen?“
„Wenn du mir sagst, dass es dir möglich is ...“
„Hier, mein Wort darauf, dass du das Geld rechtzeitig hast“ – er hielt seinem Schwiegervater die Hand hin.
„Damit machst du alles wieder gut, mein Junge“, sagte Cohn gerührt und schlug ein. „In solchen Stunden spürt man doch, dass man zusammengehört.“
Viertes kapitel
Wie Leopold das grosse Geschäft an sich reisst
Leopold sann jetzt Tag und Nacht darüber nach, wie er die zweimalhunderttausend Mark beschaffen könne. Er lief von einer Bank zur andern. Aber er war aus Furcht, man könne ihm das Gechäft entreissen, nicht zu bewegen, sich zu decouvrieren und die Unterlagen aus der Hand zu geben; und so beschied man ihn entweder abschlägig oder man verlangte Anteile am Gewinn, die in keinerlei Verhältnis zu der Leistung standen, um die er bat.
Auch seine Versuche, die nötigen Summen durch geschäftliche Transaktionen in seinem Geschäfte aufzutreiben, schlugen fehl. Er verschleuderte die von ihm teuer eingekaufte Ware gegen Kasse, während er selbst seinen Dreimonatskredit wechselmässig weiter in Anspruch nahm. Das hatte naturgemäss eine ganz bedeutende Steigerung seines Absatzes zur Folge. Aber die grossen Barmittel, die er auf diese Weise in die Hand bekam, reichten kaum für die geschäftlichen und gesellschaftlichen Verpflichtungen, die immer grösser wurden. Und die Gefahr, einen Zusammenbruch seines Geschäftes zu erleben, ehe es ihm gelang, sich auf Grund des ihm in Aussicht gestellten Terraingeschäftes ein für alle Male zu rangieren, rückte immer näher.
Denn der Gedanke, dieses Terraingeschäft, das ihm sein Schwiegervater so leichtfertig in die Hände spielte, auf andere als auf eigene Rechnung zu machen, kam ihm nie.
Um sich geschäftlicher Verpflichtungen zu entledigen, waren Konkurs und Zwangsvergleich noch immer die bewährtesten Mittel.
Nur hiess es, eine Kombination schaffen, welche die Effektuierung des Terraingeschäftes trotz – ja vielleicht grade infolge dieses Konkurses möglich machte.
Und diese Kombination offenbarte sich ihm während der Marcellus-Messe im königlichen Dom am Freitagabend.
Am nächsten Morgen setzte er alle Hebel in Bewegung, um den Aufenthaltsort Jacobys ausfindig zu machen. Weder auf dem Einwohnermeldeamt Berlins, noch auf einem der Vororte war er zu ermitteln. Und so drahtete er denn dringend an seinen Schwiegervater, der erst heute morgen wieder auf einer Karte angefragt hatte, ob die Beschaffung der zweimalhunderttausend Mark auch ganz sicher sei:
„Verbürge mich für rechtzeitige Beschaffung, drahte Jacobys Aufenthalt, den dir zu Liebe wieder aufnehme
Gruss Leopold.“
Und Cohn schmunzelte vergnügt, als er das Telegramm las; hatte den ganzen Tag über für jeden Kunden, den er bediente, ein freundliches Wort, unterrichtete strahlend Marcuse und drahtete nach Berlin zurück:
„Sehr lieb von dir, Jacoby wohnt Rosenstrasse 3.
Gruss euch allen, Vater.
Leopold fuhr selbst zu Jacoby, den er auch antraf.
„Um Himmels willen! – was is passiert!“ rief Jacoby, als Leopold ins Zimmer trat. Er wusste: ein freudiger Anlass konnte es nicht sein, aus dem er zu ihm kam.
„Nich mehr und nich weniger, als dass mein Schwiegervater vor der Pleite steht.“
Jacoby entfärbte sich.
„Gott im Himmel! das is ja nich möglich! –“
„Leider doch!“
„Das überlebt er nich!“
„Ich fürchte auch.“
„Du hast ihn zugrunde gerichtet! Deine Pflicht ist es, ihn zu retten.“
„Wo kann ich es schon,“ erwiderte Leopold. – Dann fuhr er fort: „Du hast es so gut gewusst, wie ich. Du hättest ja reden können damals, wenn du glaubtest, es geschieht ihm unrecht.“
„Hätt’ ich nur! hätt’ ich nur!“ jammerte Jacoby und schlug sich vor den Kopf. „Aber deine Emilie hat mich betölpelt mit schöne Reden – ja, ich bin mit schuld an seinem Unglück – aber ich bin bestraft – das geschieht mir recht – ich hab’s nicht besser verdient!“
„Mit deinem Gejammer machst du es nicht gut,“ sagte Leopold.
„Sage mir, wie ich es gut machen kann!“ erwiderte Jacoby. „Wenn eine Möglichkeit existiert – es gibt kein Opfer, das ich nicht brächte!“
Leopold sah ihm in die Augen.
„Ich hätte nicht übel Lust, dich beim Wort zu nehmen!“ sagte er.
„Tu’s!“ bat Jacoby.
„Es gibt eine Möglichkeit, ihn zu retten.“ Und nun erzählte ihm Leopold unter strengster Verschwiegenheit von dem Terraingeschäft und der Option seines Schwiegervaters, und wie er, Leopold, sich seit Tagen vergeblich bemühe, das Geld zusammenzubringen.
„Diese Summe! Das is nich möglich!“ sagte Jacoby.
„Doch!“ widersprach Leopold. – „Wenn es dir Ernst is um seine Rettung – du brauchst nichts weiter zu tun, als auf – na sagen wir mal fünf Jahre irgendwo ausserhalb Deutschlands – du lieber Gott, die Welt is gross ...“
„Ein Verbrechen soll ich begehen!“ schrie Jacoby auf – „nie im Leben!“
„Reg dich nich auf!“ erwiderte Leopold in aller Ruhe. „Wer spricht von Verbrechen? Dazu werd’ ich mir ausgerechnet n’ Helden wie dich aussuchen. – Aber lassen mer’s; wenn de nich mal das kleine Opfer ...“
„Bis ans Ende der Welt will ich gehen,“ beteuerte Jacoby – „und bis an mein Lebensende fortbleiben, wenn ich ihn damit retten kann. Aber ich begreif’ nich ...“
„Du wirst gleich begreifen,“ unterbrach ihn Leopold. Und er zog aus seiner Tasche einen ganzen Stoss Wechselformulare heraus und legte sie auf den Tisch.
„Was soll das?“ fragte Jacoby.
„Hier“ – und er reichte ihm ein Päckchen ausgefüllter Wechselformulare –“ gebe ich dir für dreimalhunderttausend Mark Akzepte – Se sind gut! – sämtlich auf meinen Namen – du kannst se unbesorgt nehmen.“
Jacoby zögerte.
„Wofür?“ fragte er. – „Wozu?“
„‚Du hast die Liebenswürdigkeit, mir von dir für dreimalhunderttausend Mark Akzepte dagegen zu geben – da“ – und er schob ihm ein Päckchen unbeschriebener Formulare hin – „füll aus – und schreib die Fälligkeitsdaten von dem Zettel hier ab – es is nötig, dass sie später fällig sind als meine.“ Jacoby sah ihn verwirrt an.–„Ich weiss nich, warum du zögerst – es kann kein glatteres Geschäft geben: ich geb dir dreimalhunderttausend Mark und du zahlst mir dreimalhunderttausend Mark zurück.“
„Das schon; aber wozu?“ fragte Jacoby und schüttelte den Kopf.
„Hast du Angst, ich will dich hineinlegen? Sind meine Wechsel nicht besser als deine?“
„Eben – darum – wie kann ich Akzepte ausstellen über dreimalhunderttausend Mark, wo ich nicht weis, wovon ich morgen leben soll.“
„Kannst du mehr tun, als mir das sagen? wenn ich son Esel bin und geb dir trotzdem dagegen meine, was geht’s dich an?“
Jacoby nahm den Halter auf und überlegte – dann tauchte er ein und schrieb:
„Ich kann dabei Strafbares nich finden,“ sagte er – „wenngleich ich nich weiss, wie du damit dem Alten helfen willst.“
„Brauchst du auch nicht zu wissen,“ erwiderte Leopold. „Schreib nur!“
Und Jacoby schrieb quer – Wechsel um Wechsel, füllte Summe und Fälligkeitstermine, wie Leopold sie auf dem Zettetl angegeben hatte, aus und zählte zusammen.
„Es stimmt!“ sagte er – „es sind dreimalhunderttausend Mark – da!“ – und er reichte Leopold die Formulare, der sie zusammenkniffte und in die Tasche schob.
„Was nun?“ fragte Jacoby.
„Nun, mein lieber Jacoby, wirst du doch Geld brauchen.“
„Ich? wozu?“
„Nu, ich weiss ja nich, wo du hingehst – will’s auch nich wissen! – aber reisen kostet Geld. – Und dann: leben musst du ja schliesslich auch.“
„Lieber Leopold“, erwiderte Jacoby – „was bedeutet das alles? Wie kann dadurch, dass ich fortgeh ...“
„Du brauchst also Geld,“ fuhr Leopold fort und überhörte, was Jacoby sagte. „Ich mache dir einen Vorschlag: ich kaufe dir meine Wechsel ab. Und zwar für dreissigtausend Mark. Hier, zähl nach!“ – und er reichte ihm ein Päckchen Tausendmarkscheine, die Jacoby mit zitternden Händen nahm.
„Zähle!“ wiederholte Leopold.
„Ich kann nich,“ erwiderte Jacoby – „ich bin zu erregt – das is ja ein Vermögen – das reicht ja aus, um mir eine Existenz zu gründen. –“
Und immer wieder legte er einen Schein auf den andern und vergass in seiner Erregung, zu zählen, bis Leopold, der seine Wechsel wieder an sich genommen hatte, ungeduldig wurde und sagte:
„Nun gib mir dein Ehrenwort, Jacoby, dass du mindestens fünf Jahre fortbleibst.“
„Bis an mein Lebensende, wenn ihm damit gedient ist,“ gelobte Jacoby und gab ihm die Hand.
Fünftes kapitel
Leopold Lesser geht in Konkurs
Eines Vormittags erschien Emilie im Bureau ihres Mannes.
„Da bin ich! Was sind das für Eröffnungen, die du mir zu Hause nicht machen konntest. Ich muss sagen, du verstehst es, einen in Spannung zu halten. Ich habe kein Auge geschlossen heut nacht.“
Leopold sah nach der Uhr und schmunzelte.
„Bitte, setz’ dich!“ sagte er und schob ihr einen Stuhl hin.
Emilie setzte sich.
„Zunächst,“ begann Leopold – „habe ich dir mitzuteilen, dass sich mein Umsatz in den letzten vier Wochen vervierfacht hat.“
„Ich bitt dich, Leopold,“ erwiderte Emilie, „mach mit mir keine Flausen. Ich kenne doch den Betrieb hier. Du schleuderst doch! Du verkaufst deine Waren unter Einkaufspreis.“
„Wem sagst du das?“ erwiderte Leopold.
„Du setzt zu.“
„Allerdings!“
„Jeder Kunde kostet dich Geld.“
„Gehörig!“
„Und wenn du am Quartalsersten den Lieferanten zahlen sollst, bist du pleite.“
„Erraten!“‘
„Und um mir das mitzuteilen, muss ich hierherkommen. Das konntest du mir gar nicht zu Haus erzählen. – Oder,“ fragte sie ängstlich – „was hast du vor? Willst du etwa fliehen oder gar“ – sie zitterte – „Leopold, das wäre geschmacklos!“ Sie stand auf und sah ihn ängstlich an.
„Was ist dir? Was meinst du?‘“ fragte er erstaunt.
„Du willst dich doch nicht etwa vor meinen Augen erschiessen?“
„Gott behüte! – womit soll ich mich denn erschiessen?“ – erwiderte er – „und warum? wo wir gerettet sind!“
„Leopold!“ rief Emilie entsetzt – „du hast deinen Verstand verloren.“
„Nicht, dass ich wüsste!“ erwiderte er. „Im Gegenteil, ich fühle mich ausserordentlich behaglich.“
„Wo – du doch – selbst – sagst, dass du – vor dem Konkurse – stehst!“
„Eben deshalb!“
„Leopold!“ rief sie ängstlich – „ich habe Furcht vor dir.“
Leopold trat an seinen Geldschrank und schloss ihn auf.
„Wenn du dir die Mühe machen und dein Kontobuch einer kleinen Durchsicht unterziehen wolltest. Es ist mir übrigens lieber, du nimmst das Buch mit nach Hause. Ich möchte nicht, dass man es bei mir findet.“
Er reichte ihr das Buch, dass sie gelangweilt aufschlug.
„Was soll das?“ fragte sie ..
„Blättre nur bis zu Ende!“ bat er.
„Was? – was?“ rief sie und bekam einen roten Kopf. Dreimalhunderttausend Mark zu meinen Gunsten – wo – wo kommen die her?“
„Ich weiss es nicht!“ erwiderte Leopold. „Ich dachte, dass du es vielleicht wüsstest. Ich habe nur die Mitteilungen von der Bank erhalten, dass diese Summe auf dein Konto einbezahlt worden ist.“
„Leopold! Du bist nicht bei Verstand!“ rief Emilie.
„Allerdings sind hier in den letzten Wochen Akzepte von mir in Höhe von dreihunderttausend Mark vorgekommen, die mein Geschäft infolge der hohen Kassenbestände prompt eingelöst hat.“
„Und wer – wer – hat die präsentiert?“ fragte Emilie zitternd.“
Voraussichtlich jemand, dem ich sie vorher übergeben hatte.“
„Ja – und?“
„Und der muss dann wohl die Freundlichkeit gehabt haben, die Valuta auf dein Konto einzuzahlen. Es ist möglich, dass er dabei einer kleinen Anregung von meiner Seite gefolgt ist – das Resultat ist jedenfalls: dass du zurzeit über ein Vermögen von dreihunderttausend Mark verfügst – somit also in der Lage bist, das Terraingeschäft deines Vaters auf eigene Rechnung zu machen.“
„Leopold!“ schrie Emilie – sie schrie immer, wenn sie erregt war – „dann sind wir ja Millio ...“
Leopold hielt ihr die Hand vor den Mund.
„Pscht!“ sagte er – „zunächst werde ich jetzt als rechtschaffener Kaufmann mit allem Anstand in Konkurs gehen. – Ich habe bis Ultimo etwa dreimalhunderttausend Mark zu zahlen.“
„Dreimalhunderttausend Mark,“ erwiderte Emilie. „Das ist ja genau so viel, wie mein Vermögen.“
„Ich danke Gott, dass es nicht mein Vermögen is,“ erklärte Leopold. „Ich habe getan, was ich konnte. Ich habe bisher immer pünktlich bezahlt. Auch diesmal habe ich alle Lieferanten befriedigt.“
„Also!“
„Konnte ich wissen, dass der Kerl ein Halunke is?“
„Welcher Kerl?“ fragte Emilie.
„Dessen Wechsel ich den Lieferanten in Zahlung gegeben habe und der nun, wo sie fällig sind ...“
„... nicht zahlt!“ ergänzte Emilie – „ich begreife!“
„Nich nur nicht zahlt,“ erwiderte Leopold – „er ist einfach nicht auffindbar – er ist auf und davon – kein Mensch weiss, wohin.“
„Vornehm is das!“ sagte Emilie verächtlich – „und wer is dieser Jöntelmen?“
„Was tut der Name zur Sache,“ erwiderte Leopold, und als Emilie ihre Frage wiederholte, antwortete er: „Jacoby.“
Sie standen sich jetzt gegenüber und sahen sich an. Dann platzten sie beide heraus und pruschten laut los.
„Nein, Leopold!“ rief Emilie und schüttelte sich vor Lachen. „Mit deinen Anlagen kannst du es noch einmal bis zum Bankdirektor bringen.“ –
Und so ging denn Leopold Lesser in Konkurs – in den Augen seiner Gläubiger und der Welt zugrunde gerichtet von einem gewissenlosen Menschen, von dem man nur wusste, dass er Jacoby hiess und fünfzehn Jahre lang im Hause von Lessers Schwiegervater in Neutomischel das grösste Vertrauen genossen hatte – sein blühendes Geschäft war ihm zum Opfer gefallen.
Diese Auffassung herrschte im Gläubigerausschuss; und sie übertrug sich auch auf Gericht und Konkursverwalter. Und so war denn bei der ersten Gläubigerversammlung die Stimmung eine dem Gemeinschuldner günstige und versöhnliche. Und als der alte Geheime Justizrat Gause als Anwalt der Frau Emilie Lesser auftrat und die Erklärung abgab, dass seine Klientin zugunsten der Gläubiger auf ihre sämtlichen, nicht unerheblichen Ansprüche an das Vermögen ihres Mannes verzichte, da hatte man für den Schuldner nur Ausdrücke der Teilnahme und Hochachtung. Und man verurteilte das Vorgehen eines auswärtigen Gläubigers, der ihn einer geringen Schuld wegen zum Offenbarungseide zwang.
Sechstes kapitel
Wie Emilies Vater sich dupieren lässt
Eines Morgens erhielt Emilies Vater in Neutomischel einen Brief, in dem sein Schwiegersohn ihm schrieb, dass er durch den Zusammenbruch eines seiner grössten Schuldner seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen könne und infolgedessen gezwungen sei, in Konkurs zu gehen. Er möge diese Tatsache mit derselben Ruhe aufnehmen, mit der sie seine Tochter Emilie aufgenommen habe. Er, Lesser, fühle sich jung genug, um mit frischer Kraft von vorn zu beginnen; im übrigen seien die geschäftlichen Erfahrungen, die er in Berlin gesammelt habe, mehr wert, als das verhältnismässig kleine Kapital, das er verloren habe. – Und am Schluss schrieb er: „Ich brauche dir wohl nicht erst zu versichern, dass deine Terrain - Transaktion durch meinen Konkurs in keiner Weise berührt wird. Das Geld ist mir von Prima Seite zugesichert und du kannst mit absoluter Bestimmtheit darauf rechnen.“
Drei Tage vor dem ersten April kam Cohn nach Berlin. Der Zwangsvergleich, der Leopolds Konkurs beendet hatte, gefiel ihm gar nicht.
„In sechs Wochen hätt’ ich deine Gläubiger auf Heller und Pfennig befriedigt. Aber zehn Prozent! Ich würd’ mich schämen an deiner Stelle. – Wie stehst du nu da!“
Aber Leopold zeigte ihm Briefe seiner Gläubiger, in denen sie ihm dankten und ihn ihres ferneren Vertrauens versicherten. Ja einige räumten ihm sogar von neuem Kredite ein.
„Da kann ich nicht mit!“ sagte Cohn.
„Du vergisst, dass du über dreissig Jahre älter bist als wir!“ sagte Emilie.
„Mag sein, dass es das ist. – Also reden wir von was anderm! Wie steht’s mit den zweihunderttausend Mark? Wann kann ich se haben?“
„Ich denke morgen,“ erwiderte Leopold.
„Was heisst, du denkst?“ fragte sein Schwiegervater.
„Ich hab’ vorhin mit dem Geldmann telephoniert.“
„Nu und?“
„Er macht plötzlich allerlei Ausflüchte.“
„Leopold!“ rief Cohn entsetzt – „das – das is ja nicht möglich – ich hab’ doch dein Wort – morgen muss das Geld da sein! ... Du weisst, dass ich sonst ...“
„Vor allem kalt Blut!“ unterbrach ihn Leopold – „mit Schreien kommen wir nicht weiter. Ich hab’ getan, was ich konnte. – Wenn man mich jetzt im Stiche lässt, so ist das nicht meine Schuld.“
„Wer ist der Mann?“ fragte Cohn in grosser Erregung.
„Einer meiner zuverlässigsten Freunde,“ erwiderte Leopold. – „Emilie kennt ihn auch.“