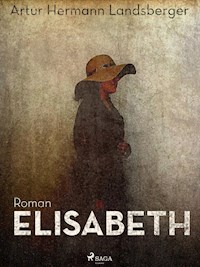
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Deutschland zwischen den Weltkriegen. Die Feindschaft der Siegermacht Frankreich ist besonders am Rhein zu spüren. Dorthin ist die junge Elisabeth Grothe mit ihrem todkranken Verlobten Reinhardt gezogen, der sich von den Qualen der Kriegsgefangenschaft erholen soll. Als sich die junge Frau gegen eine plötzliche Einquartierung französischer Soldaten wehrt, ahnt sie noch nichts von der schleichenden Bedrohung, die ihre bisher wohlgeordnete Welt zerstören wird. Als nach und nach ihre Familie an den Rhein kommt, nimmt das Drama seinen Lauf. Umsonst überlässt die Mutter die Villa mit dem gesamten Inventar den Franzosen für ein Bleiberecht. Bruder Erich, einst glühender Kommunist, wird verhaftet. Schwester Lotte wird von Soldaten entführt und kommt völlig verstört zurück. Und die lebenslustige Edith, obwohl verheiratet, lässt sich von einem Leutnant verführen. Als eines Nachts der Offizier in ihrem Haus in Elisabeths Zimmer schleicht, weiß sie nur noch einen Ausweg ...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Artur Hermann Landsberger
Elisabeth
Der roman einer deutschen frau
Saga
The Winners
Never on the winning side
Always on the right —
Vanquished, this shall be our pride
In the world’s despite.
Let the oily Pharisees
Purse their lips and rant,
Calm we face the destinies —
Better „can’t“ than Cant.
Bravely drain, then fling away.
Break the cup of sorrow!
Courage! He who lost the day
May have won the morrow.
G. S. Viereck
(am Tage des Waffenstillstands)
Vorwort
Sie haben, George Sylvester Viereck, als Einer der ganz Wenigen noch in einer Zeit, in der die Wogen des Deutschenhasses in Ihrem Lande haushoch gingen, den Mut gehabt, die Lüge zu bekämpfen.
Aber oft gehört mehr Mut dazu, die Wahrheit zu bekennen, als die Lüge zu bekämpfen. Ich weiß, wenn Einer den Mut dazu hat, sind Sie’s!
Werden Sie Mittel und Wege finden, daß die Amerikaner den Schrei eines ihnen stammverwandten Volkes hören?
Solange noch in der Welt die Macht entscheidet, werden „wehrlos gemacht“ und „ehrlos gemacht“ zwei nahe beieinander wohnende Begriffe sein. Widerspruchslos hat das deutsche Volk den Versailler Frieden und alles, was dar über hinausging, hinnehmen müssen. Es hat sich — gegen sein Gewissen — als den am Kriege allein Schuldigen bekannt — im Vertrauen auf eine Zukunft, in der das Weltgewissen das deutsche Volk auch von diesem Fluch befreien wird.
Von jeher geduldig, schleppt es sein Schicksal und erträgt, wehrlos gemacht und daher ohne Möglichkeit der Abwehr, alles, was ein unversöhnlicher Nachbar ihm auferlegt. Aber, daß die deutsche Frau und Mutter, weiß wie Eure Frauen und Mütter, noch heut, nach Jahren des sogenannten Friedens, der Brunst schwarzer Franzosen ausgeliefert ist, steht abseits aller Politik — ist eine Frage der Gesittung — und daher eine Frage, die auch Euch angeht, Amerikaner!
Der Roman der deutschen Frau, den ich schrieb, ist nicht zu widerlegen, denn er wurde aus dem Leid geboren, das die Deutschen heute noch unter den Schwarzen am Rhein erdulden.
Wenn sich die deutsche Frau in ihrer Not durch dies Buch an ihre amerikanische Schwester wendet und sich dabei Ihrer Führung, George Sylvester Viereck, anvertraut, so geht sie damit den Weg, den Herz und Verstand sie weisen.
Artur Landsberger
Erstes Kapitel
„Die Juden — sind — an allem Unglück — schuld,“ sagte Paul Schäfer, das Gebetbuch in der Hand, zu seinem Nachbarn.
Und die Gemeinde sang:
Du hast den Geist gegeben,
Der Trost im Herzen schafft,
Zu höherm Tugendleben
Dem Sünder gibt die Kraft.
„Ausrotten — muß man — sie,“ fuhr Schäfer fort. „Mit Stumpf und Stiel. — Ohne Gnade!“
Der Angeredete wandte sich ab, und die Gemeinde sang:
Send uns den Geist der Liebe,
Den Geist voll Licht und Kraft;
Besieg in uns die Triebe
Der bösen Leidenschaft.
„Und wer sich diesem Reinigungsprozeß entzieht,“ sagte Schäfer und dämpfte die Stimme — denn eine Dame vor ihm wandte den Kopf und forderte Ruhe — „verdient nicht, Deutscher zu sein.“
Beug auch die stolzen Seelen,
Laß sie die Wahrheit sehn,
Laß alle, welche fehlen,
Zu dir um Gnade flehn.
Schäfers Nachbar, Wilhelm Fürst, klappte das Gebetbuch zu und sagte:
„Quatsch!“
„Was?“ fragte Schäfer.
„Alles!“ erwiderte der, schob sich durch die Reihe der Betenden und traf im Mittelgang mit Erich Grothe, einem hochaufgeschossenen jungen Menschen, zusammen, der auf ein verabredetes Zeichen hin ebenfalls seinen Platz verlassen hatte.
Als sie durch das Portal ins Freie traten, sagte Fürst:
„Theater!“
Der junge Grothe machte ein nachdenkliches Gesicht und erwiderte zögernd:
„Fandst du nicht, daß die Predigt ...“
„Heuchelei!“ fiel der ihm ins Wort. „Als ob die Welt stillstände! Seit zweitausend Jahren immer dasselbe.“
„Und doch deckt sich, was er von der Nächstenliebe sagt und daß alle Menschen vor Gott gleich sind, mit unserem Programm.“
„Vor Gott!“ wiederholte Fürst verächtlich. „Wenn ich das höre, steigt mir der Zorn auf.“
„Die Menschen glauben es doch.“
„Leider!“ erwiderte Fürst und verkündete mit Pathos: „Aber wir sind dazu berufen, ihnen einzuhämmern, daß man sie belügt.“
Der um ein paar Jahre jüngere Grothe nickte mit dem Kopf, und Wilhelm Fürst fuhr fort:
„Wir Kommunisten lösen die auf das Jenseits ausgestellten Wechsel auf Erden ein! Wir erfüllen, sobald wir die Macht in Händen haben.“
„Hätten wir sie nur erst!“ sagte der junge Grothe. Fürst sah ihn scharf an und erwiderte:
„Das hängt davon ab, daß jeder einzelne von uns seine Pflicht tut.“
Da griff der junge Grothe in die Tasche und zog ein Kuvert hervor, das Fürst — da grade Leute aus der Kirche kamen — schnell an sich nahm.
„Drei?“ fragte Fürst, und Grothe erwiderte:
„Viereinhalb.“
„Um so besser! Denn um so schneller werden wir zum Ziele kommen. — Wo hast du’s her?“
„Mit dreitausend sollte ich meinen Schneider bezahlen und fünfzehnhundert habe ich aus dem Schreibtisch meines alten Herrn genommen.“
„Damit hast du nur deine Pflicht getan.“
„Ich will ja gewiß alles tun, was die Sache erfordert,“ erwiderte der junge Grothe. „Nur dies Komödiespielen ertrage ich nicht länger.“
„Wir wollen die Welt zum Guten erlösen, Erich!“ erwiderte Wilhelm Fürst feierlich. „Da ist jedes Mittel erlaubt, das uns dem hohen Ziel näherbringt.“
Der junge Grothe drückte dem Freunde die Hand und sagte:
„Verlaß dich auf mich.“
Dann trennten sie sich.
Die Kirche war aus. Der weite Platz füllte sich mit Menschen. Fuhrwerke und Autos setzten sich nach dem Brandenbuger Tor zu in Bewegung.
Ein elegantes Fuhrwerk, in dem. Frau Jenny Grothe mit ihren drei Töchtern saß, fuhr vorüber.
„Erich!!“ riefen die jungen Mädchen, und Frau Jenny wandte den Kopf, gab dem Diener ein Zeichen und ließ halten. Der junge Grothe trat an den Wagen; sie sprachen miteinander.
Von der Kirche Heimkehrende blieben stehen.
„Diese Mutter mit ihren drei Töchtern sind eine Sehenswürdigkeit!“ sagte Frau Schäfer, die am Arme ihres Sohnes Paul hing, und wies auf den Wagen.
„Wer sie nicht kennt, muß sie für Prinzessinnen halten,“ erwiderte der und grüßte zu dem Wagen hinüber. „Dabei müßtest du den Vater sehen, der Typ eines Kriegsgewinnlers.“
„Wer ist der junge Mann, der mit ihnen spricht?“
„Der Sohn. — Die Aelteste, Elisabeth, die neben der Mutter sitzt ...“
„Sie sieht am vornehmsten aus,“ fiel ihm die Mutter ins Wort, „und ähnelt der Mutter am meisten. — Findest du nicht auch?“
„Gewiß!“
„Wenn ich nicht irre,“ fuhr die Alte fort, „so erzähltest du mir, daß sie auch die Ernsteste und Klügste sei.“
Paul Schäfer schwieg.
„Und welche ist deine Favoritin?“ fragte die Mutter.
„Die Jüngste.“
„Wie heißt sie?“
„Lotte.“
Die Alte schwieg. Nach einer Weile sagte sie halblaut vor sich hin:
„Schade!“
„Was ist schade?“ fragte Schäfer, und die Alte erwiderte:
„Daß sie nicht Elisabeth heißt.“
„Die ist nicht mehr frei,“ erwiderte Schäfer, „— und dann — sie ist Pazifistin.“
„Das ließe sich doch ändern,“ meinte die Alte, die fühlte, daß er nicht freiwillig auf sie verzichtet hatte.
„Was?“ fragte Schäfer und sah die Mutter an.
„Ihr Pazifismus. — Aber“, fuhr sie fort und ließ den Sohn nicht aus den Augen — „das andere am Ende auch.“
„Bei der nicht!“ sagte er lebhaft. „Die steht fest — fester als ich.“
„Hm — dann freilich. — Aber vielleicht ginge es anders.“
„Wie meinst du das?“ fragte er voller Interesse.
„Daß nicht sie — sondern du — da sie doch fester steht. — Und am Ende brauchtest du auch nicht gleich Pazifist zu werden. Vielleicht genügt es, daß du deinen Chauvinismus und Antisemitismus ein bißchen dämpfst.“
Paul Schäfer schüttelte den Kopf und sagte:
„Wenn es damit getan wäre!“
„Was ist der Mann, für den sie sich interessiert?“
„Ein junger Chemiker. Einer der wenigen in Frankreich noch zurückgehaltenen Offiziere.“
„Freilich, dagegen wird bei ihrem Charakter schwer anzugehen sein,“ meinte die Alte.
Paul Schäfer gab sich einen Ruck. Er zog den steifen Rücken noch strammer, warf den Kopf zurück und sagte:
„Man darf heutzutage nicht nur nach dem Gefühl gehen. Selbst nicht bei der Wahl seiner Frau. Es gibt Höheres! Und da ich bei Lotte die gleiche Gesinnung finde und zugleich die Mittel ...“
„Paul!“ fiel ihm die Mutter ins Wort. „Seit wann denkst du materiell?“
„Nicht für mich,“ erwiderte der. „Aber ich muß finanziell unabhängig sein, um ganz meinen politischen Idealen leben zu können.“
„Erst mach mal dein Examen!“ sagte die Mutter und beschleunigte den Schritt.
Im japanischen Salon der Villa Grothe saß inzwischen der Herr des Hauses, Generaldirektor Leopold Grothe, mit seinem Schwiegersohn, Iwan Schiff, vor einer Flasche altem Tokayer.
„Na ja,“ sagte der Alte, „im Grunde hast du recht — du und ich, wir haben weder den Krieg noch den Frieden gemacht — warum also sollen wir leiden? — Aber wenn man bedenkt, um wieviel besser es uns heute geht als vor dem Kriege, dann muß man denen dankbar sein, die ihn gemacht haben.“
„Was ich nicht begreife,“ erwiderte Iwan Schiff, „ist, daß man heute, nach fünf Jahren, noch immer vom Kriege redet. Es gibt doch bei Gott angenehmere Dinge, über die man sich unterhalten kann.“
„Köstlich!“ rief der Alte. „Natürlich gibt es angenehmere Dinge. Zum Beispiel alten Tokayer und was dazugehört — Weiber!“
„Pscht, Schwiegerpapachen!“ wehrte Iwan Schiff. „Das sind keine Klostergespräche.“
„Richtig,“ erwiderte der und wischte sich den Mund ab. „Dies Haus ist ein Kloster.“
„Deine Schuld! Bei mir geht’s lustiger zu. Obschon meine Frau, deine Tochter, aus deinem Kloster stammt.“
„Edith hat nie in dem Maße unter dem Einfluß meiner Frau — oder besser: unter Elisabeths Einfluß gestanden. Denn in Wahrheit ist sie es, die in meinem Hause den Ton angibt.“
„Elisabeth ist eine Heilige!“
„Wenn auch nicht das. — Ich glaube sogar, daß sie, erst einmal geweckt, viel Temperament entwickeln wird.“
„Ich habe mir alle Mühe gegeben,“ erwiderte Schiff — „und ehrlich um sie gerungen.“
„Mit falschen Mitteln, mein Lieber! Tüchtigkeit, die sich in Zahlen ausdrückt, imponiert ihr nicht.“
„Worin soll sich Tüchtigkeit anders ausdrücken als im Geldverdienen?“
„In der Gesinnung — meint sie.“
„Damit verdient man heutzutage nichts. — Im Gegenteil! Gesinnung hemmt.“
„Richtig! Ich bin ganz deiner Meinung! Wenn ich mir unter dem Einfluß Elisabeths und meiner Frau auch eine gewisse Beschränkung aurerlege und mir manches Geschäft aus den Fingern gehen lasse.“
Iwan Schiff lächelte verschmitzt und sagte:
„Du meinst, es durch mich machen läßt, statt es selbst zu machen.“
„Sei nicht so gründlich,“ erwiderte der Alte.
„Ich verstehe! Hauptsache, es wird gemacht. Also, wie steht das Geschäft mit dem Franzosen?“
„Schlecht. — Auf reellem Wege ist, fürchte ich, nichts zu machen.“
„Damit habe ich auch keinen Augenblick gerechnet. Es muß völlig geheim bleiben. Sonst hetzt die Presse, wie immer, wenn ein wirtschaftlich bedeutendes Unternehmen an ein ausländisches Konsortium übergeht.“
„Seit wann stört dich, was die Presse schreibt, wenn es etwas zu verdienen gibt?“ fragte der Alte. Und Schiff erwiderte:
„Meiner Stellung an der Börse wegen.“
Der Alte faßte seinen Schwiegersohn beim Arm und lachte laut.
„Die Börse!“ rief er. „Dieser Klub der Selbstlosen, die vor lauter Patriotismus keinen Dollar auch nur anrühren, um die Mark zu stützen.“
„Das stimmt. Aber irgendwie muß man den Schein wahren. Dollars kaufen, die Mark drücken und eine der wichtigsten Industrien an Frankreich ausliefern — um mir das leisten zu dürfen, dazu bin ich noch nicht einflußreich genug.“
„Schön! Ich nehme es auf mich,“ erwiderte der Alte. „Aber die Schwierigkeit liegt woanders. Die Franzosen, die erst förmlich enthusiasmiert für das Geschäft waren, stellen sich plötzlich uninteressiert.“
„Das habe ich erwartet,“ erwiderte Schiff.
„Wieso?“ fragte der Alte erstaunt.
„Nun, sie werden das natürliche Verfahren anwenden und direkt verhandeln.“
„Mit wem?“
„Mit den Angestellten, die Bescheid wissen und ihnen für ein paar Millionen das Herstellungsverfahren verraten.“
„Prachtvoll!“ sagte der Alte wiehernd. „Und das nennst du ‚direkt verhandeln‘ und ‚natürliches Verfahren’?“
„Ich glaube, daß du und ich im gegebenen Falle ebenso ...“
„Pscht! Man erlaubt sich genug! Wozu also, wenn man sich mal nichts erlaubt, noch explizieren, daß man im gegebenen Fall auch so handeln würde. — Im übrigen aber fürchte ich, du hast recht.“
„Was heißt, du fürchtest. Ich finde, es erleichtert uns das Geschäft. Ich fahre noch heute abend an den Rhein, schiebe mich in die Konstellation hinein, decke alles auf, spiele den Retter des Vaterlandes — und wenn dann der Skandal ausbricht, der natürlich von der Hauptsache ablenkt, machst du das Geschäft.“
„Ausgezeichnet!“ rief der Alte, goß sich ein und wollte eben ansetzen, als die Tür aufging und Frau Jenny mit ihren drei Töchtern ins Zimmer trat.
„Willkommen in der Heimat,“ empfing der alte Grothe seine Familie. „Na, wie war die Reise in die Gefilde des Ewigen? Seid ihr mehr erbaut oder mehr hungrig? Nebenan wartet das Frühstück.“
„Es war sehr lustig, Papa,“ erwiderte Edith. „Haben dir nicht die Ohren geklungen?“
„Mir? wieso mir?“ fragte der Alte, und Iwan Schiff meinte:
„Ihr wart doch im Dom und nicht auf der Börse!“
„Wie man’s nimmt,“ erwiderte Edith.
„Pastor Anger hat nämlich gegen die Wucherer und Geschäftemacher gewettert, die Christus aus dem Tempel trieb.“
„Bist du toll?“ schalt der alte Grothe. „Was hat das mit mir und deinem Mann zu tun?“
„Danach müßt ihr Pastor Anger fragen,“ erwiderte Edith. „Er hat eine Parallele zwischen damals und heute gezogen.“
„Blödsinn!“ rief Iwan Schiff.
„Vielleicht, daß du da nicht zu folgen vermagst,“ meinte Elisabeth. „Er sprach von christlicher Nächstenliebe.“
„Wir Juden haben mehr Herz als ihr!“
„Verzeih!“ erwiderte Elisabeth. „Vielleicht hast du recht. Man soll nicht verallgemeinern. Ich kenne kaum einen Juden. Ich kenne nur dich.“
Iwan Schiff wollte erwidern. Der alte Grothe hielt ihn zurück. Aber Frau Jenny sagte:
„Es ist doch sonst nicht deine Art, Elisabeth, jemanden zu kränken.“
„Mich hat es bewegt, was Pastor Anger sagte,“ erwiderte sie. „Ich hatte das Gefühl, er war im Recht, wenn er gegen unsere Zeit, die Gott für überwunden hält, anging und sich gegen die schamlosen Protzen und Prasser wandte, die nur ans Geldverdienen denken und keinen Sinn und kein Herz für die Not ihres Vaterlandes haben.“
„Papperlapapp!“ erwiderte der Alte. „Das sind kommunistische Hetzereien, die nicht auf die Kanzel gehören.“
„O nein, Papa, das sind die elementarsten Sätze christlicher Ethik.“
Iwan Schiff versuchte, dem Streit, der drohte, den Boden zu entziehen, indem er das Ganze ins Lächerliche zog und mit Pathos sagte:
„Geh’ in ein Kloster, Elisabeth!“
Aber die erwiderte:
„Laß deine Scherze! dazu sind die Dinge zu ernst.“
„Ich habe mir nur erlaubt, Maria Stuart zu zitieren,“ erwiderte er.
„Iwan! was fehlt dir?“ rief Edith. „Du und die Klassiker! Und noch dazu Schiller! Wie ist das möglich neben all den Devisen und Effekten?“
Lotte, die Jüngste, legte den Arm um Edith und sagte:
„Beruhig’ dich, es fehlt ihm nichts. Schiller hat nie etwas auch nur Aehnliches gesagt.“
Iwan Schiff wurde nervös:
„Unseren Kenntnissen in Effekten und Devisen verdankt ihr Fuhrwerk, Auto, Villa, Reisen — ich weiß nicht, ob aus dem Studium Goethes oder Schillers Aehnliches herausspringt.“
„Es gibt Menschen, die ohne Auto und Villa glücklich sind,“ sagte Elisabeth.
„Also da haben wir’s!“ rief der Alte. „Dazu schickt man seine Kinder in die Kirche, damit sie revolutionär und gegen die Eltern aufgehetzt werden.“
„Du übertreibst, Leopold,“ vermittelte Frau Jenny. „Du bist es ja nicht, der die Kinder in die Kirche schickt, sondern sie gehen teils aus eignem Antrieb, teils mir zuliebe ...“
„Und mir zuliebe werden sie von nun ab nicht mehr gehen!“ unterbrach sie Grothe.
Frau Jenny überhörte es — oder sie tat doch so — und fuhr fort:
„Und was sie dort hören, ist weder revolutionär, noch Verhetzung. Was Pastor Anger predigt, ist die Quintessenz der christlichen Lehre. Steht das aber im Widerspruch mit unserer Ethik und Lebensführung, dann werden am Ende nicht unsere Kinder, sondern wir gut daran tun, uns zu prüfen, ob nicht wir uns auf falscher Bahn bewegen.“
„Ich sag’ es ja!“ rief der Alte. „Kommunismus in Reinkultur! Die Kinder lehren die Eltern, die sich auf falscher Bahn bewegen. Der Schülerrat verfügt über die Lehrer, der Kinderrat über die Eltern.“ — Er lachte laut auf und fragte seinen Sohn, der eben ins Zimmer trat: „Gestattest du, Erich, daß ich noch einen Schluck Tokayer trinke?“
„Lieber Leopold,“ sagte Frau Jenny, „du verstehst mich falsch.“
„Natürlich! Wir verstehen uns überhaupt nicht. Längst nicht mehr.“
„Wir haben uns aber früher glänzend verstanden, und es gab nichts, worüber wir nicht derselben Meinung waren.“
„Bis vor ein paar Jahren, wo ich ein anderer wurde.“
„Da hast du’s! Du wurdest ein andrer. Ich aber bin dieselbe geblieben.“
„Das ist es ja, daß du, während ich groß wurde und mich emporgewickelt habe, stehengeblieben bist,“ sagte der Alte.
„Für deine Art Geschäfte und deine Lebensführung werde ich nie Verständnis aufbringen.“
„Jenny! was fällt dir ein?“
„Wie du dein Geld verdienst, geht mich vielleicht nichts an — obschon ich wünschte, es wäre weniger und auf andre Art. Aber das Leben, das du führst, empört mich. Nicht meinetwegen — ich verlange längst keine Rücksicht mehr — aber der Kinder wegen, für die ich einstehe und von denen ich Achtung auch dem Vater gegenüber fordere. Darum, Leopold, bringe mich nicht in Konflikt mit meinem Gewissen!“
„Was fällt dir ein, die Kinder gegen mich aufzuhetzen!“
„Ich will sie im Gegenteil zu dir zurückführen.“
„Eine sonderbare Methode, das muß ich sagen.“
„Du siehst ja nicht einmal, daß du sie verloren hast.“
„Kein Wunder, wenn die Mutter eine solche Sprache führt.“
„Es ist das erstemal, Leopold, daß ich in ihrer Gegenwart so spreche — nachdem ich es hundertmal ohne sie versucht habe.“
„Das ist ja die reine Verschwörung!“
„Im Gegenteil, Leopold, es ist der ehrliche Versuch, dich uns zurückzugewinnen. Wir alle sehnen uns nach einem Familienleben, wie wir es vor dem Kriege führten.“
„Die Welt hat sich umgestellt,“ erwiderte der Alte. „Nur ihr seid stehengeblieben.“
„Ich bin Mutter geblieben! Und mein Verantwortungsgefühl und meine Pflichten gegenüber meinen Kindern haben sich nicht geändert! sind die gleichen, die sie vor dem Kriege waren. Und wenn ich dir zuliebe statt der schlichten Einsegnungskette jetzt auch Perlen trage und in einem Fuhrwerk mit den Kindern zur Kirche fahre — ich bin darum innerlich doch die geblieben, die ich war!“
„Glaubst du, mir ist gleichgültig, was aus meinen Kindern wird?“
„Möglich, daß du dich darin auf mich verläßt.“
„Leider habe ich das getan! Nun sehe ich, wie falsch das war!“
„Danke mir auf Knien dafür! Hätte ich dein Leben mitgeführt, wäre ich dem Vergnügen nachgejagt, wie andere Frauen, alle Nachmittage und Abende aus dem Hause gewesen, statt mich um die Kinder zu kümmern — möglich, daß sie dann so geworden wären, wie du sie wünschst.“
„Pastoren- und Oberlehrerstöchter sind freilich nicht nach meinem Geschmack. Meine Töchter können sich den Luxus gestatten, als Damen von Welt in der großen Gesellschaft eine Rolle zu spielen.“
„Ich habe sie weder zu dem einen noch zu dem andern erzogen — vielmehr zu aufrechten, gottesfürchtigen Menschen mit Verantwortungsgefühl. Sie werden daher neben einem Oberlehrer oder Pastor genau so bestehen wie in der großen Welt an der Seite eines Prinzen.“
„Na also, wozu erregst du dich dann?“
„Weil ich euch fürchte!“
„Wen?“
„Dich und deinen Schwiegersohn.“
„Na da hört’s auf!“ rief Iwan Schiff.
„Er ist dein Schwiegersohn so gut wie meiner!
„Das denke ich doch auch, Mama!“ sagte Edith. Aber Frau Jenny widersprach:
„Du bist ein Jahr lang von mir fortgewesen, mein Kind. Es war das wichtigste Jahr in deiner Entwicklung!“ Sie legte den Arm um Edith. „Ich will dir nicht wehtun, Kind, aber du fühlst es ja selbst, daß du anders bist als deine Schwestern.“
Sie wandte sich wieder an ihren Mann, wies auf Elisabeth und Lotte und sagte: „An die aber kommt ihr mir nicht heran! Die schütze ich! Darum dieser Auftritt! Weil ich sehe, daß ihr versucht, sie zu euch hinüberzuziehen.“
„Schätzt du uns so ein, Mama?“ fragte Elisabeth.
„Na, da wollen wir doch gleich mal die Probe aufs Exempel machen,“ erwiderte der alte Grothe, griff in die Tasche und zog eine handvoll Theaterkarten hervor: „Hier habe ich für heute abend die beste Loge für den Filmball im Marmorhaus. Kostenpunkt fünftausend Mark.“
„Dafür kann man fünfzehn unterernährte Kinder sechs Wochen lang aufs Land schicken,“ sagte Elisabeth.
„Oder fünfundzwanzig Flaschen französischen Champagner trinken,“ erwiderte Iwan Schiff.
„Diese beiden Antworten beleuchten mit einem Schlage die beiden heut’ herrschenden Weltanschauungen“, sagte Frau Jenny, „und zeigen, daß es zwischen euch“ — dabei wies sie auf Iwan Schiff und ihren Mann — „und uns“ — dabei stellte sie sich wie zum Schutz vor Elisabeth und Lotte — „keine Verständigung gibt.“
„Es gibt eine Verständigung zwischen Menschen, die zusammengehören,“ widersprach Elisabeth ihrer Mutter, — „gleichviel ob es sich um Mann und Frau, um eine ganze Familie oder gar um eine Nation handelt.“
„Glaubst du wirklich?“ fragte Frau Jenny, und Elisabeth erwiderte:
„Ich habe den festen Glauben!“
„Wenn du den Glauben hast,“ sagte die Mutter — „ich habe ihn längst nicht mehr — dann versuche du es!“
„Ich will es tun, Mama!“
Der alte Grothe und Iwan Schiff sahen sich an, Iwan schüttelte den Kopf, aber der Alte, der noch immer die Billette in der Hand hielt, trat an Elisabeth heran und sagte:
„Dann gehen wir also?“
„Wohin?“ fragte Elisabeth.
„Auf den Filmball. Alles was auf sich hält, ist da.“
„Was auf sich hält?“ fragte Elisabeth.
„Nun ja,“ erwiderte der Alte. „Man muß sehen und gesehen werden. Was hat man denn sonst von seinem Gelde?“
„Oh!“ erwiderte Elisabeth. „Man kann viel von seinem Gelde haben — auch ohne Filmball ...“
Iwan Schiff wurde ungeduldig und rief:
„Also wer kommt mit?“
Edith sah Elisabeth an und fragte:
„Was meinst du?“
„Das kannst nur du entscheiden,“ erwiderte die.
„Du gehörst zu deinem Mann!“ entschied der Alte — und Edith tat, wozu es sie trieb. Sie ging zu Iwan Schiff und sagte halblaut:
„Ich.“
„Und du, Erich?“ fragte der Alte.
Erich liebte Elisabeth und es fiel ihm schwer, ihr wehzutun. Aber er stand unter dem Einfluß Wilhelm Fürsts, mit dem er täglich stundenlang in einem Café am Tisch der Intellektuellen saß. Er schwor, wie jene — deren einzige Beschäftigung diese Kampfstunden waren —, auf den Kommunismus und tat blind alles, was ihr Führer Wilhelm Fürst von ihm verlangte. Und das war bisher nur eigentlich: Geld. Und so hatte er sich daran gewöhnt, bei jeder Entscheidung, vor die er gestellt wurde, sich die Frage vorzulegen: „Kann ich dabei Geld verdienen?“
Sehr zu seinem Verdruß hatte er dabei die Beobachtung gemacht, daß er, der begeisterte Kommunist, auf diese Weise stets mit seinem Vater, dem ebenso begeisterten Kapitalisten, seinem Todfeinde, zusammenstimmte. Auch jetzt, als er auf die Aufforderung, mit zum Filmball zu kommen, erwiderte:
„Ich komme mit, aber ich trinke keinen Sekt und verlange die zweihundert Mark, die ich nicht vertrinke, in bar —“
klatschte der Alte in die Hände und rief:
„Bravo! mein Junge! Wir beide verstehen uns!“
Elisabeth, die an ihrem Bruder hing, zuckte zusammen, und Erich, der es sah, war verlegen und senkte den Kopf.
„Na, und du, Lotte?“ fragte der Alte.
Die sah ihn groß an, schüttelte den Kopf und schmiegte sich an Elisabeth. Frau Jenny legte den Arm um sie.
Wie feindliche Parteien standen sie sich gegenüber.
Am Abend desselben Tages kehrte der Rittmeister Reinhart v. Loos, beinahe eine Woche früher, als Elisabeth ihn erwartet hatte, aus Frankreich zurück.
Seit sieben Jahren — Elisabeth war damals sechzehn, der von Kraft strotzende, übermütige und tollkühne Offizier zweiundzwanzig Jahre alt — hatten sie sich nicht gesehen. Aber seit sieben Jahren verging kein Tag und keine Nacht, in der Reinhart nicht im Geiste vor ihr stand. Er nahm an allem teil, was sie erlebte. Sie sprach oft laut mit ihm, als wenn er vor ihr stände, und besprach mit ihm alles, was sie betraf, wobei es nicht selten geschah, daß er anders dachte als sie und trotz ihrer Widerrede bei seiner Entscheidung blieb. So intensiv lebte sie mit ihm, daß sie ihn auch körperlich empfand; und so sehr fühlte sie sich in ihn hinein, daß sie ohne Selbsttäuschung überall erkannte, wie er urteilen würde. Und während sie, wäre er dagewesen, ihren Willen ihm gegenüber behauptet hätte, so gab sie ihm nun, wo er fern war, regelmäßig nach — aus Mitleid vielleicht, denn sie wußte, ohne daß sie Nachricht von ihm hatte, daß er litt — vielleicht aber auch aus dem unsicheren Gefühl heraus, daß er am Ende doch noch Argumente hatte, die sie nicht sah und die sie überzeugt hätten.
Nun, da sie mit zitternden Händen das Telegramm aus Basel hielt, in dem stand:
„Ich komme, Elisabeth. Wie werde ich Dich finden? Ich bin so müde und daher ohne Mut. Aber meine Sehnsucht ist so groß, daß ich an Deine Hilfe glaube. Dein reines Herz —“
schloß sie die Augen und wiederholte ein um das andere Mal: „Dein reines Herz.“ So hatte sie ihn genannt, so nannte sie ihn noch heut. „Reinhart, mein reines Herz!“ — Sieben Jahre waren ausgelöscht in dieser Stunde — waren weggewischt mit allen ihren Schmerzen. — Ihre Herzen waren rein geblieben und trafen nun, unberührt von allem äußeren und inneren Geschehen, so zusammen, wie sie sich damals, dem Scheine nach, gelöst hatten.
Sie sah noch einmal auf das Telegramm und las:
„Wie werde ich Dich finden?“
Da lächelte sie freudig bewegt.
„So wie du mich verlassen hast,“ sagte sie laut. Und sie las weiter:
„Ich bin so müde und daher ohne Mut. Aber meine Sehnsucht ist so groß, daß ich an Deine Hilfe glaube.“
Elisabeth starrte auf das Blatt.
„Er ist krank — vor Sehnsucht krank,“ sagte sie vor sich hin — „und ich soll ihm helfen.“ — Und dann schrie sie plötzlich ganz laut, als wenn ein Schmerz sie emporriß: „Reinhart, mein Herz!! Ich komme!!“
Aufs Ungewisse lief sie zur Bahn, holte aus einem Laden weiße Rosen, die sie lose in den Arm nahm, fragte nach den Zügen, stand den halben Tag über auf dem Bahnsteig, sah Züge kommen und fahren, gab auf Fragen der Beamten, auf wen sie denn warte, keine Antwort — bis spät am Abend eine innere Stimme ihr sagte:
„Jetzt!“
Da riß sie noch einmal die müden Augen auf und sah aus einem Zuge, unter jungen Menschen, die jubelnd Müttern und Vätern in die Arme flogen, einen Greis klettern. Auf einen Stock gestützt kam er näher, und musterte aus toten Augen jeden, der an ihm vorüberging. Zehn Schritte von Elisabeth entfernt blieb er stehen, warf er den Stock hin, riß er die Arme hoch, bebte sein Körper, fiel er in die Knie und rief schluchzend:
„E—li—sa—beth!“
Obgleich seine Stimme schwach war, traf sie doch alle. Mütter ließen ihre Söhne loß, Frauen, die eben noch völlig unter dem Eindruck des Wiedersehens standen, befreiten sich von der Umarmung ihrer Männer — alle sahen auf den knienden Offizier, der wie zu einem Wunder hilflos zu Elisabeth aufsah.
Und Elisabeth beugte den Kopf, nahm ihm die Mütze vom Kopf, sah schneeweißes Haar, stöhnte laut, hörte sein Schluchzen, fühlte, wie zitternde Arme sich um ihre Knie legten, flüsterte:
„Rein—hart.“
und brach neben ihm zusammen.
Er beugte sich über sie, hob ihren Kopf, sah, daß es nur eine Ohnmacht war, flüsterte:
„So jung! so jung!“
wankte auf das Gleise zu und stürzte sich vor den Zug, der sich eben wieder in Bewegung setzte.
Im letzten Augenblick riß ihn ein Beamter zurück.
Und wenige Minuten später saßen sie im Wagen dicht aneinander geschmiegt und ohne ein Wort zu sprechen — und fuhren in die Villa Grothe.
Und während der alte Grothe mit seiner Tochter und seinem Schwiegersohn in ausgelassenster Laune auf dem Filmball beim Champagner saß und die vor seiner Loge vorbeiwirbelnden Paare mit Konfetti überschüttete, saß Elisabeth kniend vor Reinhart v. Loos, der ihr mit den abgemagerten Händen durchs Haar fuhr und mit matter Stimme aus seiner französischen Gefangenschaft erzählte:
Reinhart stand, wenn er äußerlich auch jetzt frei war, seelisch noch völlig unter dem Druck des Erlebten. Und was zeitlich hinter ihm lag, empfand er gegenwärtig und hätte es ganz natürlich gefunden, wenn seine Peiniger ihn jetzt von Elisabeth fortgerissen und unter Schlägen in einen dunklen Arrest gesperrt hätten.
Daher auch die starke Wirkung des Erzählten, das durch seine Unmittelbarkeit bildhaft wirkte. Elisabeth, die Reinharts Qualen körperlich mitfühlte, war mit ihrer Kraft zu Ende, als Reinhart fortfuhr:
„Dieser Venère im Lager von Abomey zwang mich, nachdem er mir mit dem Ochsenziemer den Verband von meinem entzündeten und geschwollenen Auge heruntergeschlagen hatte, die Ausleerungen der Dysenteriekranken mit bloßen Händen aus den Eimern zu nehmen. Ich erbrach mich. Daraufhin versetzte er mir Faustschläge ins Gesicht und ließ mir Daumenschrauben anlegen, die wenigstens das Gute hatten, daß ich das Bewußtsein verlor.“
Elisabeth krampfte die Finger zusammen und schluchzte in sich hinein.
„Du wirst begreifen, Elisabeth, daß ich in dieser Not die Stunde meiner Errettung aus den Händen des Obersten Petitdenange vom 52. Kolonialregiment, die ich aus Liebe zu dir einst gesegnet hatte, verwünschte. Ich sah mich, wieder zu Bewußtsein kommend, inmitten meiner Kameraden, in jenem Rettungstrupp von Verwundeten, Kranken und Aerzten. Eine kurze Strecke hinter der letzten Linie stand der Oberst mit einer Schar seiner Grenadiere und hielt jeden seiner Soldaten an, der nicht den Mut gehabt hatte, uns arme Teufel, die wir um Schonung baten, zu ermorden. Sie wurden beschimpft und nach vorn geschickt. Die deutschen Gefangenen ließ der Oberst, wenn eine genügende Anzahl zusammen war, durch Handgranaten erledigen, nachdem er erst eine Zeitlang an ihrer Angst sich geweidet hatte. Wie durch ein Wunder bin ich diesem Massenmord damals entkommen. Meine Verwundung am Oberschenkel machte es mir unmöglich, zu stehen, ich legte mich lang, wurde für tot gehalten und von zwei Mann und einem Unteroffizier fortgeschleppt, um später mit den ermordeten Kameraden verscharrt zu werden. — Wäre ich es nur!“ rief er mit leidverzerrtem Gesicht! „Hätte ich damals gewußt, was mir in Abomey bevorstand, ich hätte mich lebendig begraben lassen und hätte für diese Gnade Gott gedankt!“
Elisabeth wimmerte wie ein Kind und umschlang seine Knie, als wollte sie ihn zurückhalten, als empfände sie, daß er mehr als nur im Geiste fern von ihr war. So kam ihr auch gar nicht der Gedanke, den Erschöpften auf irgendeine Art zu stärken, ihn zu trösten und zu ermutigen. Sie fühlte, daß er fern von ihr war, erst einmal zu sich und dann zu ihr zurückfinden mußte.
Wenn du erst bei mir bist!
wollte sie sagen, mühte sich, brachte aber kein Wort heraus.
Daß er unter dem Eindruck des Wiedersehens auf dem Bahnsteig für Augenblicke ganz nur bei ihr gewesen war und sich für sie hatte opfern wollen, um ihre Jugend nicht an seinen lebenden Leichnam zu ketten, wußte sie nicht.
Reinhart erzählte weiter. Sie hörte ihn kaum. Erst nach einer Weile, als sie den Kopf hochrichtete und ihn ansah, rief sie:
„Und das Haar! das weiße Haar?!“
„Aus dem Lazarett, in dem ich von den Qualen wenigstens körperlich erholt, kam ich in das Lager, von dem ich dir erzählte. Meinem ersten Fluchtversuch, für den ich verhältnismäßig milde bestraft wurde, erfolgte zusammen mit drei Kameraden ein zweiter, der abermals mißlang, da ich mit meinem zerschossenen Bein liegenblieb. Man warf mir vor, auf der Flucht einen Soldaten, der auf uns schoß, durch einen Steinwurf im Gesicht verletzt zu haben. Es war nicht wahr, vielmehr hatte sich der Kerl, da er uns hatte entfliehen lassen — er wußte warum — die, übrigens harmlose Verletzung selbst beigebracht, um seine Unschuld zu beweisen und um nicht bestraft zu werden. Kurz und gut: ich sollte erschossen werden. Erspar’ mir die Erzählung der letzten Nacht, die ich in einem dunklen Loch in Gedanken mit dir verbrachte. Am nächsten Morgen führte man mich auf einen engen Hof hinaus. An einer Querseite standen die Soldaten mit ihren Gewehren; ihnen gegenüber stellte man mich auf. Ich war — dich vor Augen, Elisabeth! — ganz ruhig. Man legte mir, trotz meiner heftigen Widerrede, eine Binde um die Augen — und ich erwartete seelenruhig das Kommando. — Es kam nicht. — Nach einer Weile nahm man mir die Binde ab; ein Offizier sagte: „Morgen!“ — Ich wurde abgeführt. Und nun kam das Furchtbare, was nur perverse Gehirne sich erdenken können. Zehn Tage lang wiederholten sie die Quälerei. Zehn Tage und zehn Nächte lang lief ich, dem Wahnsinn nahe, in meinem dunklen Loch gegen die Wand. Mein Kopf war angeschwollen und schließlich nur noch eine einzige Beule. Zehn Morgen hintereinander stand ich, die Binde vor den Augen, vor den Gewehrläufen der französischen Soldaten. Immer fand sich ein neuer, plausibel klingender Grund, aus dem sie die Exekution auf den nächsten Tag verlegten. Die Minuten, die ich so stand und wartete, wurden mir zu Stunden. Schließlich, am zehnten Tage, als sie wohl merkten, daß ich dem Wahnsinn nahe war, erklärten sie mir, nachdem sie mir die Binde abgenommen hatten: „So! nun dürfte Ihnen die Lust zum Fliehen fürs erste wohl vergangen sein!“ — Ich war nicht mehr zurechnungsfähig, litt monatelang an Verfolgungswahn— aber die weißen Haare bekam ich über Nacht. Denn als ich am sechsten Tage wieder auf den Hof geführt wurde, sah ich das erstaunte Gesicht des Offiziers und hörte aus ihrer Unterhaltung, was für eine äußerliche Veränderung über Nacht mit mir vorgegangen war.“
Elisabeth hatte sich erhoben, saß jetzt neben ihm und hielt seine Hand. Er wandte den Kopf und sah sie an.
„Wenn du erst bei mir bist!“
sagte sie leise und schmiegte sich an ihn
Zweites Kapitel
Mit dem nächsten Morgen begann für das Haus Grothe ein kritischer Tag erster Ordnung.
Reinhart v. Loos war für die Nacht von Frau Jenny in dem Fremdenzimmer untergebracht worden.
„Es ist zwar nicht ganz korrekt,“ hatte sie zu Elisabeth gesagt. „Aber es gibt Fälle, in denen man nach seinem Gefühl handelt. Ich bekomme es nicht übers Herz, ihm zu sagen, er soll sich irgendwo ein Unterkommen suchen. Die erste Nacht wenigstens bleibt er hier.“
Reinhart v. Loos folgte wie ein Kind, dem man ein Märchen erzählt. Was hier geschah und mit ihm vorging, erschien so unwahrscheinlich, daß er es nicht für wirklich nahm und es für einen jener Fieberträume hielt, die er oft in Afrika gehabt hatte. Die Erinnerung daran und die Hoffnung auf Wiederkehr war es gewesen, die ihn immer wieder vor dem letzten Zusammenbruch bewahrt hatte. So fürchtete er auch heute, als Elisabeth ihm gute Nacht sagte und Frau Jenny ihn auf sein Zimmer brachte, daß diesem Traum am nächsten Morgen ein verzweifeltes Erwachen folgen werde.
Frau Jenny war von dem Zusammenbruch Reinharts so erschüttert, daß sie für Elisabeth zunächst kein Wort des Trostes fand. Erst gegen Mitternacht ging sie zu ihrem Kinde, das, wie sie es erwartet hatte, noch auf war und vor dem Bilde Reinharts saß. Es war die letzte Photographie, bevor er ins Feld ging. Ein Bild blühender Kraft und Jugend.
„Du mußt das nicht tun,“ sagte Frau Jenny und legte den Arm um ihr Kind. „Wenn du ihn lieb hast ...“
„Mutter!“ fiel sie ihr ins Wort und wandte den Kopf.
„Ich weiß! ich weiß!“ erwiderte die. „Und eben darum, Kind, mußt du vergessen, wie er aussah. Nur wenn du es überwindest, kann er überwinden.“
Elisabeth begriff.
„Es ist ja nicht meinetwegen, Mutter!“ sagte sie. „Ich werde ihn, wenn das möglich ist, nun noch lieber haben. Aber, wie er so weiterleben soll, das weiß ich nicht. — Wenn ich doch von heut auf morgen zwanzig Jahre älter werden könnte!“
„Du brächtest es fertig und tätest es!“
„Ich würde Gott auf Knien dafür danken.“
„Nein, mein Kind, das entgegengesetzte Verfahren ist das natürliche. Reinhart wird wieder jung werden.“
„Mutter! wenn das wäre!“
„Es wird sein! — Aus einem Fünfzigjährigen kann man keinen Jüngling machen. Man kann ihm die Haare färben und ihn in die Kleider eines jungen Mannes stecken — er wird darum nicht um einen Tag jünger. Aber ein Mensch von sechsundzwanzig, der überwindet, erholt sich und vergißt — zumal, wenn die Liebe seinen Willen stärkt.“
„Das glaubst du wirklich?“ fragte Elisabeth.
„Ich bin davon überzeugt. — Und was für Reinhart gilt, das gilt für alle, denen es geht wie ihm. Es sind Tausende, Hunderttausende! Es ist das ganze deutsche Volk, das krank ist an Körper und Seele. So nur darfst du beurteilen, was dich so bedrückt und was du siehst — nicht nur hier im Hause — überall ist’s so und noch schlimmer. Ein kranker Körper, der gesunden wird, wenn nur ein paar Hundert Menschen den Willen und die Kraft haben, zu heilen und zu helfen. Jeder muß mitwirken für sein Teil! Jeder muß, was er tut, für’s Ganze tun! Reinhart ist, wie jeder andere, nur ein Teil des Ganzen. Der Eine hat, wie er, mehr seelisch und körperlich gelitten; andere wieder, wie Ediths Mann, moralisch. Pflicht derer, die gesund geblieben sind, wie du und ich, ist es, zu heilen.“
„Du hast recht, Mutter! Und gerade wir Frauen können da helfen.“
„Vielleicht! — vielleicht auch nicht!“ fügte sie resigniert hinzu. „Bei deinem Vater ist es mir bisher nicht gelungen.“
Draußen ging die Tür.
„Sie kommen!“ sagte Elisabeth.
Frau Jenny schüttelte ungläubig den Kopf, sah nach der Uhr und sagte:
„Um zwei Uhr? Das wäre seit Monaten das erstemal, daß Papa so früh nach Hause kommt.“
Es war Erich, der mit Mantel und Hut erregt ins Zimmer stürzte. Noch in der Tür rief er:
„Gut, daß du noch auf bist, Elisabeth! Ich muß dich sprechen.“
„Mitten in der Nacht?“ fragte Frau Jenny. „Wo sind die andern?“ Und besorgt fügte sie hinzu: „Es ist doch nichts passiert?“
„Die baden in Sekt,“ erwiderte Erich. „Als ich fortging, stieg eine Filmdiva in dem soeben errungenen Schönheitspreis, einem Seal im Werte von hunderttausend Mark, auf den Tisch und hielt eine Rede: ‚Kinder!‘ sagte sie, ‚ihr habt, indem ihr mir den Schönheitspreis — übrigens mein elfter Pelz! — gabt, entschieden Geschmack entwickelt. Mein Freund‘ — und neben ihr stand ein dickbäuchiger Börsianer mit taubeneigroßen Perlen im Frackhemd — ‚ehrt euern Geschmack, indem er für jeden Tisch eine Flasche Sekt spendet.‘ — Beifallsbrüllen und Getrampel war die Antwort. — ‚Deutschen oder französischen?‘ schrie grell die Stimme eines Mannes, die mir bekannt schien. Unter Pusten ließ sich der dicke Börsianer auf den Tisch heben, legte den Arm um die Diva und sagte: ‚Sieht die Frau nach deutschem Sekt aus?‘ — Dabei wies er auf die Stelle, wo die Diva zufälligerweise etwas anhatte, wies auf den Kopfschmuck, die Schuhe und Strümpfe, hob den kurzen Rock, so daß man ihr spitzenbesätes Seidenhöschen sah, und sagte: ‚Vom Kopf bis zum Zeh, alles, was Sie sehen und was Sie nicht sehen, stammt aus Paris!‘ — ‚Eine Schande!‘ rief irgendwer, wurde einem Sipo übergeben und flog an die Luft. Der dicke Börsianer aber lachte laut, hielt sich den dicken Bauch und rief: ‚Vergebt ihm, denn er weiß nicht, was er tut — er spekuliert vermutlich in Mark!‘ — Ein höllisches, höhnisches Gelächter war die Antwort. Auf dem Nebentisch stand plötzlich ein breiter Amerikaner, der wie eine Bulldogge aussah, griente und die Zähne zeigte. ‚Ruhe!‘ schrie man, und der Amerikaner brüllte: ‚Meine lieben Germans. Ich will wechseln eine Pfund und noch eine Pfund und will davon bezahlen alles, was ihr tut trinken bisher und was ihr trinken hinterher.‘ — Man jubelte ihm zu. Und tausend Stimmen schrien: ‚Es lebe der Dollar!‘ Vater ließ den Amerikaner hochleben.“
„Schändlich!“ schalt Elisabeth, und Frau Jenny schloß die Augen und sagte:
„Schamlos!“
Erich aber, der einen roten Kopf hatte und noch immer im Mantel stand, fuhr fort:
„Die Kapelle spielte irgendeinen blöden Niggersong, die blöde Gesellschaft hielt es für die amerikanische Nationalhymne, sprang auf und sang mit Hingabe und Begeisterung die Melodie mit.“
„Und der Amerikaner?“ fragte Frau Jenny.
„Der tanzte plötzlich auf dem Tisch den Niggertanz, wurde auf die Schultern gehoben und unter Jubel durch den Saal getragen.“
„Dem Volk ist nicht zu helfen,“ sagte Elisabeth. Frau Jenny widersprach:
„Es ist nicht das Volk! Es ist minderwertiges Gesindel von Schiebern und Spekulanten, die auf solche Feste gehen und sich so aufführen.“
„Es ist die neue Gesellschaft!“ erwiderte Elisabeth, „die nach Zehntausenden zählt.“
„Aber es gibt auch Tausende, die das anekelt, wie es uns anekelt, die wie wir fühlen, daß Deutschland ein Trauerhaus ist, in dem man nicht tanzt, solange noch ein belgischer oder französischer Soldat als Polizist im Lande steht.“
Erich zuckte die Achseln und sagte:
„Als wenn es das wäre!“
„Was ist es denn?“ fragte Frau Jenny.
„Das Kapital!“ erwiderte der.
„Was hat denn das damit zu tun?“
„Es ist schuld an allem!“
„Seit wann sprichst du so?“ fragte Elisabeth.
Erich erschrak und verbesserte schnell:
„Das war nur so dahingesagt.“
„Aber, wenn du das Gefühl dafür nicht hast,“ erwiderte Elisabeth, „warum bist du dann so erregt davongelaufen?“
Erich sah seine Mutter an und sagte:
„Nimmst du es übel, Mama, wenn ich mit Elisabeth allein ...“
Frau Jenny lächelte und sagte:
„Durchaus nicht! Du bist bei ihr genau so gut aufgehoben wie bei mir. Und ich wäre sehr froh, wenn du dich ihr in allem anvertrautest.“ Sie sagte ihren Kindern gute Nacht und ging.
Erich, knapp zwanzig, aber wichtig, als habe er ein Ministerportefeuille zu verwalten, stellte sich vor Elisabeth, deren Gedanken während des ganzen Gespräches bei Reinhart gewesen waren, hin und sagte:
„Du wirst staunen.“
„Nanu?“ erwiderte die.
„Ich bin nicht der, für den du mich hältst.“
„Was bedeutet das?“
„Also, für was hältst du mich?“ fragte er bedeutungsvoll.
„Für den verzogenen Sohn eines sehr reichen Vaters, der nichts anderes gelernt hat, als gut tanzen, Geld ausgeben und sich wichtig zu machen.“
„Danke!“
„Verzeih meine Offenheit, aber du weißt, ich kann nicht heucheln.“
„Ich aber habe es bisher getan.“
„Inwiefern?“
„Ich bin Kommunist!“
Elisabeth mußte lächeln.
„Du weißt, scheint’s, nicht, was das ist.“
Erich entwickelte mit Pathos das kommunistische Programm. Elisabeth hatte die Augen halb geschlossen und dachte an Reinhart. — Als Erich zu Ende war, sagte sie:
„Und die Nutzanwendung?“
„Die durfte ich im Interesse der guten Sache nicht ziehen.“
„Durftest es nicht? Wer hat es dir verboten?“
„Wilhelm Fürst.“
„Dacht’ ich’s mir doch.“
„Er ist unser geistiger Führer.“
„Der streng nach dem Programm lebt?“ fragte Elisabeth. —
Erich schwieg.
„Oder tut er es etwa nicht?“
„Wie kommst du zu der Frage?“ rief Erich erregt. „Du weißt etwas!“
„Er gefällt mir nicht.“
Da widersprach Erich und setzte sich lebhaft für Fürst ein.
„Er opfert sich,“ beteuerte er. „Du hättest ihn sehen sollen.“
„War er etwa auch auf dem Filmball?“
„Allerdings — das heißt beruflich.“
„Dann hat er wohl auch beruflich Champagner getrunken und Foxtrott getanzt?“ fragte Elisabeth, die für Augenblicke Reinhart vergaß.
„Allerdings!“
„Das lasse ich mir gefallen. Auf die Methode möchte manch einer Kommunist sein.“
„Du hast keinen Grund, ihn zu verhöhnen.“
„Im Gegenteil! Ich bewundre ihn.“
„Ich sah ihn mit ein paar Damen in einer Loge und suchte ihn auf.“
„Er war wohl sehr überrascht, dich auf dem Ball zu sehen?“
„Offen gesagt, ich genierte mich.“
„Und er?“
„Er sagte leise zu mir, damit die Damen es nicht hörten: ‚Was glaubst du, wie mich das hier anekelt? Aber ich muß die Bourgeoisie da aufsuchen, wo sie am aufdringlichsten und frechsten ist.“
„Warum muß er?“ fragte Elisabeth.
„Weißt du es wirklich nicht? Ich hätte dich für klüger gehalten! Um Studien zu machen — wozu wohl sonst? Man muß doch kennen, was man bekämpft.“
„Ich finde, man sollte mit gutem Beispiel vorangehen, wenn man sich als Menschenbefreier und Weltbeglücker aufspielt.“
„Aber Elisabeth, dadurch, daß er in die Volksküche geht, bekehrt er doch diese Menschen nicht.“
„Gewiß nicht! Aber wenn er auf die Rede des Dollarkönigs erwidert hätte: Wir haben der Entente so viel Opfer zu bringen, daß wir uns nichts vergeben, wenn wir das Angebot des Amerikaners annehmen. Dafür aber soll jeder die Hälfte seiner Zeche, die der Amerikaner übernimmt, für notleidende deutsche Kinder opfern — so hätte er damit ein gutes Werk getan.“
„Das hat ja nichts mit Kommunismus zu tun!“ erwiderte Erich überlegen.
„Aber mit Menschlichkeit — und die steht höher als eure Parteiprogramme.“
„Das sind Kompromisse! Davon wollen wir nichts wissen. Sie führen nur zur Verbürgerlichung des Proletariats. Und die ist der Tod des Kommunismus. Ohne Gewalt geht es nun einmal nicht.“
Elisabeth lächelte und sagte:
„War es das, worüber du mit mir reden wolltest?“
Erich wurde etwas kleinlaut und sagte:
„Ich wollte dich um tausend Mark bitten.“
„Mitten in der Nacht?“
„Es ist nicht für mich.“
„Etwa für Fürst?“
„Ja! — Er forderte es von mir.“
„Er forderte es? — Ja, mit welchem Recht?“
„Nach unserem Parteiprogramm muß jeder, der hat, dem, der nichts hat, geben.“
„Ja, du hast doch aber nichts.“
„Ich persönlich nicht — aber Vater — und das ist dasselbe — sagt Fürst.“
„Sagt Fürst,“ wiederholte Elisabeth. „Und was Fürst sagt, ist für dich Gesetz.“
„Parteidisziplin ist oberstes Gesetz.“
„Sieh einmal an, wie du plötzlich gelernt hast, dich unterzuordnen. Auf der Schule tatest du das nicht.“
„Ich bitt’ dich, Elisabeth, was sind das für Vergleiche!“
„Nun, in bezug auf Unfreiheit scheint mir der Unterschied nicht allzu groß zu sein.“
„Ich bitte dich! die Penne und der Kommunismus, das sind doch so weltverschiedene Dinge wie ...“
„Wie was?“ fragte Elisabeth.
„Na, wie ein Frosch zum Elefanten oder die Müggelberge zum Himalaja.“
„Und was will Fürst mit dem Geld?“
„Weitergeben!“
„Heut nacht noch?“
„Ja! — Er sagt, ich könnte mir gar keine Vorstellung davon machen, wie toll es die Bourgeoisie treibt. Bis in den Tag hinein.“
„Der Aermste! Er opfert sich also geradezu für seine Ueberzeugung, und die Damen, die er bei sich hat, vermutlich auch.“
„Also bitte, gib mir das Geld!“ drängte Erich.
Elisabeth schüttelte den Kopf und sagte:
„Nein! Weder gebe ich dir einen Pfennig für deine politischen Zwecke — du bist ja viel zu ungebildet und unreif, um dich überhaupt politisch zu betätigen, und wenn du jetzt auf den Kommunismus schwörst, so ist das nichts weiter, als die bei deiner Jugend natürliche Reaktion auf den Luxus, der dich hier umgibt — noch gebe ich dir einen Pfennig für diesen sonderbaren Heiligen, der deine Gutmütigkeit ausnutzt.“
„Du hast keine Ideale, Elisabeth!“ rief Erich. „Ich habe mich schwer in dir getäuscht.“
„Du wirst zu mir zurückfinden, Erich!“ erwiderte sie in aller Ruhe ihrem Bruder, der sie gekränkt verließ und nach hinten ging bis zur Tür, hinter der die Köchin schlief. Dort klopfte er energisch.
Eine verschlafene Stimme rief:
„Wa ...?“ Und als er immer weiter klopfte: „Ja doch! wo brennt’s denn?“
„Minna!‘ rief Erich. „Machen sie auf!“
„Jesses! der junge Herr! mitten in der Nacht.“
„So öffnen Sie schon!“
Minna lachte laut und rief:
„Nee, Herr Erich, müssen Sie aber einen zu sitzen haben! — Ich bin des Nachts nicht schöner als am Tage — und jünger auch nicht. — Achtundfünfzig auf den Kopf, damit Sie’s wissen.“
„Sie sind verrückt! Wer denkt an so was? Ich habe Wichtigeres im Kopf! Parteisache!“
„Jroßer Gott! jeht es los?“
„Bald!“
„Ich komme! ich komme!“
Die Tür ging auf, und was jetzt erschien, war undefinierbar. Nicht Frau, nicht Mann, überhaupt nichts, was an einen Menschen erinnerte. Aber unter einer Haube, an der eine Art Rattenschwanz herabhing, glotzten ein Paar scharfe, leuchtende Augen hervor. Und ein Mund, dessen Zähne in einem Glas Wasser auf dem Nachttisch standen, tat sich auf, der in Form und Umfang an einen Frosch erinnerte.





























