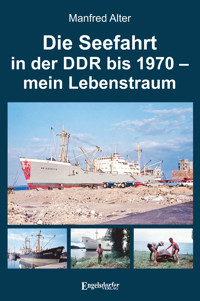
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Manfred Alter, geboren 1943, wächst in der Nachkriegszeit in bäuerlicher Umgebung im Osten Deutschlands auf. Er ist technisch interessiert und kann in der Märkischen Schweiz eine Lehre zum Motorengetriebe-Schlosser antreten, verbunden mit Internatsunterbringung und allem, was für die Mannswerdung eines Jugendlichen wichtig ist. Nach Abschluss als Facharbeiter träumt Manfred von der Seefahrt. Es gibt nur eine Konsequenz: Anheuern in der Nationalen Volksarmee – Waffengattung Seestreitkräfte! 1961 ist die Musterung und bald darauf findet er sich in der Flottenschule Stralsund „Parow“ wieder und wird vom Mauerbau rings um Westberlin überrascht. Er lernt Torpedo-Schnellboote der DDR-Marine kennen und zu warten, unter anderem im Bereitschaftshafen Gager auf Rügen. Nach drei Jahren bewirbt sich Manfred um einen Job in der Deutschen Seereederei Rostock (DSR). Sein Traum geht in Erfüllung, denn im Laufe der folgenden Jahre führen ihn die Seereisen mit den Schiffen MS „Dornbusch, MS „John Brinkmann“, MS „Weisseritz“, MS „Lieselotte Herrmann“, MS „Sellin“ und der MS „Albin Köbis“ in viele Länder, wie Ägypten, Bangladesch, Belgien, BRD, Burma/Myanmar, Dänemark, Elfenbeinküste, England, Finnland, Frankreich, Gran Canaria, Griechenland, Guinea, Indien, Jordanien, Kenia, Libanon, Libyen, Niederlande, Norwegen, Pakistan, Polen, Sansibar, Saudi Arabien, Schweden, Senegal, Sowjetunion, Südafrika, Sudan, Syrien, Tansania, Türkei, Zypern und immer wieder zurück in die Heimathäfen in Rostock, Wismar und Stralsund in der DDR.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Alter wurde am 16.03.1943 in Jakobsdorf (Mark) geboren. Er erlernte den Beruf eines Motoren-Getriebeschlossers. Nach Beendigung der Seefahrt im Jahre 1971 qualifizierte er sich zum Meister für Anlagenbau und arbeitete bis 1980 als Flugzeugmechaniker und Meister für Hubschrauberinstandhaltung auf dem Flughafen Leipzig-Mockau. Kurzzeitig war er im Kundendienst für Medizin-Technik tätig, bevor er im Institut für Bio-Medizintechnik und Informationsverarbeitung des Klinikums „St. Georg“ in Leipzig als Meister für Medizin-Technik bis zur Erreichung des Rentenalters arbeitete.
Zum Schreiben kam Manfred Alter rein zufällig erst im hohen Alter. Als er 2014 einen Krankenhausaufenthalt hatte und sich im Zug der Genesung langweilte, nahm er die Rückseite eines Speiseplanes und schrieb darauf eine Geschichte. Er bekam daraufhin sehr viel Zuspruch von der Familie. Das ermutigte ihn, über seinen Lebenstraum, die Seefahrt zu schreiben. Und das tat er mit sehr großer Freude.
Manfred Alter
Die Seefahrt in der DDR bis 1970 – meinLebenstraum
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2025
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Angaben nach GPSR:
www.engelsdorfer-verlag.de
Engelsdorfer Verlag Inh. Tino Hemmann
Schongauerstraße 25
04328 Leipzig
E-Mail: [email protected]
Copyright (2025) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Fotografien © Manfred Alter
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Inhalt
Vorwort: Aus den Erzählungen meiner Mutter
Das Jahr 1945
Kapitel 1: Erlebnisse aus meiner Kindheit
Die Schulzeit
Ein Besuch in Westberlin
Die Nachkriegsjahre
Unsere Freizeitbeschäftigungen
Der Kinofritze
Der Alltag
Mein Stiefvater
Kapitel 2: Die Jugendzeit
Arbeit in der LPG
Die Lehrjahre
Kapitel 3: Die Armeezeit
Mein Jugendtraum
Sonntag, der 13. August 1961
Bei den Torpedo-Schnellbooten
Zwischenfall
Zwei Episoden aus dem Bereitschaftshafen Gager
Freizeitgestaltung
Kapitel 4: Die Christliche Seefahrt
Wie es begann
Zwischenspiel als Springer
Kapitel 5: Mein Leben auf der MS „John Brinkmann“
Die weiße Lady
Auf dem Weg nach Conakry
Zum ersten Mal Afrika
Das liebe Geld und die Erlebnisse mit Passagieren
Die Bananenplantage
Auf Heimaturlaub
Die Kollision
Hamburg und die Hamburger Werft
Ein besonderer Osterausflug
Auf zu neuen Abenteuern – Havarie an Bord
Wieder auf Heimaturlaub
Kapitel 6: Mein Leben auf der MS „Weisseritz“
Das Schiff
1. Station – Libyen, Bengasi
2. Station – Libanon, Beirut
3. Station – Türkei, Mersin
4. Station – Zypern, Famagusta und Limassol
5. Station – Griechenland, Piräus, Eleusis und Kreta
Kapitel 7: Auf dem Kümo MS „Dornbusch“
Wartezeit als Springer
Die Sache mit der Schmuggelei
Auf nach Otterbäcken
Bauholz für Amsterdam
Kapitel 8: Auf dem Kümo MS „Sellin“
Der 2. Einsatz als Springer
Mein Schmuggelversteck
London
Kleipeda
Plötzlich in Verantwortung
Kapitel 9: Mein Leben auf der MS „Lieselotte Herrmann“
Mein lang ersehntes Schiff
Der Schiffsaufbau
Die Maschine
Los geht’s
Mit der Seemannsmission durch Kopenhagen
Die Havarie im Kanal
Rotterdam, das nächste Ziel
Antwerpen und die Kühe
Auf dem Weg nach Beirut
Beförderung
Port Said und der Suezkanal
Die Stadt Akaba
Port Sudan
Mein erster Tauchgang am Riff
Auf nach Indien
Kapitel 10: Erlebnisse auf der Ost – Asienroute mit der MS „Lieselotte Herrmann“ und der MS „Albin Köbis“
Cochin
Die Fischsenke
Eine Flussfahrt
Das First-Class-Hotel
Das Zylinderkolbenziehen – Eine Kontrolle/Wartung der Kolben
Im Hafen von Bombay
Landgang in Bombay
Die hängenden Gärten von Bombay
Ein Mungo an Bord und unser Weg zurück nach Rostock
Unser Swimmingpool
Der „Suezkanal“ 1967
Wieder am Riff
Eine Schildkröte an Bord
Der Haifisch-Fang
Viehtransport nach „Jeddah“
Der Fang im Korallenriff
Schwere See
Meine Äquatortaufen
Indisches Treiben
Das Präparieren an Bord
Ein Ankerplatz im Ganges
Landgang Kalkutta
Die Leichenverbrennung
Beobachtungen von Deck aus
Im Delta des Brahmaputra
Zwei Passagiere an Bord
Sansibar und der Besuch der Schildkröteninsel
Störung im Kühlsystem
Begrenzte Reserven
Rückreise mit Umweg
Kapitel 11: Ehefrau mit an Bord
Formalitäten
Erneut Ärger mit der Kühlmaschine
Wieder seekrank
Treff mit sowjetischen Seemännern
Man trifft sich immer zweimal
Strandbesuch in Madras
Noch einmal Bombay
Die Goldpagoden von Rangoon (Yangon)
Bordgeschichten
Ein illegaler London-Besuch
Kapitel 12: Meine letzte Seereise
Von Rostock nach Port Sudan
Das geteilte Riff.
Auf nach Durban in Südafrika
Die Gedanken sind frei
Anhang
BesondererDank gilt meinerFrauCarlaSmok
für die umfangreicheUnterstützung
beimZustandekommen diesesWerkes.
ManfredAlter
VorwortAus denErzählungen meinerMutter
Das Jahr 1945
Die Kriegswirren nahmen kein Ende. Es war ein ständiger Kampf ums Überleben. Wir wohnten in unmittelbarer Nähe der Kampfzone zur Eroberung der deutschen Hauptstadt Berlin. Der Mittelpunkt der Kampfhandlungen von deutschen Truppen und der Sowjetarmee waren die „Seelower Höhen“, über die Oder von Polen nach Kystrin/Seelow. Sie gehörten zu der schwersten und historisch bedeutsamen Kämpfen des 2. Weltkrieges in Zusammenhang mit der Eroberung Berlins.
Das Dorf „Jakobsdorf“, Kreis Lebus liegt ca. 30 km südlich von Kystrin.
Zum größten Gutsanwesen am Ort gehörten riesige landwirtschaftlich genutzte Felder. Das Herrenhaus verfügte über einen alles überragenden Aussichtsturm. Von diesem aus hatte der Herr des Gutes die Möglichkeit, sich zu jeder Zeit über den Fortgang der Arbeiten auf den Feldern zu informieren.
In ca. 100 m Entfernung vom Gutshaus befand sich das Grundstück meiner Eltern.
Der Aussichtsturm sollte unter keinen Umständen in die Hände der Sowjetarmee fallen, da er durch seine strategische Lage wichtig für die Kriegshandlungen war. Bis Berlin waren es noch 80 km. Letztendlich hieß der Befehl der deutschen Wehrmacht, den Turm durch die Artillerie zu zerstören.
Durch einen fehlgeleiteten Angriff wurde jedoch nicht der Turm, sondern das Haus meiner Eltern buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht. Es war das einzige völlig zerstörte Haus des Ortes.
Somit hatte meine Familie kein Zuhause mehr.
Meine Familie, das waren zu diesem Zeitpunkt:
Vater Fritz, Erich, Wilhelm Alter, geboren 1907,Meinen Vater lernte ich nie kennen. Er wurde kurz vor Kriegsende eingezogen. Eine letzte Nachricht vom Dezember 1944 erreichte die Familie. Er kam nicht aus dem Krieg zurück.
Mutter Hedwig Alter, geboren 1914,Oma Marie Alter, Mutter meines Vaters,Bruder Rolf Alter, geboren 1933und ich, Manfred Alter, geboren 1943.
Die Rote Armee zog durch das Land. Jacobsdorf lag mitten im Kampfgebiet. Nach der Bombardierung unseres Hauses wurde uns ein Zimmer beim Bauer Lehmann angeboten. Hier durften wir vorübergehend wohnen.
Das Zimmer im Bauernhaus war so hergerichtet, dass ein Schlafen für drei Erwachsene und ein Kleinkind möglich war. Auch ein alter Kleiderschrank wurde zur Verfügung gestellt. Die Essenzubereitung war in der Bauernküche möglich.
Nicht weit von diesem Bauerngrundstück entfernt, lag ein weitaus größeres Areal. Auf ihm stand eine riesige Scheune mit einer Tenne, dahinter befand sich eine Unterkellerung, genannt Bunker. Dieser diente den Frauen des Dorfes als Versteck. Sie suchten hier Schutz vor Bomben und vor den Sowjetsoldaten, die allerorts als Russen bezeichnet wurden. Keine Frau war vor ihnen sicher. Sie kamen mit Gewehren und Maschinenpistolen und peinigten, misshandelten und vergewaltigten junge Mädchen, Frauen und Mütter. Sie stanken wie Schweine und benahmen sich auch so.
Meine Mutter befand sich wieder einmal mit anderen Frauen des Dorfes im Bunker, als dieser von den Russen durchsucht wurde. Sie hielt mich schützend in ihren Armen, ich war gerade erst zwei Jahre alt. Mit dem Gewehr im Anschlag zwang ein Soldat meine Mutter mit dem kleinen Sohn auf dem Arm, den Bunker zu verlassen. Sie liefen durch die Scheune hinaus auf den Acker. Das Feld war mit Sträuchern und Bäumen begrenzt.
Meine Oma und mein älterer Bruder befanden sich zu dieser Zeit nicht im Bunker. Sie hörten aber das Flehen und Schreien der Frauen, darunter auch das der eigenen Schwiegertochter und Mutter.
Meine Mutter, ihren zweijährigen Sohn auf dem Arm, vom Soldaten vor sich hergetrieben, nahm die Gelegenheit wahr und rannte nach dem Verlassen des Bunkers in Richtung der Bäume und Sträucher davon. Sie schaffte ca. 50 m. Dann ertönte ein furchtbarer Knall. Meine Mutter brach zusammen. Der Schuss des Russen hatte ihr den linken Oberschenkel zerschmettert. Der komplette Oberschenkel mit Knochen war wie amputiert. Sie lag blutüberströmt auf dem Feld. Ich war aus ihren Armen gefallen und lag neben ihr.
Durch den Knall des Schusses und das Schreien meiner Mutter bekam der Russe Angst und flüchtete. Und Niemand würde ihn jemals des Verbrechens anklagen, denn es gab keinen Zeugen und es war noch Krieg.
Wie üblich gab es zu dieser Zeit keine Toiletten mit Wasserspülung. Hinter der Scheune hatte der Bauer ein Klosett mit Bretterverschlag gebaut, welches bei der Feldarbeit benutzt wurde.
Zum großen Glück für meine Mutter und mich.
Auf diesem Trockenklosett hatte sich genau zu dieser Zeit ein Angehöriger der Waffen-SS aus Angst vor den Repressalien der Russen versteckt. Durch das ständige Rufen meiner Mutter nach Hilfe packte diesen nun die Angst, entdeckt zu werden. Er entschloss sich kurzerhand, zu uns zu eilen und verließ das Versteck. Was er nun vorfand und erlebte, war nicht zu beschreiben. Er zerriss sein Hemd und schnürte damit den Oberschenkel der Mutter ab, um die starke Blutung zu stillen. Anschließend rannte er ins Dorf und holte Hilfe. Aus dem Gefühl heraus, ließ er mich bei meiner Mutter. In dieser kritischen Situation sollten Mutter und Kind nicht auseinander gerissen werden.
Der Mann rettete meiner Mutter und mir das Leben!
Mit einem damals üblichen Handholzwagen mit Eisenringen als Bereifung, der im Dorf ein wichtiges Transportmittel für alles Lebensnotwendige war, erfolgte nun der Transport in ein Krankenhaus.
Ich wurde zu meiner Oma gebracht.
Mit dem Holzwagen, der für eine normale Körpergröße schon viel zu klein war, wurde irgendwie das Unmögliche möglich. Meine Mutter wurde hinein gelegt und übers Feld bis zur Autobahn und weitere 14 km bis nach Frankfurt/Oder gebracht. Unterwegs zum Krankenhaus flehte meine Mutter ständig, dass die Russen sie erschießen sollen. Bei diesem herzzerreißenden Anblick meiner Mutter in dem unmenschlichen Transportmittel, begann auch ein Russe zu weinen und warf sogar sein Gewehr weg.
Kriegsschicksale gab es ohne Ende.
Der Krankenhausaufenthalt meiner Mutter dauerte 6 Monate.
Als meine Mutter wieder nach Hause kam, lag unsere Oma im Sterben. Die Kinder waren verlaust, mit Lumpen bekleidet. Die Oma starb. Sie wurde in einem Schweineabbrühtrog in Laken in unserer Scheune bis zur Beerdigung aufgebahrt.
Das Leiden wollte kein Ende nehmen: Die Mutter war ein Krüppel, das Bein um 7 cm verkürzt; der Mann im Krieg, vermisst, ohne ein Lebenszeichen; zwei Kinder von 2 und 12 Jahren; ein großes Grundstück mit einem dem Erdboden gleichgemachten Wohnhaus, einem Trümmerhaufen. Auf dem Hof gab es nur noch eine Scheune, ein paar Stallungen und ein kleines Wirtschaftshäuschen, indem man wenigstens Brot backen konnte.
Und trotz allem ging das Leben weiter, ein Leben unter schwersten Bedingungen, ein Leben mit der tollsten, liebsten, besten und stärksten Mutter der Welt.
Hier enden die Schilderungen meiner Mutter über die Kriegserlebnisse 1945 und die für sie so tragischen Ereignisse.
Kapitel 1 Erlebnisse aus meinerKindheit
Die Schulzeit
Die Einschulung im Jahr 1949 ist fest in meinem Gedächtnis verankert, so dass ich die Ereignisse beim Schreiben noch einmal im Detail erlebe.
In Jakobsdorf gab es eine Schule mit zwei Klassenzimmern. Das 1. bis 4. Schuljahr lernte in dem einen und das 5. bis 8. Schuljahr im anderen Raum. Es wurde täglich von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr unterrichtet. Um eine bestimmte Ordnung in diesem Durcheinander zu gewährleisten, wurde u. a. der Rohrstock eingesetzt. Er lag auf dem Schreibpult des Lehrers. Bei Ungehorsam durfte der Schüler schon einmal vortreten, die Arme vorhalten und bekam einen Hieb mit dem Rohrstock auf die gerade ausgestreckten Finger. Besonders Lehrer der „alten Schule“ praktizierten dies gern. An unserer Schule war es der Lehrer mit dem Namen G. Er war fast militärisch gekleidet mit Offiziersstiefelhosen und Stiefeln, die nur so glänzten. Er hatte einen Säbelschmiss über der linken Wange, einen kurzen Haarschnitt und vor allem ein nie lächelndes Gesicht. Deshalb war die Angst im Unterricht stets präsent.
Die Grenzen zwischen amerikanischem, britischem und französischem Sektor waren zu dieser Zeit offen und man konnte von Ostberlin aus in jeden Stadtteil von Berlin gelangen. Jakobsdorf lag zwischen den Bahnstationen Frankfurt/Oder und Erkner. Ab Erkner verkehrte die S-Bahn durch ganz Berlin. Hier war auch der Kontrollpunkt. Kontrolliert wurden Erwachsene durch Vorlage des Personalausweises. Kinder konnten den Kontrollpunkt ohne weiteres passieren.
Es wurden die tollsten Geschichten erfunden, um Ostmark in Deutsche Mark zu wechseln, denn die brauchte man ja zum Einkaufen in Westberlin. Die Umtauschkurse waren abenteuerlich.
Für uns Kinder war das besonders wichtig für das Erlangen einer Schultüte (Zuckertüte) zur Einschulung. Die Schultüten gab es nur im Westteil der Stadt.
Manche Eltern waren aus der Not heraus sehr erfinderisch. Aus Zeitungen wurde eine Tüte gerollt, vorher mit Klebemittel aus Wasser und Mehl bestrichen, irgendwie mit buntem Papier vervollkommnet und fertig war die Tüte. Es gab auch Kinder, denen eine Schultüte versagt blieb, da ihre Eltern zu arm waren.
Ich bekam eine Zuckertüte.
In Jakobsdorf wohnte Stephan N. mit seiner Ehefrau Lieschen. Der Stephan, stark lungenkrank, rauchte aber wie ein Schlot. Er war das Versorgungsdepot hauptsächlich mit Westzigaretten. Er fuhr regelmäßig nach Westberlin, um die Zigaretten zu besorgen, die er dann auch in den Nachbarorten verkaufte. Kleine Mitbringsel, die er sich gut bezahlen ließ, waren ebenso in seinem Angebot.
Einschulung
Meine Mutter hatte ein wenig Geld aus der Bewirtschaftung des Hofes und der Feldarbeit bei den Bauern beiseite gelegt. So konnte sie für mich eine Zuckertüte bei Stephan bestellen. Aber wie sollte die Tüte gefüllt werden? Zwei Drittel der Tüte wurde mit kleinen Bällen aus bedrucktem Zeitungspapier ausgepolstert. Süßigkeiten gab es nur über den Zuckerabschnitt der Lebensmittelmarken. Um die Zuckermarken nicht so sehr zu strapazieren, brachte Stephan noch einige Leckereien aus Westberlin mit.
Für mich war die Schultüte wunderschön und sehr, sehr groß. So kam es mir jedenfalls vor. Und auch die Einschulungsfeier fand ich wunderbar. Trotzdem war eine Traurigkeit irgendwie im Herzen, denn zwei meiner Freunde hatten keine Schultüte. Aber wir Jungen hielten zusammen und so griffen wir in unsere Tüten und gaben ein paar Süßigkeiten ab.
Ein Besuch in Westberlin
Die Einschulung war Vergangenheit und die gewonnenen Lebensjahre veränderten auch den Jungen Manfred. Die Selbstständigkeit wuchs und wuchs. So war ich schon mal in der Lage mit Jugendfreunden Westberlin allein zu besuchen.
Dazu gehörte natürlich Geld. Aber woher nehmen? Ziemlich einfach und fast automatisch löste sich dann das Problem. Gleich in unserer Nähe befand sich ein sehr großer Bauernhof. Hier zog eine neue Familie mit zwei Jungen ein, die den Hof bewirtschafteten. Schnell wurde unter uns Bengel Freundschaft geschlossen. Der Ältere der Jungs, so in meinem Alter, war streng in die Arbeitsabläufe der Landwirtschaft eingebunden. Jede freie Minute suchte er den Kontakt zu uns, um unter anderem auch an unseren Dämlichkeiten teil zu haben. Wir quatschten viel und träumten ohne Ende. Vorgelebt wurde es ja, denn Westberlin war nicht weit. Irgendwie kamen wir im Gespräch auf Wasserpistolen. Was brauchte ein Junge in dieser Zeit: ein Messer, vielleicht eine Taschenlampe, eine Wasserpistole wäre toll. So brannten wir darauf, Westberlin einen Besuch abzustatten. Ganz geheimnisvoll zog unser neu gewonnener Jugendfreund 100 Mark aus der Hosentasche. Oh Gott! Jeder von uns dachte, der hat das Geld geklaut. Klauen hatte bei allen von uns absolut keinen Platz. Wir saßen im gleichen Boot, dazu noch arm wie die Kirchenmäuse. So nahmen wir an, dass es bei ihm zu Hause so viel Geld gab und dass es für jeden zugänglich war. Seine Meinung war, es würde nicht auffallen. Er war sich zu 100 % sicher. Und er wollte auch eine Wasserpistole. Wahrscheinlich besessen von der Idee, Berlin zu besuchen, nahmen wir das Geld. Nun war es an uns, den Besuch vorzubereiten. Lange Hosen waren das „A und O“, die mussten wir uns beschaffen. In denen sollten die Wasserpistolen versteckt werden. Für uns gab es ja nur kurze Hosen, dazu wurden lange Strümpfe getragen. Sie wurden mit einem Leibchen gehalten. Dieses war aber sehr teuer, so dass die meisten Jungs um die Oberschenkel je einen Einweckgummi trugen, der die Strümpfe vor dem Herunterrutschen bewahren sollte. Meist wurde noch ein Knoten in den Gummi gemacht, damit er den Strumpf besser hielt. Am Abend hatte man dann eine tiefe Druckstelle am Bein, keine schöne Empfindung.
Da unser Ort Jakobsdorf einen Bahnhof besaß, war es einfach bis nach Westberlin zu reisen. Der Ort war eingebunden im Schienennetz „Berlin-Warschau-Moskau“. Eiligst wurden die Fahrkarten gekauft. Wir erreichten die Stadt Erkner, hier endete die Regionalbahn. Es hieß Umsteigen in die S-Bahn. In den Zügen kontrollierte die ZBK, d. h. Zugbegleitungskontrolle. Im Volksmund hieß sie: „Zigeuner brühen Kaffee“ und trugen schwarze Uniformen. Für die S-Bahn war die ZBK nicht zuständig. Aber von Erkner in Richtung Frankfurt/Oder wurde fleißig kontrolliert, denn weiter gen Osten blühte der Schmuggel. An der 2. Station in Westberlin stiegen wir aus. Wir konnten es kaum erwarten, zum ersten Mal im Westen! Wir fühlten uns frei. Das Gefühl war unbeschreiblich und sollte noch lange anhalten. Einfach Glückseligkeit! Bis zur nächsten Bank waren es nur ca. 100 Meter. Und schon hatten wir nach dem Tausch richtiges Geld in der Hand. Mit ständig aufgerissenem Mund und Augen begegneten wir dieser unbekannten Welt. Immer wieder rechnend, wie viel Geld haben wir denn noch? Ein Kinobesuch, Einkauf von Kaugummi und das Wichtigste die drei Wasserpistolen rissen ein Loch in den Geldbeutel und einige Westmark mussten noch übrig bleiben. Davon konnte man ja nie genug haben. So ging ein traumhafter Tag zu Ende. Der Bahnhof Erkner rückte immer näher und wir hatten „Schiss“ vor der Kontrolle. Jetzt mussten unsere langen Hosen Sicherheit bringen. Die Wasserpistolen hatten wir im Hosenbein in Knöchelhöhe ordentlich mit Weckgummi befestigt – kein klappern, nichts! Wir erreichten den Kontrollpunkt. Er war besetzt mit zwei ZBK-Leuten. Außer „Guten Tag“ passierte nichts. Wir erreichten den Personenzug Erkner in Richtung Frankfurt/Oder. Unsere Unruhe war noch lange nicht vorbei. Es gab ja die ZBK. Und die Kontrolleure stiegen jeweils beim nächsten Bahnhof, wiederum in einen anderen Zugwagen. Ständig dachten wir daran. Auf keinen Fall Hosenbeine hoch! Wir hatten es geschafft und stiegen in Jakobsdorf aus. Es folgte eine Umarmung unter uns vor lauter Erleichterung. Mein Gott, waren wir doch schon wieder ein Stück erwachsener geworden. Im meinem tiefsten Herzen lebt diese Begebenheit bis heute nach.
Diese Wasserpistolen in Form eines Colts waren für uns ein tolles Stück. Sie sollten allerdings eine Menge Ärger bereiten, nicht nur uns, sondern auch unseren Eltern. Durch eigene Dummheit verbreitete sich die Sache mit den Pistolen schneller als gedacht. Wie konnte es anders sein, wir ärgerten die Mädchen damit. Im Dorf gab es einen ABV, Abschnittsbevollmächtigten (Volkspolizist), mit Dienstgrad Hauptmann. Er war ein richtiger „Radaukommunist“. Wir mieden ihn, soweit wir konnten und wollten ihm auf gar keinen Fall begegnen. Er hatte zu dieser Zeit Hochkonjunktur und denunzierte Jeden, egal ob Klein oder Groß. Nun war ihm schnell zu Ohren gekommen, dass einige von uns Bengels Wasserpistolen hatten. Da war er „am Zug“. Alles, aber auch alles, sollte ans Tageslicht kommen. Meine arme Mutter, sie litt regelrecht darunter, was dieser Idiot jetzt veranstaltete. Er beschuldigte alle einer Straftat. Wir hatten gegen Alles verstoßen – Betreten kapitalistischen Bodens, Devisenschmuggel, Diebstahl. Unsere Eltern waren eine Schande, zuerst der Bauer, dessen Sohn das Geld gestohlen hatte, dann meine Mutter und die Mutter meines Freundes. Wir Jungs sollten doch als sozialistische Bürger erzogen werden! Bei solchen Ereignissen wurde man schnell Erwachsen.
Die Nachkriegsjahre
Aber auch andere Geschehnisse formten mein junges Leben. Da waren die Erlebnisse um meinen Vater. Mein Vater wurde noch kurz vor Ende des 2. Weltkrieges als Kanonenfutter eingezogen. In der ersten Zeit erhielt meine Mutter noch Nachrichten von ihm. Sein letzter Brief war vom 14.12.1944. Danach war kein Lebenszeichen mehr von ihm zu hören. Mögliche Nachforschungen ergaben einfach nichts. Das Kriegsende war nun schon einige Jahre vorbei. Die ersten Kriegsgefangenen kamen zurück nach Deutschland. Die Familien hofften und warteten. Der Rücktransport aus den Gefangenenlagern erfolgte meist mit Güterzügen, keine herkömmlichen Personenwagen. Es waren Viehtransporter mit offen aufgezogenen Toren. Sitzend oder stehend säumten die Kriegsgefangenen die breiten Tore, um sich zu zeigen, sich dadurch erkenntlich zu machen. Sogar Schilder mit ihren Namen hatten sie sich um den Hals gehängt. Für denjenigen, der seinen Liebsten aus dem Krieg erwartete, war es zwingend, am Bahnhof zu sein. Es gab einen Tag in der Woche, an dem die komplette Strecke von Polen aus über Frankfurt nach Berlin zum Transport der Gefangenen freigegeben wurde. Zu Beginn der Transporte begleitete ich meine Mutter noch, später ging ich allein zum Zug. Die Ungewissheit konnte sie einfach nicht mehr verkraften. Immer und immer wieder verließ ich ganz traurig den Bahnhof. Meine Mutter weinte dann auch. Die Traurigkeit nahm erst ein Ende, als es keine Transporte mehr gab. Zu diesem Zeitpunkt war klar, ich würde meinem Vater nie begegnen. Nach vielen Jahren, nachdem alle Nachforschungen erfolglos geblieben waren, ließ meine Mutter ihren geliebten Mann, den Vater zweier Söhne für vermisst und für tot erklären.
Das Leben ging weiter. An der Seite meiner Mutter waren die zwei Jungs. Mein Bruder Rolf, 10 Jahre älter als ich, war mit einer Gehirnhautentzündung gesundheitlich vorbelastet. Dazu kam, dass er einen Unfall erlitt. Mit zwei seiner Jugendfreunde spielte er aus lauter Neugier bei einem abgeschossenen Flugzeug. Es kam zu einer Explosion am Flugzeug. Dabei verlor einer der Freunde sein Leben. Dessen Bruder mussten ein Bein und ein Arm amputiert werden. Mein Bruder kam mit einem Schrecken davon. Durch die Explosion bekam er zwei Splitter ab, einen am Kopf und einen unterm Herzen. Der Splitter am Kopf konnte chirurgisch gut behandelt werden. Eine OP war zur damaligen Zeit nicht möglich und so behielt er bis zu seinem Lebensende den Splitter verkapselt im Muskelgewebe. Bedingt durch den großen Altersunterschied hatte ich mit meinem Bruder wenige Berührungspunkte. In meinen Erinnerungen spielt deshalb meine Mutter eine sehr viel größere Rolle. Den Kummer mit ihrem Sohn Rolf konnte sie ein Leben lang nur schweren Herzens beschreiben.
Mein Zuhause bestand zu dieser Zeit nur aus einigen kleinen Stallungen. Sie wurden soweit das möglich war hergerichtet, d.h. ein wenig wohnlich gemacht. Aber sehr, sehr lange wurde noch auf Strohsäcken geschlafen. Der Strohsack bestand aus ganz normalen Zuckersäcken in Form einer Matratze, die je nach der Größe des selbstgezimmerten Bettes zugeschnitten war. Die Zuckersäcke wurden zusammen genäht und es blieb nur eine Öffnung zum Befüllen. Gestopft wurde die Matratze mit gedroschenem Weizenstroh (mittels Dreschflegel). Anschließend wurde auch die Öffnung zugenäht. Der Boden des Holzbettgestelles bestand aus ganz normalen Schalbrettern. Auf den Brettern lagen aufgeschnittene Zuckersäcke, darauf die Matratze, abgedeckt mit einem Laken. Somit war das Bett fertig. Ein gewisser Luxus waren das Kissen und die Zudecke. Beide waren schon mit Daunenfedern gefüllt. Es gab ja die Federviehhaltung im Dorf. Der Geruch des Weizenstrohs war trotzdem ständig in der Nase.
Zur Einrichtung gehörte ein Kochherd mit Holzfeuerung, der auch zur Beheizung aller angrenzenden Räumlichkeiten diente. Türen gab es im Inneren nicht. Man schlief auch in unmittelbarer Nähe. Der Innenraum war so etwas wie unser Hauptquartier. Alle Tagesabläufe wurden hier besprochen. Einen Stillstand, auch auf Grund der sich ständig verändernden Lebensumstände, gab es nicht. Meine fleißige Mutter war emsig wie eine Biene, trotz ihres schweren Handicaps. Um Geld zu verdienen arbeitet sie bei einem Bauern. Jeden Tag gab es für mich ein „Hasenbrot“, wenn sie abends von der schweren Arbeit heim kam. Das hatte sie von der Mahlzeit, welche der Bauer aufs Feld brachte, beiseite gelegt. Oh, das schmecke soooo gut. Über die Jahre wurde mit viel Arbeit die Lebensgrundlage geschaffen. Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Bruder in das ganze Geschehen integriert war. Von klein auf wurde nur ich umfänglich in alle Abläufe des Tages einbezogen. An erster Stelle stand die Schule mit all ihren Pflichten. Danach fast ebenso wichtig, das Helfen auf dem Hof. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir schon eine kleine Landwirtschaft zur Eigenversorgung aufgebaut. Wir besaßen Hühner, Kaninchen, zwei Ziegen und ein Ferkel. Über Nacht waren die Kaninchen schon mal gestohlen worden, da die Einfriedung des Grundstückes überall desolat war. Ein Jammer! Der Verlust von 20 Kaninchen war ein trauriger Einschnitt in unserem Leben.
Ich war immer noch ein Kind und Freizeit gab es wenig. Unser Spielen in dieser Zeit war auch eigentlich kein spielen. Es war sehr gefährlich. Die Felder und Feldwege waren von Kriegsmaterialien und schweren Geschützen noch nicht beräumt. Auf einem ganzen Feldstraßenabschnitt standen Batterien, aufmunitioniert mit Granaten. Auf den Feldern waren Flakstationen eingegraben. Bestände von Kriegsmaterial, egal in welcher Form, als Versteck oder einfach nur weggeworfen, fand man fast in jedem Winkel. Zuerst kamen die Räumkommandos auf die Felder, damit die Bauern sie wieder bestellen konnten. Ein Feldgeschütz war für uns Kinder zum Karussell geworden. Es war mit drei Sitzen bestückt, das komplette Geschütz um 360 ° drehbar, ermöglicht durch eine Kugellagerung. Ein kleiner Anstoß genügte, und das Teil wollte nicht aufhören, sich zu drehen. Allein ein Junge war in der Lage bei voller 3-Mann-Besetzung, das Ding durch einen Schubs von außen auf Höchstgeschwindigkeit zu bringen. Die Laufzeit war enorm. Jeder Karussellbesitzer wäre neidisch gewesen.
Interessant waren auch die Flakstellungen. Die Munition der Geschosse hatte als Treibladung gegenüber Schwarzpulver einen Spagetti-Treibstoff gebündelt in der Geschoßhülse. Es wurden viele der kompletten Geschosse zu mir nach Hause transportiert. Da gab es noch so etwas wie eine Werkstatt mit Schraubstock. Im Schraubstock eingespannt wurden zwei Schnitte gegenüberliegend zum Geschoss hin eingesägt. Dadurch nahm man die Spannung um das Geschoß weg und konnte es mittels einer Hin- und Herbewegung entfernen. Somit lag die Spagetti-Sprengladung frei. Der Spaß für uns lag nun in der Vorbereitung eines großen Lagerfeuers. Auch fanden wir nagelneue Karabinermunition in konservierten Lagerungskisten. Die Karabinermunition wurde genau so geöffnet wie die Patronenhülse der Geschütze. Das gewonnene Schwarzpulver wurde dann in Blechgefäßen „Töpfen“ gezündet. Aber nicht nur Munition war in unserem Besitz. So entdeckten wir in einem alten Backhaus auf einem Bauerngrundstück, gestapelt bis zur Decke, schwarze Stahlhelme an den Seiten mit SS-Runen. Jeder von uns Jungs war nun mit einem Stahlhelm ausgerüstet. Bei mir bekam er einen Platz unter dem Bett. Dazu kam noch ein Bajonett und das dazugehörige Koppel der Wehrmacht. Sogar Karabiner waren im Angebot. Alle Munition wurde bei uns im Schuppen gelagert, auch die Karabiner. Ausprobiert hatten wir sie nicht. Da war doch die Angst zu groß. So waren wir als Kinder fast oder schon kleine Soldaten. Natürlich durften unsere Eltern von allen diesen Kapriolen auf keinen Fall etwas mitbekommen.
Unsere Freizeitbeschäftigungen
Wir waren immer beschäftigt und dachten uns ständig neuen Blödsinn aus. Durch unseren Ort floss ein kleines Flüsschen mit dem Namen „Goldenes Fließ“. Es floss beiderseits der Straße und querte diese auch. Von den „Boosener Bergen“ kommend erreichte das Flüsschen zuerst eine Wiese. Der Wasserstand war beim befliesen der Wiese und dem Fluss nahezu gleich. Da hatten wir Jungs die Idee, dem Flüsschen eine Sperre zu setzen. Das wird ein tolles Ding. Und schon ging es los, Spaten wurden geholt und eine Lagebesprechung abgehalten. Wir hoben von der Graswiese Graspolster aus und schichteten damit eine Staumauer. Alles wurde genau beobachtet, denn der Fluss floss ja weiter. Durch das unterschiedliche Niveau in der Wiese floss das Wasser mal da und mal dort hin. Das war ein Vorteil für uns. Wir hatten es geschafft. Unter der Straße floss kein Wasser mehr, es kam kein Wasser mehr an. Das war eine große Freude für uns nach all der Schinderei. Das böse Erwachen kam umgehend. Es türmte sich Ärger ohne Ende auf. Der kam zuerst von den Dorfbewohnern, dann vom Bürgermeister, am Ende noch von unseren Eltern. Die Täterermittlung ging ratzfatz. Es folgte die Begleichung, die Wiederherstellung des Naturzustandes. Nie wieder so eine Aktion!
Für uns Jungs war es ein Muss, schwimmen zu lernen. Mit Hundepaddeln fing alles an. Obwohl es einen großen Dorfteich gab, bevorzugten wir einen Feldwiesenteich, in dem sich eine riesige Menge Kaulquappen tummelte. Auch Schlingpflanzen befanden sich darin. Und ein kleines Sprungbrett fand ebenso seinen Platz. Später besuchten wir schon einen größeren See. Er befand sich im Ort Briesen. Da lernten wir richtig das Schwimmen. Zu erreichen war er nur zu Fuß so gute 6 km auf Feldwegen und entlang an Waldstücken. Wenn man nur ein Fahrrad hätte! In unserem Dorf gab es einen Bäcker, einen Fleischer, einen Schuster sowie eine Verkaufsstelle für Lebensmittel. Die Söhne der Fleischerei besaßen zuerst ein Fahrrad. Kein Problem, Geld war da genug vorhanden. Die Kinderfahrräder wurden schnell mal aus Westberlin rüber geholt. Was für ein großes Glück für uns! Alle Jungs aus dem Ort lernten auf diese Rädern das Radfahren. Wir waren wieder einmal unterwegs zum Badesee, meistens so 3 bis 4 Jungs. Wenn einer der Fleischerjungen mit dem Fahrrad dabei war, hatte das seinen besonderen Reiz. Fast militärisch wurde der Weg zum Badesee und wieder nach Hause abgesteckt. Hilfreich waren die errichteten Strommasten, die jeweils den gleichen Abstand hatten. Und so lösten wir das Problem. Der Erste nahm das Fahrrad und fuhr bis zum 2. Strommast, ließ dort das Fahrrad stehen und lief per pedes weiter. Einer von den Ankommenden nahm nun das Fahrrad, die anderen liefen weiter. Am nächsten 3. Strommast wurde das Fahrrad wieder abgelegt und weiter gelaufen. Es erfolgte ein weiterer Wechsel, und so weiter und so fort. Auf diese Art war der Ausflug zum Badesee abwechslungsreich und nicht so anstrengend.
Unser großer Dorfteich war zu jeder Jahreszeit unser Tummelplatz. Hier wurde im Sommer gebadet, Ton wurde gefördert, aus dem wir Tonfiguren herstellten. Kriegsschiffe waren das meistgefertigte Motiv. Außerdem fertigten wir uns Flöße an. Das geschah wie folgt. Unser Dorfteich hatte eine Verbindung über ein starkes Wasserrohr zu einem kleinen Dorfteich. Dieser war mit den Jahren verlandet. Größtenteils wucherten Schilfgewächse darin. Das dickere Schilf eignete sich hervorragend zum Bau eines Floßes. Drei Bündel wurden zusammen gebunden, die wiederum aus einzelnen Bündeln bestanden. Die Tragfähigkeit war enorm. Schnell wurden noch ein paar Paddel gefertigt und schon stachen wir in See, immerhin mit zwei Besatzungsmitgliedern. Mit den gefertigten Flößen wurde gerudert und untereinander gekämpft. Auch Fische lebten in Massen im Teich, vor allem Karauschen, die man fast ohne Netz fangen konnte. Zum Verzehr waren sie nicht geeignet. Sie schmeckten nach Morast.
Im Winter wurde der Dorfteich, unser Spielplatz Nr. 1, zur großen Attraktion. Die Wintermonate waren lang und die sehr hohen Minustemperaturen ließen alles gefrieren. Da alle Teiche miteinander verbunden waren, bildete sich nun bei starkem Frost eine durchgehende dicke Eisschicht. Sie stellte eine zusammenhängende Verbindung aller Wege im Dorf dar und wurde zum „Verkehrsknotenpunkt“ im Ort. Tolle Infrastruktur! Unser Grundstück grenzte direkt an den 3. Dorfteich. Der Teich war wie eine Einfriedung. Und so schnallte ich mir die Schlittschuhe schon zu Hause an. Bis in die Abendstunden hinein, solange man etwas sah, wurde Eishockey gespielt. Die Eishockeyschläger durften nicht fehlen. Jeder suchte sich aus den Baumästen die geeigneten Formen für die Schläger heraus. Am besten geeignet waren Weidenkätzchenstämme. Das Straßenniveau lag ca. 1,50 m höher das des Teiches. So bot es sich an, Schlitterbahnen von der Straße ab bis zum Teich anzulegen. Die Straße diente als Anlaufstrecke. Es wurden unter uns Jungs richtige Wettkämpfe ausgetragen. Damit die Schlitterbahn ständig eine gute Qualität hatte, brachte jeder, wenn möglich, einen mit Wasser gefüllten Eimer mit. Diese Dienstleistung erfolgte stets in den Abendstunden. Als das Wasser beim Entleeren der Eimer bereits gefror, wurde genau dosiert. So bekam die Bahn die richtige Qualität für den nächsten Tag. Um die weiteste Strecke zu erreichen, wurde ein bestimmtes Schuhwerk gewählt. Die billigste Qualität waren Schuhe und Stiefel aus „Igolit“, ähnlich wie Gummi anzusehen. Im Sommer waren sie sehr schweißtreibend, denn sie hatten keine Fütterung. Meine Mutter hatte mir verboten, sie im Winter zu tragen, da die Schuhe bei Kälte schnell Risse und Brüche bekamen und undicht wurden. Aber sie brachten nun einmal die besten Schlitterergebnisse. Unterwegs war die Gefahr des Ausrutschens auf der Straße sehr groß. Und so endete das Tragen dieser Monster mit dem Versteck durch meine Mutter. Die Schuhe wurden erst im Sommer wieder freigegeben. Wir brauchten ja diese Schuhe, andere konnten wir uns nicht leisten.
Eine weitere Aktion, die wir als Kick brauchten, nannten wir „Sumpfeis“. Dazu musste die Eisdecke eine Stärke von ca. 6 cm haben. Optimal war, wenn es geschneit hatte, bevor die Eisdecke anfing zu gefrieren. Dann bedeckte den ganzen Teich so etwas wie Schneematsch. Wir warteten regelrecht auf solche Tage. Hatte die Eisdecke ihre Stärke erreicht, konnte es losgehen. Zuschauer waren auch da. In einer Entfernung von ca. 4 m vom Ufer entfernt, nahmen wir in einer Linie Aufstellung. Vier von uns hakten sich unter und gingen bis zur Sumpfeislinie, dem Startpunkt. Mit langsamen Bewegungen schritten wir vorwärts. Durch Hüpfen und Stampfen begann das Eis langsam zu brechen und bildete eine Art Spinnennetz aus. Vor uns tat sich das geborstene Eis leicht auf. Unsere Eiswelle nahm nun ihre Form an, die wir unbedingt brauchten. Es war geschafft! Nun galt es den Eiswellenberg, der sich ständig vor uns aufbaute, entgegen zu gehen. Da galt es das eigene Gewicht geschickt in Einsatz zu bringen. Die Schrittfolge war ständig anzupassen. Es kam des Öfteren vor, dass beim Durchbrechen des Eises ein Loch gerissen wurde. Der Unglücksrabe, den es erwischte, wurde aber gleich wieder hochgezogen. Wir liefen so lange, bis das Eis nicht mehr beherrschbar war. Dann wurde abgebrochen, indem 2 Mann nach links und 2 nach rechts die Flucht ergriffen. Schließlich wollte Keiner eine Wässerung am eigenen Leib erfahren.
Ein ganz besonders schnelles Fortbewegungsmittel waren die sogenannten „Pickschletten“, mit denen regelrechte Rennen ausgetragen wurden. Sie waren schnell und einfach zusammen gebaut. Wir brauchten Schlittschuhe, einige Bretter, zwei Klötze, zwei Besenstiele und eine handvoll Nägel. Los geht’s! Aus den Brettern bauten wir einen Sitz wie von einem Stuhl, mit Leisten fixiert und befestigt. Die Klötze wurden unten am Sitz angenagelt. An die Klötzen schraubten wir die Schlittschuhe an. Zum Bewegen der Schlette kamen noch zwei Besenstiele zum Einsatz, die an einem Ende mit einem Nagel versehen waren. Der war mittig eingeschlagen und an einem Schleifstein spitz geschliffen. Als Auflage auf dem Holzsitz diente ein Kissen. Gefahren wurde nur im Knien. Ein kleiner Schubs genügte und schon wollte das Gefährt gar nicht mehr aufhören zu gleiten. Am besten lief die Schlette, wenn ein Wasserfilm die Eisschicht bedeckte.
Das „Eisschollentanzen“ war tatsächlich als Mutprobe zu verstehen. Bei einer Eisstärke von 10 cm wurde mit einem Beil eine Scholle von ca. 3 x 3 m aus dem Eis geschlagen. Sie war somit frei schwimmend. Der Kick bestand nun darin, die Scholle zu betreten, verschiedene Bewegungen auszuführen und dabei nicht unter zu gehen. Man betrat das Eisstück ganz langsam und verharrte solange, bis die Scholle immer tiefer im Wasser unterging. Mit der Pickschlette konnte man das Gleiche tun. Die mutigste Aktion war, vom Festeis auf die freischwimmende Scholle zu gleiten. Ein großer Andrang von Zuschauern war ständig garantiert. Eines Tages, die Dämmerung setzte bereits ein, bekamen wir Besuch von einem Jugendfreund. Sein Name war Georg. Er wohnte weit außerhalb unseres Dorfes fast einsam zusammen mit seiner Oma. Er hatte sich auf den Weg gemacht, um Einkäufe zu erledigen. Sein Rucksack war voller Lebensmittel. Sein letzter Anlaufpunkt war die Fleischerei, die sich in unmittelbarer Nähe zum Teich befand. Die Freude war groß, als er dort auf unsere Meute stieß. Es wurde über Dies und Das gequatscht. Seine Kinderwelt war mit der unseren nicht vergleichbar, er war am schlechtesten dran. Bald drängte er zum Abschied. Der Nachhauseweg war nicht so ohne, ausgefahrenen Feldwege und alles im Frostzustand mit dem schweren Rucksack auf dem Rücken. Und dann hatte es ihn doch gepackt. Auch er wollte die Eisscholle bezwingen. Mitten auf der Scholle rutschte er aus und fiel hin. Blitzschnell zogen wir ihn von der Scholle. Ohne zu überlegen griffen wir ihm unter die Arme und nahmen ihn mit zu meiner Mutter. Die fiel aus allen Wolken, es bedurfte keiner Erklärung. Viel wurde nicht gesprochen, es musste gehandelt werden. Meine Aufgabe war es, den Kanonenofen auf Glühtemperatur zu halten. Die Lebensmittel, sogar die Lebensmittelkarten waren total nass. Die Rettung dieser Karten war überlebenswichtig. Der Jugendfreund wurde komplett ausgezogen, in eine Decke gehüllt und dicht an den Kanonenofen gesetzt. Heißer Tee wurde verabreicht. Er durfte sich auf keinen Fall erkälten. Meine Mutter zog alle Register. Wenn sie das nicht beherrschte, wer sonst? Eine Benachrichtigung seiner Oma war nicht möglich. Unvorstellbar, was die alte Frau in dieser Nacht durchmachte. In aller Frühe verließ Georg unser Haus. Meine Mutter hatte alles gerichtet. Der Rucksack war wieder prall gefüllt. Sogar die Lebensmittelkarten hatte sie retten können. In Anbetracht der Lebenssituationen zu dieser Zeit, gab es von unserem Jugendfreund nie wieder ein Lebenszeichen.
Der Kinofritze
Ein ganz besonderes Erlebnis war für uns Kinder und Jugendliche stets das Überland-Kino. Alle fieberten regelrecht dem Tag der Aufführung entgegen. Mit einem gerade noch fahrtüchtigen PKW mit Anhänger, in welchem die gesamte Vorführtechnik transportiert wurde, erreichte der „Kinofritze“ mit Müh' und Not den Veranstaltungsort. Das waren meist größere Säle in Gaststätten, die sonst für Familienfeste und sonstige Feiern genutzt wurden. Alles sollte nun schnell funktionieren und so wurde dem Kinofritzen beim Auspacken und Transportieren der Kino-Technik geholfen.
Die Gaststätte in unserem Ort hatte etwas ganz besonderes vorzuweisen, einen „Vorführraum“. Diesen durfte außer dem Kinofritzen niemand betreten mit Ausnahme einer helfenden Hand beim Aufstellen der Technik. Der Raum befand sich direkt neben dem Saal und man hatte in die Trennwand zwei gleich große Löcher gestemmt. So war es möglich den Lichtstrahl des Filmprojektors in den Saal und über die Köpfe der Zuschauer hinweg auf die Leinwand zu projizieren. Das Aufstellen der Stühle musste vorher noch als Allemanns-Manöver realisiert werden. Vor dem Saal wurde ein Tisch für die Kassierung aufgestellt. Der Eintritt kostete 60 Pfennige.
Der weitere Ablauf gestaltete sich nun folgendermaßen. Es gab zwei Veranstaltungen am Vorführtag, eine Kinderveranstaltung und fünf Stunden später eine Erwachsenenvorstellung. Für uns gab es keine Möglichkeit, sich in einen Film für Erwachsene hineinzuschmuggeln.
Aber die Neugier, was denn da alles zu sehen war, machte erfinderisch. So wurden die Fenster, jeder kleine Spalt und sogar das Schlüsselloch untersucht. Wir Kinder gaben einfach nicht auf! Jede kleine Öffnung, egal ob drinnen oder draußen, wurde inspiziert und auf Eignung getestet. So entdeckten wir schließlich einen Ventilator am obersten Punkt des Saales. Zu unserem Glück befand er sich genau gegenüber der aufgebauten Leinwand. Die Frage war nun, wie kommen wir von außen über die Dächer da hinauf. All unser Erfindergeist war gefragt, denn wir wollten unbedingt auch einmal das „Erwachsenenkino“ erleben. Das erklimmen des Daches der Nebengelasse erschien zunächst recht einfach, da die Nebengelasse nicht so hoch waren, wie der Saal. Wir benötigten eine Anstellleiter. Jeder Großbauer im Dorf hatte davon mehrere, aber Diebstahl war für uns kein Ding. Außerdem wollten wir auf keinen Fall von der Straße aus gesehen werden. Die Ideen überschlugen sich. Als Ersatzleiter eignete sich der Birnbaum, der genau an der Ecke zwischen Saalgebäude und einem Nebengelass stand. Der Baum war uralt. Sein Stammdurchmesser betrug ca. 30 cm. Die Früchte (Knödeln) waren pfirsichgroß und schmeckten sehr gut. Da Keiner das Obst erntete, fielen die reifen Früchte wie gesät zu Boden. Das erwies sich später beim Filmeschauen als besonderer Vorzug. Die Konstruktion zur Besteigung des Daches war nach einigen Überlegungen dann doch recht einfach – Holzsprossen wurden zwischen dem Stamm des Birnbaumes und dem Mauerwerk des Nebengelasses eingebaut. Das lief unter Geheimstufe 1 und nur zwei Freunde wussten etwas darüber: Dieter Schulz (Spitzname Stenner) und ich, Manfred Alter (Spitzname Juste). Eine Checkliste wurde gefertigt und dann ging es ans Sägen, Bohren und Meißeln. Die gute Vorbereitung zum Entstehen einer Leiter zahlte sich beim Platzieren der Sprossen zwischen Mauerwerk und Birnbaum aus. Es arbeitete immer nur einer, der andere stand „Schmiere“. Kam ein Dorfbewohner unserem Unterfangen zu Nahe, wurde gepfiffen – ein Pfiff bedeutete Arbeiten einstellen, zwei Pfiffe bedeuteten Arbeiten wieder aufnehmen. Ein Glück, dass jeder Dorfjunge auf die unterschiedlichsten Arten pfeifen konnte. Zum Plan gehörte noch der Bau einer Bank. Das war wirklich das Allergrößte. Endlich war das Werk vollbracht. Eine tolle Leiter war entstanden, von der Straße her nicht einsehbar, denn der Birnbaum bot größtmöglichen Schutz. Die Bank stand in Augenhöhe zum Ventilator und wir saßen somit wirklich in der ersten Reihe, von einer Decke umschlungen mit unzähligen köstlichen Birnen in Angebot.
Und dann kam der Kinofritze endlich. Wir waren sehr aufgeregt und neugierig. Unser erster Film war ein Liebesfilm, Ton und Bild waren top. Nur eine Gefahr bestand, dass wir im Überschwang des Erfolges das Geheimnis ausplauderten. Aber „nix da“. Wir hatten uns geschworen, es niemandem zu erzählen, auch wenn uns das einiges abverlangte.
Dieses, eines unserer schönsten Jugenderlebnisse, sollte nach 60 Jahren noch einmal erzählt werden. Bei einem Treffen der Jugendfreunde von damals wurden viele Erlebnisse aufgefrischt, das vom Kinofritze hatte dabei einen besonderen Stellenwert. Der Mitkonstrukteur Dieter Schulz besuchte mich 2014 zu Hause in Leipzig. Die längste Zeit schwelgten wir in den Erinnerungen an unser großes Geheimnis beim Kinofritze. Und das ist sicher einmalig.
Der Alltag
Für uns war kein Tag wie der andere. Das Leben musste einfach gemeistert werden. Geld war nun das Maß aller Dinge. Es zu erwirtschaften bedeutete Fleiß ohne Ende. Die Schule fand nun je nach Klasse an einem anderen Ort statt. Bis zur vierten Klasse besuchten wir sie in unserem Dorf. Ab der 5. Klasse war der Schulort „Pillgram“. Man erreichte ihn mit der Eisenbahn Richtung Frankfurt/Oder. Mittendrin wechselte der Ort, jetzt war es „Biegen“ in Richtung „Müllrose“. Da der Weg per Fuß zu weit war, wurde meist mit dem Fahrrad gefahren. Ab der 6. Klasse wechselte der Schulort noch einmal. Wir fuhren mit dem Zug nach „Briesen“ in Richtung „Erkner“. Das war der längste Weg zur Schule. Allein die Bewältigung der Schulwege war eine Tortur für uns Kinder. Zu Hause angekommen ging es ohne Pause an die umfangreichen Pflichten. Die Schularbeiten wurden erst in den Abendstunden erledigt. Auch meine Mutter kam manchmal sehr spät nach Hause. Sie verdiente das Geld beim Bauern auf dem Feld. Die schlimmste Arbeit auf dem Feld war das Rübenverziehen. Nicht auszudenken, mit welchen Qualen sie die Arbeit infolge ihrer Behinderung verrichten musste. Ich erinnere mich nur mit schwerem Herzen daran.
Immerhin besaß meine Mutter ein Grundstück mit einem zerschossenem Haus und angrenzendem Gartengrabeland. Mit der Zeit war es schon ein wenig besser eingefriedet. Von Vorteil war, dass wir noch außerhalb des Dorfes einen 3/4 Morgen eines Feldgrundstückes besaßen. Es grenzte an andere Felder und der Weg dorthin verlief über ein Bauerngehöft in einer Entfernung von ca. 200 m. Zu dieser Zeit hieß es bei uns, wie bei allen, immer mehr anschaffen und bewirtschaften. Inzwischen besaßen wir vier Enten, acht Hühner, 10 Kaninchen, eine Ziege, zwei Lämmer und ein ca. 70 Pfund schweres Ferkel. Tagsüber musste das liebe Vieh versorgt werden. In den Abendstunden ging es nochmals los. Vom Rübenfeld holten wir die Blätter von den Zuckerrüben, manchmal nur ein Blatt, manchmal 3 bis 4 je Pflanze, immer darauf bedacht, die Rübe in ihrem Wachstum nicht zu schädigen. Die Aktion war stets mit einem schlechten Gefühl verbunden. Letztendlich war es Diebstahl, denn das Feld gehörte ja dem Bauern. Befördert wurde alles, mit einem kleinen Handwagen mit Holzrädern, die eine Eisenbereifung hatten. Das war unser Transportfahrzeug für zu befördernde Dinge aller Art. Der Handwagen machte auf dem Kopfsteinpflaster richtig Krach, so wusste jeder gleich, hier kommt Manfred.
Eines Tages machte ich eine schreckliche Entdeckung. Meine Mutter war wie immer noch beim Bauern. Nach der Schule kümmerte ich mich um den Tierbestand. Als ich den Schweinestall betrat, sah ich unser teuer erkauftes Ferkel bewegungslos in einer Ecke liegen. Eine leichte rötliche Verfärbung bedeckte den ganzen Körper. Meine Mutter zu erreichen war unmöglich. Ich wusste nicht auf welchem Feld sie gerade war und auch nicht, wie ich dort hinkommen könnte. Als sie vom Feld nach Hause kam und das Ferkel sah, brach sie fast zusammen. Das Ferkel gehörte zur Grundlage unserer Ernährungskette über das ganze Jahr hinweg. Es sollte ja einmal ein Schwein werden mit einem Gewicht von ca. drei Zentnern und geschlachtet werden. Der Tag war lang und hart, aber es nützte alles nichts. Der nächste Tierarzt hatte seine Praxis im 6 km entfernten Briesen. Wir legten das Ferkel, mit Säcken zugedeckt, in unseren Handwagen. Es bewegte sich fast nicht mehr. Und auf ging es nach Biesen über den Ort Petersdorf. Trotz einiger Kriegsschäden in der Straße, war die Asphaltdecke noch so lala. Ich weiß nicht mehr, wie viele Pausen wir einlegen mussten. Aber bis heute habe ich noch vor Augen, wie es meiner Mutter erging. Endlich erreichten wir den Tierarzt. Seine Diagnose lautete: Rotlaufkrankheit. Das Ferkel bekam eine sehr teure Spritze. Wieder fehlte uns sehr viel Geld. In der Dunkelheit erreichten wir endlich unser zu Hause. Meine Mutter war derartig entkräftet, sie konnte sich nur noch hinlegen. An dem kleinen Handwagen zog ich eine Steckwand heraus und zog das Ferkel auf einem Sack liegend, bis in den Stall. Weder Nahrung noch Trinken nahm es an. Das Ferkel hatte es nicht überlebt. Am nächsten Tag schaufelte ich nach der Schule unter Tränen eine Grabstelle im Garten aus. Das Leben ging weiter. Ein neues Ferkel wurde vom Bauern gekauft und meine Mutter ging wieder einmal in die Schulden.
An einem Sonnabendnachmittag waren wir beide, meine Mutter und ich, wieder einmal auf dem Rübenfeld. Schnell hatten wir unseren Handwagen mit den Rübenblättern beladen. Vom Feld her kommend ereichten wir die Hauptstraße des Dorfes, vorbei an der Kreuzung, die alle Straßen miteinander verband. Nach rechts führte der Weg nach Hause. Zur linken Seite lag ein Bauerngehöft, dessen Besitzer gleichzeitig der Schmied des Dorfes war. Zum Hof gehörten große Scheunen zum Unterbringen von Stroh, Heu und Getreide. In den Stallungen waren Kühe, Pferde und Schweine untergebracht. Gleich an einem der Stallungsgebäude befand sich die „Knechtstube“, in welcher sein Knecht wohnte und lebte. Der Knecht war derjenige, der in der Landwirtschaft alle Facetten beherrschen musste. Er schuldete dem Bauern alles für Unterkunft, Lohn und Brot. Der Bauernhof und die Schmiede waren eingefriedet. In Dorf war es nun so etwas wie ein Gesetz, dass die Straße gekehrt wurde, so lang, wie das Grundstück des Besitzers die Straße säumte. Vor unseren Handwagen gespannt, begegneten wir dem Knecht, der gerade dabei war, die Straße entlang des Grundstückes zu kehren. Es folgte ein freundliches „Guten Tag“ von beiden Seiten. Man wechselte einpaar Worte. Meine Mutter war auf einmal im Redefluss, er war wohl auch auf der selben Frequenz. Also verabschiedete ich mich und fuhr nach Hause. Es war ja Sonnabend und die Freunde warteten schon auf mich. Da ich der Einzige war, der ein Grundstück besaß, war das unsere kleine Kommandozentrale. Erzählt habe ich meiner Mutter grundsätzlich nie etwas von unseren Unternehmungen. Da war so etwas wie ein Abkommen zwischen uns, eine Sache des Vertrauens. Meine Mutter sah ich erst spät abends nach meiner Heimkehr. Sie und ihre flüchtige Bekanntschaft trafen sich nun öfters. Sympathie auf beiden Seiten war vorhanden. Ich erlebte, wie meine Mutter verliebt war. Es sollte und es musste passierten. Es war an der Zeit, hier musste ein Mann her! Bei seinem ersten Besuch bei uns gab es „Muckefuck“-Kaffee und meine Mutter hatte einen Kuchen gebacken. Sie zeigte ihm alles, aber auch wirklich alles. Er verabschiedete sich mit einem Schmunzeln im Gesicht und einer freundlichen Geste in meine Richtung. Ich glaube, ich war auch einverstanden. Was ich noch mit bekommen hatte, meine Mutter wollte alles über sein bisheriges Leben wissen. Auch sein Leben war bisher leidvoll. Er kam aus sowjetischer Gefangenschaft. Im tiefsten Osten der Sowjetunion in „Karaganda“ arbeitete er in einem Torfabbaugebiet bis er eine schwere Lungenentzündung bekam. Da er polnisch konnte, was der russischen Sprache ähnelt, wurde er als Dolmetscher eingesetzt. Er gehörte dann mit zu den ersten Gefangenen, die nach Deutschland abgeschoben wurden. Sein Heimatort, d.h. was davon noch übrig war, lag dicht an der polnischen Grenze. Seine Eltern und seine Frau hatten die Russen erschossen. Das Grundstück war lange Zeit von den Russen besetzt gewesen, ein Bauernhof, der landwirtschaftlich gut aufgestellt war. Nun wurde der Hof von Polen bewirtschaftet. Auf der Suche nach einer Bleibe begegnete der Mann meine Mutter.
Mein Stiefvater
Es kam der Tag, an dem er bei uns einzog. Unsere Räumlichkeiten waren wie sie waren, mehr gab es nicht. Aber eine völlig neue Situation trat ein. Jetzt war ein richtiger Mann im Hause. Seinen Arbeitsplatz behielt er weiter beim Bauern. Er war der zweite Schmied im Dorf. Dort wurden u. a. Pferde beschlagen, Stahlreifen glühend auf die Holzräder der großen Leiterwagen aufgezogen. Zu Hause wurde alles umgekrempelt. Er legte überall Hand an, war ein Meister in fachlicher und handwerklicher Hinsicht. In Sachen Landwirtschaft konnte ihm keiner etwas vor machen, auch nicht beim Schweine schlachten. Die Wurstrezepturen suchten seines Gleichen. Er schnitt auch Weiden, flocht sie zu Körben und verkaufte sie. Er dengelte die Sensen fürs ganze Dorf. Er baute die schönsten Kaninchenställe. Hoftore, Gartenzäune und Schuppen entstanden. Das Fachwerk der Scheune wurde repariert. Ein Heiligtum war seine Pferdepeitsche. Ich durfte sie mir anschauen und auch einmal damit knallen. Alles unter seiner Aufsicht. Die Peitsche bestand aus einer ausgesuchten Rute aus Schleenholz, die Peitschenriemen aus Schweineleder. Am oberen Drittel waren die Riemen geflochten. In meiner Erinnerung sehe ich meinen Stiefvater ständig arbeiten.
Die Veränderungen brachten auch für meine Mutter eine große Entlastung. Sie musste sich nicht mehr auf den Feldern schinden. Die Schwerstarbeit hatte für immer ein Ende. Ihr Reich waren jetzt das Haus mit Hof und Garten und die Tiere.
In den folgenden Jahren bekam die Familie noch einmal Zuwachs und ich einen Bruder, 8 Jahre jünger und zwei Schwestern, die 10 und 12 Jahre jünger waren. Ihre Kinder- und Jugendzeit war mit der von mir erlebten und geschilderten nicht vergleichbar.
Kapitel 2 DieJugendzeit
Arbeit in der LPG
Viel zu schnell entwuchs ich dem Kindesalter. Das gleiche galt auch für meine Freunde aus Kindertagen. Das Spielen trat immer mehr in den Hintergrund und die Ernsthaftigkeit des Lebens gestaltete noch mehr unsere Tagesabläufe. Ich war jetzt in dem Alter, mir in den Ferien Geld zu verdienen. Wo sonst, als in der Landwirtschaft. Sämtliche Großbauern waren enteignet. Die Meisten flohen danach schnell noch in den Westen. Berlin war ja noch offen. Die Bauerngehöfte mit ihren Ländereien gehörten nun dem Staat, der DDR. Es wurden Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (LPGs) gegründet. Um die riesigen Felder nebst Stallungen und Scheunen zu bewirtschaften, fehlten Arbeitskräfte an allen Ecken und Enden. Für die LPGs war das ein sehr großes Problem. Die Machthaber des Arbeiter- und Bauernstaates ließen deshalb auch Jugendliche ab einem bestimmten Alter in den LPGs arbeiten (es grenzte an Kinderarbeit). Wir arbeiteten in den Ferien für eine Mark pro Stunde in der LPG. Wenn Kartoffeln geerntet (gerodet) wurden, setzte man die Arbeitskräfte dort gebündelt ein. Die Arbeit nannte sich Kartoffeln lesen und brachte das meiste Geld. Abgerechnet wurde hier nicht nach Stunde, sondern nach der Korbzahl. Für jeden vollen Kartoffelkorb bekam man eine Marke. Die Marken wurden zusammengezählt und abgerechnet. Diese Arbeit war Accordarbeit.
Für das Sammeln des Kartoffelkäfers bekam man einen Pfennig pro Käfer. Angeblich hatten die Amerikaner die Kartoffelkäfer aus der Luft auf die Felder geworfen, um die Ernte zu vernichten. So ähnlich stand es auf Flugblättern, die in großer Anzahl auf den Feldern verstreut lagen. Die Flugblätter sollten die DDR-Bürger vor dem Klassenfeind warnen. Welch ein Unsinn! So begann mit dem Kartoffelkäfer ein kalter Krieg. Dabei hatten wir den Krieg gerade erst hinter uns. Ich wollte keinen Krieg mehr! Die Kartoffelkäfer ablesen konnte jeder wann und wo er wollte und Lust dazu hatte. Schnell waren Gläser gefunden in denen die Käfer gesammelt wurden. Dank des tollen Preises wimmelte es auf dem Kartoffelfeld von Groß und Klein. Am großen Dorfteich fand die Abgabe statt. Die gesammelten Käfer wurden in ein Eichglas geschüttet, so wusste man die Anzahl. Die Bezahlung erfolgte an Ort und Stelle. Die Käfer wurden dann auf einen großen Haufen geschüttet und verbrannt.
Die Arbeitsdisziplin war wichtig und pünktlich 8.00 Uhr hatte man auf einem ehemaligen Gutshof zu erscheinen. Es begann mit der Einteilung der Arbeit, die an den Tagen unterschiedlich sein konnte. Es war Sommerzeit. Die Sommermaat hatte begonnen. Riesenflächen an Getreide (Gerste, Roggen, Weizen) waren zu mähen und anschließend in den Scheunen unter zu bringen. Die meisten Bauern besaßen Dreschmaschinen. Nach der Maat blieb ein Stoppelfeld zurück. Aber jeder Halm des Kornes war wichtig, es wurde intensiv geerntet. Das geschah mit der „Hungerharke“, einem urigen Eisenschwein. Das Einzige, was daran nicht aus Eisen war, waren die Scheren, in denen das Pferd eingespannt wurde. Das ganze Gerät bestand aus einer Achse, von welcher sich die Hungerharke aufbaute. Mittig war der Sitz des Kutschers angebracht, der aus Sicherheitsgründen eine Rückenlehne hatte. Die gesamte Länge getrug ca. 3 m, der Durchmesser der Räder ca. 1,5 m. Die Harke bestand aus Eisenstreben, die in einer Länge von einem Meter im Abstand von 20 cm im Kreis angeordnet waren. So erhielt man einen Bogen, den man mittels eines Hebelarmes heben und senken konnte. Die Hungerharke war eine äußerst gefährliche Maschinerie. Ihr Einsatz erfolgte in zwei Arbeitsgängen, zuerst das Herablassen der Harke bis in die Stoppeln des abgemähten Getreides. Nun begann sich das Pferd vorwärts zu bewegen. War die Harke gefüllt mit Stroh, wurde der zweite Arbeitsgang gestartet. Mittels Hebel wurde die Harke angehoben und das zusammengeharkte Restgetreide fiel auf das Feld. Es wurde immer so ausgeklinkt, dass das geharkte Getreide in einer Reihe lag. War die Arbeit auf dem Feld getan, mussten die Pferde versorgt werden. Der nächste Tag war auch für sie wieder anstrengend. Um auf das zu beackernde Feld zu gelangen, waren manchmal ziemlich weite Strecken zu bewältigen. Bei einem Feld bot sich eine Fahrt auf der Autobahn an. Das war aber strengstens verboten! Trotzdem, mein Freund und ich übergingen alle Belehrungen und starteten auf der Autobahn ein Rennen. Die Strecke wurde festgelegt und schon ging es los. Wir hatten keine Vorstellung davon, was uns erwartete. Da waren die Eisenschweine ohne Federung und eine Autobahn, deren Betonflächen mit Löchern von Granatsplittern übersät waren. Ein plötzlicher Knall brachte uns zur Vernunft. Hier fahren wir uns tot! Zum Glück hatte niemand etwas von unserem Ausflug mitbekommen. Wir erledigten ganz verschiedene Arbeiten, mit unter schwierige, gefährliche Aktionen. Wir fuhren mit der Hungerharke, häufelten Kartoffeln an oder fuhren mit geernteten Strohgarben ins Dorf. Die Garben türmten sich in stattlicher Höhe auf dem Wagen. Es gelang uns nicht immer beim ersten Anlauf, die vollen Wagen bis in die Strohscheunen der Bauerngrundstücke zu bringen. Da lauerte immer ein Anschiss und wir hatten manchmal „die Hosen voll“.
Ein Bauernhof mit Gaststätte und Fleischerei war das letzte Gehöft, das noch nicht enteignet war. Wahrscheinlich brauchte das Dorf die Gaststätte und noch mehr die Fleischerei. Der Fleischerei war ein Verkaufsladen angegliedert. Hier konnte man die gekaufte Ware auch gleich mal anschreiben lassen, sollte kein Geld vorhanden sein. Also machte man Schulden. Für mich war das irgendwie peinlich. Wenn die Lohnzahlung erfolgte, wurden die Schulden sofort beglichen. Die Söhne der Familie waren im gleichen Alter wie wir. Der Jüngere war 8 Tage älter als ich und hieß Reinhard. Er hatte äußerst strenge Eltern. Seine Liste an Aufgaben war sehr lang und er hatte fast nie Freizeit. So sprach er uns des Öfteren an, wenn er unsere Hilfe brauchte. Es müssten Rüben geputzt werden, die Haustiere versorgt oder bei Oma in der Gaststätte geholfen werden. Reinhard fasste hin und wieder mal in die Kasse, um uns zu bezahlen. Wir Jungs gingen öfters auf Hasenjagd. Wir nannten das „einen Feldausflug machen“. Feldhasen gab es zu dieser Zeit ohne Ende. Ein Hund musste immer dabei sein. Wir erzählten unserem Freund, dass wir wieder einmal so einen Ausflug geplant hatten. Er war total begeistert und wollte unbedingt mit seinem Hund dabei sein. Das lief! Wir holten Ihn ab, aber nicht direkt von seinem Bauerngehöft. Er kam pünktlich mit seinem Hund und einer Tasche. Seine ersten Worte waren: hier in der Tasche sind Würste drin, falls der Hund mal nicht gehorcht und euch beißen will, gebt ihm dann ein Stück von der Wurst. Dazu kam es nicht. Der Hund parierte einfach. Die Hasenjagd war zu Ende. Wie immer hatten wir keinen Hasen erwischt. Aber ein jeder von uns hatte eine schöne große Jagdwurst bekommen. Eine Erklärung an meine Mutter war dann dringend notwendig.
Jede Woche, immer freitags, musste Reinhard 1000 Mark bei der nächsten Bank in Briesen einzahlen. In der Bank kannte ihn Jeder. Der kürzeste Weg nach Briesen war 6 km über die Feldstraße. Das war auch unsere Strecke zum Badesee. Allein konnte Reinhard diesen Weg nicht gehen. Wir organisierten uns zum Begleitschutz. Somit war der Freitag für uns der Tag überhaupt. Dafür verwöhnte uns Reinhard. Es gab Eis, Süßigkeiten, mal ein Taschenmesser oder eine Stablampe. Wir waren gut ausgerüstet, das brauchte einfach so ein Junge.
Wie aus heiterem Himmel, die Familie von Reinhard war eines schönen Tages einfach weg. Die Fleischerei, die Gaststätte, das ganze Anwesen waren verlassen. Im Dorf erzählte man sich, dass die Familie in Westberlin ihr neues Domizil gefunden habe.
Durch die Enteignungen der großen Privateigentümer erlebte das Dorf fast einen Kollaps, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht. Auch in meiner Familie gab es große Veränderungen. Mein Stiefvater verlor seine Arbeit beim Bauern. Er bekam aber sofort eine Anstellung im Sägewerk, das im Dorf ansässig war. Mit Kusshand hatte man ihn genommen. Für die Familie war sehr wichtig, dass wir nun gratis viele Holzabschnitte als Feuerholz bekamen. Das half wirtschaften und ich hatte eine weitere Aufgabe, das Holz im Sägewerk aufladen, nach Hause fahren, abladen und einschichten.
Die Lehrjahre
Meine Konfirmation stand nun bevor. Wieder ein Stück mehr am Erwachsenwerden. Ich hasste diese Konfirmationsstunden. Ein Gesangsbuch musste jeder kaufen. Es kostete 5 Mark. Zur Konfirmation gehörte ein Anzug. Eine Auswahl an Form und Farbe war kaum möglich. Mein Anzug hatte einen hässlichen Braunton und wurde nie wieder getragen. Dazu kam noch ein weißes Hemd mit Fliege. Ich wollte das alles nicht. Meine Mutter machte zwar immer einen auf Christin, nur in die Kirche ging sie nie. Wenn sie mich beim Fluchen erwischte, war ihr Spruch immer: „Du sollst Gott nur in der Not anrufen!“ Nach der Konfirmation erfolgte der Schulabschluss und bald darauf der Beginn der Lehre.
Von einem Beruf zu träumen war die eine Seite, aber wie sah es in Wirklichkeit aus? Mutter und Vater konnten mir nicht helfen und nirgendwo bekam man Informationen zur Berufswahl. Ich schrieb viele Bewerbungen. Auf jeden Fall sollte es ein technischer Beruf sein. Ich wollte auch nicht in der Nähe bleiben, ich wollte weg von zu Hause, nie wieder Dorf, nie wieder Landwirtschaft. Nach vielen Absagen fand ich endlich das, was mir zusagte, eine Lehre zum Motorengetriebe-Schlosser. Es sollte perfekt werden. Oh, ich war glücklich! Die Ausbildungsstätte hatte den Namen „MTS-Spezialwerkstatt“ Müncheberg. Die Lehre dauerte drei Jahre. Gewohnt wurde im Internat. Müncheberg war eine kleine Stadt im Märkischen (Märkische Schweiz) nicht weit von Bukow entfernt. Die Entfernung zu meinem Heimatort war ca. 30 km. Die Distanz konnte man mit dem Fahrrad auf guter Asphaltstraße zurücklegen oder mit dem Zug von Jakobsdorf bis Fürstenwalde mit Umsteigen in Richtung Straußberg bewerkstelligen. Wir bezeichneten die kleine Eisenbahn liebevoll als unseren „Pollo“. Blumenpflücken während der Fahrt war verboten. Die Bahn fuhr direkt am Internat vorbei, bevor sie nach 2 Kilometern den Bahnhof in Müncheberg erreichte. Überlegungen waren dann schnell mal im Focus, wir könnten ja einfach mal während der Fahrt abspringen.
Die Spezialwerkstatt war ein sehr großer Komplex, der alle Bereiche der Ausbildung, der Unterbringung und Freizeit wohlüberlegt verband. Hier hatte die DDR für die Jugend etwas Großartiges entstehen lassen. Allein die Aufteilung und die Logistik zum Erreichen der einzelnen Komplexe waren bis ins Detail durchdacht und organisiert. Das Internat war durchgängig mit Lehrlingen belegt. Ein 3-jähriger Ausbildungsdurchgang hatte 84 Lehrlinge, aufgeteilt in je zwei Lehrgruppen pro Jahr mit einer Stärke von 14 Mann.
Der u-förmig angeordneten Baukomplex Unterbringung vereinigte alle Wohnbedürfnisse: das Erdgeschoß mit Speisesaal, eine kleine Verkaufsstelle im Foyer, Sanitätsräume, Erzieherzimmer, Kulturräume und zwei Tischtennisräume. Im Kellergeschoß befanden sich u. a. Duschen und zwei Zimmer mit Badewannen. Waschräume gab es auf jeder Etage. Im 1. und 2. Obergeschoß lagen die Wohnräume der Lehrlinge. In der Mitte des Komplexes befand sich eine Wiese, umgeben von schön gestalteten Sitzbänken. Der Platz war auch für Appelle vorgesehen. Von hier aus konnte man direkt alle anderen Stationen von Ausbildung und Freizeit erreichen.
Links neben dem Haupteingang schlossen sich die Sportanlagen mit Fußballplatz, Bahnen für Leichtathletik, Weit- und Hochsprunganlage und Swimmingpool an. Zur rechten Seite lagen die Volleyballplätze. Im hinteren Teil der Betriebsberufsschule befand sich die Turnhalle. Sie war mit Turngeräten aller Art ausgestattet. Da hätte man Spitzensportler werden können. Alle Sportanlagen konnten täglich genutzt werden.
Hinter dem Haupteingang befand sich der komplette Ausbildungstrakt





























