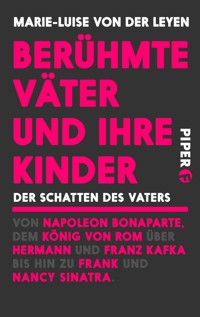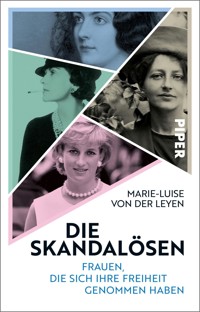
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Über Pionierinnen, Grenzgängerinnen, Wegbereiterinnen Alle Lebensgeschichten in diesem Band erzählen von inspirierenden Frauen, die mit unbändiger Energie den schmalen Grat zwischen gesellschaftlicher Akzeptanz und Ablehnung ausgelotet haben. Sie haben Normen bewusst oder unbewusst infrage gestellt und dabei immer wieder um ihren Platz in der Gesellschaft gekämpft. An diesen Figuren zeigt sich deutlich, welch strenge Maßstäbe an das Verhalten von Frauen gelegt wurde. Durch sie wurde der Weg für nachfolgende Generationen geebnet und so das weibliche Selbstbewusstsein geprägt. Um diese neun mutigen Frauen geht es: - Dorothea von Hannover - Lou Andreas-Salomé - Lola Montez - George Sand - Fanny zu Reventlow - Elisabeth Petznek (Erzherzogin von Österreich) - Coco Chanel - Prinzessin Diana - Georgina Cavendish (Herzogin von Devonshire)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2025Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München, nach einer Idee von Chica von Walderdorff.Covermotiv: A. Dagli Orti / © NPL - DeA Picture Library / Bridgeman Images (Lola Montez); picture alliance / KEYSTONE | IBA-Archiv (Fanny zu Reventlow); picture-alliance / dpa / Press Association | Stillwell (Diana von Wales); picture-alliance/ dpa | Man_Ray_Trust/ADAGP_Paris_200 (Coco Chanel)Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Skandalöse Frauen
1 Sophie Dorothea von Braunschweig-Lüneburg(1666 – 1726)
2 Herzogin Georgiana von Devonshire(1757 – 1806)
3 George Sand (1804 – 1876)
4 Lola Montez (1821 – 1861)
5 Lou Andreas-Salomé (1861 – 1937)
6 Franziska Gräfin zu Reventlow (1871 – 1918)
7 Elisabeth Petznek, Erzherzogin von Österreich(1883 – 1963)
8 Coco Chanel (1883 – 1971)
9 Prinzessin Diana von Wales (1961 – 1997)
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Widmung
Für
Antonia
Louis
Friedrich
und Alva
Skandalöse Frauen
Skandalös ist, was Anstoß erregt, weil es allgemein verbindliche Werte verletzt. Genau die sind aber nicht immer so leicht festzumachen: Sie verändern sich kontinuierlich und mit ihnen die Grenzen zwischen akzeptiertem und skandalösem Verhalten. Was heute akzeptiert ist, war es in der Vergangenheit durchaus nicht immer, sondern führte zur Ausgrenzung. Deshalb ist eine Geschichte über »skandalöse Frauen« auch eine Geschichte über die – sich verändernde – Betrachtung dessen, was als skandalös empfunden wurde, und darüber, welcher Einsatz nötig war, um gesellschaftliche Maßstäbe langfristig zu verändern.
»Skandalöse Frauen« waren Grenzgängerinnen, die den manchmal schmalen Grat zwischen Akzeptanz und Ablehnung ausgelotet, die gesellschaftlichen Normen bewusst oder unbewusst infrage gestellt und die Konsequenzen daraus auf sich genommen haben. Dabei waren die Maßstäbe, die an das Verhalten von Frauen gelegt wurden, in den patriarchalischen Systemen erheblich strenger als die Maßstäbe für Männer – und besonders unterschiedlich im sexuellen Bereich.
Sexuelle Freizügigkeit für einen Mann war gesellschaftlich akzeptiert, für eine Frau dagegen ein Tabu und ihre Jungfräulichkeit ein lange hoch gehandelter Wert. Während der Ehe waren die Vorschriften für Frauen jedoch nicht minder streng: Ging ein (Ehe-)Mann fremd, galt das als Ausdruck einer allgemein bewunderten Potenz. Ging dagegen eine (Ehe-)Frau fremd, war das moralisch verwerflich und wurde bestraft. Zeugte zum Beispiel der Herzog von Devonshire Kinder mit seiner Mätresse, durften diese am väterlichen Hof aufwachsen. Die uneheliche Tochter der Herzogin dagegen wurde der Mutter entzogen und vom Hof verbannt.
Es grenzt an ein Wunder, dass der Herzog seine Frau nicht verstieß: Wurde eine Frau des Ehebruchs bezichtigt, ließen sich die Ehemänner nämlich in der Regel scheiden und behielten dabei das von der Frau in die Ehe eingebrachte Vermögen und auch die gemeinsamen Kinder, die ihre Mütter meist nicht einmal mehr sehen durften. Den – für Frauen – verbindlichen Wertekodex zu verletzen erforderte daher von den meisten ungewöhnlichen Mut und große Kraft. Und hatte für sie fast immer erhebliche Einschränkungen und seelische Verletzungen zur Folge. Dennoch waren gerade diese Frauen wichtig für das weibliche Selbstbewusstsein nachfolgender Generationen: weil sie die Grenzen, die ihnen selbst gesetzt waren, infrage gestellt, auf lange Sicht verschoben und schließlich aufgehoben haben.
Natürlich waren nicht alle in diesem Buch beschriebenen Protagonistinnen bedauernswerte Opfer überkommener Wertvorstellungen: Diejenigen, die sich nicht um die öffentliche Meinung scherten, sondern sie rücksichtslos provozierten, wie beispielsweise Lola Montez, waren jedoch die Ausnahmen und glücklicherweise die Einzigen, die auch heute noch als »skandalös« empfunden würden – sogar dann, wenn sie Männer wären.
1 Sophie Dorothea von Braunschweig-Lüneburg(1666 – 1726)
Sophie Dorothea von Braunschweig-Lüneburg war das einzige Kind des Herzogs Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg und seiner Frau Eleonore d’Olbreuse und dank ihres familiären Hintergrunds eine reiche Erbin aus fürstlichem Haus. Es war daher nicht verwunderlich, dass viele junge Prinzen Europas um ihre Hand anhielten. Umso mehr, als die Prinzessin mit ihrem üppigen braunen Haar und den blitzenden dunklen Augen nicht nur bildhübsch, sondern überdies anmutig, charmant, fröhlich und temperamentvoll war. Sie liebte es, sich schön zu kleiden und allgemein zu gefallen. Dabei war ihr auch eine gewisse Koketterie nicht fremd, was ihr zuweilen die Kritik ihrer Tante und späteren Schwiegermutter Sophie am Hof von Hannover eintrug.
Dessen ungeachtet war ihr einziger Makel eigentlich nur die Herkunft ihrer Mutter, die aus niederem, hugenottischem Adel stammte, was in einem herzoglichen Haus nicht als standesgemäß galt. Darüber hinaus war Sophie jahrelang die Mätresse des Herzogs gewesen, ehe dieser seine Geliebte zunächst in morganatischer Ehe geheiratet und einige Jahre nach der Eheschließung in den Stand einer Herzogin von Celle erhoben hatte – ein äußerst ungewöhnlicher Vorgang, denn Mätressen heiratete man üblicherweise nicht.
Auch wenn ihr Stand und ihre Stellung nicht von Anfang eindeutig und allgemein akzeptiert waren, gelang es Eleonore dennoch, frischen Wind an den Hof von Celle zu bringen. Sie folgte darin dem Beispiel ihrer Schwägerin Sophie, die auf dem Schlossgelände in Hannover ein großes Opernhaus mit 1300 Plätzen errichten und die Ausstattung der schlösslichen Prunkräume nach ihrem Geschmack verändern ließ.
Dabei beschränkten sich Sophies architektonische Aktivitäten nicht auf das Innere des Schlosses, sondern bezogen beispielsweise auch die Gärten der Sommerresidenz Herrenhausen mit ein. Für deren Gestaltung konnte sie mit dem berühmten Philosophen und Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibniz den glänzendsten Geist ihrer Zeit gewinnen, den sie bewunderte und mit dem sie befreundet war.
Eleonore wiederum brachte die französische Lebensart, in der sie aufgewachsen war, an den Hof in Celle. Mit ihr zogen nicht nur Stil und Eleganz, sondern auch Musikanten und Komödianten ein, für die Herzog Georg Wilhelm ein eigenes – heute noch existierendes – prächtig ausgestattetes Theater bauen ließ, das regelmäßig bespielt wurde. Kurzum: Das Leben im Schloss war geprägt von einer heiteren und aufgeschlossenen Atmosphäre.
Sie sollte auch Sophie Dorotheas Erziehung bestimmen und machte sie – anders als viele andere hochadelige Töchter – zu einer selbstbewussten jungen Frau. Die späte Legitimation ihrer Mutter als Herzogin focht sie nicht an: Der Standesdünkel an den europäischen Fürstenhöfen, mit denen sie durch ihren Vater verwandt war, war ihr fremd. Bewusst dagegen war ihr natürlich, dass sie eines Tages einen Mann heiraten würde, den ihre Eltern aus dynastischen Gründen für sie aussuchten. An dieser Gepflogenheit führte im 17. Jahrhundert in ganz Europa kein Weg vorbei. Und so liebevoll der Umgang im Elternhaus auch sein mochte – Töchter dienten nun einmal dem Erhalt der Macht, ja ihrer Expansion. Das sah auch ihr Vater nicht anders. Sophie Dorothea konnte nur hoffen, dass ihr künftiger Bräutigam ihr einigermaßen gefallen würde, der Rest würde sich dann schon finden.
Es zeigte sich, dass Herzog Georg Wilhelm nicht den Geschmack seiner Tochter, sondern eher die Verwandtschaft im Auge hatte, als er im Jahre 1676 seine Zustimmung zur Verlobung der zu dieser Zeit gerade mal zehnjährigen Sophie Dorothea mit Prinz Anton Friedrich von Wolfenbüttel gab. Nachdem der zukünftige Bräutigam auf dem Schlachtfeld gefallen war, kam ein direkter Vetter zum Zuge: Erbprinz Georg Ludwig von Hannover, Sohn seines Bruders, des damaligen Herzogs und späteren Kurfürsten Ernst August von Hannover. Er war in den Augen des Herzogs eine noch bessere Partie: zum einen dadurch, dass sein Vater daran arbeitete, vom Herzog zum einflussreichen Kurfürsten aufzusteigen, zum anderen war er durch seine Großmutter mütterlicherseits, eine Tochter König Jakobs I. von England, nah mit dem englischen Königshaus verwandt und konnte sich Hoffnungen auf den englischen Thron machen, den er 1714 als König George I. auch tatsächlich bestieg. Diese Möglichkeit war freilich zum Zeitpunkt, als er und Sophie Dorothea sich im Jahre 1682 näher kennenlernten, noch bloße Spekulation.
Der Bräutigam galt als nicht besonders attraktiv und wird zudem als steif, kühl und verschlossen beschrieben – durchaus kein Bewerber nach Sophie Dorotheas Geschmack. Auch ist nirgendwo die Rede davon, dass er seinerseits besonders beeindruckt von ihr gewesen wäre. Aber das waren in der Heiratspolitik des Adels und Hochadels auch keine gängigen Kriterien. Es nützte nichts, dass sich die selbstbewusste Sechzehnjährige heftig gegen die Wahl des Vaters wehrte, darin unterstützt von ihrer Mutter Eleonore, die sie ebenso wenig goutierte. Schließlich war ihre eigene Heirat mit Herzog Georg Wilhelm – eine absolute Ausnahme an europäischen Höfen – tatsächlich eine Liebesheirat gewesen. Sie wünschte deshalb auch ihrer lebenslustigen Tochter eine hoffnungsvollere Perspektive.
Der Widerstand der beiden Frauen erwies sich leider als zwecklos: Der Herzog ließ sich weder von ihren Argumenten noch von ihren Bitten oder ihren Tränen umstimmen, sondern blieb bei seiner Entscheidung, von der zu diesem Zeitpunkt freilich niemand voraussehen konnte, wie verhängnisvoll sie tatsächlich war. Sophie Dorothea blieb nichts anderes übrig, als sich zu fügen. Es spricht für ihren guten Charakter, dass sie trotz allem willens war, die Erwartungen zu erfüllen, die in sie gesetzt wurden. Dazu gehörte in erster Linie, für Nachwuchs zu sorgen.
Die Hochzeit wurde im Spätherbst des Jahres 1682 zunächst in kleinem Rahmen im Schloss von Celle gefeiert und fand ihre ausgedehnte Fortsetzung im Leineschloss von Hannover, wo Sophie Dorothea von der Bevölkerung jubelnd begrüßt wurde. Besonderen Eindruck machte sie offenbar auf den Korrespondenten der französischen Zeitschrift Mercure Galant: »Sie hat eine sehr schöne Gestalt«, berichtete er nach Paris, »[…] kastanienbraunes Haar, ein niedliches Grübchen auf dem Kinn, einen glatten und schönen Teint und einen sehr schönen Busen; sie ist eine vortreffliche Tänzerin, spielt das Cembalo und beherrscht auch den Gesang. Sie besitzt überaus viel Geist und Lebhaftigkeit, eine glückliche und durch ihre Lektüre reich genährte Fantasie; sie hat von Natur einen sehr guten Geschmack, den die sorgfältige Erziehung, die man ihr angedeihen ließ, noch gefördert hat. Sie äußert über alle Dinge richtige Ansichten und beweist bei allem, worüber man mit ihr spricht, ein scharfsinniges Urteil.«[1]
Der Heirat vorausgegangen waren umfangreiche Verhandlungen über die Mitgift der Braut, die zu einem für das Haus Hannover äußerst günstigen Abschluss kamen: Sophie Dorothea brachte die stattliche Mitgift von 150 000 Talern sowie eine jährliche Rente von 10 000 Talern in die Ehe ein, über die freilich nicht sie selbst, sondern nur ihre Schwiegerfamilie verfügen durfte, dazu sieben Ämter aus der Grafschaft Hoya mitsamt ihren Einnahmen sowie die vertraglich festgelegte Zusicherung, dass nach ihrem Tod der gesamte – von ihrem Vater zu erbende – Besitz an das Haus Hannover fallen würde. Erbprinz Georg Ludwig machte also eine außerordentlich gute Partie.
Das änderte allerdings nichts daran, dass ihn seine junge Frau persönlich nicht sonderlich interessierte und er das Liebesleben mit seiner Mätresse, Gräfin Katharina Maria von dem Bussche, auch nach der Hochzeit weiterführte. Ein Privileg, wie es am Hof in Hannover auch sein Vater Ernst August in Gestalt von Katharinas Schwester, der Gräfin Clara Elisabeth von Platen, in Anspruch nahm.
Diese bewohnte mit ihrem Ehemann Franz Ernst von Platen, der es dank ihres Einflusses und der Gunst des Herzogs zum Geheimen Rat und Ersten Minister gebracht hatte, das Schlösschen Monplaisir in der Nähe der Residenzstadt. In dem – wie jeder wusste – ausgelassene Feste gefeiert wurden, auf denen es längst nicht so sittsam zuging wie am Hof in Hannover. Es war ein beliebter Anziehungspunkt der höfischen Herren und ausgesuchter Damen, zugleich das Machtzentrum der Gräfin, die als eine Meisterin der Manipulation und der Intrige galt.
Im November 1683 wurde das erste Kind des Erbprinzenpaares geboren. Es war – und das war das Wichtigste – ein Sohn, schon das ein Wunder: Wie viele Tränen vergossen doch viele hochgestellte Wöchnerinnen ihrer Zeit über die Geburt einer Tochter, zumindest solange kein Stammhalter geboren war. Und das auch noch in einem aus heutiger Sicht völlig ungerechtfertigten Schuldbewusstsein, für das Geschlecht des Kindes verantwortlich zu sein.
Das andere Wunder war: Das Kind überlebte, was in einer Epoche hoher Säuglingssterblichkeit durchaus die Ausnahme von der Regel war. Es wurde nach seinen beiden Großvätern Georg August genannt und verschaffte Sophie Dorothea zumindest vorübergehend eine gewisse Achtung vonseiten ihres Ehemannes. Auch am Hof war ihre Stellung durch die Geburt des kleinen Prinzen stabiler geworden. Nicht zuletzt bei ihrer Schwiegermutter, Herzogin Sophie, die der jungen Frau ihres Sohnes bis dahin eher kühl gegenübergestanden hatte, während ihr Schwiegervater, Herzog Ernst August, ihr von Anfang an mit Freundlichkeit begegnet war.
Entsprechend dankbar nahm sie daher auch im Jahre 1686 seine Einladung an, ihn in Gesellschaft ihrer Hofdame Eleonore von dem Knesebeck auf eine Reise nach Venedig zu begleiten, wo er im eleganten Palazzo Ca’ Foscari am Canal Grande die Wintermonate zu verbringen pflegte. Ein luxuriöses Unterfangen, mit dem er immer wieder die höfische Staatskasse stark strapazierte. Losgelöst von der Etikette des Hannoveraner Hofes gondelte Sophie Dorothea auf den venezianischen Kanälen ein paar herrliche Wochen lang von Palazzo zu Palazzo und von Maskenball zu Maskenball und stellte unter der wohlwollenden Obhut ihres Schwiegervaters nur zu gern unter Beweis, was für eine fabelhafte Tänzerin sie war.
Aber nicht nur ihr tänzerisches Talent, sondern auch ihre Schönheit und Liebenswürdigkeit erregten allgemeine Aufmerksamkeit und die Bewunderung vieler Verehrer. Sehr zum Missfallen der Gräfin Platen, die sich ebenfalls in der Entourage des Herzogs aufhielt und die mit ihren 38 Jahren auf dem glänzenden Parkett in Venedig weit weniger beachtet wurde als in dem von ihr kontrollierten Netzwerk in Hannover. Sie teilte dieses Missfallen mit dem Erbprinzen Georg Ludwig, der sich zu einer Visite in der Lagunenstadt herbeiließ und auf die Anerkennung, die seine Ehefrau dort erfuhr, weit weniger stolz als eifersüchtig war.
Nur ungern nahm Sophie das gewohnte Hofleben in Hannover wieder auf, in dem sich ihr Ehemann, meist in militärischer Mission unterwegs, rarmachte. Immerhin war er präsent genug, seine Mätresse Katharina von dem Bussche, die von seiner Mutter vom Hof verbannt worden war, gegen eine neue Favoritin, Ehrengard Melusine von der Schulenburg auszuwechseln. Und mit seiner Ehefrau die Tochter Sophie Dorothea zu zeugen: Sie kam im Jahre 1687 zur Welt.
Damit meinte Georg Ludwig offenbar, seine dynastischen ebenso wie seine ehelichen Pflichten erfüllt zu haben, denn es folgten keine weiteren Kinder – wenn man von den beiden Töchtern absieht, die seine neue Mätresse von ihm bekam. Auch wenn Sophie Dorothea gern auf diese Pflichten verzichtete, so fand sie sich mit der Aussicht auf ein jahrzehntelanges, eintöniges Eheleben an der Seite eines ungeliebten Mannes doch nur schwer ab. Schließlich war sie gerade erst 21 und eine lebenslustige junge Frau.
»[…] bereits im Ausgang der 1680er-Jahre war die Ehe des Prinzenpaares so weit zerrüttet, dass es nur eines Anstoßes von außen bedurfte, um sie zu sprengen«, konstatiert der Historiker Georg Schnath, der sich jahrzehntelang mit dem Schicksal von Prinzessin Sophie Dorothea beschäftigt hat.[2]
Der Anstoß ließ nicht lange auf sich warten. Auf einem Maskenball, den Herzog Ernst August nach venezianischem Vorbild im Februar 1690 im Schloss von Hannover gab, traf die Prinzessin auf einen Mann, der sie auf Anhieb in seinen Bann zog: den blendend aussehenden Grafen Philipp Christoph von Königsmarck, mit 24 Jahren gerade ein Jahr älter als sie selbst und seit Kurzem Offizier in der Garde des Herzogs Ernst August.
Sie kannte ihn seit ihrer Jugend, hatte ihn aber aus den Augen verloren, weil die Bekanntschaft aufgrund seines – lediglich gräflichen und daher nur unzureichenden – Standes von ihren Eltern nicht weiter gefördert worden war. Sein Vater war früh im Krieg gegen die Franzosen gefallen. Der Mutter gelang es nicht, den beträchtlichen Familienbesitz, der aus Gütern in Norddeutschland, Estland und Schweden bestand, zusammenzuhalten, da der schwedische König Karl XI. einige Güter, die den Königsmarcks von der Krone übertragen worden waren, entschädigungslos zurückforderte.
Dazu kamen die teure internationale Ausbildung und die aufwendige Lebensführung der beiden Söhne: Philipp beispielsweise war in London in Fächern wie Tanzen, Reiten und Fechten zum Kavalier ausgebildet worden, hatte dann in Oxford Latein und Englisch studiert und schließlich wie sein Bruder Karl Johann eine Weile in Paris gelebt. Auch von Spielschulden war die Rede. Und davon, dass Philipp ein gern gesehener Gast auf den Festen der Gräfin Platen in Monplaisir war. Es hieß, er habe eine Affäre mit ihr gehabt: seine späteren Briefe bestätigen diese Vermutung. Und es hieß auch, dass sie ihre Tochter Sophie Charlotte aus ihrer Beziehung mit Herzog Ernst August mit Königsmarck verheiraten wollte.
Trotz aller dieser Gerüchte galt der weltgewandte junge Graf als mutiger, zuverlässiger und verdienter Offizier, der sich zuerst in kaiserlichem Dienst gegen die Türken und schließlich in den Feldzügen des Herzogs Ernst August als Oberst seines Garderegiments zu Fuß bewährt hatte. Darüber hinaus stammte er aus einer angesehenen Familie und war ein Ehrenmann, der zur engsten Hofhaltung zählte, zu allen Festen eingeladen wurde und in der Hannoveraner Osterstraße residierte. Zu seinem noblen Haushalt gehörten, dem Vernehmen nach, die stattliche Zahl von 29 Dienern und 52 Pferden und Maultieren. Kein Wunder also, dass er ins Visier der Platen geriet. Das konnte auf kurze Sicht von Vorteil, auf lange Sicht aber auch gefährlich sein.
Es entging ihr nicht, dass der junge Graf der Erbprinzessin den Hof machte, ebenso wenig, dass diese davon äußerst angetan war, auch wenn sie sich bemühte, die Fasson zu wahren und ihm deshalb zu seinem Leidwesen in Gesellschaft anderer immer wieder betont zurückhaltend begegnete. Dennoch kam es, wie es kommen musste: Sophie Dorothea und Philipp Königsmarck wurden ein Paar. Für beide war es die Liebe ihres Lebens.
Natürlich wussten sie, dass die Umstände äußerst ungünstig waren. Es war gefährlich, sich innerhalb des Schlosses zu treffen, wo nicht nur die Höflinge, sondern auch das Personal, ja, wie es schien, sogar die Wände Augen und Ohren hatten. Noch schwieriger war es, die Begegnungen nach draußen zu verlegen, denn die Prinzessin wurde, wo sie ging und stand, von jedermann erkannt. Und wenn auch der Erbprinz ganz offiziell ein Liebes- und Familienleben außerhalb der Ehe führte, so war seiner Ehefrau derlei doch strengstens untersagt. Es konnte sie nicht nur ihren Ruf, sondern auch ihr Heim, ihre Kinder und ihr Vermögen kosten.
Und Königsmarck wiederum riskierte zumindest seine Karriere. Auf die Idee, dass eine Beziehung zu der Prinzessin auch sein Leben gefährden könnte, kam er nicht. Eine besondere Herausforderung stellte angesichts der gebotenen Heimlichkeit und Vorsicht die Frage dar, wie man miteinander kommunizieren könnte. Schließlich gab es kaum einen Vorwand, unter dem der Graf seiner Angebeteten seine Aufwartung machen, mit ihr spazieren gehen oder auch nur einen Brief schreiben konnte.
Dass sie sich bei höfischen Gesellschaften trafen, bei denen sie ihre Gefühle verbergen mussten, verstärkte nur ihr Bedürfnis, sich einander zu erklären – und tatsächlich führten sie auch eine umfangreiche geheime Korrespondenz. Als Postillon d’amour fungierte dabei Eleonore von dem Knesebeck und ging damit ein hohes Risiko ein, zumal auch sie auf Mittelsmänner angewiesen war. Dennoch gelang es ihr, dafür zu sorgen, dass die Briefe und Nachrichten den Empfänger beziehungsweise die Empfängerin erreichten – und diese sich austauschen oder aber im Geheimen treffen konnten.
Auf der Seite Königsmarcks war es sein Sekretär Georg Konrad Hildebrand, der die Botendienste übernahm. Natürlich mussten die Liebenden trotzdem die Entdeckung der Briefe fürchten. Deshalb benutzten sie Decknamen, teilweise auch unsichtbare Tinte und verschlüsselten ihre Botschaften, sodass die Mitteilungen damals wie heute nur schwer zu entziffern und zu verstehen sind. Zudem waren die von der Hand Königsmarcks ausnahmslos an Eleonore von dem Knesebeck adressiert. Das Paar bediente sich dabei der am Hof üblichen französischen Sprache, wobei das Französisch von Sophie Dorothea – sicher nicht zuletzt dank ihrer französischen Mutter – fließend, das Königmarcks hingegen ziemlich fehlerhaft und nach Gehör zu Papier gebracht ist.
Der erste Brief, der aus der Korrespondenz erhalten ist, wurde von ihm Anfang Juli 1690, fünf Monate nach dem bedeutsamen Maskenball, während eines militärischen Einsatzes in Flandern an Sophie Dorothea geschrieben. Wie intim die Beziehung damals schon war, lässt sich daraus nicht ablesen. Immerhin ist er doch bereits sehr persönlich, wenn der Verfasser darin nach Linderung seiner durch die Trennung bedingten Liebesleiden verlangt: » […] da Sie es sind, die meine Leiden verursachten, ist es nur gerecht, dass Sie sie auch lindern.« Und: »Wenn ich nicht an eine Person schriebe, für die ich ebenso viel Achtung wie Liebe empfinde, würde ich Worte finden, die meine Leidenschaft besser ausdrückten […].«[3]
Später spricht er offen über die gemeinsamen Liebesnächte und über das Entzücken, das er in ihren Armen findet: »Was würde ich dafür geben, daß es schon Mitternacht wäre! Halten Sie etwas ungarisches Rosenwasser bereit, falls mich vor allzugroßer Freude eine Ohnmacht überkommt! Ist es wahr? Heute abend werde ich die bezauberndste Frau der Welt umarmen, ihre süßen Lippen küssen … Ich werde aus Ihrem eigenen Munde hören, daß ich Ihnen nicht gleichgültig bin, ich werde Ihre Knie umfassen, meine Tränen werden Ihre wunderbaren Wangen benetzen, und Sie werden es ihnen nicht verbieten, meine Arme werden voller Seligkeit den schönsten Leib der Welt umarmen […].«[4] Stets sind seine Briefe von Sehnsucht, aber immer auch von Ungeduld und Besorgnis geprägt, vor allem, wenn er lange keine Nachricht von ihr erhalten hatte:
»[…] Ich schreibe Ihnen diese Zeilen unter Seufzen und Zittern«, lässt er sie im Sommer 1692 aus dem niederländischen Venlo wissen, »ich weiß nicht, woran ich bei Ihnen bin, ich habe bisher nur einen einzigen Brief von Ihnen erhalten«, und er fährt fort: »Wenn ich an die früheren Wonnen denke, erscheint mir mein Unglück noch größer. Ich denke dann bei mir: Wie? Nie wieder sollst Du diese strahlenden Augen küssen, diesen göttlichen Mund, diesen köstlichen Busen! Ah, ich werde nie wieder in diesen Armen ruhen, die mich mit solcher Lust umfingen, und ich werde alles verlieren, wenn ich Sie verliere!«[5]
Häufig verraten seine Geständnisse aber auch eine heftige Eifersucht, wenn er ihr beispielsweise vorwirft, sich in seiner Abwesenheit prächtig zu amüsieren, oder ihr andere Liebhaber unterstellt: »Großer Gott, wenn ich sähe, dass Sie einen anderen mit ebensolcher Leidenschaft umarmen, wie Sie sie mir geschenkt haben«, schreibt er ihr einmal, »und mit ihm in ebensolcher Lust ›das Ross besteigen‹ – dann will ich verflucht sein, wenn ich nicht wahnsinnig werde.«[6] Ihre Antwort beruhigt ihn nur kurzfristig: »Welchen Anlass habe ich gegeben«, fragt sie ihn gekränkt, »dass Sie eine so schlechte Meinung von mir haben? Etwa weil ich Sie mit solcher Ergebenheit geliebt habe, weil ich alle Freunde, die ich auf der Welt habe, vernachlässigt und mich weder um die Mahnungen meiner Eltern noch um all das Unglück, das mir zustoßen kann, gekümmert habe? Sagen Sie selbst, was ich tun muss, um Sie von Ihrer krankhaften Eifersucht zu befreien.«[7]
Aber auch die Prinzessin sorgte sich um die Beständigkeit seiner Gefühle, wenn sie sie ihn anflehte: »Bleiben Sie mir treu, mein Geliebter, mein ganzes Lebensglück hängt davon ab. Ich jedenfalls will nur noch für Sie leben, und Ihnen auf ewig zu gehören.«[8] So, wie sie ihrerseits seine Zweifel zu zerstreuen suchte, beruhigte auch er die Geliebte: »Können Sie wirklich glauben, daß ich eine andere als Sie liebe?«, fragt er in einem Brief aus Berlin im April 1691. »Nein, ich beteuere Ihnen feierlich, daß ich nach Ihnen nie mehr lieben werde. Es wird mir nicht schwerfallen, mein Wort zu halten, denn kann man noch eine andere Frau begehrenswert finden, wenn man Sie angebetet hat? […] Kann man, wenn man eine Göttin angebetet hat, die sterblichen Weiber noch eines Blickes würdigen?«
Und versichert ihr zugleich: »Ich bete Sie an meine bezaubernde brunette und ich werde bis zu meinem Tode nichts anderes fühlen […].«[9] Hochbrisante heimliche Nachrichten – jede einzelne von ihnen begleitet von der ängstlichen Sorge, dass sie in falsche Hände geraten und das Geheimnis entdeckt werden könnte. Über die möglichen Konsequenzen mochten die Liebenden gar nicht nachdenken.
Glücklicherweise war der Hof zu dieser Zeit mit hochpolitischen Angelegenheiten beschäftigt, nämlich der Erlangung der Kurwürde, um die Herzog Ernst August schon seit Jahren kämpfte. Endlich rückte das Ziel in greifbare Nähe: Im Jahre 1692 wurde er durch kaiserlichen Beschluss in den Kreis der neun mächtigen Kurfürsten aufgenommen, denen das Recht zustand, den deutschen König zu wählen. Dafür musste Ernst August dem Kaiser unter anderem eine hohe Geldsumme zahlen, ihm darüber hinaus Soldaten stellen und die Primogenitur in seinem Herzogtum einführen, die ausschließlich dem ältesten Sohn die Erb- und Rechtsnachfolge einräumte. Ein Schachzug, der verständlicherweise nur dem Erbprinzen Georg Ludwig zusagte, der damit zum Kurprinzen aufstieg, während er unter seinen jüngeren Brüdern Maximilian Wilhelm, Christian Heinrich und Ernst August heftigen Widerspruch hervorrief.
In der Zwischenzeit prüfte Sophie Dorothea die Möglichkeit, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen. Dazu war das Einverständnis ihres Vaters nötig. Der aber sah sich an den mit dem Haus Hannover geschlossenen Ehevertrag gebunden und wies das Ansinnen seiner Tochter strikt zurück. Auch ihr selbst wurde klar, dass im Fall einer Scheidung zunächst ihrem Schwiegervater und nach seinem Tod ihrem Ehemann ihr gesamtes Vermögen zufallen und sie nicht einmal Anspruch auf Unterhalt haben würde. Darauf aber wäre sie angewiesen, zumal sich die wirtschaftliche Lage ihres Geliebten eher verschlechterte als verbesserte und er sich, obwohl auch er auf Scheidung drängte, nicht in der Lage sah, ihr ein standesgemäßes Leben zu bieten.
Wovon also sollte sie im Falle einer Scheidung leben? Und was würde aus ihren beiden Kindern? Sie waren beide noch sehr jung: Sohn Georg August gerade neun, die Tochter Sophie Dorothea erst fünf Jahre alt. Ihre Überlegungen wurden nicht gerade dadurch erleichtert, dass ihr Geliebter mit seinem Regiment in die Niederlande beordert worden war und sie einander wochenlang nicht sehen konnten. Dazu kam die wachsende Sorge, ihn auf dem Schlachtfeld zu verlieren. »Gleich nach dem Aufwachen habe ich erfahren, dass eine furchtbare Schlacht stattgefunden hat«, schreibt sie ihm im August 1692 und fleht ihn an: »Setzen Sie mich in Zukunft nicht mehr solchen Ängsten aus – verlassen Sie mich nie mehr. Wenn Sie mich wirklich lieben, verbringen Sie den Rest meines Lebens mit mir, lassen Sie uns ein Glück erschaffen, das im anderen wohnt und von niemandem zerstört werden kann.«[10]
Dazu kam die ständige Angst vor Entdeckung: Ihre Liebe hatte ihre Leichtigkeit verloren. Denn auch Königsmarck wurde sich der Aussichtslosigkeit der Lage mehr und mehr bewusst, wenn er beispielsweise schrieb: »Der Schmetterling, der sich an der Kerze verbrennt, das wird mein Schicksal sein.«[11] Oder wenn er einen Vers des schlesischen Dichters Benjamin Neukirch zitierte:
»Und also lieb ich mein Verderben
Und heg’ ein Feuer in meiner Brust,
an dem ich doch zuletzt muss sterben.
Mein Untergang ist mir bewusst.
Das macht: ich habe lieben wollen,
was ich doch nur anbeten sollen.«[12]
Oft schrieb er der Geliebten ausführlich, oft allerdings auch nur flüchtige Nachrichten auf Zetteln und Seiten von unterschiedlicher Größe und holzigem Papier – auf allem eben, was auf seinen Reisen gerade zur Hand war. Und er erbat seine Billetts stets zurück, damit sie nicht in ihren Gemächern gefunden würden. Die Prinzessin dagegen verfasste ihre Briefe auf seidig-feinen Bögen mit Goldrand; immer wieder enthalten sie auch Zusätze von der Hand ihrer Vertrauten, Eleonore von dem Knesebeck – ein Zeichen, wie eng und vorbehaltlos das Verhältnis zu der ihr ergebenen Hofdame war. Waren die Liebenden räumlich weit getrennt, so übergaben sie die Briefe der öffentlichen Post, dabei adressierte Königsmarck die seinen an die Knesebeck.
Waren sie jedoch am gleichen Ort, so wurden die für den Grafen bestimmten Nachrichten von der treuen Hofdame an einem vereinbarten Ort versteckt, zum Beispiel in seinem in der Garderobe abgelegten Hut oder Mantel.
Nicht nur der Aufwand, mit dem sie ihre Beziehung zu verbergen trachteten, sondern auch der Inhalt der Briefe und nicht zuletzt die Länge ihrer Affäre über insgesamt vier Jahre, legen nahe, dass es sich bei beiden um eine wirkliche Liebe handelte, die genau deshalb aus dem Ruder zu laufen drohte: Eine flüchtige Affäre konnte – mit Glück – unentdeckt bleiben; eine langjährige »ernsthafte« Beziehung aber, die, weil beide sich nichts sehnlicher wünschten, als fernab vom Hof zusammenzuleben, auf eine vollständige Veränderung ihrer Lebensumstände zielte, hatte das Potenzial zu einem höfischen Skandal.
Und so vorsichtig sie auch waren, so waren sie letztlich doch nicht vorsichtig genug. Waren nicht vielleicht doch zu viele Mitwisser eingebunden? Wussten sie genau, wem sie trauen konnten? Hatten sie Neider oder Feinde, die ihre Situation ausnutzen wollten, sei es um sich Vorteile, sei es auch nur um sich Genugtuung zu verschaffen, wie beispielsweise die Gräfin Platen?
Die Liebenden wussten genau, wie gefährlich sie war, zumal Philipp sich ihr entzogen und überdies ihre Tochter zurückgewiesen hatte. Es war zu befürchten, dass sie nur darauf wartete, sich für diese Beleidigung zu rächen und zugleich der beliebten, fast zwei Jahrzehnte jüngeren Kurprinzessin eins auszuwischen, die ihr ihren einstigen Liebhaber ausgespannt hatte. Nach wie vor war sie bestens informiert und hatte als langjährige Mätresse von Herzog Ernst August großen Einfluss auf ihn und den Hof.
Deshalb war es vermutlich ihr zuzuschreiben, dass er seine Schwiegertochter nachdrücklich vor einer unschicklichen Beziehung zu Königsmarck warnte. Wenn er jedoch davon wusste, war davon auszugehen, dass zumindest auch Herzogin Sophie im Bilde war. Zudem gab es immer wieder Hinweise darauf, dass auch andere Bescheid wussten, allen voran ihre Mutter am Hof in Celle, die ihrer Tochter besorgt ins Gewissen redete.
Im Frühsommer 1694 unternahm Sophie Dorothea einen letzten verzweifelten Versuch, die Zustimmung ihres Vaters zu einer Scheidung zu erwirken – erfolglos. Stattdessen ist in den Überlieferungen von einer geplanten Flucht der Liebenden die Rede. Der Historiker Georg Schnath kommt zu dem Schluss, dass diese Annahme möglich, aber zugleich auch fraglich ist, eine Flucht aber zumindest nicht für den Tag geplant war, an dem einer der beiden potenziellen Deserteure plötzlich verschwand.
Es war der 11. Juli 1694: »Königsmarck verließ in später Abendstunde – zwischen 10 und 11 Uhr – sein Haus an der Osterstraße. Er trug leichte Straßenkleidung: eine graue Leinwandhose, ein weißes Kamisol und einen braunen Regenrock oder Reitkasak, jedenfalls keine Uniform oder Hoftracht und höchstwahrscheinlich auch keine Waffe. Bürger wollen bemerkt haben, dass er den Weg zum Leineschloss nahm. Seitdem ward niemals wieder etwas von ihm gesehen.«[13]
Die Vorbereitung zu einer Flucht, so vermutet Schnath, hätte anders ausgesehen. Tatsächlich ist Philipp Königsmarck nach Schnaths Recherchen an dem besagten Abend im Leineschloss von vier Hofkavalieren gestellt und getötet worden. Sein Leichnam wurde in einem mit Steinen beschwerten Sack in der Leine versenkt.[14]
Die Hofkavaliere hat der Historiker als den Oberkammerjunker Wilken Klencke, den Hofkavalier Philipp Adam von Eltz, den Kammerjunker Hans Christoph von Stubenvol und den italienischen Geistlichen Don Nicolo Montalban identifiziert. Letzterer erhielt vom Hof in Hannover kurz nach dem Verschwinden des Grafen ein Darlehen über die bedeutende Summe von 10 000 Talern, das er nie zurückzahlte, sowie auf Empfehlung des Kurfürsten das Archidiakonat des Bistums Mantua. Gewohnt, dass ihr junger Herr oft ohne Angabe, wann er zurück sein würde, zu verreisen pflegte, erstatteten seine Leute erst vier Tage später, nämlich am 15. Juli, Vermisstenanzeige – Zeit genug für die Täter, zu entkommen und alle Spuren zu beseitigen.
Es waren qualvolle Tage für die Kurprinzessin: Wenn Königsmarck, wie man es beobachtet hatte, in Richtung Schloss unterwegs gewesen war, so musste sie ihn erwartet und, als er nicht kam, sehr bald befürchtet haben, dass ihm etwas zugestoßen war. Aber was? Hatte man ihm aufgelauert oder ihn gefangen genommen? Hielt man ihn im Schloss versteckt? War er womöglich entführt oder sogar ermordet worden? Und hatte die Gräfin Platen die Hände im Spiel? Leider durfte Sophie Dorothea diese Fragen niemandem stellen und auch keine Suchtrupps nach ihm ausschicken, weil sie damit Aufsehen erregt und den Geliebten womöglich in noch größere Gefahr gebracht hätte.
Der Hof schwirrte von Gerüchten. Immer wieder meldeten sich Leute, die ihn lebend oder tot gesehen haben wollten. Wie glaubhaft waren ihre Aussagen? Vor allem der sächsische Kurfürst und spätere König August der Starke machte sich Sorgen um den Grafen, der erst vor Kurzem als General in seine Dienste getreten und mit dem er gut befreundet war, und ließ wochenlang nach ihm suchen. Erfolglos: Seit dem Abend, an dem man ihn im Leineschloss gesehen hatte, fehlte von ihm jede Spur. Aber auch Sophie Dorothea selbst – das wurde mit seinem Verschwinden deutlich – befand sich in größter Gefahr.
In den folgenden Tagen wurde die Wohnung des Vermissten ebenso wie auch die Räume der Kurprinzessin und die ihres Hofstaats durchsucht. Die meisten Briefe aus dem Besitz des Grafen wurden nicht gefunden, da es seinem Sekretär Georg Konrad Hildebrand gelungen war, sie in Sicherheit zu bringen, indem er sie dem schwedischen Schwager Königsmarcks, Carl Gustav Lewenhaupt, übergab. Ein anderer Teil geriet in die Hände des früheren Erziehers und Hofmeisters des Grafen, Friedrich Adolf Hansen. Nur deshalb ist die Korrespondenz zu großen Teilen heute noch vorhanden: teils in der schwedischen Universität Lund, teils im Deutschen Zentralarchiv in Merseburg.
Was aus dem Besitz Sophie Dorotheas beschlagnahmt wurde, ist nicht bekannt, aber es ist anzunehmen, dass verräterische Briefe in die Hände der höfischen Beamten und des Herzogs Ernst August gelangten und die wahre Natur der Beziehung zwischen ihr und Philipp Königsmarck offenbarten. Womöglich, um einen noch größeren Skandal zu vermeiden, konzentrierten sich die Untersuchungen zunächst vor allem auf Eleonore von dem Knesebeck und ihre Rolle als angebliche Drahtzieherin und Fluchthelferin. Anfang August wurde sie gefangen genommen und im Amtshaus Springe in der Nähe von Hannover, später auf der mittelalterlichen, als uneinnehmbar geltenden Festung Scharzfels im Südharz, untergebracht.
Wenige Tage zuvor war auch Sophie Dorothea des Hofes verwiesen worden, der Umgang mit ihr wurde dabei eng zwischen den herzoglichen Brüdern in Celle und Hannover abgestimmt. Sie achteten geflissentlich darauf, dass der Ruf ihrer beider Häuser nicht mehr als unvermeidbar beschädigt wurde. Deshalb bezogen sich die gegen die Prinzessin erhobenen Vorwürfe auch nicht auf ihren Ehebruch, sondern auf ihre Absicht, ihren Ehemann »böswillig« zu verlassen. Von Königsmarck war dabei nicht die Rede. Auch zu seinem Verschwinden nahm der Hof in Hannover nur insofern Stellung, als dass er auf Nachfrage verlauten ließ, er habe den Grafen nicht in der Hand. Umso größere Sorge trug er, auch Sophie Dorothea aus der Öffentlichkeit zu entfernen.
Man brachte sie in das Amtshaus von Ahlden in der Lüneburger Heide, ein tristes Fachwerkschloss an der Aller, einem Nebenfluss der Leine, das im Besitz ihres Vaters war. Hier wurden ihr sechs Räume im Nordflügel zugewiesen, hier sollte sie die nächsten 32 Jahre ihres unglücklichen Lebens verbringen. Es war zwar ein weitläufiges Gefängnis, aber eben doch ein Gefängnis, in dem ihr zunächst nur der Aufenthalt im Schlossinneren, nach zwei Jahren auch in den Außenanlagen gestattet war, ehe ihr schließlich erlaubt wurde, sich unter Aufsicht mit der Kutsche im Umkreis von zwei Kilometern zu bewegen.
Dafür, dass sie die Vorschriften einhielt, sorgten vierzig Wachleute, von denen bis zu zehn in ständigem Einsatz waren. Sie hatten beispielsweise auch das Recht, die Post der Prinzessin zu kontrollieren und zu zensieren und die wenigen, zumeist amtlichen Besucher zu überprüfen und gegebenenfalls abzuweisen. Auch ihr Hofstaat war angehalten, die Prinzessin rund um die Uhr zu beobachten und Bericht über sie zu erstatten: sie war also von Spitzeln umgeben.
In der Zwischenzeit wurde die Trennung und schließlich die Scheidung durch die herzoglichen Brüder Georg Wilhelm und Ernst August vorbereitet. Demzufolge fiel das Vermögen, das Sophie Dorothea in die Ehe eingebracht hatte, an den Kurfürsten, sie selbst erhielt eine Apanage von 8000 Talern, die nach und nach auf 18 000 Taler erhöht wurde. Ihre Kinder durfte sie nie wiedersehen, sie blieben am Hof von Hannover, eine Wiederverheiratung war ihr verboten – ihrem Ehemann blieb sie dagegen freigestellt. Wie lange sie in Ahlden bleiben musste, wurde nicht festgelegt. Es gab kein Gerichtsurteil, vielmehr stand die Entscheidung darüber im Ermessen ihrer Familie. Gerade deshalb hoffte sie zunächst, dass ihre Verbannung nur von kurzer Dauer sein würde.
Die Nachrichten über das Verschwinden Königsmarcks und auch die Gerüchte über seine Affäre mit der Kurprinzessin verbreiteten sich in großer Geschwindigkeit an den Höfen Europas. Schließlich waren die Beteiligten in der gesamten Aristokratie wohlbekannt und die Angelegenheit mehr als skandalös. Es mag der Grund gewesen sein, warum den herzoglichen Brüdern in Celle und Hannover so viel an einer einvernehmlichen Einigung und der Verbannung ihrer Tochter beziehungsweise Nichte und Schwiegertochter gelegen war:
»Beide beteiligten Fürsten glaubten, sich und ihre Länder nicht der Gefahr aussetzen zu dürfen, dass die Prinzessin – mit oder eigenes Zutun – mit den zahlreichen Gegnern des Hauses in Verbindung kam und zum Ziel oder zum Werkzeug ihrer Intrigen gemacht wurde«, vermutete der Historiker Georg Schnath.[15]