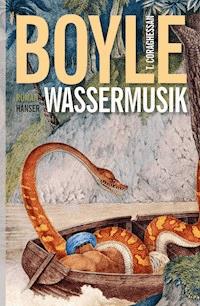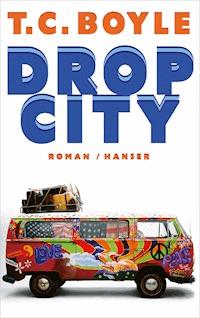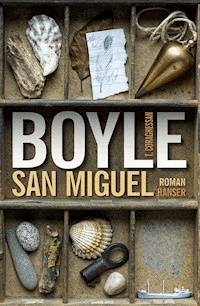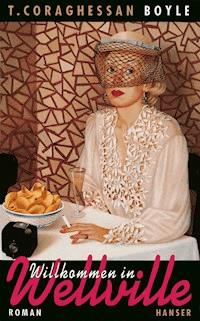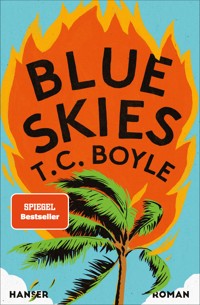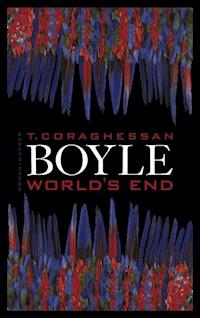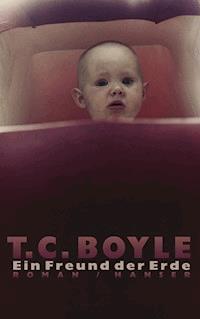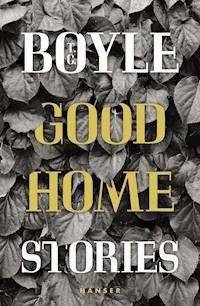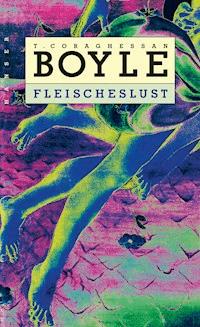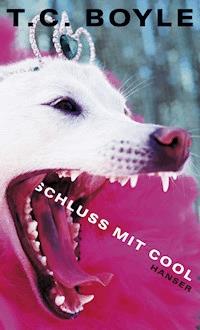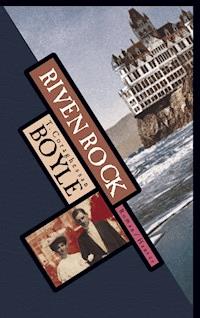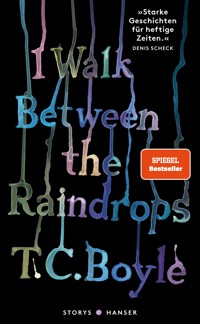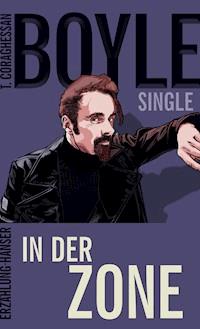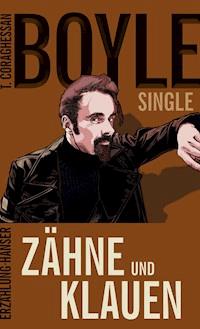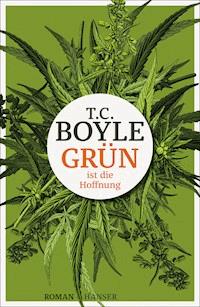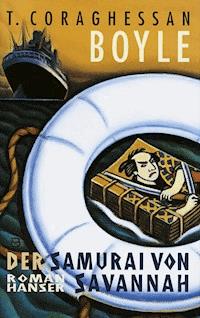Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einem geschlossenen Ökosystem unternehmen Wissenschaftler in den neunziger Jahren in den USA den Versuch, das Leben nachzubilden. Zwei Jahre lang darf keiner der acht Bewohner die Glaskuppel von „Ecosphere 2“ verlassen. Egal, was passiert. Touristen drängen sich um das Megaterrarium, Fernsehteams filmen, als sei es eine Reality-Show. Eitelkeit, Missgunst, Rivalität – auch in der schönen neuen Welt bleibt der Mensch schließlich doch, was er ist. Und es kommt, wie es kommen muss: Der smarte Ramsay verliebt sich in die hübsche Dawn – und sie wird schwanger. Kann sie das Kind austragen? T.C. Boyles prophetisches und irre komisches Buch, basierend auf einer wahren Geschichte, berührt die großen Fragen der Menschheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 919
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Zwei Jahre lang darf keiner der acht Bewohner die Glaskuppel von »Ecosphere 2« verlassen. Egal, was passiert. Touristen drängen sich um das Megaterrarium, Fernsehteams filmen, als wäre es eine Reality- Show. Eitelkeit, Missgunst, Rivalität – auch in der schönen neuen Welt bleibt der Mensch schließlich doch, was er ist. Und es kommt, wie es kommen muss: Der smarte Ramsay verliebt sich in die hübsche Dawn – und sie wird schwanger. Kann sie das Kind in der geschlossenen Sphäre austragen oder muss das Experiment abgebrochen werden? Der neue Roman von T. C. Boyle ist ein prophetisches und irre komisches Buch, das die großen Fragen der Menschheit berührt.
Hanser E-Book
T. CORAGHESSAN BOYLE
DIE TERRANAUTEN
Roman
Aus dem Englischen
von Dirk van Gunsteren
Carl Hanser Verlag
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel The Terranauts bei Ecco in New York.
Unter dem Titel »Die Terranauten« erschien zwischen 1979 und 1981 im Bastei Verlag eine deutschsprachige Science-Fiction Heftromanserie, von der einzelne Sammelausgaben in Buchform im Mohlberg Verlag erschienen sind.
2. Ebookversion 11/2020
ISBN 978-3-446-25559-3
© 2016 by T. Coraghessan Boyle
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Carl Hanser Verlag München 2017
Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München
© Ken Hermann/Getty Images
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Für Neal und Shray Friedman und
Roy und Edicta Corsell
Den Berichten der Teilnehmer am ersten Biosphäre-2-Versuch schulde ich besonderen Dank, insbesondere Abigail Allings und Mark Nelsons Life Under Glass und Jane Poynters The Human Experiment, des weiteren aber auch Rebecca Reiders Dreaming the Biosphere, das eine umfassende Darstellung des Projekts enthält, und John Allens Grundlagenwerk Biosphere 2: The Human Experiment.
Wir sollten nie daran zweifeln, dass eine kleine Gruppe umsichtiger, entschlossener Menschen die Welt verändern kann. Tatsächlich ist dies das Einzige, was die Welt je verändert hat.
Margaret Mead
L’enfer, c’est les autres.
Jean-Paul Sartre, Huis Clos
Inhalt
Vor dem Einschluss
Einschluss. Jahr eins
Einschluss. Jahr zwei
Wiedereintritt
VOR DEM EINSCHLUSS
DAWN CHAPMAN
Man hatte uns von Haustieren abgeraten, desgleichen von Ehemännern oder festen Freunden, und dasselbe galt natürlich für die Männer, von denen, soviel man wusste, keiner verheiratet war. Ich glaube, Mission Control hätte es begrüßt, wenn wir auch keine Eltern oder Geschwister gehabt hätten, aber die hatten wir nun mal, alle bis auf Ramsay, der ein Einzelkind war und in der vierten Klasse seine Eltern bei einem Frontalzusammenstoß verloren hatte. Ich fragte mich oft, ob das bei der Auswahl eine Rolle gespielt hatte – zu seinen Gunsten, meine ich –, denn es war offensichtlich, dass er in gewissen wichtigen Bereichen Defizite hatte, und für mich war er, auf dem Papier jedenfalls, das schwächste Mitglied der Crew. Aber das hatte ich nicht zu bestimmen – Mission Control verfolgte einen eigenen Plan, und wir konnten zwar Spekulationen anstellen, letztlich aber nur den Kopf beugen und auf das Beste hoffen. Natürlich hatten wir alle das Auswahlverfahren durchlaufen – in den letzten Monaten hatten wir, wie es schien, nichts anderes getan –, und obwohl wir ein Team waren, obwohl wir in den vergangenen zwei Jahren der Ausbildung alle am selben Strang gezogen hatten, blieb die Tatsache, dass es nur acht der sechzehn Kandidaten in die Auswahl schaffen würden. Das war die große Ironie: Wir atmeten zwar Teamgeist, aber selbst darin versuchten wir einander zu übertreffen, wobei alles, was wir dachten oder taten, von Mission Control genau registriert wurde. Wie hatte unser Chefzyniker Richard es ausgedrückt? Eine Miss-Amerika-Wahl ohne Miss und ohne Amerika.
An das genaue Datum kann ich mich nicht erinnern (dabei weiß ich, dass ich das sollte, schon damit alles stimmt), aber etwa einen Monat vor dem Einschluss wurden wir zum Abschlussgespräch bestellt. Ein Monat, ja, das kommt ungefähr hin: genug Zeit, um die Nachricht zu verbreiten und mit der Vorstellung des achtköpfigen Teams so viel Presseresonanz wie möglich zu erzeugen. Hätten sie es früher bekanntgegeben, wäre das öffentliche Interesse womöglich erlahmt, und wegen der Fehlschläge bei der ersten Mission war man bei Mission Control natürlich darauf bedacht, das zu vermeiden. Es muss also im Februar gewesen sein. Ein Februarmorgen auf dem Colorado-Plateau: Der Winterregen hat alles erblühen lassen, und das Licht überzieht die Berge wie mit einem sanften Film. Die Luft war bestimmt erfüllt von einem leisen, süßen Duft nach Salbei und Karamell, den ich auf dem Weg zu einem frühen Frühstück in der Cafeteria mit Genuss einatmete. Vielleicht blieb ich kurz stehen, um die Flip-Flops abzustreifen und den kühlen, körnigen Staub zwischen den Zehen zu spüren oder den geordneten Kolonnen der ausschwärmenden oder zum Bau zurückkehrenden Blattschneiderameisen zuzusehen; ich war sowohl in meinem Körper als auch außerhalb davon, eine Hominidin im fortpflanzungsfähigen Alter, die vornübergebeugt und in naturwissenschaftliche Trance versunken dastand und sich fragte, ob diese Erde, diese alte, ursprüngliche Erde, in einem Monat noch ihr Zuhause sein würde.
Tatsache war, dass ich um vier Uhr aufgewacht war und nicht mehr hatte einschlafen können, und jetzt wollte ich allein sein und meine Gedanken sortieren. Ich hatte eigentlich keinen Hunger – Aufregung schlägt mir auf den Magen –, zwang mich aber zu Pfannkuchen, Blaubeermuffins und Sauerteigtoast, als wollte ich mich vor einem Marathonlauf mit Kohlehydraten vollstopfen. Ich glaube, ich habe nichts davon wirklich geschmeckt. Und dazu Kaffee. Ich trank wahrscheinlich einen ganzen Becher, Schluck für Schluck, ohne es überhaupt zu merken, und das war eine Gewohnheit, die ich eigentlich ablegen wollte, denn wenn ich unter den Auserwählten war – und dessen war ich mir sicher, zumindest redete ich es mir ein –, würde ich ohne Koffein auskommen müssen. Ich hatte nicht wie sonst ein Buch mitgenommen. Auf der Theke lag zwar eine Tageszeitung, aber ich warf nicht mal einen Blick darauf. Ich aß, führte die Gabel zum Mund, kaute, schluckte und wiederholte das Ganze, mit kleinen Unterbrechungen, um die Pfannkuchen in mundgerechte Bissen zu schneiden oder einen Schluck Kaffee zu trinken. Die Cafeteria war ganz leer, bis auf ein paar Küchenhelfer, die mit leerem Blick aus den Fenstern starrten, als wären sie noch nicht imstande, sich diesem Tag zu stellen. Oder vielleicht gehörten sie auch zur Nachtschicht, vielleicht lag es daran.
Irgendwann lösten sich meine Gedanken endlich in nichts auf, und für einen Sekundenbruchteil vergaß ich, was über uns allen hing, doch dann hob ich den Kopf und sah Linda Ryu auf mich zukommen, in der einen Hand einen Becher Tee, in der anderen einen glasierten Donut. Sie wissen es vielleicht nicht – die meisten wissen es nicht –, aber Linda war meine beste Freundin in der erweiterten Crew; ich kann es eigentlich nicht erklären, aber wir verstanden uns vom ersten Tag an hervorragend. Wir waren ungefähr gleich alt – sie zweiunddreißig, ich neunundzwanzig –, aber das erklärt eigentlich gar nichts, denn alle weiblichen Kandidaten waren ungefähr im selben Alter, von der jüngsten (Sally McNally, sechsundzwanzig, die keine Chance hatte) bis hin zur ältesten (Gretchen Frost, vierzig, die erstklassige Chancen hatte, weil sie wusste, wie man sich bei Mission Control einschmeichelte, und außerdem über die Ökologie des Regenwaldes promoviert hatte).
Bevor ich reagieren konnte, setzte Linda sich mir gegenüber, fuchtelte mit dem Donut herum und schenkte mir ein Lächeln, das irgendwo zwischen Mitgefühl und Verlegenheit lag. »Nervös?«, sagte sie, lachte auf, bleckte die Zähne und schwenkte den Donut. »Wie ich sehe, schaufelst du dich mit Kohlehydraten voll. Ich auch«, sagte sie und nahm einen Bissen.
Ich versuchte, ein unverbindliches Gesicht zu machen, als wüsste ich gar nicht, wovon sie redete, aber sie durchschaute mich sofort. In den vergangenen zwei Jahren hatten wir gemeinsam auf dem Forschungsschiff in der Karibik, der Ranch im australischen Busch und den Versuchsfeldern auf dem E2-Gelände gearbeitet und waren wie Schwestern geworden, aber im Augenblick war mein Abschlussgespräch von 8:00 bis 8:30 das einzig Wichtige. Ich deutete ein Lächeln an. »Ich weiß gar nicht, warum wir nervös sein sollten – ich meine, die testen uns doch nun schon seit über einem Jahr. Und jetzt also noch ein Gespräch, na und?«
Sie nickte und wollte das Thema nicht weiterverfolgen. Es ging ein Gerücht um, wir alle hatten es gehört: Dies war das alles entscheidende Gespräch, Daumen rauf oder Daumen runter. Da gab es nichts zu beschönigen. Es war der Augenblick, auf den wir all die scheinbar endlosen Tage, Wochen, Monate gewartet hatten, und jetzt, da es so weit war, hatten wir nur noch Angst. Ich wollte ihre Hand nehmen, sie umarmen und beruhigen, aber wir hatten bereits alles gesagt, was es zu sagen gab, hatten tausendmal darüber spekuliert, wer würde dabei sein dürfen und wer nicht, und uns in den vergangenen Wochen ständig umarmt. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich spürte, dass mich eine Kälte überkam, der Beginn einer innerlichen Distanzierung. Am liebsten wäre ich aufgestanden und gegangen, aber hier saß meine beste Freundin, und in diesem Moment sah ich, wie selbstlos sie war, wie sehr sie mir den Erfolg wünschte – uns beiden eigentlich, vor allem aber mir, damit ich, sollte sie es nicht schaffen, triumphierte –, und ich merkte, dass in mir etwas nachgab.
Ich wusste besser als jeder andere, wie schwer es Linda treffen würde, nicht in die Crew aufgenommen zu werden. Oberflächlich betrachtet entsprach ihr Persönlichkeitsprofil genau den Anforderungen – sie war lebhaft, energisch, behielt auch in kritischen Lagen einen klaren Kopf und war eine Optimistin, die immer einen Ausweg sah, ganz gleich, wie hoffnungslos die Situation zu sein schien –, doch sie besaß auch eine dunkle Seite, von der niemand etwas ahnte. Sie hatte mir Dinge gestanden, die, hätte man bei Mission Control davon gewusst, wie eine Bombe eingeschlagen hätten. Nicht ausgewählt zu werden würde sie besonders hart treffen, härter als jeden anderen, doch dann fragte ich mich, ob ich mit solchen Überlegungen nicht meine eigenen Ängste auf sie projizierte: Wir alle wünschten uns so sehr, in die Crew aufgenommen zu werden, dass wir an gar nichts anderes mehr denken konnten. Und was die Sache noch verschlimmerte, war, dass Linda und ich im Grunde um dieselbe Position konkurrierten, und zwar für die am wenigsten technisch orientierte, abgesehen von der des Kommunikationsoffiziers, die Ramsay, da waren wir uns einig, praktisch schon in der Tasche hatte, denn er war politisch begabt und imstande, nicht nur beide Seiten, sondern auch die oberen, mittleren und unteren Etagen zu bearbeiten.
Ich musterte ihr Gesicht, ihr unaufhörliches Kauen. »Stevie ist so gut wie drin, oder?«, sagte sie mit belegter Stimme.
Ich nickte. »Sieht so aus.« Linda hatte alles gegeben, um sich als Generalistin der Gruppe unentbehrlich zu machen und sich für eine der vier Positionen zu empfehlen, die höchstwahrscheinlich mit einer Frau besetzt werden würden. Sie hatte sich nicht nur mit Gartenbau in geschlossenen Systemen und der Steuerung von Ökosystemen, sondern vor allem auch mit Meeresbiologie beschäftigt. Bei unseren Tauchgängen vor der Küste von Belize hatte sie mehr Stunden unter Wasser verbracht und mehr wirbellose Tiere gesammelt als irgendein anderer, und doch hatte ich den Eindruck, dass Stevie van Donk auf diesem Gebiet die Nase vorn hatte. Zum einen, weil sie Meeresbiologie studiert hatte, zum anderen, weil sie im Bikini einfach großartig aussah.
»Sie ist ein solches Aas.«
Dazu sagte ich nichts, auch wenn ich insgeheim ganz ihrer Meinung war. Aber Aas hin oder her: Stevie war drin.
Doch das war noch nicht alles: Diane Kesselring war wie geschaffen für den Posten der Nutzpflanzensupervisorin, und als Aufsicht für die Wildbiotope kam in erster Linie Gretchen in Frage. Wenn man die Zuständigkeitsbereiche Gesundheit, Analytische Systeme und Technosphäre – zu diesem Zeitpunkt männliche Domänen – ausschloss, blieb eigentlich nur eine Art Hausmeisterposten übrig: als Nutztierwärterin, zuständig für die Zwergziegen, Ossabaw-Schweine, Moschusenten und Hühner, die die Crew mit wichtigen tierischen Fetten und Proteinen versorgen sollten.
»Was ist denn los, Dawn?« Linda beugte sich über den Tisch und nahm meine Hand, doch ich gab keine Antwort. Ich konnte nicht. Ich war fix und fertig. »Du wirst mir doch nicht zusammenbrechen, oder? Nach allem, was wir durchgestanden haben? Du wirst es schaffen. Das weiß ich. Wenn irgendjemand es schafft, dann du.«
»Aber was ist mit dir? Ich meine, wenn sie mich auswählen …«
Ihr Lächeln war das traurigste, das ich je gesehen hatte, nicht mehr als ein kleines Zucken der Lippen. »Wir werden sehen.« Sie wandte den Blick ab. Der Saal war leer, die Leute an dem anderen, weit entfernten Tisch waren, je nachdem, zu welcher Schicht sie gehörten, entweder an die Arbeit oder nach Hause und zu Bett gegangen. Mein Magen fühlte sich an, als wäre er aufgepumpt. Ich spürte die Ader an meinem Haaransatz pochen, wie immer, wenn ich völlig erschöpft war. Lindas Eltern hatten außerhalb von Sacramento gelebt und Pferde, Hühner und vietnamesische Hängebauchschweine gehalten, und sie kannte sich mit Haustieren so gut aus wie ein Tierarzt – aber sie war eben keine Tierärztin, sondern hatte bloß einen Bachelorabschluss in Nutztierwissenschaften; außerdem war sie, wenn ich das sagen darf, etwas fülliger als das gängige Schönheitsideal und, objektiv betrachtet, nicht besonders hübsch. Nicht dass das eine Rolle hätte spielen sollen, aber es spielte natürlich eine Rolle. Mission Control wollte dasselbe wie die NASA: Leute, die dem Bild des »Abenteurers« entsprachen, mit hoher Motivation und hoher sozialer Kompetenz und ohne Neigung zu Depressionen. Aber das traf auf alle zu, die es bis hierhin geschafft hatten (in den »Sechzehner«, wie Richard es nannte, eine sportliche Anspielung, die mir erst jemand erklären musste, damit ich sie verstand). Ich hätte mir etwas vorgelogen, wenn ich geleugnet hätte, dass ihnen, abgesehen von den Faktoren, die sie in einer Vielzahl von Tests ermittelten – vom Minnesota Multiphasic Personality Inventory bis hin zu Situationen, in denen wir unter Druck als Team agieren mussten –, vor allem an Kandidaten gelegen war, die gut aussahen, die attraktiv waren, attraktiver jedenfalls als Linda.
Hätte ich das jetzt nicht sagen sollen? Ich weiß nicht, aber manchmal muss man einfach objektiv sein, und wenn ich vor dem Spiegel stand, sah ich – auch ohne Make-up – eine Frau, die unsere Mission für die Öffentlichkeit besser repräsentieren würde als Linda. Jetzt ist es heraus. Tut mir leid. Aber es ist eine Tatsache.
»Ja«, sagte ich. »Ja. Ja. Ich bete dafür, dass du dabei bist, wirklich – ich bete für dich genauso wie für mich. Sogar mehr als für mich. Stell dir bloß mal vor: Wir beide da drinnen. Die zwei Musketiere, hm?« Ich versuchte zu lächeln, konnte aber nicht. Meine Augen füllten sich mit Tränen. Die Sache war nur (und ich schäme mich, es zuzugeben): Meine Tränen galten nicht nur ihr.
Linda legte den Donut hin und leckte ganz langsam ihre Fingerspitzen ab. Dann hob sie den Kopf, und ich sah, dass auch ihre Augen feucht waren. »Na, komm«, sagte sie und warf das Haar mit einem Kopfrucken aus dem Gesicht, »mach dir keine Sorgen. Was auch geschieht, es gibt ja immer noch Mission 3.«
****
Bei der Arbeit trugen wir, Männer wie Frauen, mehr oder weniger das Gleiche: Jeans, T-Shirt und Wanderstiefel, vielleicht noch ein Kapuzenshirt in den kühlen Morgenstunden oder im Winter, der hier erstaunlich kalt sein konnte, doch an diesem Tag hatte ich mich für ein Kleid entschieden. Nichts Extravagantes, bloß ein blassgrünes Futteralkleid, das ich ein-, zweimal getragen hatte, als ich mit ein paar anderen in Tucson durch die Bars gezogen war, und ich hatte etwas Make-up aufgelegt und das Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Mein Haar ist einer meiner Pluspunkte, so dicht, dass man die Kopfhaut nicht sehen kann, auch nicht, wenn es vom Duschen tropfnass ist, und es hat jede Menge Volumen, trotz der niedrigen Luftfeuchtigkeit. Stevie ist blond und hat einen Mittelscheitel ohne Pony, als wollte sie für eine Rolle in einem Surferfilm vorsprechen, aber ihr Haar ist viel dünner als meins und hängt schlaff herunter, es sei denn, sie dreht es mit Lockenwicklern auf, und wer wird nach dem Einschluss noch Zeit für so was haben? Aber wie gesagt: Sie war drin und Linda nicht – das war jedenfalls meine Vermutung –, und das hatte nichts damit zu tun, dass Linda asiatischer Abstammung war, sondern damit, wie sie in einem Bikini aussah. Und mit Stevies Abschluss in Meeresbiologie natürlich. Es wäre vielleicht taktlos gewesen, es auszusprechen, aber Stevie hatte Linda in beiden Punkten einiges voraus, und wenn ich dabei sein durfte, dann nicht auf Kosten von Stevie, Gretchen oder Diane, die viel qualifizierter waren als ich, sondern auf Kosten von Linda. Ich hatte meinen Abschluss in Umweltwissenschaften gemacht, was ungefähr so viel wert war wie Lindas Bachelor in Nutztierwissenschaften – in diesem Punkt lagen wir also gleichauf. Was die anderen drei Frauen in der erweiterten Crew betraf, so waren sie, nach unserer Meinung jedenfalls, gar nicht mehr im Rennen.
Acht war die magische Zahl. Acht Teilnehmer. Vier Männer, vier Frauen. Man hat uns mangelnde Diversität vorgeworfen, aber: Nur zwölf Astronauten waren auf dem Mond, und es waren allesamt Männer. Wenn man die Teilnehmer der ersten und der zweiten Mission zusammenzählte, kam man auf sechzehn, und die Hälfte davon würden Frauen sein. Darunter, wie ich hoffte, auch ich.
Als ich zu Ende gegessen, Linda umarmt und ihr meine guten Wünsche ins Ohr geflüstert hatte, war ich schon etwas spät dran, und das vergrößerte meine Nervosität um das kleine bisschen, auf das ich gut verzichten konnte. Ich eilte über den Hof, wich einem verirrten Touristen aus, stürzte in mein Apartment und zog mich aus, um eine Zwei-Minuten-Dusche zu nehmen (eine Disziplin, in der ich mittlerweile Meisterin war, denn schließlich trainierte ich für die Mission, bei der nur 280 Liter pro Person und Tag verbraucht werden durften). Ich hatte mir am Vorabend das Haar gewaschen und das Kleid, ein Paar flache Schuhe und die Korallenkette herausgelegt, und so brauchte ich nicht lange. Lippenstift, Lidschatten und ein bisschen Highlighter, und schon war ich wieder zur Tür hinaus.
Es lag derselbe zarte, süße Duft in der Luft, den ich schon zuvor bemerkt hatte, jetzt allerdings war er unterlegt mit einem leisen Geruch nach den Dieselabgasen der beiden Bulldozer, die Erde an der Stelle aushoben, wo ein Gästehaus für die Würdenträger, Wissenschaftler und Freunde des Projekts gebaut wurde, für Leute also, die bereit waren, durch finanzielle Zuwendungen in drei Größenordnungen – Gold, Silber und Bronze – zum Gelingen beizutragen. Auf dem Weg zu Mission Control begegnete ich niemandem, den ich kannte, was mir angesichts meiner seelischen Verfassung ganz recht war. Touristen standen, ausgerüstet mit Fotoapparaten, Ferngläsern und Tagesrucksäcken, grüppchenweise herum, aber keiner würdigte mich eines Blicks – warum auch? Ich war ein Niemand. Aber wenn es so lief, wie ich es mir vorstellte, würden sie morgen Schlange stehen, um ein Autogramm von mir zu bekommen.
Ich nahm die Treppe in den zweiten Stock und kam dabei ein bisschen ins Schwitzen, aber das machte nichts – die Anstrengung beruhigte mich. Es war ganz einfach: Fuß, Knöchel, Knie, Hüfte, einatmen, ausatmen. Ich hatte auf den Versuchsfeldern und in den Intensivkulturbiomen gearbeitet und bei jeder Gelegenheit ausgedehnte Wüstenwanderungen gemacht, und darum war ich ganz gut in Form, auch wenn ich nicht joggen ging oder mit Gewichten trainierte wie viele andere. Ich fand, das sei nicht nötig. Die Crewmitglieder von Mission 1 hatten rapide an Gewicht verloren, die Männer um achtzehn, die Frauen um zehn Prozent, und es war wahrscheinlich ganz gesund, vor dem Einschluss noch ein paar Pfunde zuzulegen. Linda und ich hatten das immer wieder besprochen. Es kam darauf an, diese Extrapfunde an den richtigen Stellen zu deponieren, denn Mission Control hatte uns im Auge und wollte der Öffentlichkeit auf keinen Fall einen Haufen dicklicher Terranauten präsentieren.
Josie Muller, die Sekretärin, winkte mich lächelnd herein, und ich versuchte, das Lächeln zu erwidern, als wäre alles wie immer, als wäre das, was gleich im Kontrollzentrum mit den stumpfweißen Gipskartonwänden, dem haferbreifarbenen Teppichboden und dem panoptischen Ausblick auf E2 passieren würde, das Normalste von der Welt. »Setz dich doch«, sagte sie. »Es dauert noch kurz.« Wir sahen beide zu der glänzenden Eichentür, die zum Allerheiligsten führte.
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich würde warten müssen, sondern angenommen, mein Termin um acht sei der erste des Tages, und darum war ich pünktlich auf die Minute, denn ich wollte einfach reingehen und die Spannung aus mir herausfließen lassen wie Wasser, das in einen Abfluss rinnt. »Ist da drinnen jemand?«
Sie nickte.
»Die haben um halb acht angefangen? Ich wusste nicht, dass es so früh losgeht.«
»Na ja, ihr seid schließlich sechzehn Kandidaten, und sie wollen mit jedem mindestens eine halbe Stunde reden, um … alles zu besprechen. Die Sache abzuschließen.«
»Nur so aus Neugier: Wer ist denn gerade dran?«
Am Anfang, ein oder zwei Wochen nachdem ich als Kandidatin für das Projekt ausgesucht worden war, hatten Josie und ich uns im El Caballero in Tillman einen Krug Mango-Margaritas geteilt, und von da an hatte ich immer das Gefühl gehabt, dass sie auf meiner Seite war. Oder mir wenigstens die Daumen drückte. Mehr als einigen anderen jedenfalls. Sie war Ende vierzig, ihr Haar war bereits grau, und sie trug eine Schildpattbrille, die ihre Augen klein wirken ließ und deren Bügel gegen die Schläfen drückten. Sie beugte sich vor und flüsterte: »Stevie.«
Stevie. Das war in Ordnung. Stevie war dabei, das hatte ich bereits akzeptiert. Wenigstens nicht Tricia Berner, eine der drei Frauen, die nach Lindas und meiner Meinung keine Chance hatten, obwohl ich, wenn ich nachts wach lag und an die Decke starrte, bis die Dunkelheit sich ausbreitete, zugeben musste, dass sie eben doch eine Chance hatte. Sie war nicht nur auf ihre Weise attraktiv, sofern man sich mit ihrem Stil anfreunden konnte, der ziemlich gewöhnlich war – kurze Röcke, zu viel Make-up, wuchernder Schmuck –, sondern auch mit Abstand die beste Schauspielerin von uns allen. Und das wog schwerer, als man hätte meinen sollen, denn von Anfang an, schon während der Bauphase, bei Mission 1 und auch in unserem Training, war es bei diesem Projekt ebenso sehr um Theater wie um Wissenschaft gegangen. Für die bevorstehende Mission 2 und den Entschluss, den wir alle gefasst hatten, galt das umso mehr. Aber davon später. Ich will nur sagen, dass sich mein Magen beim Anblick der geschlossenen Tür, ganz gleich, wer dahinter war, so zusammenkrampfte, dass ich die Frühstückspfannkuchen ein zweites Mal schmeckte.
Es war zehn nach acht, und ich hatte mich ein halbes Dutzend Mal in den Sessel in der Ecke gesetzt und war wieder aufgestanden, um die gerahmten Fotos der Mission-1-Crew an den Wänden zu studieren, bis ich sie aus dem Gedächtnis hätte nachzeichnen können, als die Tür aufschwang und Stevie erschien. Sie trug tatsächlich Pumps und sah mich mit einem leeren Blick an, als würde sie mich gar nicht kennen, als hätten wir nicht gemeinsam Leinen eingeholt, bei zweiundvierzig Grad im Schatten Mist geschaufelt oder unzählige Male Seite an Seite an irgendeinem Tisch gehockt und gegessen. Sie hatte sich Strähnchen gemacht und so viel Make-up aufgelegt, dass auch die auf den billigen Plätzen etwas davon hatten, aber es war nicht zu erkennen, ob sie gerade in einer Komödie oder einer Tragödie spielte. Die mussten sie doch ausgewählt haben, oder? Für den Bruchteil einer Sekunde jubelte ich innerlich und sah Linda ihren Platz einnehmen – wir beide zusammen, verschworene Schwestern, ein Bollwerk gegen den Machtanspruch von Mission Control einerseits und die Tyrannei der Mehrheit andererseits –, aber dann fiel mein Blick auf ihre Augen: Sie waren von einem harten, kalten Blau, so dunkel, dass sie beinahe schwarz wirkten, und voller Triumph. Sie verzog den Mund zu einem Lächeln, sodass ich ihre makellosen Zähne und das feste, rosige Zahnfleisch bewundern konnte, und zeigte mir den erhobenen Daumen. Ich verstand. Wir hätten uns umarmen können – nein, wir hätten uns umarmen sollen, denn schließlich waren wir doch wie Schwestern, und die Mission ging uns über alles –, doch etwas in mir verhärtete sich, und der Augenblick war vorüber, und dann war sie an mir vorbei, grinste so breit wie nur was und plapperte auf Josie ein, und die plapperte zurück.
Die Tür stand offen. Ich brauchte nicht mal zu klopfen.
Drinnen saßen vier Personen, zwei auf dem Sofa, die anderen beiden in ergonomisch gestalteten Bürosesseln. Mit drei von ihnen hatte ich gerechnet, die vierte aber war eine totale Überraschung. Oder vielmehr, um ehrlich zu sein, ein Schock. Mein erster Gedanke war: Die überlassen aber auch wirklich nichts dem Zufall. Und dann: Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
Aber lassen Sie mich erklären. Die beiden auf dem Sofa gehörten praktisch zum Inventar: Jeremiah Reed und Judy Forester – der Visionär, der das Projekt erdacht und ins Leben gerufen hatte, und seine rechte Hand und Vertraute. Unter uns nannten wir Jeremiah »Gottvater« und Judy, um bei der religiösen Metaphorik zu bleiben, »Judas«, denn sie war eine Verräterin oder hatte jedenfalls das Potential dazu. Das war der allgemeine Eindruck, so war sie nun mal gestrickt: immer eine Haaresbreite davon entfernt, einen in die Pfanne zu hauen, ein Mensch, der bei der Stasi eine steile Karriere hingelegt hätte. Aber 1994 gab es keine Stasi mehr, und so war sie eben hier, bei uns. Linda und ich hatten sie in letzter Zeit nur noch »das E2-Orakel« genannt, weil einige ihrer Anweisungen hochgradig rätselhaft waren. Sie war nicht viel älter als ich, aber Jeremiahs – Gottvaters – rechte Hand, und das verlieh ihr eine Macht über uns, die in keinem Verhältnis zu dem stand, wer sie tatsächlich war. Oder gewesen wäre, wenn sie nicht mit unserem Gott geschlafen hätte. Ob ich ihr in den Hintern kroch, auch wenn ich mich dafür hasste? Aber natürlich. Und ich war nicht die Einzige.
Das dritte Element der Heiligen Dreifaltigkeit war ein frisch gesalbter Neuling, den man hinzugezogen hatte, damit er im Tagesgeschäft für Kostendämpfung und Effizienz sorgte. Er hieß Dennis Roper, trug das Haar stufig geschnitten und hatte Koteletten, als wäre es 1982. Wir nannten ihn »Jesulein«. Etwa einen Monat nach seiner Einsetzung hatte er Linda angebaggert, was in meinen Augen nicht nur unprofessionell, sondern, angesichts der Macht, die er besaß, auch ausgesprochen mies war. Linda hatte ein paarmal mit ihm geschlafen, obwohl das, wie wir beide wussten, ein Fehler war, ganz gleich, ob damit eine Gegenleistung verbunden sein würde – ja eigentlich sogar besonders dann –, und kaum hatte er genug von ihr gehabt, da hatte er sich an mich herangemacht. Aber ich hatte ihn auf Granit beißen lassen, denn so tief wollte ich nicht sinken, nicht mal, wenn er halbwegs gut ausgesehen hätte, was aber nicht der Fall war. Mit kleinen Männern konnte ich noch nie viel anfangen, und außerdem – ganz gleich, ob groß oder klein – finde ich es gut, wenn sie Persönlichkeit haben.
Ich stand also mitten im Raum, die Tür hinter mir war weit offen, weil ich in meiner Aufregung vergessen hatte, sie zu schließen, und die vier (zu dem Vierten komme ich gleich) sahen mich seelenruhig an, als hätten sie den ganzen Tag Zeit, um zu tun, was sie eben zu tun hatten, und dabei waren sie nach meiner Rechnung schon um zehn Minuten in Verzug. »Hallo«, sagte ich, nickte ihnen nacheinander zu und zeigte auf den Stuhl, der vor ihnen stand, »soll ich mich dahin setzen?«
»Hallo, Dawn«, sagte Judy und bedachte mich mit einem breiten Lächeln, das alles Mögliche bedeuten konnte. Die anderen lächelten ebenfalls: alles so freundlich und alltäglich wie nur was, weit und breit kein Druck, einer für alle und alle für einen.
Keiner hatte auf meine Frage geantwortet, und so setzte ich mich unaufgefordert auf den Stuhl – war das schon eine Art Test? – und sah sie an, als wollte ich sagen: Ich bin kein bisschen eingeschüchtert, denn ich bin hundertprozentig sicher, dass ich für die Crew so unerlässlich bin, wie man es nur sein kann.
»Keine Sorge, es dauert nicht lange«, sagte Dennis, ging auf Zehenspitzen zur Tür, schloss sie geräuschlos und setzte sich wieder auf seinen Bürosessel. Er atmete tief ein und aus, und dann beugte er sich vor, stützte die Ellbogen auf die Knie und sah mich unverwandt an. »Ich weiß, es ist ein großer Tag für die Kandidaten, und wir alle freuen uns darauf, die Vorbereitungen abzuschließen und alles bereit zu machen für den Einschluss. Wir haben nur noch ein paar kleine Fragen nach bestimmten Details, damit alles unter Dach und Fach ist – ist das in Ordnung?«
Die vierte Person im Raum hatte bisher weder ein Wort gesagt noch das Gesicht verzogen oder sich im Sessel zurechtgesetzt, um die Spannung in Hintern und Hüften zu lösen. Es war Darren Iverson, der Millionär oder vielmehr Milliardär, der das Projekt von Anfang an mit etwa hundertfünfzig Millionen Dollar finanziert hatte und auch für die laufenden Kosten aufkommen würde, die ungefähr bei zehn Millionen Dollar pro Jahr lagen, davon eine Million allein für Energie. Er war ein paar Jahre jünger als Jeremiah, also etwa Mitte fünfzig, und wirkte eigentlich nicht wie ein Milliardär – oder so, wie man sich einen Milliardär vorstellt. Er trug sandbraune, farblich aufeinander abgestimmte Hemden und Hosen, die aussahen, als hätte er sie bei Sears gekauft, und Arbeitsstiefel mit Profilsohle, ebenfalls braun. Auch seine Augen und die paar Haare, die er noch hatte, waren braun. In seiner Gegenwart nannten wir ihn Mr Iverson. Wenn er nicht da war, hieß er »Gott Mammon«.
Ich sah ihn, GV, Judy und dann wieder Dennis an. »Ich komme mir vor wie bei Star Trek oder so«, sagte ich, aber niemand lachte. Star Trek war einer unserer Lieblingsfilme, ebenso wie Lautlos im Weltraum, aus offensichtlichen Gründen. »Ihr wisst schon: ›… um neue Welten zu erforschen, neues Leben …‹« Noch immer keine Reaktion. Ich war aufgeregt, mir war eigentlich sogar ein bisschen schwummrig von der Anspannung und der Tatsache, dass mein Verdauungssystem damit beschäftigt war, das Frühstück zu verarbeiten, und ich fügte, ob es nun unpassend war oder nicht, hinzu: »… neue Zivilisationen.«
Dennis richtete sich auf. »Gut, aber wir würden jetzt gern über ein paar Dinge sprechen, die bisher außen vor geblieben sind« – und jetzt klang es wie eine Frage –, »nämlich über deine persönlichen Lebensumstände?«
Ich war völlig überrascht, ließ mir aber nichts anmerken. Eigentlich hatte ich angenommen, dass sie mich zu Nährwerten, geschätzten Ernteerträgen, Milchproduktion, Mindesteiweißbedarf und so weiter befragen würden, zu den technischen Aspekten der Aufgaben, die ich würde übernehmen müssen, und das hier traf mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ich konnte nur nicken.
»Hast du einen Freund?«
»Nein«, sagte ich ein bisschen zu schnell, denn das war gelogen. Wider besseres Wissen hatte ich mich zu einer Beziehung hinreißen lassen – oder nein, ich hatte mich hineingestürzt, kopfüber und ohne Fallschirm –, und zwar mit Johnny Boudreau, der beim Bau von E2 einer der Vorarbeiter gewesen war und an den Wochenenden als Gitarrist und Sänger in einer Bar auftrat.
Dennis – Jesulein! – drehte einen Notizzettel in seiner Hand um und las mit übertrieben zusammengekniffenen Augen, was dort stand. »Und was ist mit John Boudreau?«
Ich wollte sagen: Spioniert ihr mir etwa nach?, beherrschte mich aber. Ich konnte mich mit einem Mal gar nicht erinnern, wie Johnny aussah, vor meinem geistigen Auge war kein Bild von ihm, und mir wurde bewusst, dass wir, wenn es mir mit ihm wirklich ernst war, einen Monat Zeit hatten, uns mit den Tatsachen zu arrangieren, und dann kam der Einschluss. 730 Tage. Ich zuckte die Schultern.
In die bleierne Stille hinein sagte Judy: »Du benutzt Verhütungsmittel, oder?«
Ich nickte.
»Und – entschuldige, aber du verstehst sicher, wie wichtig das ist – hast du in den vergangenen Monaten verschiedene Partner gehabt, ich meine, war da irgendwas, das den Erfolg der Mission … irgendwie …?« Sie sah Dennis an.
»E.«, sagte er und sprach mich mit meinem Crewnamen an – E. war die Abkürzung für Eos, die rosenfingrige Göttin der Morgenröte, und ich fasste das als Kompliment auf, auch wenn es über Bande gespielt war –, »was wir meinen, ist, dass nach dem Einschluss auf keinen Fall irgendwelche Infektionen auftreten dürfen, und –«
»Du meinst Geschlechtskrankheiten?« Ich war nicht wütend, noch nicht. Sie wollten nur das Beste für die Mission, und das Beste für die Mission war auch das Beste für mich. »Keine Sorge«, sagte ich und sah Dennis bedeutsam an, »ich war nur mit Johnny zusammen. Ausschließlich.«
Judy: »Und er ist, äh …«
»Gesund? Soviel ich weiß, ja.«
Dennis: »Er spielt in einer Band, nicht?«
»Also bitte«, sagte ich und warf einen Blick an den beiden vorbei zum Sofa, wo Gottvater wie eine Sphinx thronte, und dann zu dem braunen Loch namens Gott Mammon, »ich weiß nicht, was das eigentlich soll. Der Missionsarzt, und das wird ja wohl Richard sein« – nichts, nicht der Hauch einer Reaktion –, »wird jedes Crewmitglied gründlich untersuchen, und sollte ich – oder einer der Männer – tatsächlich Gonorrhöe, Syphilis und Chlamydien haben, wird er uns eben behandeln, oder?«
Schweigen. Von fern, wie aus einem defekten Lautsprechersystem, hörte man das gedämpfte Rumpeln der Bulldozer. GV – schlank und blass wie eine Wolke mit seinen in alle Richtungen abstehenden Haaren und dem weißen Vollbart – streckte die Beine und ergriff zum ersten Mal das Wort. Seine Stimme war wie ein erlesenes Tenorinstrument und zu jeder Nuance und Schattierung imstande – in jüngeren Jahren, lange vor dem Projekt, war er in Broadway-Produktionen wie Hair und Der Mann von La Mancha aufgetreten. »Eigentlich geht es um Empfängnisverhütung«, sagte er. »Das verstehst du doch sicher: Wir können nicht riskieren, dass ein weibliches Crewmitglied etwas, äh … ausbrütet. Um es mal unverblümt auszudrücken.«
Es war keine Frage, und ich gab keine Antwort. »Wenn es euch beruhigt, mache ich einen Schwangerschaftstest«, sagte ich. »Kein Problem, das kann ich euch versichern.«
»Ja«, sagte er, verschränkte die Finger, stützte das Kinn darauf und sah mich unverwandt an, »aber was ist nach dem Einschluss?«
Und da – ich konnte nicht anders – grinste ich sie nacheinander an und sagte so nett wie möglich: »Das müsst ihr die Männer fragen.«
****
Vorhin habe ich mal das Wort »Marathonlauf« benutzt, eigentlich mehr als Metapher, denn ich bin, wie gesagt, keine Läuferin – warum Energie für etwas derart Unproduktives verschwenden? –, aber als ich diesen Raum verließ, wusste ich zum ersten Mal in meinem Leben, wie es sich anfühlt, ins Ziel einzulaufen. Und zwar nicht als eine unter vielen, sondern als Siegerin. Als die Siegerin. Ich war drin. Sie mochten mich, ihnen gefielen meine Entschlossenheit, meine Bereitschaft, hart zu arbeiten, und die vielen Pluspunkte auf meinem Bewertungsblatt, die meine Minuspunkte (die sie vor lauter Gratulationen aufzuzählen vergaßen) bei weitem überwogen. Alle grinsten, sogar Dennis. GV, der gern die NASA als Vergleich heranzog, sprang fuchtelnd von seinem Stuhl auf, schüttelte mir die Hand und versicherte mir, ich hätte das Zeug zu einer Heldin der Nation, das habe er immer schon gewusst. Judy umarmte mich. Und auch GM, der die ganze Zeit wie ein Katatoniker dagesessen hatte, erhob sich und trat zu mir, um mich mit einem minimalistischen Händedruck, bei dem er mich nur mit zwei Fingern berührte, zu beglückwünschen.
Darüber hinaus erinnere ich mich an wenig, aber bestimmt war mein Gesicht gerötet, und die Ader an meiner Stirn pulsierte. Ich war so dankbar – und erleichtert –, dass ich sie allesamt hätte küssen können, aber das tat ich natürlich nicht. Glaube ich jedenfalls. Später sagte Dennis, ich sei unter Verbeugungen zur Tür gegangen und habe ihnen von dort ausladend zugewinkt wie eine Schauspielerin, bevor sie nach dem Schlussapplaus in den Kulissen verschwindet, aber auch daran kann ich mich nicht erinnern. Es war jedenfalls ein berauschender Augenblick, auch wenn ich nicht mit Sicherheit sagen kann, was wirklich passiert ist und was nicht. Aber es spielte auch keine Rolle. Nicht mehr.
Unglücklicherweise – und hier muss man das Feingefühl der Terminplanung bewundern – war Linda die erste Person, die ich sah, als ich aus der Tür trat. Sie saß in dem Sessel, in dem vorhin ich gesessen hatte, und blätterte in ihren Notizen über geschlossene Systeme, Gruppendynamik und Technik, über Vernadsky, Brion und Mumford, auch wenn das jetzt keinen Sinn mehr hatte. Mir fiel auf, dass sie jetzt ein Kleid trug – ein bronzefarbenes Viskosefähnchen, das an ihr leider nur billig wirkte – und das sonst so unordentliche Haar aufgesteckt hatte. Was fühlte ich? Soll ich ganz ehrlich sein? Ich war natürlich traurig, aber in diesem Augenblick war das nicht mehr als eine kleine Turbulenz, das Absprengen und Zurückbleiben der ersten Raketenstufe, während die Raumkapsel weiter und weiter raste.
Sie bemerkte mich nicht. Hob nicht mal den Kopf. Ich sah, dass ihre Lippen sich bewegten und lautlos Sätze formulierten, die wir wie Beschwörungen gemeinsam gesprochen hatten – Gedanken sind keine Form von Energie. Wie also können sie physikalische Prozesse beeinflussen? –, als würde das die Leute in dem Raum interessieren. Sie hatten sich nach meinem Liebesleben erkundigt. Sie hatten Fragen gestellt wie: »Wie sind deine Gefühle gegenüber Ramsay? Gegenüber Gretchen und Stevie? Glaubst du, du kannst mit ihnen zusammenarbeiten?« Und was hatte ich geantwortet? Aber natürlich, hatte ich gesagt. Na klar. Es sind die nettesten Leute der Welt. Ich freue mich auf diese Aufgabe. Wir ziehen das durch, wir schaffen das, alles. Es wird toll!
Ich spürte, dass Josie mich ansah, aber ich wandte mich nicht zu ihr, noch nicht. Ich glitt wie auf einem Transportband durch den Raum, und dann stand ich vor Linda und sagte ihren Namen, nur einmal und ganz leise, und sie blickte auf. Mehr war nicht nötig. Ich brauchte kein Wort zu sagen. Die Erkenntnis flirrte wie eine kleine Welle über ihr Gesicht, doch dann schob sie alles beiseite und hob mit einer mühsamen Geste die Arme, um mich zu beglückwünschen. »Dawn«, murmelte sie, »Dawn, ach, Dawn, ich freue mich so, ich –«
Es war eine ungelenke Umarmung. Ich stand vor ihr, und sie saß im Sessel, das Notizbuch auf dem Schoß, die Füße nebeneinander auf dem Teppich. Ich spürte die Muskeln in meinem Kreuz. Sie hielt mich fest – es war beinahe, als wäre es ein Ringkampf, als wollte sie mich niederzwingen. Ich brachte kein Wort heraus – alles, was ich hätte sagen können, hätte irgendwie triumphierend geklungen, und ich wollte nicht triumphieren, nicht auf ihre Kosten.
»Dawn«, sagte sie, »Dawn«, und zog meinen Namen in die Länge, bis er wie ein Klagelaut klang, und dann trat Josie zu uns, und Judy erschien in der Tür. Ich ließ los, und Linda sank in den Sessel zurück.
»Gratuliere.« Nur ich sah, dass Josies Lippen sich bewegten. Sie war wirklich eine Expertin für lautlose Mitteilungen. Judy sagte: »Linda? Komm rein – wir warten schon auf dich.«
****
Ich blieb eine halbe Stunde, saß im Sessel und plauderte mit Josie. Ein Gedanke nach dem anderen schoss mir durch den Kopf: Ich dachte an die Einschlusszeremonie und die Anproben für die Overalls und fragte mich, ob wir unser Zimmer wohl selbst würden aussuchen dürfen (sofern Josie es wusste, ließ sie nichts durchblicken). Um Punkt neun Uhr erschien Ramsay in T-Shirt und Jeans, auf dem Kopf eine Baseballmütze mit nach hinten gedrehtem Schirm, und rieb mit der rechten Hand über einen dunklen Bartschatten. Ich hatte ihn ein paar Tage nicht gesehen, weil unsere Trainingsstunden sich nicht überschnitten hatten, und dieser Anflug eines Bartes überraschte mich. Ich nahm an, dass er in der Crew war, und Dennis’ Frage hatte das mehr oder weniger bestätigt – er hatte, sehr deutlich, wie ich fand, nicht nach meinem Verhältnis zu jenen anderen Männern und Frauen gefragt, die für Linda und mich zur zweiten Riege gehörten, sondern nur nach denen, die wir als Favoriten eingestuft hatten –, und wenn das stimmte, würde Ramsay sich rasieren müssen, bevor wir der Presse präsentiert wurden, oder Mission Control würde ein ernstes Wort mit ihm reden. Aber darüber hinaus verrieten seine Kleidung und seine ganze Haltung – wie er hereinschlurfte, Josie und mich angrinste und sich auf die Kante des Schreibtischs setzte, als gehörte dieser ihm – ein Selbstvertrauen, das an Arroganz grenzte. Oder auf Insiderwissen beruhte. Ja, vielleicht war das der Grund. Er hatte sich von Anfang an hervorragend mit GV und Judy verstanden, alles im Rahmen einer guten Zusammenarbeit natürlich, und mir wurde bewusst, wie naiv es gewesen war zu denken, es gebe hier keine Hackordnung.
»Hallo, Mädels«, sagte er, »was läuft? Fühlt ihr euch auch, als könntet ihr Bäume ausreißen? Aber halt, halt, halt! E., ich will der Erste« – er warf einen Blick zu Josie – »oder vielmehr der Zweite sein, der dir gratuliert. Gut gemacht! Einer für alle und alle für einen, stimmt’s?«
Ich starrte ihn verblüfft an. »Woher weißt du das?«
»Woher? Man braucht ja nur in dein Gesicht zu sehen. Josie, hast du einen Schminkspiegel? Hier, sieh dich an.« Josie kramte eine Puderdose aus der Handtasche und reichte sie ihm, und er klappte sie auf, war mit ein paar großen Schritten bei mir und hielt mir den kleinen rechteckigen Spiegel vors Gesicht. »Siehst du?« Er wandte den Kopf und sah schelmisch zu Josie. »Siehst du, wie der Zygomaticus deine Mundwinkel nach hinten und oben zieht? Und da ist auch der Risorius, unter medizinischen Laien auch als Seht-doch-wie-stolz-ich-bin-Muskel bekannt.«
Wider Willen war ich geschmeichelt. All diese Sprüche, die ich an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit angeberisch und nervtötend gefunden hätte, erschienen mir witzig und aufrichtig, ja sogar rührend. »Was ist mit dir?«, fragte ich ihn. »Hast du schon was gehört?«
»Ich bin um neun dran«, sagte er, mehr nicht. Er klappte die Puderdose zu und wies damit auf die Tür. »Wer ist jetzt da drinnen?«
»Linda.«
»Oh«, sagte er, »Linda, ja. Natürlich. Linda.« Er blickte mich an und wusste genauso gut wie ich: Wenn ich ausgewählt war, musste Linda wohl draußen bleiben – so sah es jedenfalls aus, es sei denn, Mission Control hatte ein Einsehen und beschloss, alle sechzehn einzuschließen.
Ich kam nicht dazu, etwas zu sagen, weder zu ihrer noch zu meiner Verteidigung, denn die Tür ging auf, und Linda trat heraus, und man brauchte kein Hellseher zu sein, um zu wissen, wie es gelaufen war. Sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen – Ramsay und sie konnten sich nicht besonders gut leiden, und er war vermutlich der Letzte, vor dem sie zusammenbrechen wollte, besonders wenn er drin war und sie draußen. Hinter ihr, an der Tür, stand Judy mit ausdruckslosem Gesicht und winkte Ramsay hinein. Er warf Josie die Puderdose zu, rief: »Was, bin ich schon dran?«, und ging an Linda vorbei, ohne sie auch nur anzusehen.
Vielleicht zögerte ich einen kleinen Augenblick, bevor ich aufsprang, um zu ihr zu gehen, sie in die Arme zu nehmen und etwas Tröstliches zu murmeln, auch wenn wir beide wussten, dass es keinen Trost gab. Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, ich hätte diesen Moment weder vorhergesehen noch mich innerlich darauf vorbereitet, aber in allen Szenarien, die mir eingefallen waren, hatte sie sich, wie ich es an ihrer Stelle getan hätte, schließlich in das Unvermeidliche gefügt, und dann hatten wir uns aufgerappelt und die Entscheidung gemeinsam verarbeitet. Doch sie überraschte mich: Ohne den Blick zu heben, ging sie hinaus, mit hängenden Schultern und schweren Schritten, als wäre der Raum irgendwie gekippt, sodass sie steil bergauf steigen musste. Als ich sie einholte, war sie bereits auf dem Korridor und steuerte auf die Treppe zu. »Linda!«, rief ich, eher verblüfft als bestürzt. »Linda!«
Sie sah sich nicht um, sondern ging die Treppe hinunter. Im Licht der Deckenleuchten schimmerte das hochgesteckte Haar wie Zellophan. Sie war klein – eins sechzig, während ich eins fünfundsiebzig groß bin –, und aus diesem Blickwinkel wirkte sie wie ein Mädchen, das am Ende eines schlimmen Schultags nach Hause trottet. Und es war tatsächlich ein schlimmer Tag, der allerschlimmste, und ich musste mich mit ihr aussprechen – ihr zuliebe, aber auch mir selbst zuliebe.
»Linda!«
Noch immer drehte sie sich nicht um, und ich glaube, sie hätte es ins Erdgeschoss und hinaus in die Hitze geschafft, wenn sie nicht Schuhe mit Absätzen getragen hätte. (Das war noch so was: Wir waren uns einig gewesen, dass es unpassend wäre, hochhackige Schuhe anzuziehen, denn schließlich war das hier ja kein Schönheitswettbewerb – und jetzt spazierte sie in farblich auf ihr Kleid abgestimmten Pumps herum.) Ich rannte die Treppe hinunter und griff nach ihrem Arm, sodass ihr nichts anderes übrigblieb, als stehen zu bleiben und mich anzusehen. »Es tut mir leid«, sagte ich. »Es ist schrecklich. Es ist scheiße. Ich meine … wie konnten sie nur?«
»Dir tut es leid? Wieso sollte es dir leid tun? Du bist schließlich drin.« Sie funkelte mich an und riss sich los.
»Ich weiß, ich weiß. Es ist falsch. Ganz falsch. Sie sind Idioten – GV, Judy, alle. Das wissen wir doch längst. Ich meine, wie oft haben wir darüber gesprochen, dass sie überhaupt kein Gespür haben, dass sie echten Einsatz gar nicht zu schätzen wissen und –«
»Aber dich haben sie ausgewählt, oder?«
Ich zog den Kopf ein, als hätte ich einen Treffer erhalten. Zwei Techniker, die wir kannten, gingen zur Treppe. Als sie Lindas Gesicht sahen, wussten sie, was los war, und schlurften wortlos an uns vorbei. Ich wartete, bis sie den Absatz erreicht hatten, und rang mit mir. Was ich dann sagte, war gelogen, und wir beide wussten es, kaum dass ich es ausgesprochen hatte. »Sie hätten dich statt mich nehmen sollen.«
»Dass ich nicht lache. Du weißt doch ganz genau, wie das hier läuft. Ganz egal, was für Qualifikationen ich habe – und meine sind besser als deine, wenn du’s genau wissen willst –, unterm Strich bin ich die Asiatin. Und außerdem bin ich dick.«
»Du bist nicht dick«, sagte ich automatisch.
»Dick, klein und nicht halb so gutaussehend wie du. Oder Stevie. Oder sogar Gretchen.«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte.
»Blond sollen sie sein. Oder etwa nicht?« Sie fuchtelte vor meinem Gesicht herum. »Rothaarig. Oder Rotblond. So nennst du deine Haarfarbe doch immer, stimmt’s?«
Ich traute meinen Ohren nicht. Glaubte sie wirklich, die Haarfarbe spielte eine Rolle? Wo ich so viel über Nahrungsmittelproduktion gelernt hatte, während sie in Taucheranzug und Flossen versucht hatte, mit Stevie gleichzuziehen? »Komm schon, Linda«, sagte ich, »ich bin’s, deine Freundin. Ich weiß, es tut weh, aber wir werden das durchstehen wie wir alles durchgestanden haben, was sie mit uns angestellt haben, das –«
»Ach, leck mich doch«, sagte sie und stöckelte wacklig die Treppe hinunter, und in diesem Augenblick wurde mir bewusst, dass sie die Schuhe extra für dieses Gespräch gekauft hatte, denn ich hatte sie noch nie an ihr gesehen. Der Gedanke machte mich traurig. Ich wollte das hier nicht. Ich wollte irgendwohin gehen und die Nachricht in die Welt hinausschreien, ich wollte meine Mutter und Johnny anrufen, aber Linda zog mich runter. Wieder rief ich ihren Namen. Sie fuhr herum. »Was?«
Ich stand auf der drittletzten Stufe. »Sollen wir uns nicht irgendwo hinsetzen und darüber reden? Einen Kaffee trinken? Oder was mit Alkohol?«
»Was mit Alkohol? Morgens um fünf nach neun? Hast du sie noch alle?«
»Warum nicht? Wir haben den Rest des Tages frei. Wir könnten doch irgendwas Verrücktes machen. Billard spielen und uns betrinken.«
»Nein«, sagte sie. »Kommt nicht in Frage.«
»Lieber einen Kaffee?«
Sie verzog das Gesicht, blieb aber reglos stehen. Die Absätze erhoben sie über den schimmernden Fußboden, und das Kleid warf an der Taille Falten, denn es war eine Nummer zu klein. (Und überhaupt war es nicht gerade vorteilhaft, denn sie wirkte darin viel zu stämmig, und das war typisch für Linda, deren Stilbewusstsein immer ein bisschen neben der Spur war, und ich fragte mich, warum sie mir das Ding nicht vorher gezeigt hatte. Oder vielleicht fragte ich mich das lieber nicht.) Ich ging die letzten Stufen hinunter zu ihr, und sie ließ es sich gefallen, dass ich ihr den Arm um die Schultern legte und sie hinausführte. »Weißt du was?«, sagte ich. »Wir fahren in die Stadt, zu dem Laden mit den Eclairs, den du so magst. Okay?«
Sie gab keine Antwort, aber ich spürte, dass sie nicht mehr ganz so verspannt war. Wir gingen weiter.
Das war schon besser, viel besser, und ich glaube, ich hätte das, was ich dann sagte, nicht sagen sollen, aber ich wollte eben auf die positive Seite der Sache hinweisen. »Ich weiß, wie du dich fühlst, wirklich«, sagte ich, als wir hinaus ins gleißende Sonnenlicht traten, »aber wie du gesagt hast: Es gibt ja immer noch Mission 3.«
****
Wir fuhren die sechzig Kilometer nach Tucson, das Radio voll aufgedreht und mit offenen Fenstern, der Fahrtwind wehte uns die Haare ins Gesicht und erzählte von Freiheit und Ferne wie damals, bevor ich Johnny kennengelernt und mich bei jeder Gelegenheit mit ihm davongeschlichen hatte, um E2 und den ganzen Druck wenigstens mal für einen Tag hinter mir zu lassen. Den Wagen hatte ich von meiner Mutter übernommen, einen Camry mit abgefahrenen Reifen, Rostpickeln und fast zweihunderttausend Kilometern auf dem Tacho, aber noch immer zuverlässig und ganz gut in Schuss, und mir fiel ein, dass ich nicht wusste, was ich damit machen sollte. Aufbocken? Tat man das nicht mit unbenutzten Autos? Aber wo? Ich würde keine Zeit haben, quer durchs Land zu fahren und den Wagen bei meinen Eltern abzustellen. Mission Control bezahlte die Einlagerung unserer persönlichen Habe – Möbel, Kleidung und so weiter –, aber von Wagen war nie die Rede gewesen. Würden wir sie auf dem Gelände stehenlassen dürfen? Je länger ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass man es uns wohl nicht erlauben würde: Die Wagen würden vor sich hin rosten, und diesen Anblick wollte man der Presse und den Touristen nicht zumuten. Und ich konnte den Camry ja nicht einfach irgendwo parken und erwarten, dass er nach meiner Rückkehr noch da sein würde. Aber vielleicht machte ich mir ganz unnötig Gedanken. Wenn die Mission vorüber war, würde es vielleicht gar keine Autos mehr geben – jedenfalls meins nicht.
Ich sah zu Linda, die, seit wir eingestiegen waren, verständlicherweise nicht viel gesagt hatte – das war, wie ich jetzt erkannte, vielleicht Teil meiner unbewussten Strategie gewesen, dass Fahrtwind und Musik für eine Geräuschkulisse sorgten, hinter der wir uns über unsere Gefühle klar werden konnten –, und hatte eine Idee. »Mir ist was eingefallen«, rief ich, um den Wind und das Radio zu übertönen. »Willst du einen Wagen? Ich meine, wenn’s zu heiß ist, um mit dem Fahrrad zu fahren? Oder zum Einkaufen?«
Linda starrte geradeaus. Sie hatte das Haar gelöst, das ihr jetzt ins Gesicht hing, als wären wir unter Wasser. »Was, du meinst den hier?«
Ich nickte, auch wenn sie es nicht sehen konnte, denn sie würdigte mich noch immer keines Blickes. Das Radio spielte den Song eines Sängers, der sich einen Monat nach unserem Einschluss umbringen würde. Nicht dass zwischen diesen beiden Ereignissen irgendeine Verbindung bestanden hätte – ich erwähne das bloß wegen der zeitlichen Einordnung. Here we are now, entertain us, sang er. Die Musik quoll aus den Lautsprechern. Ich sah kurz zu Linda, in den Rückspiegel – Lastwagen, nichts als Lastwagen – und wieder auf die Straße.
»Willst du damit sagen, ich soll mich um deinen Wagen kümmern?«
»Ja«, sagte ich. »So ungefähr. Ich meine, wenn du ihn gebrauchen kannst. Sonst steht er ja nur herum und rostet. Oder vertrocknet.«
»Und wenn Mission 3 anfängt und ich dran bin – sofern ich überhaupt jemals drankomme? Dann willst du ihn zurück?«
Ich zuckte die Schultern. Der Sänger sang und würde bald tot sein, auch wenn er das noch nicht wusste – oder vielleicht doch. Eine Strähne hing mir in den Mund. Ein Lastwagen scherte aus, um zu überholen, und ich verzog genervt das Gesicht. Mir war großzügig zumute – eigentlich war ich überglücklich, und das, was ich hier tat und in den nächsten vier Stunden auf der Straße, in der Konditorei und in dem Handtaschengeschäft, das Linda so gefiel, tun würde, erschien mir mehr und mehr wie eine lästige Pflicht –, und so sagte ich: »Du kannst ihn behalten. Ich überschreibe ihn dir, ganz offiziell. Umsonst, geschenkt – dann gehört er dir. Und wenn du dann dran bist, kümmere ich mich um ihn. Du weißt schon: das Öl wechseln, waschen und polieren … Na, was meinst du?«
Sie schüttelte den Kopf. Sie wollte keinen Wagen. Und sie wollte genauso wenig wie ich so tun, als ob nichts wäre. Aber sie würde nicht kriegen, was sie wollte. Nicht jetzt und – das ahnte ich wohl damals schon – auch nicht zwei Jahre später.
****
Es war schon nach zwei, als ich wieder zu Hause war. Das Licht meines Anrufbeantworters blinkte. Ich musste Johnny und meine Mutter anrufen, in dieser Reihenfolge. Bei Johnny hatte ich es schon zweimal versucht, einmal von dem Apparat aus, der in der Konditorei im Flur vor den Toiletten hing, das zweite Mal auf dem Rückweg, an einer Tankstelle, als Linda gerade zwei Diät-Cola besorgt hatte, aber beide Male, wie nicht anders zu erwarten, nur seinen Anrufbeantworter erreicht. Offenbar war er in der Arbeit – dann würde er es eben später erfahren. Aber wie würde er reagieren? Natürlich würde er sich für mich freuen oder jedenfalls so tun, als ob, aber dann würde er der Komödie überdrüssig werden und seinem Sarkasmus freien Lauf lassen, und das konnte übel werden. In letzter Zeit hatte er mich öfters als seine »Dschinnie in der Flasche« bezeichnet und mich anderen als »die Frau, die demnächst in den Knast geht« vorgestellt. Und meine Mutter würde glatt durchdrehen, denn endlich konnte sie allen Leuten erzählen, dass ihre Tochter nicht bloß niedere Arbeiten in einem Gewächshaus in Arizona verrichtete und dafür nicht mal den Mindestlohn bekam, sondern vielmehr berühmt wurde, ihren Collegeabschluss in eine Karriere verwandelte und an einem Projekt teilnahm, das laut Time für die Zukunft der Menschheit so bedeutsam war wie die Apollo-Missionen zum Mond. Diese Einschätzung stammte natürlich aus der Zeit vor dem Scheitern von Mission 1, aber das störte meine Mutter kein bisschen. Es war das Urteil, zu dem Time gekommen war, und das reichte ihr. Und wenn Sie es genau wissen wollen: Mir reichte es ebenfalls.
Da stand ich also mitten im Raum, der Schweiß floss in Strömen, mein Haar war völlig zerzaust, das Endorphin-High vom Morgen ließ mich noch immer ein paar Zentimeter über dem Boden schweben, und der Zucker (wir hatten uns Eclairs und Cremetörtchen geteilt) rauschte wie Raketentreibstoff durch meine Blutbahn. Ich starrte auf das gelbe Blinken des Apparats, als wüsste ich nicht, was es zu bedeuten hatte. Hinzu kam, dass ich ein bisschen zappelig war, denn ich hatte mir, während Linda und ich in der Konditorei versucht hatten, uns auszusprechen, eine Überdosis Koffein verpasst und zwei Becher Café au lait getrunken. Und dann die Diät-Cola. Ich war im besten Sinne aufgedreht, beflügelt. Die Nachricht war bestimmt von meiner Mutter, denn sie war vor diesem Abschlussgespräch genauso aufgeregt gewesen wie ich – Sei einfach du selbst, hatte ihr Rat gelautet –, und ich wollte gerade auf die Wiedergabetaste drücken, als das Telefon klingelte.
All das Koffein, all der Zucker – ich zuckte zusammen und nahm erst nach dem dritten Läuten ab.
Es war Johnny. »Na, schon was gehört?«
»Ja«, sagte ich. »Ich bin drin.« Ich hatte mich lange darauf vorbereitet, das Für und Wider abgewogen und überlegt, was ich sagen würde, doch jetzt, da der Augenblick gekommen war und ich es aussprach, war ich überrascht, wie neutral mein Ton war. Es war eine Nachricht zum Durchs-Zimmer-Tanzen, zum Aus-dem-Fenster-Schreien, und doch klang ich, als würde ich ihm die Uhrzeit sagen.
Schweigen. Im Hintergrund hörte ich Geräusche: einen sich mühenden Lastwagenmotor, das Scheppern von Metall auf Metall. Als er schließlich etwas sagte, klang seine Stimme womöglich noch neutraler als meine. »Toll. Das freut mich für dich, wirklich.«
»Aber für dich freut es dich nicht, stimmt’s?«
»Was soll ich machen, während du da drinnen bist – mir eine Sexpuppe kaufen?«
»Von mir träumen.«
»Tja, werde ich wohl. Von meiner Freundin in der Flasche. Luftdicht verschlossen. Unter Glas.«
»Versiegelte Süße«, sagte ich. »Stell dir vor, ich bin ein Glas Marmelade.«
»Und was ist mit den vier Männern? Weißt du, wer die sind?«
»Ramsay ist mit Sicherheit dabei. Und Richard Lack ebenfalls. Von den anderen beiden hab ich noch nichts gehört – die Gespräche laufen noch. Linda ist draußen. Aber das hast du vielleicht schon geahnt. Sie nimmt es sehr schwer.«
Wieder Schweigen. »Dann soll ich also auf dich warten? Und was ist mit dir – du bist mit vier Typen eingeschlossen und willst mir erzählen, dass da nichts passiert?«
»Das habe ich nie gesagt. Du wusstest von Anfang an –«
Er unterbrach mich. »Ich will nicht darauf rumreiten. Heute ist ein Tag zum Feiern, stimmt’s? Wann sehen wir uns – um fünf?«
»Fünf ist gut.«
»Wir könnten vielleicht zum Italiener gehen. Oder willst du lieber ein Steak? So was wirst du in nächster Zeit ja nicht allzu oft kriegen. Dann Drinks und ein bisschen tanzen, und dann fahren wir zu mir und besprechen alles wie vernünftige Erwachsene – ohne was an.«
»Klingt nach einem Plan«, sagte ich.
»Um fünf«, sagte er und legte auf.
In dem Augenblick, als ich den Hörer losließ, läutete das Telefon erneut, als hätte die tickende Uhr an einem Bündel Dynamitstangen die eingestellte Zeit erreicht. Die hohe, fordernde Stimme, die an mein Ohr drang, war die von Judy: »Herrgott, Dawn, wo bist du denn gewesen? Seit drei Stunden versuche ich ununterbrochen, dich zu erreichen. Ist dir nicht klar, wie knapp die Zeit ist? Wir brauchen dich zur Anprobe, und zwar sofort, hast du verstanden?«
Ich bin eigentlich niemand, der sich immer gleich entschuldigt, aber wenn ich was falsch gemacht habe, gebe ich es zu, und hier war das offenbar der Fall (obwohl ich fand, sie hätten mir sagen müssen, dass ich mich in Bereitschaft halten sollte). »Tut mir leid«, sagte ich.
»Was hast du dir bloß dabei gedacht? Von jetzt an musst du rund um die Uhr erreichbar sein. Wir sind jetzt im Countdown, ist dir das klar?«
»Tut mir leid«, sagte ich noch einmal. Und dann, bevor sie fortfahren konnte: »Wer sind die anderen? Wer ist dabei? Mit wem werde ich zusammenleben?«
»Das erfährst du, wenn du hier bist.«
»Von Stevie weiß ich es. Und Ramsay auch, oder? Denn ich nehme doch an, dass –«
»Alles Weitere dann, wenn du hier bist. Nur eins noch: Um fünf Uhr gibt’s ein Dinner bei Alfano, nur Mission Control und die acht ausgewählten Kandidaten. Ich habe außerdem zwei, drei Journalisten und einen Fotografen eingeladen, aber die offizielle Bekanntgabe ist erst morgen, bei der Pressekonferenz.«
Wenn ich die Telefonschnur dehnte und mich nach rechts wandte, konnte ich durch das Fenster E2 sehen: Die Glasscheiben fingen das Sonnenlicht ein und warfen es über das Gelände, das Fachwerk der weißen, miteinander verbundenen Streben verlieh der Kuppel das Aussehen eines gewaltigen Bienenstocks. Honigwaben – das war das Wort, das mir durch den Kopf schoss, mit der dazugehörigen Assoziation von Süße, konzentrierter, klebriger Süße.
Ich blendete Judy für einen Augenblick aus und dachte an die Zukunft und daran, was sie bereithielt und was im Hier und Jetzt mit mir geschah. »Ja«, sagte ich, »ja, okay«, ohne genau zu wissen, was wir gerade vereinbarten.
»Die Details erfährst du natürlich noch – das hier ist ja erst der Anfang. Fürs Erste, heute Abend, solltest du immer daran denken, dass du von jetzt an die Mission repräsentierst, und das heißt, dass du so gut wie möglich aussehen musst.«
»Was ist mit dem Kleid, das ich heute Morgen angehabt habe? Wäre das in Ordnung?«
»Was für ein Kleid?«
»Bei dem Abschlussgespräch? Ein hellgrünes Kleid?«
»Ich kann mich gar nicht –«
»Ein hellgrünes Futteralkleid.«
Ich sah einen Spatz die Flügel ausbreiten und vom Balkon herunter zum Rasen fliegen. Und was war das? Eine Wolke am sonst wolkenlosen Himmel, die einen Schatten über den Hof zog. Dunkel, hell und wieder dunkel. »Ach so, ja, natürlich«, sagte Judy. »Ein Futteralkleid, oder?«
Ich sagte nichts.
»Ich weiß nicht.« Sie seufzte. »Hast du nicht was, das ein bisschen schicker ist?«