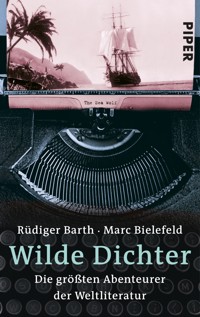9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine mitreißende Reportage über die letzten zehn Wochen der Weimarer Republik. Tag für Tag schildern die Historiker Rüdiger Barth und Hauke Friederichs die dramatischen Ereignisse im skrupellosen Kampf um die Macht, an dessen Ende Adolf Hitler Reichskanzler wird und Deutschland in die Diktatur führt. November 1932, die Weimarer Republik taumelt. Die Wirtschaft liegt am Boden. Auf den Straßen toben Kämpfe zwischen Linksextremisten und Rechtsradikalen. Wenige Männer entscheiden in den kommenden Tagen über das Schicksal der Deutschen. Die Nationalsozialisten um Adolf Hitler und Josef Goebbels greifen nach der Macht, Reichskanzler Franz von Papen zögert zurückzutreten, General Kurt von Schleicher sägt an dessen Ast. Sie alle umgarnen den greisen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, fintieren, drohen und täuschen. Das farbige und vielschichtige Porträt jener Tage, die Europa in die größte Katastrophe der bisherigen Geschichte führten. Eine Katastrophe, die vermeidbar gewesen wäre - das zeigt dieses Buch in aller Dramatik. Und ist damit eine fesselnde Lektüre in Zeiten, in denen um demokratische Werte gerungen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Rüdiger Barth | Hauke Friederichs
Die Totengräber
Der letzte Winter der Weimarer Republik
Über dieses Buch
Der Winter 1932/33: Es schlägt die Stunde der Strippenzieher, der Glücksritter, Extremisten und Volksverführer: Ein skrupelloser Kampf um die Macht entbrennt.
November 1932, die Weimarer Republik taumelt. Die Wirtschaft liegt am Boden und auf den Straßen toben Kämpfe zwischen Linksextremisten und Rechtsradikalen. Wenige Männer entscheiden in den kommenden Tagen über das Schicksal der Deutschen. Die Nationalsozialisten um Adolf Hitler und Joseph Goebbels greifen nach der Macht. Reichskanzler Franz von Papen muss zurücktreten, General Kurt von Schleicher übernimmt – doch Papen sinnt auf Rache. Sie alle fintieren, drohen, täuschen und umgarnen den greisen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. Es beginnt ein dramatischer Kampf um die Macht.
Rüdiger Barth und Hauke Friederichs erzählen mitreißend, Tag für Tag, die letzten zehn Wochen der Weimarer Republik anhand von Tagebüchern, Briefen und Akten. So entsteht das farbige und vielschichtige Porträt einer Zeit, die uns irritierend aktuell erscheint und deren Weg in den Abgrund nicht zwangsläufig war.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Rüdiger Barth, geboren 1972 in Saarbrücken, hat in Tübingen Zeitgeschichte und Allgemeine Rhetorik studiert. Er arbeitete 15 Jahre lang für das Magazin »Stern«, lebt als Autor in Hamburg und ist Mitgründer der »Looping Studios«.
Hauke Friederichs, geboren 1980 in Hamburg, hat in Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Hamburg promoviert, dazu Kriminologie, Politologie und Journalistik studiert. Er schreibt u.a. für »Die Zeit« und »Geo Epoche«.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Schiller Design, Frankfurt
Fotos S. 6/7: © Getty Images / Ullstein Bild
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490545-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Die Totengräber
Vorspann: Die Lage
Der Sturz
Donnerstag, 17. November
Freitag, 18. November
Samstag, 19. November
Sonntag, 20. November
Montag, 21. November
Dienstag, 22. November
Mittwoch, 23. November
Donnerstag, 24. November
Freitag, 25. November
Samstag, 26. November
Sonntag, 27. November
Montag, 28. November
Dienstag, 29. November
Mittwoch, 30. November
Donnerstag, 1. Dezember
Der Plan
Freitag, 2. Dezember
Samstag, 3. Dezember
Sonntag, 4. Dezember
Montag, 5. Dezember
Dienstag, 6. Dezember
Mittwoch, 7. Dezember
Donnerstag, 8. Dezember
Freitag, 9. Dezember
Samstag, 10. Dezember
Sonntag, 11. Dezember
Montag, 12. Dezember
Dienstag, 13. Dezember
Mittwoch, 14. Dezember
Donnerstag, 15. Dezember
Stille Nacht
Freitag, 16. Dezember
Samstag, 17. Dezember
Sonntag, 18. Dezember
Montag, 19. Dezember
Dienstag, 20. Dezember
Mittwoch, 21. Dezember
Donnerstag, 22. Dezember
Freitag, 23. Dezember
Samstag, 24. Dezember
Sonntag, 25. Dezember
Montag, 26. Dezember
Dienstag, 27. Dezember
Mittwoch, 28. Dezember
Donnerstag, 29. Dezember
Freitag, 30. Dezember
Samstag, 31. Dezember
Sonntag, 1. Januar 1933
Im Strudel
Montag, 2. Januar
Dienstag, 3. Januar
Mittwoch, 4. Januar
Donnerstag, 5. Januar
Freitag, 6. Januar
Samstag, 7. Januar
Sonntag, 8. Januar
Montag, 9. Januar
Dienstag, 10. Januar
Mittwoch, 11. Januar
Donnerstag, 12. Januar
Freitag, 13. Januar
Samstag, 14. Januar
Sonntag, 15. Januar
Montag, 16. Januar
Dienstag, 17. Januar
Mittwoch, 18. Januar
Donnerstag, 19. Januar
Freitag, 20. Januar
Samstag, 21. Januar
Sonntag, 22. Januar
Montag, 23. Januar
Dienstag, 24. Januar
Mittwoch, 25. Januar
Donnerstag, 26. Januar
Freitag, 27. Januar
Samstag, 28. Januar
Sonntag, 29. Januar
An die Macht
Montag, 30. Januar
Abspann
Quellen und Literatur
Eine Auswahl zur weiteren Lektüre
Zeitungen
Making-of
Dank
Chronik
DER STURZ
DER PLAN
STILLE NACHT
IM STRUDEL
AN DIE MACHT
Personenregister
Die Totengräber
Paul von Hindenburg (*1847)
Weltkriegslegende. Reichspräsident, der die Demokratie verachtet
»Hindenburg ist ein granitgesichtiger, bassstimmiger Feldmarschall mit einem Befehlsgehabe, das kleine Unteroffiziere zittern lässt.«
Hubert Renfro Knickerbocker, Korrespondent der New York Evening Post
Kurt von Schleicher (*1882)
General und Kanzlermacher, der plötzlich selbst Kanzler werden könnte
»Leicht wird es nicht sein, mit Schleicher zu paktieren. Er hat einen klugen, aber lauernden Blick. Ich glaube, er ist nicht offen.«
Adolf Hitler
Franz von Papen (*1879)
Hasardeur, der auf Rache sinnt
Papen sieht aus »wie ein verbiesterter Ziegenbock, der ›Haltung‹ anzunehmen versucht. Eine Figur aus ›Alice in Wonderland‹.«
Harry Graf Kessler, Publizist und Bonvivant
Adolf Hitler (*1889)
»Führer« der NSDAP, der eine Diktatur errichten will
»Als ich schließlich Adolf Hitlers Salon im Hotel Kaiserhof betrat, war ich überzeugt, dem zukünftigen Diktator Deutschlands zu begegnen. Nach etwas weniger als fünfzig Sekunden war ich absolut sicher, dass dies nicht der Fall sein konnte.«
Dorothy Thompson, US-amerikanische Reporterin
Joseph Goebbels (*1897)
Propagandachef der NSDAP
»Der Führer spielt (…) sein Schachspiel um die Macht. Es ist ein aufregender und nervenspannender Kampf, aber er vermittelt auch das prickelnde Gefühl einer Partie, in der es um alles geht.«
Joseph Goebbels
Vorspann: Die Lage
Im November des Jahres 1932, vierzehn Jahre nach ihrer Gründung, befindet sich Deutschlands erste Demokratie in einer tiefen Krise. Die Reichstagswahl vom 6. November, die zweite in diesem Jahr, war ein Desaster für die gemäßigten Parteien, die hinter der Weimarer Republik stehen. Jeder dritte Arbeiter oder Angestellte ist arbeitslos, mehr als fünf Millionen Menschen. Viele von denen, die noch Arbeit haben, mussten massive Lohnkürzungen hinnehmen.
Die Wirtschaft ist am Boden, die politische Kultur verroht. Auf den Straßen der Städte entflammen immer wieder Kämpfe, Hunderte Menschen sind schon gestorben. Führende Politiker, Unternehmer und Publizisten fürchten einen Bürgerkrieg.
Regieren kann Reichskanzler Franz von Papen lediglich dank der Notverordnungen, die ihm Reichspräsident Paul von Hindenburg erteilt. Notverordnungen haben Gesetzeskraft – nur werden sie nicht von den Volksvertretern beschlossen. Artikel 48 der Weimarer Verfassung gibt dazu dem Staatsoberhaupt das Recht, und Hindenburg hat seit 1930 ausgiebig davon Gebrauch gemacht.
Der Reichstag kann Notverordnungen zwar aufheben oder mit einem Misstrauensantrag den Rücktritt der Regierung erzwingen – es sind die Kontrollinstrumente einer Verfassung, deren Autoren nach Balance gestrebt hatten. Um diese Schritte zu verhindern, hat der Präsident allerdings zweimal das Parlament aufgelöst und damit Neuwahlen herbeigeführt. Die Folge ist eine beispiellose Lähmung der deutschen Politik.
Gerade hat das deutsche Volk wieder gewählt. Im künftigen Reichstag wird sich Kanzler Franz von Papen, ein überzeugter Monarchist, einer Mehrheit aus Abgeordneten gegenübersehen, die wie er die Demokratie abschaffen wollen, allerdings auf ihre Art. Diese Mehrheit, das sind vor allem Kommunisten und Nationalsozialisten, linke und rechte Extremisten, deren einzige Gemeinsamkeit ihr Hass auf das System ist.
Der Präsident will endlich Klarheit, der Kanzler braucht Verbündete, aber nur die Deutschnationale Volkspartei, die DNVP, hält ihm die Treue. Sie stellt 51 von 584 Abgeordneten, lächerlich wenig. Bis zuletzt hat Papen darauf gesetzt, dass die NSDAP seine Politik unterstützen könnte – seit Juli dieses Jahres stellen die Nationalsozialisten die bei weitem stärkste Fraktion im Parlament. Notfalls würde Papen auch deren Chef Adolf Hitler als Vizekanzler einbinden; um die deutschen Faschisten unter Kontrolle zu bringen. Gerade hat Papen einen weiteren Versuch unternommen, die NSDAP zur Mitarbeit zu bewegen, er nennt es eine »Zusammenfassung aller nationalen Kräfte«. Von Hitler jedoch gab es eine glatte Abfuhr – per Brief.
Dieses Deutsche Reich des November 1932 ist ein besorgniserregendes Land. In seinem Buch »Deutschland. So oder so?«, das vor ein paar Monaten erschienen ist und schon mehrere Auflagen erlebt hat, schreibt der US-amerikanische Reporter Hubert Renfro Knickerbocker: »Fünfzigtausend Bolschewisten haben die russische Revolution gemacht. In Deutschland gibt es schätzungsweise 6 Millionen Wähler der Kommunistischen Partei. 200000 Faschisten haben in Italien Mussolini zur Macht verholfen. Hinter der nationalsozialistischen Partei Adolf Hitlers stehen möglicherweise 12 Millionen Wähler. Wie lange kann das Leben der deutschen Republik dauern?«
Das ist die Frage. Der kommende Winter entscheidet über das Schicksal dieses Staates, der Weimarer Republik.
Der Sturz
17. November bis 1. Dezember 1932
Donnerstag, 17. November
Der Reichskanzler vor dem Sturz!
Heute fällt die Entscheidung
Der Angriff
Papen bietet Demission an
Rücktritt des Gesamtkabinetts? – Heute Vortrag bei Hindenburg
Vossische Zeitung
Regiert wird das Deutsche Reich von Preußen aus, von der Hauptstadt Berlin. In Wahrheit konzentriert sich die Macht nur auf eine Handvoll nebeneinanderliegender Häuserblocks. Man nennt dieses kleine Areal nach der Straße, an die es angrenzt, die »Wilhelmstraße«.
Wenn man den Reichstag verlässt, unter dem Brandenburger Tor hindurchläuft und hinter dem Hotel Adlon am Pariser Platz nach rechts biegt, hat man die Straße schon erreicht. Man passiert die britische Botschaft und das Landwirtschaftsministerium, dann kommt zur Rechten das Ensemble der Palais in den Blick, aus dem der Anbau der Reichskanzlei hervorsticht, errichtet vor einem Jahr, verkleidet mit Travertin.
Von der Straße sehen die Fassaden abweisend aus, aber dahinter erstrecken sich alte, große Gärten. Unterirdische Gänge führen auf der westlichen Seite der Wilhelmstraße von Gebäude zu Gebäude, auch über die Dachböden soll ein geheimer Weg verlaufen. Die Gärten sind durch Tore miteinander verbunden, die gerne für heimliche Besuche genutzt werden.
Die Kabinettssitzung, in der es für Regierungschef Franz von Papen um seine Karriere geht und in der General Kurt von Schleicher aus den Schatten treten wird, findet, soweit wir wissen, im Gartensaal der Reichskanzlei statt. In den hellen Monaten ist dies dank der bodentiefen Fenster, die nach Westen zeigen, ein lichtdurchfluteter Raum. Ein sonniger, frischer Herbsttag ist angebrochen. An den Eichen, Ulmen und Linden hängt leuchtend das Laub, es sind Bäume darunter, die wohl schon hoch gewachsen waren, als Friedrich der Große hier spazieren ging.
Auf den hinteren Mauern, zur Friedrich-Ebert-Straße hin, wachen noch immer die Terrakotta-Adler des königlichen Preußens, auf den Häuptern vergoldete Bronzekronen. In diesem Häuserensemble hat Otto von Bismarck, der erste Kanzler des Deutschen Reiches, achtundzwanzig Jahre lang gelebt. Irgendwo in diesen Gärten, so erzählen es sich die Kinder der Bediensteten, die oft hier spielen, soll eine seiner treuen Doggen begraben liegen, und auch der Trakehnerhengst, der ihn 1866 über die Felder von Königgrätz getragen hat. An dieser Schlacht hat als Achtzehnjähriger auch Paul von Hindenburg teilgenommen, als Leutnant des 3. preußischen Garderegiments zu Fuß.
Heute ist Hindenburg fünfundachtzig Jahre alt und der wichtigste Mann Deutschlands. Im Weltkrieg war er der siegreiche Befehlshaber der Kesselschlacht von Tannenberg, später Chef der Obersten Heeresleitung, noch immer zehrt er von diesem Ruhm. Sein mächtiger Schnurrbart, die tiefen Falten um den Mund, die stahlfarbenen Bürstenhaare – er sieht in ruhigen Momenten aus wie ein Denkmal seiner selbst. Seit 1925 ist er der Reichspräsident, um dessen Wohlwollen alle buhlen. Um ihn, den Greis.
Auch die Minister und Staatssekretäre, die sich an diesem Morgen im Gartensaal versammeln.
Seit gestern streift der amerikanische Gewerkschaftsfunktionär Abraham Plotkin durch Paris. Er ist mit dem Frachtschiff von New York nach Le Havre gereist, als einer von fünf Passagieren, ohne jeden Komfort, eine bescheidene Anreise, wie er es mag. Und wie es sein Geldbeutel erlaubt. Er ist vierzig Jahre alt. Zu Hause hat er seine Anstellung bei der Textilgewerkschaft verloren – die Wirtschaftskrise.
Als er ein Junge war, wanderte seine Familie aus dem zaristischen Russland nach Amerika aus. Nun kehrt Plotkin nach Europa zurück, mit wenig mehr als der Kleidung, die er am Leib trägt, seinem Gehstock und seiner Schreibmaschine.
Kurz nach seiner Abreise hat er ein Tagebuch begonnen. Plotkin ist wissensdurstig und wortgewandt und hat einen Blick für die Lage der einfachen Menschen. Aber Frankreich ist nicht der Grund, warum er nach Europa gekommen ist. In vier Tagen wird er weiterfahren.
Sein Ziel liegt in Deutschland, wo er den Kampf der einfachen Leute miterleben will, die für ihre Rechte streiten. Er hat gehört, dass sich auf den Straßen Berlins Linksradikale und Rechtsradikale prügeln, dass es Tote gegeben hat. Die Hauptstadt zieht ihn magisch an. Alfred Döblins »Berlin Alexanderplatz« hat er aufgesogen, und jetzt will er in das Milieu eintauchen, das der Schriftsteller so eindrucksvoll geschildert hat. Er will Huren treffen, Krämer, Bettler und Ganoven. Er will sich die Nationalsozialisten anschauen, von denen alle sprechen, halb bang, halb gebannt. Es heißt, die Reden des Joseph Goebbels im Berliner Sportpalast seien in ihrer mitreißenden Suggestionskraft mit nichts vergleichbar. Für andere Touristen mag der November nicht die beste Reisezeit sein, um Berlin zu erkunden, der Monat, in dem gewöhnlich mit Macht der Winter über die Stadt kommt.
Plotkin kümmert das nicht. Er möchte von den Deutschen lernen.
Der mit seinen fünfzig Jahren langsam etwas füllig werdende Wehrminister Kurt von Schleicher trifft im Gartensaal ein. Auf Fotos wirkt er linkisch, sein Lächeln steif, aber meist blitzen seine Augen. Viele, die ihm zum ersten Mal begegnen, sind weniger von seinem Aussehen beeindruckt als vielmehr von seiner lebhaften Persönlichkeit. Kahl ist sein Haupt schon länger, groß ist er auch nicht, dennoch hat er Schlag bei den Frauen. Wer Schleicher nicht wohlgesonnen ist, erzählt Geschichten über seine wechselnden Liebschaften. Dass er verheirateten Frauen Blumenbouquets schicke, darunter Ehefrauen einflussreicher Männer. Dass er sich so Feinde fürs Leben schaffe.
In der Wilhelmstraße hatte er sich einen Ruf als eingefleischter Junggeselle erworben, der die Vorzüge des ungebundenen Lebens durchaus zu genießen wisse. Bis er im Juli 1931 Elisabeth von Hennigs heiratete, die Tochter eines Kavallerie-Generals. Eine Frau aus einer Soldatenfamilie.
Kurt von Schleicher entstammt ebenfalls einer Soldatenfamilie. Sein Urgroßvater starb 1815 in der Schlacht von Ligny, zwei Tage vor Waterloo, beim Sturmangriff auf Napoleons Truppen. Auch Kurts Vater wurde Soldat, zuletzt war er Oberstleutnant.
Wie Reichspräsident Hindenburg hat Kurt von Schleicher die militärische Laufbahn im 3. Garderegiment zu Fuß begonnen, und dort lernte er nach der Jahrhundertwende auch Hindenburgs Sohn Oskar kennen, mittlerweile dessen Adjutant, sowie Kurt von Hammerstein-Equord, den heutigen Chef der Heeresleitung.
Im Weltkrieg machte Schleicher rasch Karriere. Er diente seit 1914 in verschiedenen Stäben, organisierte, plante, lenkte und lernte Generäle kennen, die ihn schätzten und förderten. Generalmajor Wilhelm Groener wurde zu seinem Mentor, ein väterlicher Freund, der Schleicher machen ließ, auch jenseits der Befehlsketten. Zum Ende des großen Krieges war Schleicher schließlich Paul von Hindenburg zu Diensten, dem damaligen Chef der Obersten Heeresleitung. Der Kontakt riss auch danach nicht ab.
Fortan arbeitete der Offizier in der schlecht ausgeleuchteten Sphäre, in der Politik und Militär aufeinandertreffen. Schleicher war Chef des Ministeramts, der oberste Strippenzieher. Er traf die Spitzen der Parteien und knüpfte enge persönliche Bande – auch zu Reichspräsident Friedrich Ebert, dem Sozialdemokraten. Die von ihm aufgebaute »Wehrmachtsabteilung« im Ministerium unterstand direkt seinen Anweisungen: Dort wurde die Politik der Reichswehr gemacht – und wird es bis heute.
Als Wehrminister arbeitet Kurt von Schleicher oft bis in die Nacht, er schläft wenig und reitet schon bei Tagesanbruch eine Stunde durch den Tiergarten. Man sieht ihm sein Pensum trotzdem kaum an. Er redet stets eindringlich, mit Charme, mit Chuzpe, wie es ihm passt, ein Meister der kleinen Runden.
Kein deutscher Staatsbürger hat Kurt von Schleicher je in einer Wahl seine Stimme geben können. Dennoch war er es, der Hindenburg im Sommer dieses Jahres den Namen des Kanzlers Franz von Papen eingeflüstert hat, daran hegt wohl niemand Zweifel.
Am heutigen Morgen ist er pünktlich im Gartensaal zur Kabinettsitzung um elf Uhr erschienen.
Kanzler Franz von Papen, dreiundfünfzig Jahre alt, der Hausherr, trifft ein paar Minuten später ein. Er setzt sich, so erzählen es Beteiligte, an die Mitte des Tisches, gegenüber den hohen Fenstern, so dass er den Blick in den Garten schweifen lassen kann. Zu seiner Linken nimmt Schleicher Platz, sein Freund, dem er den überraschenden Karrieresprung vor sechs Monaten verdankt. Sechs Monate, in denen Papen Schleicher als wichtigsten Ratgeber des Präsidenten abgelöst hat. Sechs Monate können lang genug sein, um aus Freunden Gegner zu machen.
Nur ein paar Schritte weiter brütet Präsident Paul von Hindenburg in seinem Büro über den Papieren. Der große Bismarck, der Einiger des Deutschen Reiches, hatte es fürwahr nicht so schwer wie er. Die Deutschen sind in der Krise völlig zerstritten, die Parteien, die sie wählen, rangeln um die Macht, und die innere Einheit des Volkes ist in höchster Gefahr. Außer ihm ist da niemand mehr, hinter dem sich eine Mehrheit der Deutschen versammelt. Nur Paul von Hindenburg kann Deutschland retten.
Anfang Juni dieses Jahres ist er aus dem renovierungsbedürftigen Reichspräsidentenpalais ausgezogen, in dem die Möbel schon mit Stützklötzen abgesichert werden mussten, weil sich die Holzfußböden hier und da bedenklich abgesenkt hatten. Seitdem arbeitet und empfängt das Staatsoberhaupt in der Reichskanzlei.
Erst in drei Wochen, am 6. Dezember, soll der Reichstag wieder tagen, und bis dahin sollte klar sein, wer der neue Kanzler ist. Aber wen soll Hindenburg jetzt bestellen? Gemäß den Gepflogenheiten müsste er den Vertreter der stärksten Fraktion im Reichstag mit der Regierungsbildung beauftragen. Das wäre Adolf Hitler, »Führer« der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, sein Gegner aus der Präsidentschaftswahl im April. Im Parlament stellt die Partei in Hermann Göring seit Ende August erstmals den Reichstagspräsidenten, eines der höchsten Ämter des Reiches. Ihre Abgeordneten provozieren häufig mit Zwischenrufen, stören den Betrieb, einmal haben sie einen linken Journalisten im Parlamentsrestaurant so zusammengeschlagen, dass ihr Opfer ins Krankenhaus musste – ein alles in allem widerlicher Haufen. Kaum vorstellbar, dass bei diesen Volksvertretern die Staatsgeschäfte in guten Händen wären. Lieber wäre es Hindenburg, wenn Franz von Papen Kanzler bliebe, ein Konservativer, dessen steter Frohsinn ihm nach wie vor gefällt. Da wäre allerdings auch noch Kurt von Schleicher, der vor allem aufs Militär setzt. Manche sagen, Schleicher sei spitzzüngig und schwer zu durchschauen. Aber Hindenburg verlässt sich schon lange auf diesen wachen Kopf.
Politik ist verzwickt, erst recht für einen ewigen Soldaten. Kompromisse entstehen nicht auf Befehl. Und die Demokratie ist die komplizierteste Form der Politik. Aber wie auch immer er sich entscheidet, Hindenburg muss Schaden vom deutschen Volk abwenden.
Und von seinem eigenen Nachruhm, versteht sich.
Hindenburgs Mann im Gartensaal heißt Otto Meissner, seit 1920 Leiter des Büros des Reichspräsidenten. Der Sohn eines Postbeamten aus dem Elsass, zweiundfünfzig Jahre alt, spricht fließend Französisch und Russisch. Er ist promovierter Jurist, arbeitete zunächst bei der Eisenbahn. Im Weltkrieg stieg er bis zum Hauptmann auf, er hat Hindenburg 1915 kennengelernt.
Otto Meissner ist ein pragmatischer Mensch. Bereits am 7. Mai 1932 hat er gemeinsam mit Hindenburgs Sohn Oskar sowie General Schleicher einflussreiche Nationalsozialisten um Adolf Hitler getroffen. Sie sprachen darüber, wie das Kabinett um den eigensinnigen Kanzler Heinrich Brüning elegant zum Rücktritt gezwungen werden könnte, um Platz für einen Neuanfang zu machen.
Der Plan ging auf. Nun, wenige Monate später, ist es der geschmeidige Papen, der unter Druck steht.
Seit einem halben Jahr sitzt Carl von Ossietzky in Haft, der Herausgeber der linksintellektuellen Zeitschrift Weltbühne. Wegen angeblichen Geheimnis- und Landesverrats. Er hat einen Artikel über die geheime Aufrüstung der Reichswehr gebracht: »Windiges aus der Luftfahrt«. Den Militärs war der Pazifist seit langem verhasst, nun haben sie zurückgeschlagen.
»Vaterlandsverräter« ist ein Vorwurf, der Ossietzky trifft. Schließlich hatte die Armee gegen Reichsgesetze verstoßen! Ihre verdeckte Aufrüstung und damit die Verstöße gegen den Versailler Vertrag waren sogar schon Thema im Reichstag, alle Dokumente, die in dem Weltbühne-Artikel zitiert sind, alle Daten und Fakten waren schon zuvor öffentlich gewesen. Geheimnisverrat?
Immerhin, ein zweites Verfahren der Staatsanwaltschaft gegen ihn wird in diesen Stunden niedergeschlagen. Sein wichtigster Autor Kurt Tucholsky hatte in der Weltbühne geschrieben: »Soldaten sind Mörder«. Die Reichswehr sah sich in ihrer Ehre gekränkt.
Ossietzky, dreiundvierzig Jahre alt, leidet in seiner Einzelzelle unter der schlechten Verpflegung und vor allem unter dem Rauchverbot.
Unter Intellektuellen und Linken gilt er als Justizopfer. Im Mai, beim Haftantritt, geleiteten ihn zahlreiche Schriftsteller zum Gefängnis Berlin-Tegel. Arnold Zweig war dabei, Lion Feuchtwanger, Erich Mühsam und Ernst Toller. Ossietzky hielt eine kurze Rede: Bewusst gehe er in Haft, um so für die 8000 politischen Gefangenen zu demonstrieren, »die unbekannt im Dunkel der Gefängnisse schmachten«. Kein Sonderrecht und keine Sonderstellung verlange er. »Ungebessert« wolle er entlassen werden.
Erst am 10. November 1933 soll es so weit sein. Fast ein ganzes Jahr noch.
Keiner hatte mit Franz von Papen gerechnet, im Juni dieses Jahres, als er Kanzler wurde, er kam vom rechten Rand der Zentrums-Partei, und jetzt hat er nicht vor, so schnell wieder abzutreten. Kanzler soll er vor allem geworden sein, weil Schleicher ihn für steuerbar hielt.
Eigentlich wollte Papen dieser Tage nach Mannheim reisen, um die neue Rheinbrücke einzuweihen, und in Württemberg und Baden erwartete man den Kanzler zum »Staatsbesuch«, wie die Zeitungen schrieben. Alles abgesagt. Gestern haben die Führer des konservativen Zentrums Papen mitgeteilt, dass sie zwar »dem Gedanken einer Politik der nationalen Konzentration grundsätzlich zustimmen«, dass er aber für eine solche Koalition nicht der geeignete Kanzler sei. Sie sprachen von drohenden chaotischen Zuständen, falls er bleibe, am besten solle Papen gleich zurücktreten. Sozialdemokraten und Nationalsozialisten haben sich auf ein Treffen gar nicht erst eingelassen.
Papen hat all dies registriert. Natürlich schmollen die Leute vom Zentrum, er war ja mal selbst einer von ihnen, jetzt fühlen sie sich von ihm verraten.
Im Krieg war er ein treuer Offizier des Kaisers – als Agent und Saboteur in Washington, als Kommandeur an der Westfront und als Major in der Türkei. Als Abgeordneter vertrat er danach für das Zentrum reaktionäre, nationalistische Positionen. Und nun regiert er ohne Mehrheit die ungeliebte Republik als Kanzler. Papen schwebt eine Verfassungsreform vor: den Reichstag für ein halbes Jahr lahmzulegen, und dann dem Volk eine neue Verfassung zur Abstimmung vorzulegen. So will er die lästigen Nachteile des Parlamentarismus beseitigen.
Papen stammt aus einem begüterten Adelsgeschlecht, mit achtzehn war er Page am kaiserlichen Hof in Berlin. Seine Ehefrau ist Erbin des Keramikherstellers Villeroy & Boch. Geldsorgen kennt Papen nicht. Spötter nennen ihn einen »Herrenreiter«, aber Freunde des Reitsports gibt es viele in Berlin. Wenn Papen auf seinem Pferd durch den Tiergarten trabt, mit verwegener Mütze und Fliege, sieht das gekonnt aus.
Die Verfassungsreform, die er anstrebt, würde einen ersten Schritt zurück zur Monarchie bedeuten – oder wenigstens zu einer autoritären Regierung. Papens Traum. Es wäre allerdings eine Art Staatsstreich.
Für Frederic M. Sackett, den Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in Berlin, gibt es ein Problem: Personell ist sein Haus erschreckend schwach aufgestellt. Und die Herren in Washington machen gerade ordentlich Dampf. Aus Berlin kommen ihnen zu wenige Lageberichte, Analysen, Einschätzungen.
Dabei hat er dem State Department erst vor ein paar Wochen geschrieben, Hitler sei »einer der größten Showleute seit P.T. Barnum«, dem Zirkusunternehmer, und Joseph Goebbels nannte er bei dieser Gelegenheit Hitlers »silberzüngigen Leutnant«. Seit 1930 ist Sackett in der Stadt, das macht ihn zu einem Veteranen in der Botschaft, in der es kaum Diplomaten gibt, die schon längere Zeit in Deutschland leben. Und nur wenige beherrschen die deutsche Sprache. Etatkürzungen haben auf allen Ebenen ihre Spuren hinterlassen. Viele Mitarbeiter sind jung und unerfahren. Geheimdienstliche Tätigkeiten existieren nicht. Kurzum: Die US-Botschaft, die neuerdings in der Bendlerstraße beheimatet ist, ist ein inkompetenter Laden.
Frederic M. Sackett selbst, dreiundsechzig Jahre alt, ist noch immer, man muss es so sagen: persönlich beleidigt. Mit Kanzler Heinrich Brüning hatte er ein exzellentes Verhältnis aufgebaut, auf der Nähe zum Zentrums-Mann fußte seine ganze Strategie: Dessen Regierung zu helfen, die deutsche Wirtschaft zu stabilisieren, Brünings vernünftigen Kurs gegen die extremen Parteien zu unterstützen – das war sein Credo.
Seit Juni 1932 aber ist alles anders. Brüning ist abserviert. Dessen Nachfolger Franz von Papen ist für die Amerikaner Persona non grata. Im Weltkrieg war Papen Militär-Attaché in Washington, baute heimlich für die Deutschen einen Agentenring auf, wobei er sich so dreist verhielt, dass er des Landes verwiesen wurde. Wie mit Papen umgehen? Ignorieren, das ist die einzige Möglichkeit.
In den letzten Wochen hat sich Sackett zu Hause im Wahlkampf für seinen Freund, den Präsidenten Herbert C. Hoover, aufgerieben – letztlich vergeblich. Nun ist er zurück in Berlin und versucht, sich in diesen turbulenten Tagen einen Überblick zu verschaffen. Allein der Gedanke, dass die Nationalsozialisten an die Macht kommen könnten: unerträglich.
Papen braucht mehr denn je Unterstützung, um nicht zum Rücktritt gezwungen zu sein. Er ergreift im Gartensaal das Wort.
Der Reichspräsident müsse sich nochmals an die Parteiführer wenden, sagt er, für eine Regierung der »nationalen Konzentration« mit ihm als Kanzler werben. Aber das Reichskabinett dürfe nicht den Eindruck erwecken, an der Macht zu kleben. Ausgerechnet Kurt von Schleicher, der Wehrminister, stimmt sofort zu. Nur durch eine Demission des gesamten Kabinetts könne man die in nationalen Kreisen betriebene »Brunnenvergiftung« bekämpfen. Er meint jene Gerüchte, laut denen diese Regierung schuld sei, dass es noch immer keine breite nationale Front gibt.
Man grummelt anerkennend in der Runde. Hier ist das »Kabinett der Barone« versammelt, wie es im Volksmund heißt. Die meisten Herren tragen ein »von« im Namen, sie stammen aus adeligen Familien. Sie wurden von Papen jedoch nicht nur wegen ihrer Herkunft ausgewählt. Es sind ehrenwerte Fachleute darunter.
Nun gut, sagt Kanzler Papen.
Offenbar gibt er auf.
Er werde dem Reichspräsidenten mitteilen, sagt er, dass sein gesamtes Kabinett bereit für den Rücktritt sei.
Stille kehrt ein im Raum. Draußen, im Garten, lassen die schrägen Sonnenstrahlen das Laub glänzen. Keiner seiner Minister widerspricht dem Regierungschef. Schleicher lässt sich seine Genugtuung nicht anmerken. Papen hat sich innenpolitisch längst als Dilettant entpuppt, unfähig, breite Bündnisse zu schmieden.
Papen nickt. Ist es vorbei? Entgleitet ihm so schnell wieder das höchste Amt?
Carl Schmitt, Professor für Staatsrecht, berät die Reichsregierung in einem hochverwickelten Fall, der als »Preußenschlag« in aller Munde ist. Reichspräsident Hindenburg hatte im Juli per Notverordnung die preußische Landesregierung abgesetzt und seinen Vertrauten, Kanzler Franz von Papen, als Kommissar eingesetzt. Ein Bollwerk der SPD und der Republik war geschleift. Seine Begründung: Die Sozialdemokraten hätten die Gewalttaten von Kommunisten nicht verhindert und somit die innere Lage in Preußen nicht im Griff. Beim »Altonaer Blutsonntag« waren kurz zuvor achtzehn Menschen gestorben, während Nationalsozialisten durch ein kommunistisches Viertel marschiert waren. Für fast alle Toten waren allerdings Polizisten verantwortlich, die wild durch die Gegend geschossen hatten.
Mit Gewalt haben sich die Sozialdemokraten gegen diese Attacke Papens nicht gewehrt: nicht ihren Kampfbund, das »Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold«, losgeschickt, auch nicht zum Generalstreik aufgerufen wie beim Kapp-Putsch 1920. Sie stehen zum Staat – auch wenn dieser sie bekämpft. Der Kampf der deutschen Sozialdemokratie führt über den Rechtsweg. Als treue Republikaner glauben sie an die Unabhängigkeit der Justiz, und nun läuft eine Klage der abgesetzten preußischen Regierung Otto Brauns am Staatsgerichtshof in Leipzig. Auch die Länder Bayern und Württemberg haben die höchsten Richter der Republik angerufen. Sie fürchten, dass sie die Nächsten sein könnten, deren Macht gebrochen werden soll.
Schlägt nun die Stunde Adolf Hitlers?
Der »Führer« der Nationalsozialisten will endlich an die Macht. Sein jüngstes Antwortschreiben an Franz von Papen hat an Deutlichkeit nichts zu wünschen übriggelassen: »Das Einzige, was mich mit Bitternis erfüllt, ist, zusehen zu müssen, wie unter der wenig glücklichen Hand Ihrer Staatsführung, Herr Reichskanzler, von Tag zu Tag von einem nationalen Gut vertan wird, an dessen Schaffung ich vor der deutschen Geschichte einen redlichen Anteil besitze.«
So kündigt Hitler das Ende einer Zusammenarbeit, die noch gar nicht begonnen hat. Es sind markige Worte von einem Parteiführer, der auch sonst in diesen Tagen markig auftritt. Die Entschlossenheit mag nicht gespielt sein, doch die Zuversicht ist es sehr wohl.
Tatsächlich ist man dieser Tage nervös bei der NSDAP. Zum ersten Mal seit 1930 haben die Nationalsozialisten bei der Wahl am 6. November massiv Wähler verloren – zwei Millionen! –, der Höhepunkt der Zustimmung scheint überschritten. Schwere Finanzsorgen plagen die Partei. Die Wahlkämpfe waren horrend teuer, über Wochen reiste Hitler täglich im Flugzeug von einem Auftritt zum nächsten, um allgegenwärtig zu erscheinen. Und Zehntausende Männer der Sturmabteilung marschieren nicht für lau: Lokale, Küchen und Heime der SA haben große Summen gekostet. Die Banken geben keine neuen Kredite, die Förderer aus der Industrie halten sich mit weiteren Spenden zurück. In der Organisation selbst bereitet Hitler sein Widersacher Gregor Strasser Ärger. Strasser plädiert für einen pragmatischen Kurs und hat einige Abgeordnete der Reichstagsfraktion und manchen Gauleiter hinter sich versammelt.
Auch die Kassenlage des wichtigen Berliner Gaus ist trostlos – dazu erreicht dessen Leiter Joseph Goebbels dieser Tage ein Bericht seiner Leute. »Nur Ebbe, Schulden und Verpflichtungen«, klagt er später in seinem Tagebuch, »dazu die vollkommene Unmöglichkeit, nach dieser Niederlage irgendwo Geld im größeren Umfange aufzutreiben.«
Goebbels schickt die SA-Männer wieder mit dem Klingelbeutel auf die Straße, besser als Bettler auftreten als gar nicht präsent sein. Aber wenn der Griff zur Macht dieses Mal nicht glückt, kann es gut sein, dass die nationalsozialistische Bewegung in diesem Winter ihren Antrieb, ihre Anziehungskraft, ihre Glaubwürdigkeit verlieren wird – und schließlich zerbricht.
Freitag, 18. November
Der Kanzler ohne Volk gibt das Rennen auf.
Bevorstehender Rücktritt der Papen-Regierung?
Völkischer Beobachter
Proletarische Offensive sprengt Papen-Kabinett
Papen-Regierung zurückgetreten – Schleicher-Presse fordert Hitler als Kanzler – Äußerste Gefahr für das arbeitende Volk
Die Rote Fahne
Die Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung beginnen am späten Vormittag. Paul von Hindenburg trachtet auch nach einer Lösung, die er als »nationale Konzentration vom Zentrum bis zu den Nazis« bezeichnet. Als Ersten empfängt er um halb zwölf Alfred Hugenberg, Parteiführer der konservativen DNVP. Der ist bekannt dafür, besonders engstirnig seine Interessen zu vertreten. Das Sprachrohr der Großindustriellen und Landjunker. Hugenberg bringt schwere Bedenken gegen Adolf Hitler vor.
Über Hugenberg wird viel gespottet, Karikaturisten nehmen ihn mit Vorliebe aufs Korn. Doch er hat Macht. Sie baut auf Druckerpressen und Filmrollen. Hugenberg zählt zu den größten Medienunternehmern in Europa, befiehlt über Tageszeitungen, Zeitschriften, Filmproduktionsfirmen, er kennt seinen Einfluss auf die öffentliche Meinung und damit auf die Politik genau. Eine rechte Regierung ohne seine DNVP? Momentan nicht in Sicht.
Um sechs Uhr abends wiederum trifft Ludwig Kaas vom Zentrum beim Präsidenten ein. Er empfiehlt einen »Treuepakt« von drei bis vier »mutigen Parteiführern«. Hitler scheint ihn nicht zu beunruhigen. Eduard Dingeldey von der Deutschen Volkspartei gibt sich eine halbe Stunde später die Ehre. Dingeldey sagt, die Ernennung des Reichskanzlers sei eine Frage des persönlichen Vertrauens des Herrn Reichspräsidenten. Seine Partei werde den Kandidaten Hindenburgs unterstützen. Und: »Persönlich würde ich gegen eine Wiederbetrauung Papens nicht das mindeste einzuwenden haben.«
Für Hindenburg ist die demokratische Willensbildung immer wieder ein quälender Prozess. Als er 1925 zum ersten Mal zur Wahl des Reichspräsidenten antrat, hat er sich vorher von seinem früheren Kaiser Wilhelm II. in dessen niederländischem Exil den Segen erteilen lassen. Ein Republikaner ist Hindenburg nie geworden, aber ihn füllen Vaterlandsliebe und Pflichtbewusstsein aus, und er kennt seine Pflichten als Reichspräsident. Auch seine Rechte, natürlich. Mit jedem muss er nicht reden.
Die SPD hat er nicht zu Gesprächen eingeladen. Die schon fast siebzig Jahre alte Sozialdemokratie, die diese Republik ermöglicht hat, wird mittlerweile so ziemlich von allen angefeindet, vor allem von den Kommunisten. Im April 1932 hatte sie Hindenburg bei der Wiederwahl unterstützt, um dessen Rivalen Hitler zu verhindern. Den Dank des Alten hat die Partei dafür nicht erhalten, im Gegenteil. »Wer hat mich denn gewählt? Mich haben die Sozis gewählt, mich haben die Katholiken gewählt«, klagte er einmal gegenüber seinem Pressechef. »Meine Leute haben mich nicht gewählt.« Seine Leute, die Monarchisten, Republikgegner, Konservativen: weitgehend zu Hitler übergelaufen. Dem Präsidenten sind die Stimmen der sozialdemokratischen Anhänger vor allem peinlich.
Und womöglich ärgert er sich auch noch darüber, dass die SPD eine Gesprächseinladung des Kanzlers über das weitere parlamentarische Schicksal der Regierung vor wenigen Tagen strikt abgelehnt hat: »Wir gehen nicht zu Papen«, hat Kurt Schumacher auf einer Sitzung des Fraktionsvorstands der Sozialdemokraten verkündet.
Bella Fromm, die Frau mit dem koketten Mund und den dunklen Augenbrauen, ist einundvierzig und Gesellschaftsreporterin der Vossischen Zeitung. Das Blatt gehört zur Pflichtlektüre all jener, die in Berlin etwas mit Politik zu tun haben, die in der Gesellschaft eine Rolle spielen oder spielen wollen. Minister lesen sie, Abgeordnete und deren Mitarbeiter, Beamte, Militärs, Lobbyisten, Diplomaten und ihre Gattinnen.
Journalistin ist Fromm mehr aus Not denn aus Leidenschaft geworden. Sie stammt aus dem jüdischen Großbürgertum, ihre Eltern betrieben einen gutgehenden internationalen Handel mit Weinen von Main und Mosel. Die Tochter ließen sie auf einem Konservatorium in Berlin erziehen. Kurz vor dem Ausbruch des Weltkriegs heiratete Bella, bekam eine Tochter, Gonny, und war fortan in ihrer Ehe unglücklich. Scheiden? Dafür musste sie dem Gatten einen Ehebruch nachweisen – was ihr gelang. Sie heiratete noch mal und trennte sich wieder. Nur kurz genoss Bella Fromm die Freiheit, dann kam die Inflation. Sie verlor einen Großteil des geerbten Vermögens – das Geld reichte indes noch für eine Villa in Berlin, einen Sportwagen und zwei Reitpferde. Aber sie brauchte eine Einnahmequelle, und da sie in der Hauptstadt zur besseren Gesellschaft gehörte, begann sie, über deren Leben zu schreiben. Seit 1928 ist sie Kolumnistin der Vossischen und Mitarbeiterin der B.Z. und anderer Blätter aus dem Hause Ullstein.
Bella Fromms Kolumne »Berliner Diplomaten« in der Vossischen ist beliebt bei den Lesern. Über die ausländischen Gesandten, das Personal des Außenministeriums und die Politiker in der Hauptstadt pflegt sie meist freundlichen Klatsch zu berichten. Das Gift ihrer politischen Analysen lässt sie nicht in die Zeitung fließen. Das ist nur für ihr Tagebuch bestimmt.
Die Überlegung, die Nationalsozialisten in die Regierung einzubinden, um sie dadurch unschädlich zu machen, hält Bella Fromm für äußerst gefährlich. Vor vier Tagen hat sie im Hotel Kaiserhof den ehemaligen Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht getroffen, der auf dem Weg zu Hitler war. »Ich möchte wissen, was er dort will«, hielt sie fest. »Sicherlich nichts, was für anständige Leute etwas Gutes bedeutet.« In der Vossischen bekommen ihre Leser solche Sätze nicht geboten.
Um an exklusive Informationen zu kommen, schreckt sie allerdings auch vor Undercover-Einsätzen nicht zurück. Als vor einem Jahr der Reichspräsident das diplomatische Korps zu einem Empfang bat, war die Presse nicht geladen, also schlüpfte Fromm in Männerkleidung und mischte sich unter die Schaulustigen vor dem Reichspräsidentenpalais, um zu sehen, wer wann mit wem kam, und vor allem auch, wer wann mit wem ging. Meist hat sie aber kein Versteckspiel nötig. Vor allem die Herren im Auswärtigen Amt und der Reichskanzlei sind ihrem Charme erlegen.
Wer sich im Kaiserhof herumtreibt, darüber ist sie ebenfalls stets ausgezeichnet informiert. »Kaiser Adolf« nennt Bella Fromm den »Führer« der Nationalsozialisten im vertrauten Kreis. Wenn der Parteichef der NSDAP in dem Luxushotel Hof hält, ist sie mitunter in der Empfangshalle und schaut sich das Spektakel an.
Einmal, gar nicht lange her, harrte sie dafür stundenlang aus. Zunächst passierte nichts. Hitler pflegt andere immer warten zu lassen. Die aufgeregten Nationalsozialisten, in Erwartung einer Audienz, stellten sich an die Bar und stillten ihre Ungeduld mit Bier. Korrespondenten ausländischer Zeitungen schauten herein, lungerten eine Stunde herum, gaben dann auf.
Um sieben Uhr abends endlich öffneten sich Türen, und oberste Parteiführer in braunen Hemden quollen in die Lobby des Hotels. Für Fromm sah es aus wie das Treiben auf einem Jahrmarkt, weil die Männer Armbinden und Abzeichen trugen, in Hellblau und Grellrot und Goldgelb und weiß Gott welchen Farben.
Die Braunhemden stolzierten einher wie Pfauen, und sie dachte, glücklicherweise bemerken sie nicht, wie albern sie sich benehmen. Ihre Hosen erschienen ihr übertrieben weit geschnitten, als ob die Männer Flügel an den Beinen hätten.
Nach einigem Getrappel standen die Parteigänger in Reihen, ein Murmeln erfüllte den Raum, und nun manifestierte sich Adolf Hitler. Sie registrierte den ernsten, kriegerischen Ausdruck in seinem Gesicht, sah Arme emporschnellen, hörte die dröhnenden »Heil«-Rufe der Männer. Bella Fromm dachte bei sich: »Manitou«.
Adolf Hitler schritt durch den Raum, ohne nach links und rechts zu sehen. Und glitt flugs durch eine Seitentür.
Als der Spuk vorbei war, fingen einzelne Beobachter an zu lachen. Allesamt Ausländer. Die können es sich leisten zu lachen, dachte Bella Fromm.
Und heute – heute wird Hitler wieder in Berlin erwartet. Der Kaiserhof vibriert schon.
Im Hotel Kaiserhof steigt Adolf Hitler, erst seit Februar dieses Jahres deutscher Staatsbürger, aus Prinzip ab, wenn er in Berlin ist. Und in den letzten Monaten war er häufig in der Stadt: geheime Verhandlungen mit Regierungsvertretern, Vorsprechen bei Hindenburg, Konferenzen mit seinem Gefolge. In seiner Suite empfängt er hochrangige Gäste, Journalisten und politische Gegner. Das Hotel, mit seinen schweren Kronleuchtern und stuckverzierten Wänden, ist so etwas wie die Kampagnenzentrale der Nationalsozialisten, eine ideale Basis, ein Ort mit hohem Symbolwert. Die Attraktion des Baus am Wilhelmplatz ist der gläsern überwölbte Speisesaal, in dem es sich vorzüglich speisen lässt. Schon bei der Eröffnung vor fünfzig Jahren bot das Hotel allerlei Annehmlichkeiten: pneumatisch betriebene Aufzüge und eigene Heizkörper auf den 230 Zimmern. Und die Lage: unschlagbar. Man sieht von hier direkt auf die Wilhelmstraße 77.
Sobald Adolf Hitler aus dem Kaiserhof zwischen die Säulen vor dem Eingang tritt, liegt sie zum Greifen nah vor ihm: die Reichskanzlei.
Der V. Strafsenat des Reichsgerichts in Leipzig verurteilt drei Kommunisten zu hohen Gefängnisstrafen. »Hochverrat in Tateinheit mit Verbrechen gegen das Sprengstoffgesetz und Vergehens gegen das Schusswaffen- und Kriegsgerätegesetz«, so lautet die Anklage. Ein einunddreißigjähriger Schreiner erhält eine Strafe von sechs Jahren Zuchthaus und zehn Jahren »Ehrverlust« – das bedeutet unter anderem Entzug des Wahlrechts –, zwei Bauarbeiter, fünfundzwanzig und achtundzwanzig Jahre alt, müssen für je drei Jahre ins Zuchthaus. Die Polizei hatte bei den Männern 65 Kilogramm Sprengstoff, Gewehre, Pistolen und Munition entdeckt. Die Richter gehen davon aus, dass die Verurteilten damit Anschläge begehen wollten.
In Hofgeismar in der Nähe von Kassel stehen vier Nationalsozialisten vor Gericht. Sie hatten einen Panzerwagen konstruiert, mit kugelsicheren Platten und Schießscharten, den die Polizei in der Nacht zum 1. August beschlagnahmte. Die Angeklagten sagen vor Gericht aus, dass sie mit dem Wagen ihre NSDAP vor Überfällen der Kommunisten schützen wollten. Der Staatsanwalt beantragt für die SA-Männer Geldstrafen zwischen 50 und 200 Mark.
Für Harry Graf Kessler, früherer Diplomatenanwärter, heute Kunstsammler und Intellektueller, ist dies ein Tag der Freude. Endlich, Papen ist zurückgetreten. Dieser ewig lächelnde, leichtsinnige Dilettant hat in einem halben Jahr mehr Unheil angerichtet als irgendein Kanzler vor ihm. Am schlimmsten ist vielleicht, dass er den Weltkriegshelden Hindenburg bloßgestellt hat. Vor ein paar Monaten hat Kessler geschrieben, Papen sehe aus »wie ein verbiesterter Ziegenbock, der ›Haltung‹ anzunehmen versucht, dazu im seidengefütterten schwarzen Sonntagsrock. Eine Figur aus ›Alice in Wonderland‹.«
Kessler ist Mitglied des Reichsbanners, des sozialdemokratischen Schutzverbands, bei der Wahl im November hat Kessler für die Sozialdemokraten gestimmt, wie jeder fünfte deutsche Wähler. Schließlich ist die SPD eine der letzten Parteien, die versuchen, die Republik zu verteidigen.
Auch Bella Fromm wird dem scheidenden Kanzler nicht hinterhertrauern. Papen hat vor allem die Großgrundbesitzer im Osten des Landes vertreten, die in diesen Tagen nach der Macht greifen wollen und von denen sie glaubt, »dass sie die radikale Bewegung unterschätzen«. Damit meint sie die Nationalsozialisten.
Vor zwei Monaten hat sie noch einen Sonntag mit Schleicher und Papen auf der Rennbahn verbracht. Der Kanzler war dazugekommen, als sie mit dem General und einer Freundin zusammenstand. Papen küsste ihr die Hand, er war ausgesucht galant. »Frau Bella, wäre es nicht eine glänzende Idee, eine Gruppenaufnahme für Ihre Zeitung zu machen?«, fragte er. Natürlich nur, damit die Leute glauben, er stünde mit dem Reichswehrminister noch immer auf bestem Fuße, dachte Fromm. Sie wusste: Das ist alles nur Show. Längst haben sich die beiden Männer entfremdet.
Bei Karstadt’s Lebensmittel am U-Bahnhof Hermannplatz kostet an diesem 18. November das Pfund Markenbutter 1,44 Reichsmark, das Pfund Schweinebauch 64 Pfennig und der Liter Edenkobener Wein 60 Pfennig – vorausgesetzt, man erwirbt von diesem Tropfen zehn Liter.
Ein Arbeiter verdient durchschnittlich 164 Reichsmark im Monat.
»So leben sie alle Tage« – das steht auf einem Flugblatt, das die Kommunisten auf den Straßen Berlins verteilen. »Hitlers Rechnung im Kaiserhof: 1 Frühstück Mk. 23,0 – und das zwölf Mal, 276 Mark! Und 28890 Mark für das Zimmer! Und ihr müsst hungern!«
Propaganda oder Wahrheit? Ende 1931 bezahlten die Nationalsozialisten für drei Nächte und sieben Zimmer inklusive Essen und Service nachweislich alles in allem 650,86 Mark. Das ist die Wahrheit. Jedenfalls gehört der Kaiserhof zu den teuersten Hotels der Hauptstadt.
Ebenso wahr ist indes, dass Hitler oft die weithin gerühmten Speisen der Küchenchefs im Kaiserhof meidet. Man weiß ja nie, wer Übles ausheckt. Außerdem hat er eine viel bessere Option. Magda Goebbels kocht exquisit – vegetarische Gerichte, so wie ihr »Führer« es mag. Die Familie Goebbels wohnt einige Autominuten entfernt, in Charlottenburg, in Richtung des Deutschen Stadions. Die Wohnung hat hohe Wände und bietet viel Platz. Magda hat sie in die Ehe eingebracht. Bezahlt hat sie ihr Exmann, der Millionär Günther Quandt. Im Salon steht ein Flügel.
Die Adresse hat einen durchaus attraktiven Klang: Reichskanzlerplatz 2.
Joseph Goebbels ist fünfunddreißig und ein kleiner, dünner Mann; schmächtiger Oberkörper, großer Kopf, braune Augen, schwarze Haare. Er humpelt wegen eines Klumpfußes, Folge einer Knochenmarksentzündung in der Kindheit. Als »Schrumpfgermanen« verspotten ihn seine Gegner. Doch am Rednerpult verströmt er Kraft, ein Demagoge, der in Berlin Tausende neue Anhänger für die Nationalsozialisten gewonnen hat. Im November 1926 übernahm er in der Hauptstadt einen völlig zerstrittenen Haufen. Nun herrscht er über den Gau Groß-Berlin.
Nicht wenige Berliner fürchten diesen Menschen wegen seiner Radikalität, seiner Skrupellosigkeit, seiner Schläue. Goebbels ist krankhaft ehrgeizig, größenwahnsinnig, arbeitswütig. Und süchtig nach Anerkennung. Vor allem geht es ihm um die Gunst eines Mannes: Adolf Hitler. Dessen Aufstieg wird er mit allen Mitteln orchestrieren. An dessen Seite wird dereinst, sobald der »Führer« der Führer aller Deutschen sein wird, seine eigene Brillanz scharf leuchten. Hitler? »Ein fabelhafter Mann!«, notiert Goebbels im November 1932. »Für ihn lasse ich mich vierteilen.« Er hofft, dass Hitler und Hindenburg, wenn sie sich endlich wieder persönlich gegenüberstehen, einander die Hände reichen, sich in die Augen schauen, Vertrauen zueinander fassen. Hindenburg nenne Hitler, so heißt es, abfällig den »böhmischen Gefreiten«.
Auf dem Flugplatz in Tempelhof landet um ein Uhr die Sondermaschine aus München. An Bord sind Adolf Hitler, Wilhelm Frick, Chef der NSDAP-Fraktion im Reichstag, Gregor Strasser, Organisationsleiter der Partei – und Ernst »Putzi« Hanfstaengl, der Auslandspressechef. Sie sind gekommen, um über die Machtübernahme zu verhandeln. Vom Flughafen lässt sich Hitler zu Goebbels nach Hause fahren. Hier informiert der Berliner Gauleiter seinen Gast, was in den vergangenen Tagen passiert ist.
Die Frage ist, was Kurt von Schleicher vorhat. Der Einflüsterer Hindenburgs. Hanfstaengl nennt den Reichswehrminister in Gesprächen mit englischsprachigen Informanten nur »Mr Creeper«, was nichts anderes heißt als: Herr Schleicher. Aber es klingt wie ein skurriler Name aus einem Roman von Charles Dickens. Oh, Hanfstaengl ist ein Mann der Kultur, Erbe eines bekannten Kunsthändlers, sein Klavierspiel lustvoll, allerdings rustikal. Wie kein Zweiter vermag er Wagners Prachtarien so in die Tasten zu hämmern, dass es Hitler im Innersten berührt.
Wie konnte der gebürtige Österreicher Adolf Hitler in diesem Jahr so rasch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, ohne die er bei der Reichspräsidentenwahl gar nicht hätte antreten dürfen? Das fragen sich nicht wenige Menschen in Deutschland, auch der SPD-Landtagsabgeordnete Oskar Thielemann will das wissen.
Die offizielle Begründung lautet: Der Freistaat Braunschweig habe Hitler zum Regierungsrat ernannt und ihm wegen »wertvoller Dienste« die Staatsbürgerschaft verliehen. Wertvolle Dienste? Welche denn? Thielemann hat eine Anfrage an das von Nationalsozialisten geführte Innenministerium des Freistaats gestellt: »Welche Aufträge hat der Regierungsrat Hitler bisher der braunschweigischen Wirtschaft zuführen können und welche Arbeiten hat er bisher überhaupt für den Staat Braunschweig geleistet?«
Gestern ist die Antwort eingetroffen: »Der Regierungsrat Hitler hat den Herrn braunschweigischen Minister des Innern nach dessen Mitteilung als Sonderberater in wirtschaftlichen Fragen, insbesondere in der Frage der Erhaltung der Unterharzer Erzbergbaues, wertvolle Dienste geleistet.«
Hitler, ein Experte für Bergbau? Das dürfte nicht nur den SPD-Abgeordneten überraschen.
Abraham Plotkin ist sich selbst ein Rätsel. Schreibend will er seinen eigenen Antrieb ergründen, will er begreifen, was er in Europa sucht. Als er ein Kind war, flüchtete seine Familie vor »den dunklen Schatten des Terrors« im zaristischen Russland nach Amerika. »Nun gehe ich zurück. Warum? Ich kann es nicht sagen. Vielleicht gehe ich zurück, um dem Stumpfsinn in den Städten meines Landes zu entkommen.« Und weiter: »Vielleicht werde ich mich später, falls ich mir je darüber im Klaren sein sollte, albern fühlen. Man kann niemals davor sicher sein, ob man nicht in Wirklichkeit ein Dummkopf ist.«
Um Mitternacht kehrt Hitler in die Wohnung am Reichskanzlerplatz zurück. Das Ehepaar Goebbels erwartet ihn schon. Erst erzählt der Gast, der ganz bei sich zu sein scheint, noch ein wenig vom Tag. Die Regierung werde morgen erneut einen »Burgfrieden« verkünden, bis zum 2. Januar soll Ruhe herrschen, keine Aufmärsche, keine Großkundgebungen unter freiem Himmel. Gregor Strasser allerdings bereitet dem »Führer« Verdruss – von seinem Organisationsleiter spricht Hitler neuerdings mit Verachtung. Doch genug der Bedenken, es soll noch Musik geben. Schließlich steht der Flügel nicht umsonst im Salon, und Goebbels spielt gern mal Akkordeon. Musik sei die einzige Entspannung, bemerkt er, die sich Hitler nach nervenzerreibenden Kämpfen gönne.
Samstag, 19. November
Heute geht Hitler zu Hindenburg
Vossische Zeitung
Nach Papens Rücktritt: Keine halben Entscheidungen! Die Forderung in der geschichtlichen Stunde
Völkischer Beobachter
Einheitsfrontappell des Zentralkomitees der KPD:
Vereinigt euch zum gemeinsamen Kampf gegen die faschistische Diktatur!
Die Rote Fahne
Die Verhandlungen zur Regierungsbildung werden mit Ernsthaftigkeit und Fleiß fortgesetzt, mag Hindenburg auch fünfundachtzig sein. Auf der Besucherliste des Präsidenten steht heute ein Gast, den er nur widerwillig empfängt. Adolf Hitler hatte Staatssekretär Otto Meissner, den wichtigsten Mitarbeiter des Präsidenten, um eine Unterredung mit Hindenburg unter vier Augen gebeten. Sie vereinbaren strikte Vertraulichkeit.
Um halb zwölf stellt sich der Parteichef der Nationalsozialisten wie verabredet ein. Der Präsident macht Hitler klar: Er wolle an dem Grundsatz einer überparteilichen Regierung festhalten. Eine Regierung, die von Herrn Hitler geführt würde, wäre aber eine Parteienregierung. Hitler könne doch seine Ziele auch anders erreichen, in einer von einem überparteilichen Manne geleiteten Regierung. Dafür würde Hindenburg seiner Partei einige Ministerposten gewähren.
Hitler, angereist mit den größten Erwartungen, hat Mühe, seine Empörung zu verbergen. Er könne nur in ein Kabinett eintreten, wenn er die politische Führung übernehme. Und er droht: »Gewiss kann man noch einige Zeit mit einem überparteilichen Kabinett autoritär regieren, gestützt auf die Machtmittel des Staates. Aber lange würde das nicht dauern, bis Februar wäre eine neue Revolution da, und Deutschland würde dann aufhören, ein außenpolitischer Machtfaktor zu sein.«
Der Präsident verweigert sich.
Dabei wahrt das Staatsoberhaupt die Form. Vor ihm sitzt schließlich ein Kanzlerkandidat – theoretisch zumindest.
Das Gespräch dauert nicht wie vereinbart fünfzehn, sondern fünfundsechzig Minuten. Es ist erst ihre vierte persönliche Unterredung überhaupt. Meissner merkt sich so etwas. Meissner merkt sich alles. Hinterher erzählt ihm Hindenburg jede Wendung des Gesprächs.
Demnach hat Hitler den Vorschlag auf den Tisch gebracht, dass Hindenburg ein »Ermächtigungsgesetz« unterzeichnen könnte, ein vor Jahren etwa unter dem liberalen Kanzler Gustav Stresemann bewährter, legaler Schritt, um einem ohne Mehrheit regierenden Kanzler weitgehende Vollmachten zu geben und den Präsidenten aus dem Kleinklein des politischen Alltags herauszuhalten. Es bedeutete jedoch auch die Ausschaltung des Parlaments. Gewiss, unter Stresemann 1923 waren es andere Zeiten, der Ruhrkampf gegen die Franzosen, die Hyperinflation, aber es gab damals ebenso wie heute schwere innere Unruhen, von rechts wie links verursacht.
Ein Ermächtigungsgesetz. Das wäre vielleicht ein Weg.
Hitler verlässt gegen halb eins mittags die Reichskanzlei und steigt in seinen Wagen. Auf der Wilhelmstraße vor der Einfahrt haben sich viele Menschen versammelt. Sie durchbrechen die Ketten der Polizisten und drängen zum Tor. Zögerlich bildet sich eine Gasse. Nur schrittweise kommt der Parteiführer voran. Vor dem Hotel Kaiserhof jubelt die Menge. »Heil Hitler!«, brüllen die Menschen, vor allem Männer sind es, in braunen Hemden.
Hitler baut sich nicht vor ihnen auf, hat nichts zu vermelden, er verzieht sich ins Hotel, und zurück bleibt das Gemurmel der Hoffnung und der Ungeduld. Nur kurz zeigt sich ihr »Führer« am Fenster.
Um fünf Uhr am Nachmittag stellt sich Fritz Schäffer von der Bayerischen Volkspartei in der Wilhelmstraße 77 beim Reichspräsidenten ein. Hitler, findet Schäffer, sei weniger bedenklich als dessen Umgebung. Der Herr brauche indes ein starkes Gegengewicht.
Danke, sagt Hindenburg und grübelt weiter.
Jede Partei ist nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht, und dazu sind die schwer einzuschätzenden persönlichen Ressentiments oder Abhängigkeiten der handelnden Figuren zu bedenken. Wie sähe eine Entscheidung aus, die die Deutschen nicht spaltet, sondern miteinander versöhnt? Das Volk zu einen, das ist das Wichtigste.
In den Kammersälen in der Teltower Straße beginnt um zwei Uhr der 19. Bezirksparteitag der KPD für Berlin-Brandenburg-Lausitz-Grenzmark. Mehr als eine Million Wähler der KPD leben hier, es ist der wichtigste Parteibezirk Deutschlands. Rund 800 Delegierte haben sich eingefunden. Die Kommunisten sind selbstbewusst. Dass die Wilhelmstraße in Turbulenzen ist, wird ihnen immer mehr Wähler zutreiben.
Ganz oben auf der Tagesordnung steht heute: »Die politische Lage und unsere nächste Aufgabe«. Es referiert der Genosse Walter Ulbricht, Mitglied im Zentralkomitee der KPD. Während der großen Arbeitsniederlegung bei den Verkehrsbetrieben in Berlin hatte er Anfang November gemeinsam mit Joseph Goebbels die Streikleitung übernommen. Nun warnt Ulbricht vor einer Regierungsbeteiligung der NSDAP.
Aber eigentlich geht es den Kommunisten vor allem um einen Feind: die Sozialdemokraten. Um jene Genossen, die den wahren sozialistischen Weg verraten haben – so sieht es zumindest die KPD, behauptet es ihre Propaganda. Längst nicht alle Sympathisanten der Partei verstehen, warum ihre Anführer entschlossener gegen die Sozen ins Feld ziehen als gegen die Nazis. Frei bestimmen, wie sie mit den Sozialdemokraten umgeht, kann die Spitze der deutschen KPD aber ohnehin nicht. Moskau entscheidet über die Strategie. Und Moskaus Strategie sieht vor, dass zunächst die Nationalsozialisten in Deutschland die Regierung übernehmen. Haben nicht Marx und Engels vorausgesagt, dass die Reaktion dem Kommunismus den Weg zur Macht ebnen werde? Sobald die NSDAP in Deutschland herrscht, werden Abertausende Arbeiter zur KPD überlaufen.
Das ist der Plan.
Hören die Genossen in der Sowjetunion zu, wenn Hitler und Goebbels öffentlich reden? Einmal an der Macht, wollen die Nationalsozialisten für immer bleiben – und den Marxismus ausrotten.
In Hindenburgs Büro in der Wilhelmstraße geht ein Brief ein. Es sind längst nicht alle deutschen Wirtschaftsführer, die ihn unterschrieben haben, aber eine ansehnliche Zahl. »Ew. Exzellenz, Hochverehrter Herr Reichspräsident! Gleich Euer Exzellenz durchdrungen von heißer Liebe zum deutschen Volk und Vaterland, haben die Unterzeichnenden die grundsätzliche Wandlung, die Eure Exzellenz in der Führung der Staatsgeschäfte angebahnt haben, mit Hoffnung begrüßt.« Einer, der den Brief unterzeichnet hat, ist der Kölner Bankier Kurt Freiherr von Schröder, einflussreich im Rheinland, mit Hitler hat er noch viel vor.
Von Konzernlenkern wie Fritz Thyssen, Erwin Merck und dem früheren Bankier Hjalmar Schacht kommen gleichlautende Briefe. Auch sie schreiben, dass »die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei grundsätzlich« die Politik Hindenburgs bejahe. »Die Übertragung der verantwortlichen Leitung eines mit den besten sachlichen und persönlichen Kräften ausgestatteten Präsidialkabinetts an den Führer der größten nationalen Gruppe wird die Schlacken und Fehler, die jeder Massenbewegung notgedrungen anhaften, ausmerzen und Millionen Menschen, die heute abseits stehen, zu bejahender Kraft mitreißen.«
Hindenburg ist sehr beeindruckt, wie er gegenüber Vertrauten zu erkennen gibt, vor allem auch weil Eberhard Graf von Kalckreuth unterschrieben hat, Präsident des »Reichslandbundes«, einer der einflussreichsten Großgrundbesitzer aus den Ostgebieten Preußens überhaupt.
Die »Schlacken und Fehler« werden von den Unternehmenslenkern nicht näher erläutert.
Der nationalkonservative Abgeordnete Reinhold Georg Quaatz ist nervös. Wenn Hitler und der Wehrminister Schleicher paktieren, könnten sie womöglich eine Mehrheit im Reichstag hinter sich versammeln. Und so das Wohlwollen des Reichspräsidenten erhalten. DNVP-Mann Quaatz notiert: »Dann werden wir an die Wand gequetscht.«
Alle reden von Schleicher, Schleicher, Schleicher. Er hält nicht viel von diesem Mann des Militärs. Ob der in der Lage ist, einen großen Plan zäh durchzuziehen? Und Quaatz hat gehört, dass Schleicher krank sein soll.
Was meinen Sie?, hat er vorhin Staatssekretär Meissner gefragt, will Schleicher nun Kanzler werden? Meissner und Quaatz kennen sich gut. Man redet offen.
»Schleichers Absichten sind ja immer unklar«, antwortete der Berater des Präsidenten, er selbst lehne diesen Mann als Präsidialkanzler »scharf ab«. Aber so komme es ohnehin nicht, denn Hindenburg wolle den General für ein Militärregime aufsparen.
Hitlers Besuch beim Reichspräsidenten ist schon in aller Munde. Harry Graf Kessler genießt am Abend einen intensiven Meinungsaustausch. Zum Diner geladen hat Georg Bernhard, der zur Verlagsleitung bei Ullstein gehört, ein Verteidiger des freien Wortes und Gegner der Nationalsozialisten. Einer wie Harry Graf Kessler. Auf Bernhards Einladung erscheinen auch: der Autor Heinrich Mann, der in seinem »Untertan« so einzigartig mit dem preußischen Militarismus abgerechnet hat. Wolfgang Huck, der Zeitungsverleger, einer der größten Steuerzahler Berlins. Hans Schäffer, der noch bis zum Frühjahr als Staatssekretär im Reichsfinanzministerium für den Staatshaushalt zuständig war und nun den Ullstein-Verlag leitet. Und Bernhard Weiß, der von Papen aus dem Amt gejagte ehemalige Polizeichef von Berlin. Ebenso Rudolf Hilferding, marxistischer Theoretiker, der für die SPD gleich zweimal Finanzminister war. Dazu gesellen sich weitere Politiker, Publizisten und diplomatisches Personal. Eine illustre Runde, die viel Neues vernimmt – und gewöhnlich den Rest präzise ahnt.
Aber auch hier erfährt Kessler nicht wirklich, was gerade bei Hindenburg vorgeht. Nichts als Geraune. Huck sagt, die Unterredung zwischen Hindenburg und Hitler sei manierlich verlaufen – ganz anders als bei vergangenen Treffen. Bernhard verkündet: Papens Rücktritt ist nur ein Manöver! Der komme wieder. Und gleich mehrere Herren halten einen Generalstreik für unvermeidlich, sollten die Nationalsozialisten die Macht übernehmen.
Aber wer wird nun Kanzler?
»Niemand wusste etwas«, schreibt Kessler am Ende des langen Abends in sein Tagebuch. »Alles ist mehr oder weniger dem Zufall und der guten oder schlechten Laune von vier oder fünf Personen preisgegeben.«
Hindenburg, Meissner, Schleicher, Hitler – und Papen? Oder denkt Harry Graf Kessler noch an andere? Mit transparenter demokratischer Willensbildung hat das jedenfalls nichts zu tun.
Um Mitternacht tritt Joseph Goebbels vor die SA-Führer in Berlin, die Sturmabteilung hat zum »Kameradschaftsabend« geladen, doch kameradschaftlich geht es nicht zu. Nach Monaten des Wartens wollen die Parteisoldaten endlich an die Macht. Goebels weiß, viele von ihnen hoffen auf Posten, auf Belohnung für ihre Treue. Sie sind es, die seit langer Zeit die Knochen hinhalten, die sich für »Führer« und Partei ins Krankenhaus prügeln lassen oder ihrerseits Gegner ins Krankenhaus prügeln. Auch für sie endete der August, da Hitler kurz vor der Kanzlerschaft schien, mit einer bitteren Enttäuschung.
Jetzt aber muss es klappen, Hitler muss endlich Kanzler werden. Nicht nur die SA hält die Spannung kaum mehr aus.
»Die ganze Stadt steht in einer zitternden Aufregung«, so empfindet es Goebbels.
Sonntag, 20. November
Papens Erbe:
S.P.D.-Drohungen mit politischem Massenstreik – Verstärkte Bürgerkriegshetze der Kommunisten
Völkischer Beobachter
Das ist nämlich so: die rote Wand
wird immer höher und breiter.
Der Erste hat sich den Kopf eingerannt!
Nun bitte, der nächste Reiter!
Die Rote Fahne