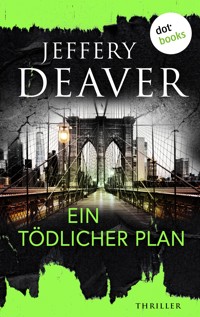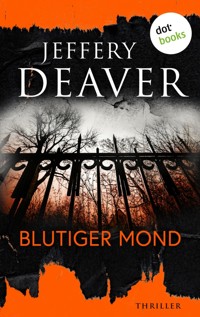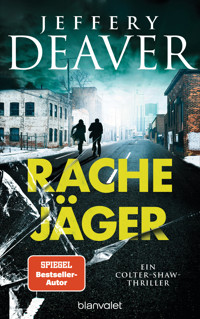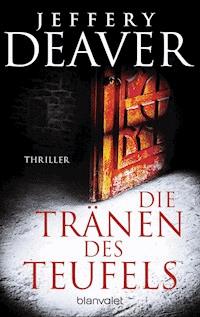
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der tödliche Countdown läuft
Am Silvestermorgen feuert in Washington, D.C. ein Unbekannter in einer U-Bahn-Station wild in die Menge und tötet 23 Menschen. Kurz darauf fordert der Drahtzieher »Digger« in einem Erpresserbrief 20 Millionen Dollar, andernfalls findet bis Mitternacht alle vier Stunden ein weiteres Blutbad statt. Als der einzige Kontaktmann Diggers bei einem Verkehrsunfall stirbt, kann nur noch einer dem FBI helfen: Handschriftenexperte Kincaid Parker, der mithilfe des Erpresserbriefs Digger auf die Spur kommen soll. Parker wollte seinen Kindern zuliebe eigentlich Abstand von der Verbrecherjagd gewinnen, doch nun wird er bald selbst zur Zielscheibe eines skrupellosen Killers …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Am Silvestermorgen feuert ein Unbekannter in einer U-Bahn-Station in Washington, D.C. mit einer schallgedämpften Maschinenpistole wahllos in die Menge und tötet dreiundzwanzig Menschen. Eine Stunde später wird Bürgermeister Kennedy ein Erpresserbrief überbracht: Entweder werden 20 Millionen Dollar an »Digger«, den Drahtzieher des Blutbades, gezahlt oder der Täter wird bis Mitternacht alle vier Stunden ein weiteres Gemetzel anrichten. Natürlich wird das FBI eingeschaltet. Hochroutiniert und schlagkräftig steht es wenige Stunden später kurz vor einer Verhaftung. Da passiert das Unfassbare: Bei einem völlig alltäglichen Verkehrsunfall stirbt der einzige Komplize und Kontaktmann Diggers. Jetzt bleibt nur noch eine Spur: der handgeschriebene Erpresserbrief. Verzweifelt bittet die ermittelnde FBI-Agentin Margaret Lukas ihren früheren Kollegen, den Handschriftenexperten Kincaid Parker, diesen Brief zu analysieren. Doch Parker zögert. Als alleinerziehender Vater, der mitten in einem Sorgerechtsstreit steckt, möchte er endlich Abstand von der Welt der Verbrecherjagd gewinnen. Schließlich stimmt er zu – unter der Voraussetzung, dass niemand von seiner Mitarbeit wissen darf. Doch während Kincaid in mühsamer Kleinarbeit dem Schriftstück Information um Information abringt, scheint es, als sei der Mörder ihm immer einen Schritt voraus. Und schon bald kriecht die Gefahr bis in Parkers Familienleben …
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat der von seinen Fans und den Kritikern gleichermaßen geliebte Jeffery Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet
und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Jeffery Deaver
Die Tränen
des Teufels
Thriller
Deutsch von Gerald Jung
Mit Dank
an Madelyn
I
DER LETZTE TAG DES JAHRES
Durch die sorgfältige Analyse eines anonymen Briefes lässt sich die Anzahl seiner möglichen Urheber drastisch einschränken und einige in Frage kommende Urheber dürfen sofort ausgeklammert werden. Die Verwendung eines Semikolons oder der korrekte Gebrauch eines Apostrophs schließt eine ganze Gruppe von Urhebern aus.
OSBORN AND OSBORN,
Probleme im Umgang
mit zweifelhaften Dokumenten
1
8:55
Der Digger ist in der Stadt.
Der Digger sieht aus wie du, der Digger sieht aus wie ich. Er geht durch die winterlichen Straßen, so wie alle, die Schultern in der feuchten Dezemberluft hochgezogen, Hals und Kinn im Mantelkragen verborgen.
Er ist weder groß noch klein, weder dick noch dünn. Seine Finger in den dunklen Handschuhen könnten fleischig sein, aber das sind sie nicht. Seine Füße sehen groß aus, aber vielleicht liegt das auch nur an den Schuhen.
Würde man ihm in die Augen schauen, würde man weder ihre Form noch ihre Farbe wahrnehmen, sondern allein die Tatsache, dass sie nicht ganz menschlich wirken, und wenn der Digger deinen Blick erwidert, könnten seine Augen das Letzte sein, was du auf dieser Welt siehst.
Er trägt einen langen schwarzen Mantel, vielleicht auch dunkelblau, und keine Menschenseele auf der Straße bemerkt, wie er vorübergeht, obwohl es viele Zeugen gibt – auf den Straßen von Washington, D.C. wimmelt es in der morgendlichen Rushhour nur so von Menschen.
Der Digger ist in der Stadt, und es ist Silvester.
Mit einer Einkaufstüte vom Bauernmarkt in der Hand weicht der Digger Paaren, einzelnen Passanten und Familien aus, geht unbeirrt weiter. Vor sich sieht er die Metro-Station. Man hat ihm gesagt, er solle Punkt neun Uhr morgens dort sein, und so wird es sein. Der Digger kommt nie zu spät.
Die Tüte in seiner vielleicht fleischigen Hand ist schwer. Sie wiegt fünf Kilo, doch bei der Rückkehr in sein Motelzimmer wird sie deutlich leichter sein.
Ein Mann rempelt ihn an, lächelt und sagt: »Entschuldigung«, aber der Digger würdigt ihn keines Blickes. Der Digger sieht niemals jemanden an und will auch nicht, dass man ihn ansieht.
»Niemand darf …« Klick. »… dein Gesicht sehen. Schau weg. Nicht vergessen!«
Ich vergesse es nicht.
Klick.
Schau auf die Lichter, denkt er, schau auf die … klick … auf die Neujahrsdekoration. Dicke Babys in wehende Luftschlangen gehüllt, und da ist natürlich auch Gevatter Zeit.
Komische Dekoration. Komische Beleuchtung. Komisch, wie hübsch das aussieht.
Er ist am Dupont Circle, dort, wo Geld und Kunst zu Hause sind, wo sich die jungen, eleganten Menschen herumtreiben. Der Digger weiß das, aber er weiß es nur, weil ihm der Mann, der ihm alles sagt, vom Dupont Circle erzählt hat.
Er hat den Eingang zum U-Bahn-Schacht erreicht. Der Morgenhimmel ist bedeckt, und da es Winter ist, liegt ein trübes Grau über der Stadt.
Der Digger denkt an seine Frau, er denkt an Tage wie diesen. Pamela mochte die Dunkelheit und die Kälte nicht, deshalb … klick … deshalb … Was hat sie deshalb gemacht? Ach ja. Sie hat rote Blumen und gelbe Blumen gepflanzt.
Er richtet den Blick auf die Metro-Station und denkt an ein Bild, das er einmal irgendwo gesehen hat. Er und Pamela waren in einem Museum. Sie schauten sich ein altes Gemälde an.
Und Pamela sagte: »Das ist unheimlich. Lass uns gehen.«
Es war ein Bild vom Eingang zur Hölle.
Der Metro-Tunnel befindet sich zwanzig Meter unter der Erde. Manche Fahrgäste gleiten hinab, andere kommen herauf. Es sieht genau aus wie auf jenem Bild.
Der Eingang zur Hölle.
Lauter junge Frauen mit kurz geschnittenem Haar und Aktentaschen unterm Arm. Lauter junge Männer mit Sporttaschen und Handys.
Und da ist der Digger mit seiner Einkaufstüte.
Vielleicht ist er dick, vielleicht ist er dünn, jedenfalls sieht er aus wie du, sieht er aus wie ich. Der Digger fällt nicht auf, und genau das ist der Grund, weshalb er seine Aufgaben so hervorragend erledigt.
»Du bist der Beste«, hat ihm der Mann, der ihm alles sagt, im letzten Jahr gesagt. »Du bist der … klick, klick … der Beste.«
Um 8:59 steht der Digger neben der Rolltreppe, die nach unten führt und voller Leute ist, die alle hinunter in den Höllenschlund fahren.
Er greift in die Tüte und legt die Finger um den Griff der Pistole, die eine Uzi oder eine Mac-10 oder eine Intertech sein könnte, die aber eindeutig fünf Kilo wiegt und mit einem Hunderter-Magazin 22er-Langwaffenmunition geladen ist.
Der Digger hat Appetit auf eine Suppe, lässt sich davon jedoch nicht ablenken.
Weil er der … klick … der Beste ist.
Er lässt den Blick über die Menge schweifen, aber er sieht niemanden an, sieht nur zu, wie die Leute warten, bis sie an der Reihe sind, die Rolltreppe nach unten zu betreten, die sie in die Hölle bringt. Er sieht weder die Männer mit den Telefonen noch die Frauen mit den Frisuren von Supercuts an, dem schicken Laden, bei dem sich auch Pamela immer die Haare schneiden ließ. Auch die Familien sieht er nicht an. Er presst die Tüte an die Brust, so wie es jeder mit seinen Feiertagseinkäufen machen würde. Eine Hand auf dem Griff der Waffe, was auch immer es für eine sein mag, die andere – außerhalb der Tüte – um etwas gekrümmt, das man für einen Laib Brot halten könnte, Brot, das hervorragend zur Suppe passen würde, aber in Wirklichkeit ein mit Mineralwolle und Gummi-Ummantelung bestückter leistungsstarker Schalldämpfer ist.
Seine Armbanduhr piept.
Neun Uhr.
Er zieht den Abzug durch.
Mit einem zischenden Geräusch arbeitet sich die Geschossgarbe die Rolltreppe hinunter, durch die Fahrgäste, die unter dem Beschuss nach vorne taumeln. Mit einem Mal wird das pst pst pst der Maschinenpistole von Schreien übertönt.
»Oh Gott, Achtung, mein Gott was ist denn los, ich bin verletzt, ich falle.« Ach, all so was.
Pst pst pst.
Dazu das grässliche Knallen der Fehlschüsse, der Kugeln, die auf Metall und Fliesen treffen. Dieses Geräusch ist unangenehm laut. Die Treffer klingen viel gedämpfter.
Alle Leute drehen sich um, niemand weiß, was eigentlich geschieht.
Auch der Digger sieht sich um. Alle runzeln verwirrt die Stirn. Auch er runzelt verwirrt die Stirn.
Keiner kommt auf den Gedanken, dass hier geschossen wird. Sie glauben, jemand sei gestürzt und habe eine Kettenreaktion ausgelöst, in deren Folge die Leute aufeinander fallen und die Rolltreppe hinunterpurzeln. Scheppern und Krachen, wenn Handys, Aktenmappen und Sporttaschen den Händen der Opfer entgleiten.
Die hundert Schuss sind in wenigen Sekunden weg.
Niemandem fällt der Digger auf, der sich wie alle anderen verdutzt umschaut.
Und dabei die Stirn runzelt.
»Schnell einen Krankenwagen Polizei, Polizei, großer Gott dieses Mädchen braucht Hilfe, sie braucht Hilfe, kann denn keiner helfen o mein Gott, er ist tot um Gottes willen, ihr Bein, ihr Bein, mein Kind, mein Kind …«
Der Digger lässt die Einkaufstüte sinken. Sie hat nur am Boden, dort, wo die Kugeln herausgekommen sind, ein kleines Loch. In der Tüte liegen die vielen heißen Metallhülsen.
»Abschalten, abschalten, schaltet die Rolltreppe aus, o mein Gott, so helft doch die Rolltreppe anhalten, sie werden alle zerquetscht …«
Und all so was.
Der Digger sieht hin. Weil alle hinsehen.
Aber es ist nicht leicht, in die Hölle zu blicken. Unter ihm stapelt sich ein Haufen blutiger Körper, wird immer höher, die Leiber winden sich … Manche leben noch, andere sind tot, einige versuchen verzweifelt, sich aus dem ständig wachsenden Haufen am Fuß der Rolltreppe herauszuarbeiten.
Der Digger schiebt sich vorsichtig rückwärts in die Menge. Und dann ist er verschwunden.
Er ist sehr gut im Verschwinden. »Wenn du gehst, mach es wie ein Chamäleon«, hatte der Mann gesagt, der ihm alles sagt. »Weißt du, was ein Chamäleon ist?«
»Eine Eidechse.«
»Genau.«
»Die ihre Farbe verändert. Habe ich im Fernseher gesehen.«
Der Digger auf den überfüllten Bürgersteigen. Leute rennen hin und her. Komisch.
Komisch …
Niemand bemerkt den Digger.
Der wie du und ich und eigentlich völlig unauffällig aussieht, mit einem Gesicht, weiß wie ein Morgenhimmel – oder dunkel wie der Eingang zur Hölle.
Im Gehen – langsam, langsam – denkt er an sein Motelzimmer. Wo er die Pistole nachladen, die Mineralwolle im Schalldämpfer austauschen und sich dann mit einer Flasche Wasser und einem Teller Suppe in seinen gemütlichen Stuhl setzen wird. Dort bleibt er dann bis zum Nachmittag sitzen und ruht sich aus, und dann – es sei denn, der Mann, der ihm alles sagt, lässt ihm eine Nachricht zukommen, die ihn davon abhält – zieht er wieder seinen langen schwarzen oder blauen Mantel an und geht hinaus.
Um das, was er eben getan hat, wieder zu tun.
Es ist Silvester. Und der Digger ist in der Stadt.
Während immer mehr Krankenwagen zum Dupont Circle rasten und Rettungsmannschaften sich durch den entsetzlichen Berg von Körpern in der Metro-Station gruben, spazierte Gilbert Havel ungefähr drei Kilometer entfernt in Richtung Rathaus.
An der Ecke Fourth und D Street, neben einem schlafenden Ahornbaum, blieb Havel stehen, öffnete den Briefumschlag, den er bei sich trug und las die Mitteilung ein letztes Mal durch.
Bürgermeister Kennedy –
Das Ende ist nacht. Der Digger ist los, und es gibt keine Möglichkeit, ihn zu hintern. Er wird wieder töten – um vier, 8 und Mitternacht, wenn Sie nicht zahlen.
Ich will haben $ 20 Millionen Dollars in bar, die Sie in eine Tasche legen und es drei Kilometer südlich der Rt 66 auf der West Seite des Beltway deponieren. Mitten auf dem Feld. Zahlen Sie das Geld zu mich bis 1200 Uhr. Nur ich das weiß, wie der Digger zu hintern ist. Wenn Sie mich Festnehmen, tötet er weiter. Wenn Sie mich töten, tötet er weiter.
Falls Sie mir nicht glauben: Einige der Kugeln des Diggers sind schwarz angemalt. Nur ich weiß das.
Das war, fand Havel, eine dermaßen geniale Idee, wie sie sonst keiner hätte. Monatelange Planung. Jede mögliche Reaktion der Polizei und des FBI vorausgesehen. Ein Schachspiel.
Von diesem Gedanken beschwingt, schob er die Nachricht zurück in den Umschlag, verschloss ihn, ohne ihn zuzukleben und spazierte weiter. Havel ging leicht vornübergebeugt, die Augen nach unten gerichtet, eine Haltung, die seine Körpergröße von einsfünfundachtzig kaschieren sollte. Doch es fiel ihm schwer. Eigentlich ging er viel lieber aufrecht und starrte die Leute an, bis sie wegsahen.
Die Sicherheitsvorkehrungen im Rathaus, am Judiciary Square Nummer 1, waren geradezu lächerlich. Niemand nahm Notiz von ihm, als er am Eingang des unscheinbaren steinernen Gebäudes vorbeiging und vor einem Zeitungsautomaten stehen blieb. Er schob den Umschlag unter das Gestell, drehte sich langsam um und schlenderte in Richtung E Street davon.
Ziemlich warm für Silvester, dachte Havel. Die Luft roch nach Herbst; verfaulte Blätter und feuchter Rauch. Der Geruch rief eine Reihe undeutlicher Kindheitserinnerungen in ihm wach. Bei einem Telefonapparat an der Ecke blieb er stehen, ließ ein paar Münzen hineinfallen und wählte eine Nummer.
»Rathaus. Sicherheitsdienst«, meldete sich eine Stimme.
Havel hielt ein Tonbandgerät an den Hörer und drückte auf PLAY. Eine computergenerierte Stimme sagte: »Briefumschlag direkt vor dem Gebäude. Unter dem Zeitungsständer der Washington Post. Sofort lesen. Es geht um die Metro-Morde.« Dann hängte er auf, überquerte die Straße, ließ das Bandgerät in einen Papierbecher fallen und warf den Becher in einen Abfalleimer.
Havel betrat eine Imbissstube und setzte sich in eine Nische am Fenster, von wo er einen hervorragenden Blick auf den Zeitungsautomaten und den Seiteneingang des Rathauses hatte. Er wollte sichergehen, dass der Umschlag abgeholt wurde; was auch prompt geschah, noch bevor Havel sich die Jacke ausgezogen hatte. Er wollte auch sehen, wer alles kam, um sich mit dem Bürgermeister zu beratschlagen. Und ob eventuell Reporter aufkreuzten.
Als die Bedienung an seinen Tisch kam, bestellte er Kaffee und, obwohl es immer noch Frühstückszeit war, ein Steak-Sandwich, das teuerste Gericht auf der Karte. Warum auch nicht? Bald schon würde er ein sehr reicher Mann sein.
2
10:00
»Papa, erzähl mir vom Bootmann.«
Parker Kincaid zögerte. Dann legte er die schmiedeeiserne Bratpfanne, die er gerade abspülte, zur Seite.
Er hatte sich angewöhnt, auf keine Frage der Kinder besorgt zu reagieren – zumindest nicht besorgt zu wirken. Deshalb lächelte er auch jetzt seinen Sohn an, während er sich die Hände mit Papiertüchern abtrocknete.
»Vom Bootmann?«, fragte er den Neunjährigen. »Also gut. Was willst du denn wissen?«
Die Küche in Parkers Haus in Fairfax, Virginia, duftete herrlich nach dem Feiertagsessen, das noch nicht ganz fertig war. Zwiebeln, Salbei, Rosmarin. Der Junge schaute zum Fenster hinaus. Er sagte nichts.
»Na los«, ermutigte ihn Parker. »Raus mit der Sprache.«
Robby war blond und hatte die blauen Augen seiner Mutter geerbt. Er trug ein dunkelrotes Hemd von Izod und eine braune Hose, die auf der Hüfte von einem Ralph-Lauren-Gürtel gehalten wurde. Seine eigensinnige Haartolle hing an diesem Morgen nach Steuerbord.
»Also«, setzte der Junge an, »ich weiß ja … ich weiß ja, dass er tot ist und alles …«
»Das stimmt«, erwiderte Parker, sagte von sich aus aber nicht mehr dazu. (»Erzähl den Kindern nie mehr als sie wissen wollen«, lautete eine der Regeln aus Parker Kincaids Handbuch für Alleinerziehende – einem Nachschlagewerk, das allein in seinem Kopf existierte, das er aber trotzdem mehrmals am Tag zu Rate zog.)
»Es ist nur … weil draußen … manchmal sieht es aus wie er. Ich … ich hab rausgekuckt, und ich hab gedacht, ich hätt ihn gesehen.«
»Und was machen wir, wenn du dieses komische Gefühl hast?«
»Ich hole meinen Schild und meinen Helm«, zitierte der Junge, »und wenn es dunkel ist, mache ich das Licht an.«
Parker blieb stehen. Normalerweise ging er, wenn er sich mit seinen Kindern unterhielt, auf Augenhöhe mit ihnen, aber beim Thema Bootsmann hatte ein Therapeut Parker empfohlen, stehen zu bleiben – damit sich der Junge in der Gegenwart eines starken, beschützenden Erwachsenen sicher fühlte. Parker Kincaid hatte wirklich einiges an sich, das einem ein Gefühl von Sicherheit vermittelte. Mit seinen knapp vierzig Jahren und einer Körpergröße von etwas über einsachtzig war er fast noch so gut in Form wie damals auf dem College. Das hatte er weder Aerobic-Kursen noch Fitness-Centern zu verdanken, sondern seinen beiden Kindern und ihrem Fußballgerangel, ihren Basketball-Spielchen, Frisbee-Turnieren und dem sonntäglichen Familien-Joggen (bei dem eigentlich Parker mehr hinter ihren Fahrrädern her lief, wenn sie ihre Runden durch den nahe gelegenen Park drehten).
»Was meinst du, wollen wir mal nachschauen? Dort, wo du etwas gesehen hast?«
»Ja.«
»Hast du Helm und Schild dabei?«
»Hab ich.« Der Junge klopfte sich auf den Kopf und hielt dann den linken Arm wie ein Ritter vor sich.
»So ist es prima. Meine Rüstung habe ich auch dabei.« Parker imitierte die Gesten des Jungen.
Sie gingen zur Hintertür.
»Dort drüben, die Büsche, siehst du?«, sagte Robby.
Parker ließ den Blick über seine knapp zweitausend Quadratmeter Land in einem älteren Neubaugebiet ungefähr zwanzig Meilen westlich von Washington schweifen. Sein Eigentum bestand hauptsächlich aus Gras und Blumenbeeten. Nur weiter hinten wucherte ein Dickicht aus Forsythien, Kudzu und Efeu, das er schon seit Jahren zurückschneiden wollte. Robby hatte nicht ganz Unrecht: Wenn man ein wenig blinzelte, erinnerte ein Abschnitt der Sträucher an die Umrisse eines Menschen.
»Sieht gruselig aus«, gab Parker zu. »Keine Frage. Aber du weißt doch, dass das mit dem Bootmann schon lange vorbei ist.« Er hatte nicht vor, die Angst des Jungen zu bagatellisieren, indem er ihm bewies, dass er sich lediglich vor ein paar zerzausten Büschen ängstigte. Aber er wollte Robby das Gefühl für den Abstand zwischen jetzt und den Ereignissen damals geben.
»Ich weiß. Aber …«
»Wie lange ist das schon her?«
»Vier Jahre«, antwortete Robby.
»Das ist ganz schön lange, was?«
»Ja, ziemlich.«
»Zeig mir mal, wie lang.« Parker streckte die Arme aus. »So lang?«
»Kann sein.«
»Ich glaube, noch länger.« Parker streckte die Arme noch weiter auseinander. »So lang wie der Fisch, den wir im Braddock Lake gefangen haben?«
»Der war sooo lang«, sagte der Junge, fing an zu grinsen und machte die eigenen Arme ganz breit.
»Ach was, er war so lang.« Parker runzelte übertrieben die Stirn.
»Nein, er war sooo lang.« Der Junge hüpfte von einem Fuß auf den anderen.
»Nein, er war länger!«, lachte Parker. »Viel länger!«
Robby rannte mit erhobenem Arm quer durch die ganze Küche. Dann kam er zurück und hob den anderen Arm. »Er war sooo lang!«
»So lang ist vielleicht ein Hai«, rief Parker. »Nein, ein Wal, nein, eine Riesenkrake. Nein, jetzt weiß ich’s – eine wuschelige Mazurka!« Ein Geschöpf aus Wenn ich Zoodirektor wäre. Robby und Stephie liebten Dr. Seuss. Parkers Spitzname für die Kinder war »die Whos«, nach den Geschöpfen in Horton hört einen Who, was ihre allerliebste Lieblingsgeschichte aller Zeiten war und sogar Winnie the Pooh in den Schatten stellte.
Parker und Robby spielten eine Runde Fangen-im-Haus, dann schnappte er sich den Jungen und nahm ihn für ein kurzes Abkitzeln fest in die Arme.
»Weißt du was?«, fragte Parker keuchend.
»Was?«
»Wollen wir morgen dieses ganze Gestrüpp einfach zurückschneiden?«
»Krieg ich die Säge?«, erkundigte sich der Junge rasch.
Ah, sie greifen nach jeder sich bietenden Gelegenheit, dachte Parker und musste insgeheim lachen. »Mal sehen«, antwortete er.
»Klasse!« Robby tänzelte aus der Küche; die Erinnerung an den Bootmann war verschwunden bei der Aussicht, mit richtigem Werkzeug arbeiten zu dürfen. Er rannte nach oben, und kurz darauf hörte Parker das übliche Gezänk zwischen Bruder und Schwester, bei dem es um die Frage ging, welches Nintendo-Spiel gespielt werden sollte. Allem Anschein nach setzte sich Stephanie durch, denn kurz darauf wehte die ansteckende Titelmelodie der Mario Bros. durch das Haus.
Parkers Blick kehrte zu den Büschen auf dem Gelände hinter dem Haus zurück.
Der Bootmann … Er schüttelte den Kopf.
Es klingelte an der Tür. Er lauschte einen Moment nach oben. Offensichtlich hatten die Kinder nichts gehört. Also ging er zur Haustür und öffnete sie.
Die attraktive Frau lächelte ihn strahlend an. Unter ihrem blonden, geometrisch geschnittenen Haar, das von der Sonne heller als sonst gebleicht war, baumelten Ohrringe hervor. (Robbys Haar hatte ihre Farbe, doch Stephanies ähnelte eher Parkers braunem Schopf.) Die Frau hatte einen unverschämt braunen Teint.
»Na, hallo«, sagte Parker versuchsweise.
Er blickte an ihr vorbei und sah erleichtert, dass der Motor des in der Auffahrt geparkten beigen Cadillac noch lief. Richard saß hinter dem Steuer und las im Wall Street Journal.
»Hallo, Parker. Wir kommen direkt vom Flughafen.« Sie umarmte ihn.
»Ihr wart … wo wart ihr eigentlich?«
»St. Croix. Es war herrlich. Oh, entspann dich, mein Gott, deine Körpersprache … Ich wollte nur rasch mal vorbeischauen.«
»Du siehst gut aus, Joan.«
»Mir geht’s auch gut. Mir geht’s wirklich gut. Ich weiß aber nicht so genau, ob du gut aussiehst, Parker. Ich finde dich ein bisschen blass.«
»Die Kinder sind oben.« Er drehte sich um, um sie zu rufen.
»Nein, lass nur, es ist …«, setzte Joan an.
»Robby! Stephanie! Eure Mama ist hier!«
Getrappel auf der Treppe. Die Whos kamen um die Ecke geschossen und rannten auf Joan zu. Sie lächelte, aber Parker sah genau, dass sie sauer war, weil er die Kinder gerufen hatte.
»Mami, du bist ja ganz braun!«, sagte Stephie und warf dabei ihr Haar wie ein Spice Girl nach hinten. Robby war ein pausbäckiges Engelchen, aber Stephanie hatte ein langes, ernstes Gesicht, das, so hoffte Parker jedenfalls, Jungs gegenüber einschüchternd intellektuell wirken würde, wenn sie erst das kritische Alter von zwölf oder dreizehn Jahren erreicht hatte.
»Wo warst du, Mami?«, fragte Robby missbilligend.
»In der Karibik. Hat euch Papa das nicht erzählt?« Ein tadelnder Seitenblick zu Parker. Doch, er hatte es ihnen erzählt. Joan verstand nur nicht, dass sich die Kinder nicht über mangelhafte Kommunikation hinsichtlich ihrer Reisepläne beklagten, sondern darüber, dass sie über Weihnachten nicht in Virginia gewesen war.
»Wie waren die Feiertage? Schön?«, erkundigte sie sich.
»Wir haben ein Air Hockey-Spiel gekriegt, und ich habe Robby heute Morgen schon dreimal abgezogen.«
»Dafür habe ich den Puck vier Mal hintereinander reingekriegt!«, konterte er. »Hast du uns was mitgebracht?«
Joan sah zum Auto. »Selbstverständlich. Aber ich habe alles noch im Koffer. Ich wollte nur kurz hallo sagen und mit eurem Vater reden. Die Geschenke bringe ich morgen mit, wenn ich euch besuche.«
»Ach, und ich habe noch einen Fußball gekriegt«, sagte Stephie, »Und das neue Mario-Spiel, und das ganze Paket von Wallace & Gromit …«
»Und ich hab den Todesstern gekriegt«, unterbrach Robby die Aufzählung seiner Schwester, »und den Millenium Falken. Und tonnenweise Micro Machines! Und einen Baseballschläger von Sammy Sosa. Und wir haben den Nussknacker gesehen …«
»Habt ihr mein Päckchen bekommen?«, wollte Joan wissen.
»Mhmm«, antwortete Stephie. »Vielen Dank.« Das Mädchen war tadellos höflich, aber eine Barbie-Puppe mit einem schicken Kleid war für sie wirklich nicht mehr interessant. Heutige Achtjährige ließen sich nicht mit den Achtjährigen aus Joans Kindheit vergleichen.
»Daddy hat das Hemd umgetauscht und eins in der richtigen Größe besorgt«, rief Robby.
»Ich habe ihn darum gebeten, falls es nicht passt«, sagte Joan rasch. »Aber ich wollte dir doch wenigstens etwas schenken.«
»Wir haben an Weihnachten gar nicht mit dir telefoniert«, sagte Stephie.
»O je«, antwortete Joan ihrer Tochter. »Dort, wo wir waren, war es sehr schwer zu telefonieren. Es war wie auf Gilligans Insel. Die Apparate haben so gut wie nie funktioniert.« Sie wuschelte Robby durchs Haar. »Außerdem wart ihr ja überhaupt nicht zu Hause.«
Sie gab ihnen die Schuld. Joan hatte nie gelernt, dass die Kinder niemals Schuld an etwas hatten, nicht in diesem Alter. Wenn man etwas falsch machte, lag es immer an einem selbst; und wenn sie etwas falsch machten, lag es auch an einem selbst.
Ach, Joan … Es waren kleine Fehler wie dieser – die leichte Verschiebung von Schuld –, die genau so schwer wogen wie Ohrfeigen. Aber er sagte nichts. (»Lass die Kinder nie sehen, wie die Eltern streiten.«)
Joan richtete sich wieder auf. »Richard und ich müssen jetzt los. Wir müssen doch Elmo und Saint abholen. Die armen Hündchen waren die ganze Woche im Käfig.«
Jetzt wurde Robby wieder munter. »Heute Abend machen wir eine Party, und dann sehen wir uns das Feuerwerk im Fernsehen an und spielen Star-Wars-Monopoly.«
»Das wird bestimmt lustig«, sagte Joan. »Richard und ich gehen ins Kennedy Center. In die Oper. Du magst doch Opern, oder nicht?«
Stephie zuckte auf ihre vieldeutige Weise die Schultern, eine Antwort, mit der sie in letzter Zeit oft auf die Fragen Erwachsener reagierte.
»Das ist ein Schauspiel, bei dem die Leute auf der Bühne die Geschichte nicht nur spielen, sondern auch singen«, erklärte Parker seinen Kindern.
»Vielleicht nehmen Richard und ich euch einmal mit in die Oper. Hättet ihr Lust dazu?«
»Denke schon«, erwiderte Robby. Ein eindeutigeres Zugeständnis an die Hochkultur war von einem Neunjährigen wohl nicht zu erwarten.
»Warte mal!«, stieß Stephie hervor. Dann drehte sie sich um und stampfte die Treppe hinauf.
»Ich habe nicht viel Zeit, Süße. Wir …«
Einen Augenblick später war das Mädchen mit seinen neuen Fußballklamotten zurück und streckte sie seiner Mutter entgegen.
»Toll«, sagte Joan, »das sieht toll aus.« Sie hielt die Kleider so linkisch wie ein Kind, das einen Fisch geangelt hat und nicht genau weiß, ob es ihn wirklich haben will.
Erst der Bootmann, jetzt Joan, dachte Parker Kincaid. Wie die Vergangenheit heute auf ihn einstürzte. Na ja, warum auch nicht? Schließlich war Silvester.
Zeit, Rückschau zu halten …
Joan war offensichtlich erleichtert, als die Kinder wieder in Stephies Zimmer stürmten, entzückt von der Aussicht auf noch mehr Geschenke. Doch mit einem Mal war ihr Lächeln wie weggewischt. Ironischerweise sah sie in ihrem Alter – sie war 39 – mit einem mürrischen Gesichtsausdruck am besten aus. Sie fuhr sich mit der Fingerspitze über die Schneidezähne und überprüfte, ob sie mit Lippenstift verschmiert waren. Er erinnerte sich an diese Angewohnheit aus der Zeit, als sie noch verheiratet waren.
»Parker, ich hätte das nicht tun müssen …« Ihre Hand verschwand in ihrer Coach-Handtasche.
Ach du Schreck, sie hat ein Weihnachtsgeschenk für mich. Und ich habe nichts für sie besorgt. Die Gedanken überschlugen sich in seinem Kopf: Habe ich irgendwo noch etwas liegen, das ich gekauft, aber noch nicht verschenkt habe? Etwas, das ich …
Aber dann sah er, dass ihre Hand mit einem Bündel Papier aus der Handtasche hervorkam.
»Ich hätte dir die Klageschrift auch am Montag von einem professionellen Zusteller überbringen lassen können.«
Klageschrift?
»Aber ich wollte zuerst mit dir reden, damit du nicht gleich an die Decke gehst.«
Ganz oben auf dem Dokument stand: »Antrag auf Änderung des Sorgerechtsentscheids.«
Die Nachricht traf ihn wie ein Schlag in den Magen.
Offensichtlich waren Joan und Richard doch nicht direkt vom Flughafen gekommen, sondern hatten zuerst bei ihrem Anwalt Halt gemacht.
»Joan«, sagte er verzweifelt, »du kannst nicht …«
»Ich will sie haben, Parker, und ich kriege sie auch. Lass uns nicht darüber streiten. Wir finden bestimmt eine Lösung.«
»Nein«, flüsterte er. »Nein.« Ein Anflug von Panik erfasste ihn, und er spürte, wie seine Kräfte ihn verließen.
»Vier Tage bei dir, die Freitage und die Wochenenden bei mir. Je nachdem, was Richard und ich vorhaben. Wir sind ja in letzter Zeit viel gereist. Sieh mal, auf diese Weise hast du doch auch wieder mehr Zeit für dich. Ich könnte mir vorstellen, dass du dich darauf freust, endlich wieder …«
»Auf keinen Fall.«
»Es sind meine Kinder …«, setzte sie noch einmal an.
»Technisch gesehen.« Parker hatte seit vier Jahren das alleinige Sorgerecht.
»Parker«, sagte sie vernünftig, »mein Leben ist stabil. Es geht mir gut. Ich trainiere wieder. Ich bin verheiratet.«
Mit einem Verwaltungsangestellten von der Kreisbehörde, der, wenn man der Washington Post glauben wollte, im vergangenen Jahr nur knapp an einer Anklage wegen der Annahme von Bestechungsgeldern vorbeigeschrammt war. Richard war nicht mehr als ein Ungeziefer vertilgender Vogel auf dem Rücken der großen Politik. Abgesehen davon war er der Mann, mit dem Joan im letzten Jahr ihrer Ehe mit Parker geschlafen hatte.
Aus Sorge darüber, dass ihn die Kinder hören könnten, flüsterte er: »Praktisch bist du seit dem Tag, an dem sie geboren wurden, für Robby und Stephie eine Fremde.« Er schlug mit dem Handrücken auf die Papiere und ließ sich von seinem Zorn hinreißen: »Verschwendest du überhaupt jemals einen Gedanken an sie? Daran, was ihnen damit angetan wird?«
»Sie brauchen eine Mutter.«
Nein, dachte Parker. Joan braucht ein neues Hobby. Vor ein paar Jahren waren es Pferde gewesen. Dann preisgekrönte Weimaraner. Dann Antiquitäten. Auch Häuser in angesagten Vierteln: Sie und Richard waren von Oakton nach Clifton, von dort nach McLean und dann nach Alexandria gezogen. »Stillstand ist Rückstand«, hatte sie dazu gesagt, obwohl Parker genau wusste, dass sie einfach nicht damit klarkam, weil sie in keinem Haus und in keiner Gegend heimisch wurde oder gar Freunde fand. Er dachte daran, was es für die Kinder hieß, immer wieder entwurzelt zu werden.
»Warum?«, fragte er.
»Ich möchte eine Familie haben.«
»Dann schaff dir welche mit Richard an. Du bist noch jung.«
Genau das wollte sie nicht, wie Parker nur zu gut wusste. So gerne sie schwanger gewesen war – und sie war niemals hübscher gewesen –, so sehr hatte sie versagt, als es darum ging, sich um die kleinen Kinder zu kümmern. Es ist wohl sehr schwer, Kinder zu haben, wenn man, emotionell gesehen, selbst noch eins ist.
»Du bist dafür absolut ungeeignet«, sagte Parker.
»Aha, du hast wohl doch gelernt, die Seidenhandschuhe auszuziehen? Mag sein, dass ich damals ungeeignet war, aber das liegt in der Vergangenheit.«
Nein, es liegt in deiner Natur.
»Ich werde dagegen kämpfen, Joan«, sagte er sachlich. »Das weißt du.«
»Ich komme morgen früh um zehn wieder«, zischte sie. »Und dann bringe ich eine Frau vom Sozialamt mit.«
»Was?« Er war wie vor den Kopf gestoßen.
»Nur, um mit den Kindern zu reden.«
»Joan … An einem Feiertag?« Parker konnte sich nicht vorstellen, dass eine Sozialarbeiterin sich auf so etwas einließ, aber dann wurde ihm klar, dass Richard wohl ein paar Verbindungen hatte spielen lassen.
»Wenn du wirklich der gute Vater bist, für den du dich hältst, dürfte es dir keine Probleme bereiten, wenn die Kinder sich mit ihr unterhalten.«
»Ich habe kein Problem damit. Ich denke dabei an die Kinder. Warte wenigstens bis nächste Woche. Was glaubst du denn, wie sie sich fühlen, wenn sie an einem Feiertag von einer Fremden ins Kreuzverhör genommen werden? Das ist doch lächerlich. Sie wollen dich sehen.«
»Parker«, erwiderte sie erbost, »diese Frau weiß, was sie tut. Sie nimmt die Kinder nicht ins Kreuzverhör. Wie auch immer, ich muss jetzt los. Der Zwinger macht feiertags früher zu. Meine armen Hündchen … Mensch, Parker, stell dich nicht so an. Davon geht doch die Welt nicht unter!«
Doch, dachte er. Doch.
Er wollte die Tür schon zuschlagen, hielt jedoch mitten in der Bewegung inne, weil er wusste, dass das Geräusch die Whos unnötig aufregen würde.
Er machte die Tür mit einem kräftigen Ruck zu. Drehte den Schlüssel um und legte die Kette vor, als wollte er diesen Orkan schlechter Nachrichten einfach aussperren. Er faltete die Papiere zusammen und marschierte in sein Zimmer, stopfte sie, ohne auch nur einen Blick darauf zu werfen, in seine Schreibtischschublade und hinterließ seinem Anwalt eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Anschließend ging er einige Minuten unruhig auf und ab, stieg dann die Treppe hinauf und streckte den Kopf in Robbys Zimmer. Die Kinder kicherten und bewarfen sich mit Micro Machines.
»Kein Krieg an Silvester«, sagte Parker.
»Aber morgen dürfen wir uns wieder bekriegen?«, fragte Robby.
»Sehr lustig, junger Mann.«
»Er hat angefangen!«, kam Stephie aus dem Hinterhalt und widmete sich wieder ihrem Buch. Unsere kleine Farm.
»Wer hat Lust, mir im Arbeitszimmer zu helfen?«, rief er.
»Ich!«, schrie Robby.
Gemeinsam verschwanden Vater und Sohn die Treppe hinunter in Parkers Kellerbüro. Kurz darauf vernahm Parker erneut das elektronische Gedudel, nachdem Stephie offensichtlich von ihrer Lektüre zur Informatik übergewechselt war und den unerschrockenen Mario in ein neues Abenteuer stürzte.
Bürgermeister Gerald Kennedy – ja, ein Demokrat, aber keiner von jenen Kennedys – blickte auf das weiße Blatt Papier auf seinem Schreibtisch.
Bürgermeister Kennedy –
Das Ende ist nacht. Der Digger ist los, und es gibt keine Möglichkeit, ihn zu hintern.
An das Blatt war ein FBI-Memo geheftet, dessen erste Zeile lautete: »Beiliegendes Schriftstück ist eine Kopie. METRO-FALL, 31/12.«
METRO-FALL, dachte Kennedy. Metro-Fall. Ihm fiel ein, dass das FBI solche Bezeichnungen liebte. Er saß wie ein Bär hinter dem verschnörkelten Schreibtisch seines georgianischen Büros im sehr ungeorgianischen Rathaus von Washington, D.C., und las die Nachricht noch einmal durch. Dann sah er zu den beiden Leuten auf, die ihm gegenübersaßen. Eine adrette blonde Frau und ein großer, schlanker, grauhaariger Mann. Kennedy, dessen Haar sich stark lichtete, dachte über andere Leute oft in Bezug auf ihren Haarwuchs nach.
»Und Sie sind sicher, dass er derjenige ist, der hinter den Schüssen steckt?«
»Demnach zu urteilen, was er über die Kugeln schreibt«, antwortete die Frau. »Dass sie schwarz angemalt sind. Das deutet schwer darauf hin. Wir sind sicher, dass die Nachricht vom Täter stammt.«
Kennedy, ein massiger Mann, der mit seiner massigen Figur gut klarkam, schob den Zettel mit seinen riesigen Händen auf der Schreibtischplatte hin und her.
Die Tür ging auf, und ein junger Schwarzer in einem zweireihigen italienischen Anzug und mit ovalen Brillengläsern trat ein. Kennedy winkte ihn zu sich an den Schreibtisch.
»Das ist Wendell Jefferies«, stellte der Bürgermeister vor. »Mein erster Berater.«
Die Agentin nickte. »Margaret Lukas.«
Der andere Agent machte eine Bewegung, die Kennedy am ehesten an ein Schulterzucken erinnerte. »Cage.« Allgemeines Händeschütteln.
»Die beiden sind vom FBI«, fügte Kennedy erklärend hinzu.
Jefferies’ Nicken verriet, dass er nicht überrascht war.
Kennedy schob seinem Berater die Kopie der Nachricht hin.
Jefferies rückte seine Designerbrille zurecht und betrachtete den Zettel. »Scheiße. Er will es wieder tun?«
»Sieht ganz so aus«, bestätigte die Agentin.
Kennedy sah sich die beiden Agenten genauer an. Cage kam von der Ninth Street, aus der FBI-Zentrale, und Lukas war die stellvertretende leitende Agentin der FBI-Außenstelle im District of Columbia. Da ihr Vorgesetzter zurzeit nicht in der Stadt weilte, hatte sie den Metro-Fall übernommen. Cage war deutlich älter als sie und schien schon lange dabei zu sein. Lukas war zwar jünger, wirkte aber zynischer und energischer. Jerry Kennedy war jetzt seit drei Jahren Bürgermeister des District of Columbia mithin der Hauptstadt, und er hatte seitdem unerschrocken und energisch dafür gesorgt, dass die Stadtverwaltung funktionierte. Er war froh, dass Lukas das Kommando hatte.
»Der blöde Sack kann nicht mal richtig buchstabieren«, murmelte Jefferies und senkte sein schmales Gesicht über das Blatt, um die Nachricht ein zweites Mal zu lesen. Seine Augen waren mehr als schlecht, ein Gebrechen, das er mit allen seinen Geschwistern gemeinsam hatte. Ein großer Teil des Gehalts des jungen Mannes ging an seine Mutter und ihre beiden anderen Söhne und zwei Töchter im Südosten von D.C. Eine gute Tat, über die Jefferies niemals ein Wort verlor; er schwieg darüber ebenso wie über die Tatsache, dass sein Vater auf der East Third Street beim Kaufen von Heroin ermordet worden war.
In Kennedys Augen war Wendell Jefferies geradezu ein Sinnbild für das Gute im District of Columbia.
»Hinweise?«, erkundigte sich der Berater.
»Nichts«, antwortete Lukas. »Wir haben VICAP eingeschaltet, die städtische Polizei, die Abteilung für Verhaltensforschung in Quantico sowie die County Police von Fairfax, Prince William und Montgomery. Aber wir haben noch nichts Konkretes.«
»Großer Gott«, sagte Jefferies mit einem Blick auf seine Armbanduhr.
Kennedy schaute auf die Messinguhr auf seinem Schreibtisch. Es war kurz nach zehn Uhr morgens.
»Zwölfnullnull … mittags«, sinnierte er und fragte sich, warum der Erpresser für seine Angabe die vierundzwanzig Stunden-Zählung benutzte, wie in Europa oder beim Militär üblich. »Uns bleiben zwei Stunden.«
»Sie müssen eine Erklärung abgeben, Jerry«, sagte Jefferies. »Und zwar bald.«
»Ich weiß«, nickte Kennedy.
Warum musste das ausgerechnet jetzt passieren? Warum hier?
Er warf Jefferies einen kurzen Blick zu. Der Mann war jung, aber Kennedy wusste, dass er eine viel versprechende politische Karriere vor sich hatte. Er war ausgebufft und sehr schnell. Jefferies’ ebenmäßiges Gesicht verzog sich zu einem mürrischen Ausdruck, und Kennedy wusste, dass er genau das Gleiche dachte wie der Bürgermeister: Warum ausgerechnet jetzt?
Kennedy warf einen Blick auf das Memo bezüglich der VIP-Tribüne beim Silvesterfeuerwerk heute Abend auf der Mall. Er und seine Frau Claire würden dort neben dem Abgeordneten Paul Lanier und den anderen wichtigen Kongress-Zoowärtern aus dem District sitzen.
Jedenfalls war es so geplant gewesen, bevor das alles geschehen war.
Warum jetzt?
Warum in meiner Stadt?
»Was tun Sie, um ihn zu schnappen?«, fragte er sie.
Die Antwort kam von Lukas, und sie kam prompt: »Wir überprüfen sämtliche VIs – vertrauliche Informanten – und sämtliche Verbindungsleute, die in irgendeiner Weise mit einheimischen oder ausländischen terroristischen Gruppen in Kontakt stehen. Bis jetzt haben wir noch nichts. Und meiner Meinung nach ist das auch kein Terroristen-Profil. Das riecht eher nach einem Profitverbrechen aus dem Bilderbuch. Deshalb haben wir zusätzlich Agenten darauf angesetzt, frühere Erpressungspläne abzugleichen, um vielleicht auf ein Muster zu stoßen. Wir suchen nach allen Drohungen, die dem District oder seinen Beschäftigten in den vergangenen zwei Jahren zugegangen sind. Bislang ließen sich noch keine Parallelen feststellen.«
»Der Bürgermeister hat schon die eine oder andere Drohung erhalten«, sagte Jefferies. »In Verbindung mit der Moss-Geschichte.«
»Was ist das denn?«, fragte Cage.
Lukas beantwortete seine Frage: »Der Kanarienvogel von der Schulbehörde. Der Kerl, für den ich schon eine ganze Weile Babysitter spiele.«
»Ach, der.« Cage zuckte mit den Schultern.
An Jefferies gewandt, sagte Agent Lukas: »Mir sind diese Drohungen bekannt. Ich habe sie mir angesehen. Aber ich glaube nicht, dass eine Verbindung besteht. Das waren nur die üblichen anonymen Drohanrufe von öffentlichen Telefonzellen. Dabei ging es weder um Geld noch um irgendwelche anderen Forderungen.«
Die üblichen anonymen Drohanrufe, dachte Kennedy zynisch.
Nur dass sie sich nicht sehr üblich anhören, wenn deine Frau morgens um drei den Hörer abnimmt und zu hören bekommt: »Lass die Finger von der Moss-Untersuchung. Sonst bist du bald so tot wie er.«
Lukas redete weiter: »Im Rahmen der Standardermittlungen lasse ich unsere Agenten die Kennzeichen aller Autos überprüfen, die heute Morgen in der Nähe des Rathauses und rings um den Dupont Circle geparkt haben. Wir überprüfen das Gebiet um den Übergabeort an der Umgehungsstraße sowie sämtliche Hotels, Apartments, Wohnwagen und Häuser in der Umgebung.«
»Sie klingen nicht sehr optimistisch«, knurrte Kennedy.
»Ich bin auch nicht optimistisch. Es gibt keine Zeugen. Jedenfalls keine zuverlässigen. Bei einem Fall wie diesem brauchen wir Zeugen.«
Kennedy sah sich die Nachricht noch einmal an. Es kam ihm unpassend vor, dass ein Verrückter, ein Killer eine so schöne Schrift hatte. An Lukas gewandt brummte er: »Dann lautet die Frage wohl eher: Soll ich zahlen oder nicht?«
Jetzt blickte Lukas zu Cage. Der sagte: »Wir müssen davon ausgehen, wenn Sie das Lösegeld nicht bezahlen oder sich kein Informant mit handfesten Hinweisen auf den Aufenthaltsort des Diggers meldet, sind wir nicht in der Lage, ihn bis vier Uhr ausfindig zu machen und aufzuhalten. Wir haben einfach nicht genug Anhaltspunkte.« Und Lukas fügte hinzu: »Damit will ich Ihnen keinesfalls geraten haben, das Geld zu zahlen. Es handelt sich allein um unsere Einschätzung dessen, was geschehen wird, falls Sie es nicht tun.«
»Zwanzig Millionen«, murmelte er gedankenverloren.
Ohne dass zuvor angeklopft worden wäre, ging die Bürotür auf und ein großer, etwa sechzigjähriger Mann in einem grauen Anzug kam herein.
Na großartig, dachte Kennedy. Noch mehr Köche in der Küche.
Paul Lanier, Abgeordneter des US-Repräsentantenhauses, schüttelte dem Bürgermeister die Hand und stellte sich anschließend den FBI-Agenten vor. Wendell Jefferies übersah er.
»Paul«, erklärte Kennedy Lukas, »ist der Vorsitzende des Kontrollausschusses.«
Obwohl der District of Columbia bis zu einem gewissen Grad autonom war, hatte der Kongress doch erst vor kurzem wieder die Finanzhoheit übernommen und der Stadt den Geldhahn zugedreht, so wie Eltern einem leichtsinnigen Kind das Taschengeld streichen. Insbesondere seit dem jüngsten Skandal in der Schulbehörde war Lanier für Kennedy das Äquivalent eines Rechnungsprüfers für einen Haufen Geschäftsbücher.
Lanier entging der verächtliche Ton in Kennedys Stimme. Lukas offensichtlich nicht. Der Abgeordnete fragte: »Können Sie mich kurz über die Entwicklung der Situation aufklären?«
Lukas tat ihre Einschätzung ein zweites Mal kund. Lanier hatte sich nicht gesetzt. Alle drei Knöpfe seines Brooks-Brothers-Anzuges waren ordentlich zugeknöpft.
»Warum hier?«, fragte Lanier. »Warum Washington?«
Kennedy musste innerlich lachen. Der Saukerl klaute ihm sogar seine rhetorischen Fragen.
»Das wissen wir nicht«, antwortete Lukas.
»Glauben Sie, dass er es wieder tun wird?«, hakte Kennedy nach.
»Ja.«
Wieder schaltete sich der Abgeordnete ein: »Jerry, du ziehst doch nicht ernsthaft in Erwägung, das Geld zu zahlen?«
»Ich ziehe jede Möglichkeit in Betracht.«
Laniers Gesichtsausdruck wurde skeptisch. »Machst du dir keine Sorgen darüber, wie das ankommt?«
»Nein, es ist mir egal, wie es ankommt«, herrschte Kennedy ihn an.
Doch der Abgeordnete fuhr in seinem perfekten Politikerbariton fort: »Damit setzt du ein falsches Zeichen. Es kommt einem Kniefall vor den Terroristen gleich.«
Kennedys Blick wanderte zu Lukas, die sagte: »Darüber sollte man natürlich nachdenken. Die Schleusentheorie. Gibt man einem Erpresser nach, melden sich schon bald die nächsten.«
»Aber über diese Sache weiß doch niemand Bescheid, oder?« Kennedy nickte in Richtung des Zettels.
»Es wissen genügend Leute Bescheid«, sagte Cage. »Und bald wissen es noch mehr. So etwas kann man nicht lange unter Verschluss halten. Briefe wie dieser haben Flügel. Darauf können Sie wetten.«
»Flügel«, wiederholte Kennedy, dem diese Bezeichnung überhaupt nicht gefiel und der umso dankbarer war, dass Lukas die Sache leitete. »Was können Sie tun, um ihn zu finden, falls wir tatsächlich zahlen?«, wollte er von ihr wissen.
»Unsere Techniker versehen die Übergabetasche mit einem Peilsender. Zwanzig Millionen wiegen ein paar hundert Pfund«, erklärte sie. »So viel kann man nicht einfach unter dem Autositz verstecken. Wir versuchen, das Versteck des Täters ausfindig zu machen. Mit ein wenig Glück erwischen wir dort beide – ihn und den Schützen, diesen Digger.«
»Mit ein wenig Glück«, wiederholte Kennedy skeptisch. Sie ist eine hübsche Frau, dachte der Bürgermeister, obwohl er, der seit 37 Jahren mit derselben Frau verheiratet war und noch kein einziges Mal daran gedacht hatte, sie zu betrügen, wusste, dass Schönheit hauptsächlich ein Ausdruck der Augen, des Mundes und der Körperhaltung war, nicht der Gott gegebenen äußeren Gestalt. Und Margaret Lukas’ Gesicht hatte sich kein einziges Mal entspannt, seit sie sein Büro betreten hatte. Kein Lächeln, kein Mitgefühl. Auch jetzt klang ihre Stimme spröde, als sie sagte: »Wir können keinen Prozentsatz angeben.«
»Nein. Selbstverständlich nicht.«
»Zwanzig Millionen«, grübelte Lanier, der große Dompteur der Finanzen.
Kennedy erhob sich, schob seinen Sessel nach hinten und trat an eines der Fenster. Er blickte hinaus auf den braunen Rasen und die mit toten Blättern gesprenkelten Bäume. Der Winter in Nord Virginia war in den vergangenen Wochen geradezu unnatürlich warm gewesen. Für heute Abend hatten die Wetterfrösche den ersten großen Schneefall in diesem Jahr angekündigt, aber zurzeit war die Luft noch warm und feucht, und der Geruch faulender Vegetation stieg bis in die Diensträume herauf. Es war beunruhigend. Auf der anderen Seite der Straße lag ein Park, in dessen Mitte eine große, dunkle, moderne Skulptur stand. Sie erinnerte Kennedy an eine Leber.
Er warf Wendell Jefferies einen Blick zu, der den Wink aufnahm und sich neben ihn stellte. Der Berater roch nach Rasierwasser und mindestens zwanzig verschiedenen anderen Düften. »Dann stehen wir jetzt ziemlich unter Druck, was, Wendy?«, flüsterte ihm der Bürgermeister zu.
Der Berater, der nicht gerade für seine Zurückhaltung bekannt war, erwiderte: »Jetzt haben Sie den Ball, Boss. Wenn Sie ihn fallen lassen, sind wir beide weg vom Fenster. Und so manches andere auch.«
Und so manches andere auch …
Dabei hatte Kennedy gedacht, nach dem Schulbehörden-Skandal könnte es nicht mehr weiter bergab gehen.
»Und bis jetzt«, sagte Kennedy, »gibt es keine Anhaltspunkte. Nichts.«
Bislang gab es dreiundzwanzig Tote.
Bislang wussten sie nicht mehr, als dass dieser Psychopath um vier Uhr versuchen würde, noch mehr Menschen umzubringen, und anschließend noch mehr.
Draußen vor dem Fenster rührte sich der unnatürlich warme Wind. Fünf gezackte braune Blätter trudelten zu Boden.
Kennedy kehrte an seinen Schreibtisch zurück, sah auf die Messinguhr. Es war 10 Uhr 25.
»Ich sage, wir zahlen nicht«, verkündete Lanier. »Meiner Meinung nach macht er sich sowieso aus dem Staub, sobald er herausfindet, dass das FBI eingeschaltet ist.«
»Er hat von Anfang an damit gerechnet, dass die Behörde eingeschaltet wird«, konterte Agentin Lukas.
Kennedy spürte ihren Sarkasmus. Lanier kriegte wieder nichts davon mit.
Der Abgeordnete wandte sich an die Frau: »Ich dachte, Sie halten nichts vom Zahlen.«
»Halte ich auch nicht.«
»Aber Sie glauben, dass er weiterschießt, wenn wir nicht zahlen.«
»Richtig«, antwortete sie.
»Also dann …« Lanier hob die rechte Hand. »Ist das denn nicht widersprüchlich? Sie finden, wir sollten nicht zahlen … aber er wird trotzdem weiter töten.«
»Genau.«
»Das hilft uns nicht viel weiter.«
»Er ist ein Mann, der darauf vorbereitet ist, so oft wie nötig zu töten, um an das Geld zu kommen«, sagte Lukas. »Mit so jemandem kann man nicht verhandeln.«
»Wird es für Sie schwieriger, ihn zu schnappen, wenn wir bezahlen?«, fragte Kennedy.
»Nein«, antwortete sie. Und nach einer kurzen Pause: »Zahlen Sie nun, oder nicht?«
Die Schreibtischlampe beleuchtete den Erpresserbrief. In Kennedys Augen glühte das Papier wie weißes Feuer.
»Nein, wir zahlen nicht«, sagte Lanier. »Wir fahren die harte Linie. Wir zeigen dem Terrorismus die kalte Schulter. Wir …«
»Ich zahle«, sagte Kennedy.
»Sind Sie sicher?«, fragte Lukas, der eine Lösung so recht zu sein schien wie die andere.
»Ich bin sicher. Tun Sie alles, um ihn zu erwischen. Aber die Stadt wird bezahlen.«
»Immer langsam«, sagte der Abgeordnete. »Nicht so hastig.«
»Es ist keinesfalls überstürzt«, fuhr ihn Kennedy an. »Ich denke schon darüber nach, seit ich das verfluchte Ding in die Finger bekommen habe.« Er zeigte fahrig auf den glühenden Zettel.
»Jerry«, fing Lanier an und lachte säuerlich, »du hast nicht das Recht, diese Entscheidung zu treffen.«
»Doch, zufällig hat er das«, sagte Wendell Jefferies, der mehrere Juradiplome sein Eigen nennen konnte.
»Dafür ist der Kongress zuständig«, erwiderte Lanier gereizt.
»Nein, das stimmt nicht«, sagte Cage zu Lanier. »Diese Angelegenheit liegt ausschließlich in der Befugnis der Stadtverwaltung. Ich habe mich auf dem Weg hierher extra beim Justizminister erkundigt.«
»Aber uns unterstehen die Finanzen!«, fauchte Lanier. »Ich werde das auf keinen Fall zulassen.«
Kennedy sah zu Wendell Jefferies hinüber, der einen Augenblick nachdachte. »Zwanzig Millionen? Wir können unser Konto ›Sonstiges‹ überziehen.« Er lachte. »Aber das müssen wir von der Rücklage der Schulbehörde abzwacken, denn die sind die Einzigen, die momentan noch einigermaßen flüssig sind.«
»Gibt es wirklich keine andere Quelle?«
»Nein. Alle anderen Ressorts haben nur Schulden oder allenfalls ein bisschen Klimpergeld.«
Kennedy schüttelte den Kopf. Was für eine verdammte Ironie – das Geld zur Rettung der Stadt stand nur deshalb zur Verfügung, weil jemand hier und dort ein bisschen gespart und damit der Verwaltung einen Riesenskandal beschert hatte.
»Das ist doch lächerlich, Jerry«, sagte Lanier. »Selbst wenn man diese Leute schnappt, versucht es nächsten Monat gleich wieder jemand. Verhandle niemals mit Terroristen. So lautet die Faustregel in Washington. Liest du denn die Anweisungen aus dem Staatsministerium nicht?«
»Nein«, erwiderte Kennedy. »Weil sie mir niemand zukommen lässt. Wendy, kümmern Sie sich um das Geld. Und Agent Lukas … schnappen Sie diesen Dreckskerl.«
Das Sandwich war ganz gut.
Wenn auch nicht gerade umwerfend.
Gilbert Havel nahm sich vor, sobald er das Geld hatte, im Jockey Club ein richtiges Steak zu bestellen. Ein Filet Mignon. Und eine Flasche Champagner.
Er trank seinen Kaffee aus und behielt den Eingang zum Rathaus im Auge.
Der Polizeichef war gekommen und rasch wieder gegangen. Ein Dutzend Reporter und Kamera-Teams waren vom Haupteingang abgewiesen und zu einem Seiteneingang dirigiert worden. Sie hatten nicht sehr zufrieden ausgesehen. Dann waren vor einiger Zeit zwei Leute im Rathaus verschwunden, die er eindeutig als FBI-Agenten erkannt hatte, ein Mann und eine Frau, die bisher nicht wieder herausgekommen waren. Die Bundesbehörde war also eingeschaltet. Aber damit hatte er ohnehin gerechnet.
Bisher somit keinerlei Überraschungen.
Havel schaute auf die Uhr. Zeit, ins Versteck zurückzugehen und den Hubschrauber-Mietservice anzurufen. Es gab noch einiges vorzubereiten. Der Plan zur Übergabe der zwanzig Millionen Dollar war sorgfältig durchdacht, der Plan zur anschließenden Flucht nicht weniger.
Havel zahlte seine Rechnung mit alten zerknitterten Eindollarscheinen, zog seinen Mantel an und setzte die Mütze auf. Er trat aus der Imbissstube, verließ den Bürgersteig und bog rasch und mit gesenktem Blick in eine kleine Verbindungsgasse ein. Die Metro-Station Judiciary Square befand sich direkt unter dem Rathaus, aber er war sicher, dass sie von der Polizei oder dem FBI überwacht wurde, weshalb er in Richtung Pennsylvania Avenue ging, von wo aus er einen Bus nach Southeast nehmen konnte.
Ein weißer Mann in einem schwarzen Viertel.
Das Leben ist manchmal schon komisch.
Gilbert Havel kam aus dem Gässchen heraus und bog in eine Seitenstraße ein, die zur Pennsylvania Avenue führte. Die Ampel schaltete auf grün. Havel trat auf die Straßenkreuzung. Plötzlich von links eine blitzartige, dunkle Bewegung. Er drehte den Kopf zur Seite, dachte noch: Scheiße, der sieht mich nicht! Der sieht mich nicht der sieht …
»Hey!«, schrie Havel.
Der Fahrer des großen Lieferwagens hatte auf einen Lieferschein geschaut und war bei Rot über die Ampel gerauscht. Jetzt blickte er entsetzt auf. Mit laut quietschenden Reifen knallte er direkt in Havel hinein. »O mein Gott! O mein Gott …«, schrie der Fahrer.
Der Lieferwagen erwischte Havel mit dem Kotflügel und quetschte ihn gegen ein geparktes Auto. Der Fahrer sprang heraus und starrte sein Opfer schockiert an. »Sie haben nicht aufgepasst! Es war nicht meine Schuld!« Dann blickte er sich um und sah, dass die Ampel gegen ihn aussagte. »Gott im Himmel.« Er sah, wie zwei Leute von der Ecke herbeigerannt kamen. Er überlegte kurz, dann sprang er wieder in seinen Laster, ließ den Motor an, setzte kurz zurück und raste davon. Schleudernd verschwand er um die nächste Ecke.
Die beiden Passanten, zwei Männer Mitte dreißig, rannten zu Havel. Einer beugte sich über ihn, um seinen Puls zu fühlen. Der andere starrte entsetzt auf die Riesenpfütze Blut.
»Dieser Laster«, flüsterte er, »ist einfach weggefahren! Einfach weg!« Dann fragte er seinen Freund: »Ist er tot?«
»Allerdings«, sagte der andere. »Der ist mausetot.«
3
12:45
Wo bleibst du?
Margaret Lukas lag bäuchlings auf einer Anhöhe über dem Beltway, der Ringautobahn um Washington.
Der Verkehr rauschte vorüber, ein endloser Strom.
Sie sah zum wiederholten Mal auf die Uhr. Und dachte: Wo bleibst du?
Ihr Bauch tat weh, ihr Rücken tat weh, und ihre Ellbogen auch.
Es war unmöglich gewesen, eine mobile Einsatzzentrale, nicht einmal eine gut getarnte, in der Nähe des Übergabeortes zu postieren, ohne dass es der Erpresser bemerkt hätte, wenn er sich irgendwo in der Nähe aufhielt. Deswegen lag sie jetzt hier in Jeans, Jacke und falsch herum aufgesetzter Kappe wie ein Heckenschütze oder Kleinkrimineller auf dem steinigen Boden. Und das schon seit einer Stunde.
»Hört sich an wie Wasser«, sagte Cage.
»Was?«
»Der Verkehr.«
Er lag ebenfalls auf dem Bauch, direkt neben ihr, so dicht, dass sich ihre Oberschenkel beinahe berührten, so wie sich ein Liebespaar vielleicht am Strand nebeneinander legen würde, um den Sonnenuntergang zu betrachten. Sie beobachteten das ebene Gelände in ungefähr einhundert Meter Entfernung. Das war der Geldübergabepunkt unweit der Gallows Road – die Straße hieß tatsächlich »Galgenstraße«, eine so offensichtliche Ironie des Schicksals, dass keiner der Agenten sich getraut hatte, einen Witz darüber zu machen.
»Kennen Sie das?«, fuhr Cage fort. »Wenn einem etwas unter die Haut kriecht, und man versucht, nicht daran zu denken. Aber es hilft nichts. Ich meine, es hört sich wie Wasser an.«
Für Lukas hörte es sich überhaupt nicht nach Wasser an. Es hörte sich an wie Autos und Lastwagen.
Wo bleibt der Unbekannte? Dort unten liegen zwanzig Millionen, und er nimmt sie nicht.
»Wo zum Teufel steckt er bloß?«, murmelte eine andere Stimme. Sie gehörte einem melancholischen Mann um die dreißig mit militärischem Haarschnitt und entsprechender Körperhaltung. Leonard Hardy gehörte der Polizei des District of Columbia an und war Teil des Teams, weil es, obwohl das FBI die Operation durchführte, nicht gut aussah, wenn nicht wenigstens ein Polizist mit dabei war. Normalerweise hätte Lukas Protest dagegen eingelegt, Leute im Team zu haben, die nicht zur Bundesbehörde gehörten, aber sie kannte Hardy flüchtig von seinen Aufträgen in der FBI-Bezirksstelle unweit des Rathauses und machte sich nichts aus seiner Anwesenheit – solange er das tat, was er bislang getan hatte: sich ruhig verhalten und die Erwachsenen nicht bei der Arbeit stören.
»Warum verspätet er sich?«, fragte sich Hardy wieder, erwartete aber offensichtlich keine Antwort. Seine gepflegten Finger mit den perfekt gestutzten Nägeln hielten unaufhörlich Notizen für seinen Bericht an den Polizeichef und den Bürgermeister fest.
»Habt ihr etwas?«, rief Lukas mit zur Seite gedrehtem Kopf flüsternd zu Tobe Geller hinüber, einem lockenköpfigen jungen Agenten, der ebenfalls mit Jeans und der gleichen marineblauen, beidseitig tragbaren Windjacke wie Lukas ausgestattet war.
Geller, auch er in den Dreißigern, hatte das aufgedreht vergnügte Gesicht eines Jungen, der sich mit jedem mit Mikrochips voll gestopften Gerät glücklich fühlt. Er sah auf einen von drei tragbaren Monitoren vor sich, tippte etwas in einen Laptop und überflog den Bildschirm abermals. »Nix«, erwiderte er. Sollte dort unten im Umkreis von hundert Metern um die Taschen mit dem Lösegeld ein lebendes Wesen auftauchen, das größer als ein Waschbär war, würden es Gellers Überwachungsgeräte erfassen.
Nachdem der Bürgermeister grünes Licht gegeben hatte, hatte das Geld auf dem Transport zum Übergabeort einen kleinen Umweg gemacht. Lukas und Geller hatten Kennedys Berater das Geld zu einer Adresse in der Ninth Street im District bringen lassen, in eine kleine, nicht näher gekennzeichnete Garage unweit der FBI-Zentrale.
Dort hatte Geller die Scheine in zwei gewaltige Taschen der Marke Burgess-Sicherheitssysteme KL-19 umgepackt, deren Segeltuch wie ganz normaler Stoff aussah, in Wirklichkeit aber mit Streifen oxidierten Kupfers imprägniert war, also einer Hochleistungsantenne. Die Senderelektronik war in den Nylongriffen versteckt, die Batterien steckten in den Plastikfüßchen am Boden. Jede Tasche sandte ein GPS-Signal aus, das deutlicher zu empfangen war, als das Hauptsendesignal von CBS und nur von mehreren Zentimetern Metall abgeschirmt werden konnte.
Zusätzlich hatte Geller vierzig Bündel Hundert-Dollar-Scheine mit selbst entworfenen Banderolen versehen, in die ultradünne Sendeplättchen eingezogen waren. Selbst wenn der Täter das Geld aus den Leinensäcken nahm oder unter mehreren Komplizen aufteilte, war Geller in der Lage, die Bündel aufzuspüren – in einem Umkreis bis zu einhundert Kilometern.
Die Taschen waren, wie im Erpresserschreiben verlangt, auf der Freifläche deponiert worden. Die Agenten hatten sich zurückgezogen, und dann hatte die Warterei begonnen.
Lukas war mit dem Verhaltensmuster des durchschnittlichen Kriminellen vertraut. Erpresser und Kidnapper bekamen vor der Geldübergabe oft kalte Füße. Aber jemand, der dazu entschlossen war, 23 Menschen umzubringen, würde jetzt nicht kneifen. Sie verstand nicht, weshalb sich der Täter dem vereinbarten Ort noch nicht einmal genähert hatte.
Sie schwitzte. Es war ungewöhnlich warm für den letzten Tag des Jahres, die Luft roch widerwärtig süß. Nach Herbst. Margaret Lukas hasste den Herbst. Lieber hätte sie im Schnee gelegen als hier in dieser fegefeuerartigen Jahreszeit zu warten.
»Wo bist du?«, murmelte sie. »Wo?« Sie schaukelte leicht hin und her und spürte den Druck auf den Hüftknochen. Sie war muskulös, aber dünn, nur wenig Polsterung schützte sie vor dem harten Boden. Zwanghaft suchte sie abermals das Gelände ab, obwohl Gellers empfindliche Sensoren den Unbekannten längst aufgespürt hätten, bevor ihre blaugrauen Augen ihn entdecken konnten.
»Hmm.« C. P. Ardell, ein wohlbeleibter Agent, mit dem Lukas gelegentlich zusammenarbeitete, drückte auf seinen Kopfhörer und lauschte, nickte dann mit seinem kahlen, bleichen Schädel und sah zu Lukas herüber. »Das war Position Charlie. Niemand ist von der Straße in den Wald abgebogen.«
Lukas schnaubte. Vielleicht hatte sie sich doch getäuscht. Ihrer Vermutung nach würde sich der Unbekannte dem Geld von Westen nähern, durch ein nicht weit von der Schnellstraße entferntes Wäldchen. Sie hatte angenommen, dass er einen Humvee oder einen Range Rover fuhr, sich eine der Taschen schnappte, die zweite aus Gründen der Zweckmäßigkeit opferte und wieder im Wald verschwand.
»Position Bravo?«, fragte sie.
»Ich frag mal nach«, sagte C. P., der auf Grund seiner verhängnisvollen Ähnlichkeit mit einem Drogenpanscher aus Manassas oder einem eingetragenen Mitglied der Hell’s Angels des Öfteren verdeckt arbeitete. Er schien von allen Agenten auf dem Beobachtungsposten der geduldigste zu sein. Seit ihrer Ankunft hatte er seine 110 Kilo nicht von der Stelle bewegt. Jetzt rief er den südlichsten Kontrollpunkt an.
»Nichts. Bis auf ein paar Kids mit einem Allrader. Keins davon älter als zwölf.«
»Unsere Leute haben sie doch nicht verscheucht, oder?«, erkundigte sich Lukas. »Die Kinder, meine ich.«
»Ach was.«
»Gut. Vergewissern Sie sich, dass das auch nicht passiert.«
Noch mehr Zeit verging. Hardy machte sich Notizen. Geller hackte auf seiner Tastatur herum. Cage zappelte nervös. C. P. nicht.
»Ist Ihre Frau sauer?«, fragte Lukas Cage. »Dass Sie am Feiertag arbeiten müssen?«
Cage zuckte die Achseln. Das war seine Lieblingsgeste. Er verfügte über ein ganzes Vokabular an Achselzucken. Cage war leitender Agent beim FBI, der, obwohl ihn seine Aufgaben quer durchs Land schickten, meistens mit Fällen zu tun hatte, die im Zusammenhang mit der Hauptstadt standen. Er und Lukas arbeiteten oft zusammen. Gemeinsam mit Lukas’ Chef, dem Special Agent, dem die Bezirksstelle Washington DC unterstand. In dieser Woche jedoch hielt sich SAC Ron Cohen anlässlich seines ersten Urlaubs seit sechs Jahren im brasilianischen Urwald auf, weshalb Lukas nachgerückt war und den Fall übernommen hatte. Hauptsächlich auf Grund von Cages Empfehlung.
Lukas hatte Cage, Geller und C. P. gegenüber ein schlechtes Gewissen, weil sie sie am Feiertag arbeiten ließ, denn sie hatten den Silvesterabend mit Ehefrauen oder Freundinnen natürlich anders geplant gehabt. Aber sie freute sich, dass Len Hardy dabei war. Er hatte ziemlich gute Gründe, sich an Feiertagen abzulenken, und das war einer der Gründe dafür, warum sie ihn ins METRO-Team aufgenommen hatte.
Lukas selbst hatte eine komfortable Wohnung in Georgetown, voller antiker Möbel, Stickereien und Quilts nach eigenen Entwürfen, eine zusammengewürfelte Weinsammlung, annähernd fünfhundert Bücher, über tausend CDs und einen Neufundländer-Mischling namens Jean Luc. Dort ließ sich sehr wohl ein gemütlicher Festtagsabend verbringen, doch in den drei Jahren, die sie nun schon dort wohnte, hatte es Lukas nie so weit gebracht. Bevor ihr Pager ihre Berufung zur Leiterin des METRO-Falles verkündet hatte, hatte sie vorgehabt, in dieser Nacht Gary Moss zu beaufsichtigen, den singfreudigen Kanarienvogel von der Schulbehörde, den Mann, der den Schmiergeldskandal beim Schulbau losgetreten hatte. Moss hatte, gut verkabelt, eine Reihe einwandfrei belastender Unterhaltungen aufgezeichnet. Kurz darauf war er jedoch aufgeflogen, und einen Tag später hatte es einen Brandanschlag auf sein Wohnhaus gegeben, dem beinahe seine beiden Töchter zum Opfer gefallen wären. Moss hatte seine Familie zu Verwandten nach North Carolina geschickt und verbrachte das Wochenende unter dem Schutz der Bundesbehörde. Nachdem der Digger auf der Bildfläche erschienen war, wurde aus Moss, zumindest vorübergehend, nurmehr ein gelangweilter Gast in einem äußerst kostspieligen Apartment-Komplex, der in Polizeikreisen unter dem Namen »Ninth Street« bekannt war – die Zentrale des FBI.
Lukas ließ erneut den Blick über das Gelände unter ihnen schweifen. Keine Spur von dem Erpresser.
»Vielleicht belauert er uns«, sagte ein Agent, der hinter einem Baum kauerte. »Sollen wir die Gegend noch mal absuchen?«
»Nein.«
»Reine Routinesache«, setzte er hartnäckig nach. »Wir nehmen fünf, sechs ungekennzeichnete Wagen. Er entdeckt uns nie.«
»Zu riskant«, erwiderte sie.
»Ähm … ganz bestimmt?«
»Ganz bestimmt.«
Mit knappen Antworten wie diesen hatte Lukas sich den Ruf eingehandelt, arrogant zu sein. Ihrer Meinung nach war Arroganz nicht notwendigerweise eine schlechte Sache. Sie vermittelte denjenigen, für die man arbeitete, Vertrauen. Außerdem fiel man damit den Chefs auf.
Sie blinzelte, als es in ihrem Ohrhörer knackte und eine Stimme ihren Namen sagte.
»Sprechen Sie«, sagte sie in das Kopfhörermikro, als sie die Stimme des stellvertretenden FBI-Direktors erkannte.
»Wir haben ein Problem«, sagte er.
Sie hasste dramatische Einleitungen. »Worum geht’s?«, fragte sie, ohne sich um die Schroffheit in ihrer Stimme zu scheren.