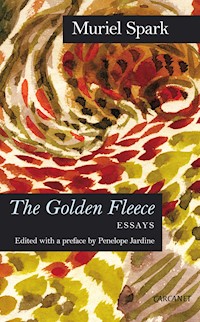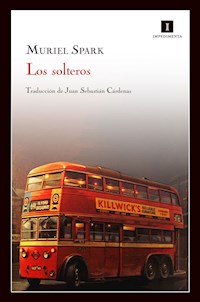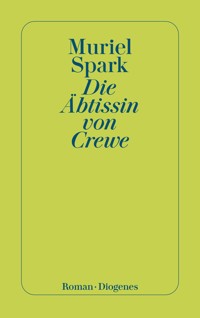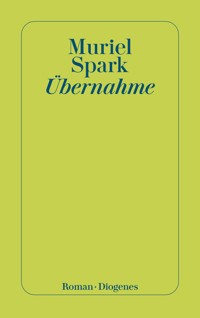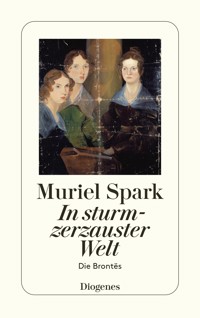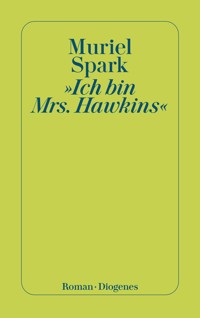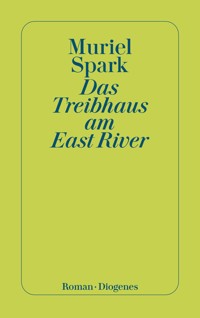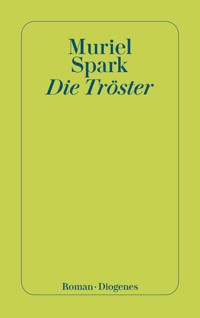
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Caroline, die junge Heldin des Romans, hört ›Stimmen‹, die sie und ihr Schicksal in ein imaginäres ›Buch im Buche‹ einweben; Baron Stock, Okkultist und Buchhändler aus Passion, gefällt sich in der unfreiwilligen Rolle eines ihrer Tröster, während er nebenher merkwürdigen Geschäften nachgeht. Die eigenwillige, ironisch gewürzte Betrachtung der Probleme eines Konvertierten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Muriel Spark
Die Tröster
Roman
Diogenes
Erster Teil
Erstes Kapitel
Als Laurence Manders am ersten Tag seines Urlaubs aufwachte, hörte er von unten die Stimme seiner Großmutter durch das Fenster dringen.
«Ich brauche ein großes Vollkornbrot. Mein Enkel, der bei der B.B.C. arbeitet, bleibt eine Woche bei mir. Er ist der Junge meiner Tochter, Lady Manders. Weißbrot ißt er nämlich nicht, das ist eine seiner Marotten.»
Laurence steckte den Kopf aus dem Fenster und rief: «Großmutter, ich esse nichts lieber als Weißbrot, und Marotten habe ich keine!»
Sie schürzte die Lippen und blickte lächelnd zu ihm hoch.
«Er ruft aus dem Fenster», meinte sie zu dem Bäcker.
«Du hast mich geweckt», sagte Laurence.
«Mein Enkel», erklärte sie dem Bäcker. «Ein großes Vollkornbrot, und vergessen Sie nicht, am Mittwoch wiederzukommen.»
Laurence sah in den Spiegel. «Ich muß aufstehen», sagte er und legte sich wieder ins Bett. Er genehmigte sich sieben Minuten.
Nach den Geräuschen, die deutlich durch die abgetretenen Dielen des kleinen Häuschens nach oben drangen, folgte er den Bewegungen seiner Großmutter. Mit achtundsiebzig verrichtete Louisa Jepp alles sehr langsam, doch mit äußerster Konzentration, wie manche Leute es tun, wenn sie leicht angetrunken sind. Laurence hörte ein Klirren – dann eine Pause – ein leises Klingen: sie deckte den Frühstückstisch. Ihre Schritte klickten wie eine langsam auslaufende Uhr, während sie zwischen Herd und Ausguß hin und her ging; sie erlaubte sich nicht, zu schlurfen.
Als er halb angezogen war, öffnete Laurence eine winzige Schublade im Oberteil der altmodischen Kommode. Sie enthielt einige persönliche Dinge seiner Großmutter, denn sie hatte ihm ihr Zimmer abgetreten. Er zählte drei Haarnadeln und acht Mottenkugeln; er fand ein kleines Stück schwarzen, mit Gagatperlen eingefaßten Samt; die Perlen hatten sich stellenweise mitsamt der Schnur gelöst und hingen nur noch lose an dem Stoff, den er auf etwa sechseinhalb mal vier Zentimeter schätzte. In einer anderen Schublade fand er einen Kamm mit ein paar Haaren seiner Großmutter darin und registrierte, daß er nicht sehr appetitlich aussah. Es bereitete ihm ein gewisses Vergnügen, diese Dinge vor sich ausgebreitet zu sehen: drei Haarnadeln, acht Mottenkugeln, ein nicht sehr appetitlicher Kamm – das Eigentum seiner Großmutter, hier in ihrem Heim in Sussex und im gegenwärtigen Zeitpunkt. So war Laurence.
«Das ist ungesund», hatte seine Mutter ihm kürzlich gesagt. «Es ist das einzig Ungesunde an dir, wie du die unsinnigsten Dinge bemerkst; das ist direkt abgeschmackt.»
«So bin ich nun einmal», hatte Laurence erwidert.
Sie wußte, daß sie damit wieder einmal auf einem toten Punkt angelangt war, fuhr aber trotzdem fort: «Jedenfalls ist es unnatürlich; denn manchmal siehst du Dinge, die du nicht sehen solltest.»
«Zum Beispiel?»
Sie sagte nichts, aber sie wußte, daß er in ihrem Zimmer gewesen war und in der unordentlichen Schublade ihres Toilettentisches herumspioniert, die kleinen Fläschchen spielerisch wie eine Katze betätschelt und die Aufschriften studiert hatte. Sie konnte ihn nie überzeugen, daß so etwas nicht recht sei. Schließlich handelte es sich um eine Verletzung der Privatsphäre.
Laurence hatte sehr oft gesagt: «Für dich wäre es nicht recht, aber für mich gilt das nicht.»
Und Helena Manders, seine Mutter, pflegte stets zu erwidern: «Das sehe ich nicht ein» oder «da bin ich anderer Meinung», obgleich sie ihm in Wirklichkeit in gewissem Sinne zustimmte.
In seiner Kindheit hatte er die Familie mit seinen ungeschminkten kleinen Wahrheiten schockiert.
«Onkel Ernest benutzt Hautnährcreme; er reibt sich damit jeden Abend die Ellbogen ein, damit sie zart bleiben»… «Eileen hat ihre Tage»… «Georgina Hogg hat drei Haare an ihrem Kinn, wenn sie sie nicht auszieht. Georgina hat einen Brief von ihrem Cousin bekommen, den ich gelesen habe.»
Das waren Aussprüche, die in der Erinnerung haften blieben. Andere Bemerkungen, die er im gleichen Atemzuge von sich gab, wie zum Beispiel: «Über dem dritten Treppenabsatz hängt jetzt seit zwei Wochen, vier Tagen und fünfzehn Stunden ein Spinngewebe, die Entstehungszeit nicht mitgerechnet»… nahm man mit Ergötzen oder gleichgültig zur Kenntnis, je nach der augenblicklichen Stimmung, und vergaß sie wieder.
Seine Mutter hatte ihn mehrfach ermahnt: «Wie oft soll ich dir noch sagen, daß du die Zimmer der Hausmädchen nicht betreten darfst! Schließlich haben sie doch ein Recht auf Ruhe und Ungestörtheit.»
Mit den Jahren lernte er, die anstoßerregenden Ergebnisse seiner Nachforschungen geheimzuhalten und nur das weiterzugeben, was zur Förderung seines Rufes als außergewöhnlich guter Beobachter notwendig war. Damals konnte sein Vater, gestützt auf einen Schulbericht, sogar sagen: «Ich hab’s ja immer gewußt, daß Laurence eines Tages über diese krankhafte Angewohnheit hinwegkommen würde.»
«Wir wollen’s hoffen», hatte Helena Manders geantwortet. Eltern ändern sich. In jenen Tagen hatte Laurence das Gefühl, daß sie ihn halbwegs im Verdacht hatte, irgendeine unbestimmte sexuelle Perversion zu betreiben, die sie nicht nennen konnte, nicht wahrhaben wollte, und die er in Wirklichkeit keineswegs betrieb. Daher kam es für sie fast einer Erleichterung gleich, einer Bestätigung, daß er noch der alte Laurence war, als er während seiner letzten Semesterferien verkündete: «Eileen erwartet ein Baby.»
«Das Mädchen ist eine gute Katholikin», hatte Helena protestiert; sie selbst war seit ihrer Heirat katholisch. Nichtsdestoweniger stellte sich Laurences Angabe als wahr heraus, als sie Eileen deswegen in der Küche zur Rede stellte. Mehr noch, Eileen weigerte sich trotzig, den Namen des Mannes preiszugeben. Laurence konnte jedoch auch diese Information liefern.
«Ich bin mit Eileens Korrespondenz immer auf dem laufenden geblieben», erklärte er. «Das belebt die Ferien ein wenig.»
«Du bist im Zimmer des armen Mädchens gewesen und hast heimlich die Briefe dieses bedauernswerten Geschöpfes gelesen!»
«Soll ich dir erzählen, was ihr Freund geschrieben hat?» fragte Laurence grausam.
«Du weißt, wie mich das schockiert», sagte sie, wohl wissend, daß sie auf ihn damit keinen Eindruck machen konnte. «Wie kannst du, ein guter Katholik … aber abgesehen davon ist es meines Wissens ungesetzlich, Briefe zu lesen, die an jemand anders adressiert sind», fügte sie geschlagen hinzu.
Nur um ihr einen guten Abgang zu verschaffen, erklärte er: «Jedenfalls hast du die beiden verheiratet, liebste Mama. Eine gute katholische Ehe – das ist das glückliche Ergebnis meines schockierenden Mißbrauchs von Eileens Briefen.»
«Der Zweck heiligt nicht die Mittel.»
Es ging genauso aus, wie er es erwartet hatte. Eine Antwort auf alles. Doch wie dem auch sei, Zwischenfälle wie dieser halfen den Schock lindern, als sie erkannte, daß Laurence sich immer mehr von der Religion abwandte und sie schließlich ganz preisgab.
Louisa Jepp saß am Tisch und füllte ihren Totoschein aus, während sie auf Laurence wartete.
«Komm herunter!» rief sie zur Decke hinauf, «und laß dein Schnüffeln, mein Lieber.»
Sobald er erschien, erklärte sie ihm: «Wenn Manchester City letzte Woche gewonnen hätte, wäre ich jetzt um dreißigtausend reicher.»
Louisa faltete ihren Totoschein zusammen und legte ihn unter die Uhr. Forthin widmete sie all ihre Aufmerksamkeit Laurence und seinem Frühstück.
Sie war zur Hälfte Zigeunerin, die dunkelhaarige und jüngste einer großen rotköpfigen Familie, die ihre Wohlhabenheit zur Zeit von Louisas Geburt dem Erfolg ihres Vaters als Getreidehändler verdankte. Dieser Erfolg war die Fügung eines günstigen Schicksals, das damit seinen Anfang nahm, daß ihr Vater noch vor einer Gerichtsverhandlung gegen ihn aus dem Gefängnis entwich und danach nie wieder zu seinem Zigeunerstamm zurückkehrte. Hundertunddreißig Jahre nach diesem Ereignis saß Louisa mit Laurence am Frühstückstisch.
Louisas Haar hat sich zwar sehr gelichtet, ist aber schwarz geblieben. Sie ist klein, und besonders von der Seite gesehen erinnert ihre Figur an eine gefällige Doppelkartoffel, die man gerade aus der Erde geholt hat: ein kleiner runder Kopf auf einem rundlichen Körper, von dem, Wurzeln gleich, die beiden dünnen Beine unter einem losen braunen Rock hervorschauen. Ihr Gesicht, nach hinten flächig zurücktretend wie ein Prisma, ist viereckig. Charakteristische Falten haben sich tief in ihre Züge gegraben, scheinen bis auf die Knochen zu gehen; sie müssen seit ihrem dreißigsten Lebensjahr dagewesen und im Laufe der Zeit immer schärfer geworden sein. Die vielen kleinen Fältchen jedoch sind nur oberflächlich, kommen und gehen wie unzählige Sterne, huschen über ihre Haut, wenn sie lächelt oder überrascht dreinschaut. Ihre tiefliegenden Augen sind schwarz, ihre Hände und Füße sehr klein. Sie trägt eine randlose Brille. Nur wenig verändert seit dem Tag, an dem Laurence zum Frühstück nach unten kam, lebt sie heute noch.
Sie trug ein braunes Kleid, eine braune Wolljacke mit vergoldeten Knöpfen und in den Ohren ein Paar Brillantohrringe.
Nachdem Laurence sie eingehend gemustert hatte, wie er es bei jedem zu tun pflegte, steckte er seine Gabel in ein Einmachglas und zog etwas langes Weißes, sauer Eingelegtes heraus.
«Was könnte das wohl sein?»
«Gekröse», antwortete sie; «es ist wunderbar.»
Er war an Louisas Essen gewohnt: Muscheln, Schnecken, Fischmilch und Rogen, Gekröse und Kalbsmilch, Gänseklein und Rinderfleck. Louisa ließ sich beim Zubereiten sehr viel Zeit; viele Prozesse des Übergießens, Eintauchens und Ziehenlassens gehörten dazu, viele Klärungs- und Siedevorgänge, viel Salzlake, mildes Pökeln und Süßen. Nur selten kaufte sie ein normales Stück Fleisch zum Braten oder Kochen; und Leute, die ihr Leben lang den Wert der Weichtiere und Innereien verkannten, wußten ihrer Meinung nach nicht, was gut für sie war.
«Was würdest du tun, wenn du dreißigtausend im Toto gewonnen hättest?» fragte Laurence.
«Ein Boot kaufen», antwortete sie.
«Ich würde dich den Fluß hinauf und hinunter paddeln», sagte Laurence. «Ein Hausboot wäre schön. Erinnerst du dich noch an die vierzehn Tage auf dem Hausboot während meines ersten Jahres auf der Vorbereitungsschule?»
«Ich meine ein Boot, mit dem man aufs Meer hinausfahren kann. Ja, auf dem Hausboot war es sehr schön.»
«Eine Jacht? Großartig!»
«Jedenfalls ein anständiges, seetüchtiges Boot», erwiderte Louisa. «Ein Boot, mit dem man den Kanal überqueren könnte.»
«Eine Motorjacht?» schlug Laurence vor.
«An so etwas Ähnliches habe ich gedacht», bestätigte sie.
«Oh, großartig!»
Sie antwortete nicht, denn er war zu weit gegangen mit seinem ‹großartig!›
«Wir könnten das Mittelmeer durchkreuzen», sagte er.
«Oh, großartig!» kommentierte sie.
«Würde es nicht mehr Spaß machen, ein Haus zu kaufen?» Laurence hatte sich eben an die dringende Bitte seiner Mutter erinnert: ‹Wenn du die Gelegenheit dazu findest, versuche sie auf jeden Fall zu überreden, etwas Geld von uns anzunehmen, damit sie bequem in einem eigenen Hause leben kann.›
«Nein», antwortete sie. «Aber wenn ich eine kleinere Summe gewönne, würde ich dieses Häuschen kaufen. Ich bin sicher, daß Mr. Webster es verkaufen würde.»
«Oh, ich würde mich so freuen, wenn dieses Häuschen dir ganz allein gehörte. Die ‹Schmugglerhöhle› ist so ein liebes kleines Haus.» Doch schon während er dies sagte, kam Laurence zum Bewußtsein, daß Phrasen wie ‹dir ganz allein› und ‹liebes kleines Haus› verrieten, worauf er hinauswollte; sie paßten nicht zum Umgang mit seiner Großmutter.
«Ich weiß, worauf du hinauswillst», entgegnete Louisa. «Hier sind Zigaretten; bediene dich.»
«Ich hab’ meine eigenen. Warum willst du Vater nicht das Häuschen für dich kaufen lassen? Das macht ihn nicht arm.»
«Ich komme ganz gut zurecht», antwortete Louisa. «Rauch eine von diesen – sie kommen aus Bulgarien.»
«Oh, großartig!» Aber er fügte rasch hinzu: «Wirklich phantastisch, und woher hast du sie?»
«Aus Bulgarien. Ich glaube, über Tanger.»
Laurence drehte eine Zigarette in den Fingern und betrachtete sie eingehend. Seine Großmutter überraschte stets von neuem. Sie hatte das Häuschen gemietet und lebte von der Altersrente.
Ihre Tochter Helena sagte häufig: «Gott weiß, wie sie es fertigbringt, aber sie scheint stets von allem reichlich zu haben.»
Ihren Freunden pflegte Helena zu erzählen: «Meine Mutter will absolut keinen Penny annehmen. Immer frei und unabhängig bleiben: die protestantischen Tugenden, wißt ihr. Gott weiß, wie sie es fertigbringt. Allerdings ist sie eine halbe Zigeunerin und weiß sich in jeder Lebenslage zu helfen.»
«Wirklich? Dann hast du also auch Zigeunerblut, Helena? Wie romantisch, und dabei bist du so blond. Man würde nie vermuten …»
«Oh, manchmal bricht es bei mir durch», pflegte Helena zu antworten.
Während der vergangenen vier Jahre seit dem Tod ihres Mannes hatte Louisa, die praktisch keinen Penny besaß, in kleinen Andeutungen nach und nach einen Hang zu fremdartigen, geheimnisvollen Luxusgütern enthüllt.
Manders’ Feigen in Saft mit dem siebzig Jahre alten Warenzeichen – eine Orientalin, die ihre verschleierte Gestalt augenscheinlich sehnsuchtsvoll und in anbetender Haltung einem Feigenbaum zuwandte – waren die einzige Gabe, die Louisa von der Familie ihrer Tochter annahm. Louisa verteilte die braunen, luftdicht verschlossenen Gläser mit den eingemachten Früchten an ihre Bekannten; sie riefen ihnen ständig die bekannte und sattsam erwähnte Tatsache ins Gedächtnis: ‹Mrs. Jepps Tochter war eine große Schönheit; sie hat in Manders’ Feigen in Saft eingeheiratet.›
«Sag deinem Vater», meinte Louisa, «daß ich mich nicht schriftlich bei ihm bedankt habe, weil er zu beschäftigt ist, um Briefe zu lesen. Die bulgarischen Zigaretten werden ihm schmecken. Sie duften köstlich. Mochte er meine Feigen?»
«O ja, er hat sich sehr amüsiert.»
«Das hat deine Mutter mir schon in ihrem letzten Brief geschrieben. Aber hat er sie gemocht?»
«Bestimmt, er fand sie köstlich. Aber es hat uns mächtigen Spaß gemacht.»
Louisa hat eine Leidenschaft für saures und süßes Eingemachtes und hält sich stets an die neuesten Methoden. Einiges konserviert sie in Gläsern, anderes in Dosen, die sie mit ihrer eigenen Dosenverschlußmaschine versiegelt. Als Louisas Feigen in Saft für Sir Edwin Manders ankamen, zwei Dosen mit säuberlich handgeschriebenen Etiketten, hatte Helena zuerst ein eigenartiges Gefühl gehabt.
«Ob sie uns damit zum besten haben will, Edwin?»
«Aber sicher.»
Helena war sich nicht ganz klar, wie dieser Scherz gemeint sein sollte. Sie schrieb an Louisa, daß sie sich alle sehr amüsiert hätten.
«Haben die Feigen ihnen gut geschmeckt?» drängte Louisa Laurence.
«Ja, sie waren wunderbar.»
«Sie sind genauso gut wie Manders’, mein Lieber; aber erzähl deinem Vater nicht, daß ich das gesagt habe.»
«Besser als Manders’», behauptete Laurence.
«Hast du denn davon gekostet?»
«Nicht selbst; aber ich weiß, daß sie ganz vorzüglich waren. Mutter hat’s gesagt.» (Was natürlich nicht stimmte.)
«Nun, deshalb habe ich sie ja auch geschickt: damit ihr sie euch gut schmecken laßt. Nachher gebe ich dir auch noch ein paar. Ich weiß nicht, was sie damit meinen – ‹sehr amüsiert›. Sag deinem Vater, daß ich ihm die Zigaretten schenke, damit er sie sich gut schmecken läßt; sag ihm das, mein Lieber.»
Laurence zog an seiner Bulgarischen. «Sehr stark», stellte er fest. «Aber Mutter regt sich schrecklich auf, wenn du so teure Geschenke schickst. Sie weiß, daß du’s nicht leicht hast und …»
Er hätte fast gesagt: ‹… es dir vom Munde absparen mußt›, wie seine Mutter zu lamentieren pflegte; doch das hätte die alte Dame nur aufgebracht. Außerdem traf diese Feststellung offensichtlich nicht zu; seine Großmutter war von allem Notwendigen umgeben, hinter dem stets eine Andeutung von verhaltenem Luxus schwebte. Selbst ihre sonderbaren Eßgewohnheiten schienen eher einer umfassenden weisen Selbstdisziplin zu entspringen, als in Anbetracht der Kosten entstanden zu sein.
«Helena ist ein liebes Mädchen, aber sie täuscht sich. Wenn sie sich die Mühe machen wollte, könnte sie sehr gut selbst sehen, daß ich absolut nichts entbehre. Meinetwegen braucht Helena sich wirklich keine Sorgen zu machen.»
Laurence hatte seine langen Beine unter das Steuer seines kleinen schnellen Wagens geklemmt und war den ganzen Tag unterwegs, um das vertraute Bild von Land und Küste zu genießen und Freunde gleicher Wesensart und Erziehung wiederzusehen, die er auch manchmal schon mitgebracht hatte, um ihnen gegenüber mit seiner köstlichen, spaßigen Großmutter zu prahlen. Louisa Jepp tat vielerlei im Laufe dieses Tages. Nachdem sie die Tauben gefüttert und geruht hatte, holte sie einen Laib Weißbrot hervor; mit ernsthaftem Gesicht schnitt sie das Brot an einem Ende an, betrachtete eingehend die Stelle, schnitt noch eine Scheibe ab und sah wieder nach. Nach der dritten Scheibe begann sie am anderen Ende, schnitt und schaute nach, bis sie nach der vierten Scheibe beim Anblick dessen, was sie zu sehen bekam, lächelte und die Scheiben wieder an das Brot drückte; danach legte sie den Laib in die Blechdose mit der Aufschrift ‹Brot› zurück.
Um neun Uhr abends kam Laurence nach Hause. In dem langgestreckten Wohnzimmer, dessen Fenster auf die Dorfstraße hinausführten, fand er seine Großmutter mit drei Besuchern. Sie saßen an den Längsseiten des Zimmers und hatten Rommé gespielt, ließen sich jetzt aber Louisas Erfrischungen schmecken. Einer saß in einem Rollstuhl; es war ein junger Mann, nicht älter als vierundzwanzig.
«Mr. Hogarth, mein Enkel; mein Enkel, Mr. Webster; und dies ist der junge Mr. Hogarth. Mein Enkel ist bei der B.B.C., der Sohn meiner Tochter, Lady Manders. Sie haben sicher seine Sportreportagen über Fußballspielen und Rennen gehört. Laurence Manders.»
«Hab’ Sie am letzten Sonnabend gehört.» Das war Mr. Webster, der älteste Gast, fast so alt wie Louisa.
«Hab’ Sie heute morgen gesehen», sagte Laurence.
Mr. Webster blickte überrascht.
«Mit dem Bäckerwagen», fügte Laurence hinzu.
«Laurence ist ein guter Beobachter», sagte Louisa; «in seinem Beruf muß er das aber auch sein.»
Laurence, von mehreren Drinks sehr angeregt, meinte verbindlich und banal: «Ich vergesse nie ein Gesicht»; und indem er sich an den alten Hogarth wandte, sagte er: «So bin ich zum Beispiel sicher, daß ich Ihr Gesicht schon früher einmal irgendwo gesehen habe.» Doch hier begann Laurence seine Sicherheit zu verlassen. «Zumindest – erinnern Sie mich an jemand, den ich kenne, ich weiß nur nicht, an wen.»
Der alte Hogarth sah Louisa verzweifelt an, während sein Sohn, der Junge im Rollstuhl, sagte: «Er sieht mir ähnlich. Vielleicht haben Sie mich schon einmal gesehen?»
Laurence musterte ihn.
«Nein», sagte er dann, «Sie habe ich nicht gesehen. Überhaupt niemanden, der so aussieht wie Sie.»
Und für den Fall, daß er etwas Verkehrtes gesagt haben sollte – denn schließlich war der junge Mann ein Krüppel – plapperte Laurence weiter: «Vielleicht werde ich mich demnächst als Detektiv betätigen. Diese Arbeit würde mir bestimmt sehr liegen.»
«O nein, Laurence, du würdest nie einen guten Detektiv abgeben», meinte Louisa sehr ernsthaft.
«Und warum nicht?»
«Ein Detektiv muß gerissen sein. Die Leute von der Kriminalpolizei sind furchtbar listig und durchtrieben, und Privatdetektive scheuen vor nichts zurück. Du bist überhaupt nicht durchtrieben, mein Lieber.»
«Mir entgeht so leicht nichts», prahlte Laurence beiläufig und ließ seinen braunen Kopf auf der Sofalehne von einer Seite zur andern rollen. «Ich bemerke Dinge, die andere Leute für verborgen halten. Eine schreckliche Veranlagung, nicht wahr?»
Laurence hatte das Gefühl, daß sie ihn nicht mochten, daß er ihren Argwohn erregte. Er wurde nervös und wußte beim besten Willen nichts Vernünftiges zu sagen. Je mehr er verbissen darüber schwatzte, was für einen wunderbaren Spürhund er abgeben würde, desto weniger schienen sie ihn zu mögen. Und die ganze Zeit, während er redete, versuchte er, wie ein Detektiv, sich ein genaues Bild von ihnen zu machen.
Ihre Gegenwart im Haus seiner Großmutter war wohl merkwürdig und erstaunlich, doch das allein konnte ihn nicht sehr überraschen: Louisa gießt Tee ein. Sie nennt den jungen Hogarth ‹Andrew›. Sein Vater ist für sie ‹Mervyn›. Webster ist ‹Mr. Webster›.
Mr. Webster mit seinem weißen Haar, dem weißen Schnurrbart und der dunkelblauen Marinejacke wies keine besondere Ähnlichkeit mit seiner Erscheinung am frühen Morgen auf: dem Händler im sandbraunen Overall, der mit Brot von Tür zu Tür zieht. Laurence war sehr zufrieden mit sich, daß er Mr. Webster gleich erkannt hatte, dessen braune Wildlederschuhe nach seiner Schätzung Größe zehn waren, dessen Alter ungefähr fünfundsiebzig sein mochte und der, seinem Akzent nach, aus Sussex stammte.
Mervyn Hogarth war klein und dünn. Er hatte eine ungesunde, blasse Gesichtsfarbe. Louisa hatte ihm eine dünne Scheibe Grahambrot mit Butter gemacht.
«Mervyn muß wegen seines Magenleidens oft in kleinen Portionen essen», erklärte Louisa.
Seiner Sprechweise nach war der alte Hogarth ein mit allen Wassern gewaschener Großstadtmensch, überlegte Laurence. Gott allein wußte, was er in diesem Haus zu suchen hatte, warum er so familiär mit Louisa stand, daß sie sich mit Vornamen anredeten und Louisa mit seinem Magenleiden so vertraut war. Doch Laurence pflegte sich über nichts zu wundern. Er stellte fest, daß der alte Hogarth mit der Nonchalance eines Mannes, der es sich leisten kann, nachlässig gekleidet zu gehen, ungebügelte Flanellhosen und eine alte rötlichbraune Tweedjacke trug. Sein Sohn Andrew war breitschultrig, hatte volle rote Lippen, ein rundes Gesicht und trug eine Brille. Seine Beine waren gelähmt.
Als Louisa Laurence fragte: «Hast du einen netten Ausflug gemacht, Lieber?» blinzelte Andrew ihm zu.
Laurence nahm ihm das übel; er hielt es für eine Ungerechtigkeit seiner Großmutter gegenüber. Der Gedanke, mit Andrew womöglich eine gönnerhafte Verschwörung gegen die alte Dame einzugehen, war ihm geradezu widerlich; er machte aus einem bestimmten Grunde, der mit einer Liebesaffäre zusammenhing, Ferien und wünschte eine Abwechslung von dem komplikationsbeladenen Leben in einer überfeinerten, spitzfindigen Gesellschaftsschicht. Die Großmutter bedeutete für ihn eine regelrechte Erquickung; ihretwegen zu blinzeln, durfte sich niemand herausnehmen. Und daher lächelte Laurence zu Andrew hinüber, als wolle er damit sagen: ‹Ich habe Ihren Wink gesehen. Ich weiß zwar nicht, was das soll, nehme aber an, Sie meinen etwas sehr Nettes damit.›
Andrew begann im Zimmer umherzublicken; er schien etwas zu vermissen, das eigentlich da sein sollte. Schließlich blieb sein Blick auf der Schachtel mit den bulgarischen Zigaretten haften, die auf Louisas Anrichte lag; er streckte den Arm aus, öffnete die Schachtel und nahm sich eine Zigarette heraus. Mr. Webster versuchte mit Louisa einen mißbilligenden Blick über die Manieren ihres Gastes zu wechseln, sie aber ließ sich nicht darauf ein. Sie stand auf und reichte Laurence die geöffnete Schachtel.
«Das sind bulgarische Zigaretten», erklärte Andrew ihm.
«Ja, ich weiß. Schmecken eigenartig, nicht wahr?»
«Man kann sich sehr daran gewöhnen», bemerkte Andrew.
«Bulgarische!» rief sein Vater aus. «Ich muß eine probieren!»
Schweigend reichte Louisa ihm die Zigaretten. Mit einem ergebenen Kopfneigen zu Laurence hin gab sie die unleugbare Wahrheit zu: die Tatsache, daß drei dicke zusammengequetschte bulgarische Zigarettenstummel bereits in dem Aschbecher neben Mervyn Hogarth lagen.
Louisa beobachtete teilnahmslos Hogarths Vorstellung, der den Eindruck zu erwecken versuchte, als genieße er eine ihm bislang unbekannte Zigarettenmarke.
«Meine liebe Louisa, wie exotisch! Ich glaube nicht, daß ich viele davon vertragen kann. So stark und so … wie soll ich’s nur ausdrücken?»
«Beißend», sagte Louisa geduldig, wie jemand, der dasselbe Wort schon einmal von demselben Mann und am selben Ort gehört hat.
«Beißend», wiederholte Mervyn in einem Ton, als hätte sie damit das einzig zutreffende Wort gefunden.
«Ein Hauch von – von Balkan», fuhr er dann fort, «ein Beigeschmack wie – wie …»
«Wie Ziegenmilch», kam Louisa ihm ein zweites Mal entgegen.
«Das ist es! Ziegenmilch.»
Louisas glänzende schwarze Knopfaugen wandten sich jetzt offen Laurence zu. Er beobachtete das Gesicht des Mannes; er blickte auf den Aschbecher mit den Zeugnissen seiner Verstellung und sah dann wieder Mervyn an. Louisa begann unhörbar zu kichern, als schüttele sie sacht eine Flasche mit Hustensaft in ihrem Leibe. Aus den Augenwinkeln heraus nahm Mr. Webster ihre Bewegungen wahr. Da sein Hals steif war, mußte er den ganzen Oberkörper drehen, um von seinem Sitzplatz aus Louisa besser sehen zu können. Als sie das merkte, wurde sie leicht verlegen, hatte sich aber sofort wieder in der Gewalt und machte ein unschuldiges Schulmädchengesicht.
«Wohnen Sie hier in der Nähe?» fragte Laurence Andrew.
Vater und Sohn antworteten gleichzeitig. Mervyn sagte: «Oh, nein»; Andrew sagte: «Oh, ja.»
Louisa konnte ihre Heiterkeit nicht länger unterdrücken, und obgleich sie ihre Lippen fest zusammenpreßte, wieherte sie durch die Nase wie ein Pony. Mr. Webster setzte seine Tasse abrupt auf den Unterteller, als hätten die Wände gesprochen.
Die Hogarths versuchten sofort ihren Schnitzer wiedergutzumachen. Beide begannen von neuem gleichzeitig zu reden – Mervyn: «Nun ja, wir leben zwar meist in London …» Andrew: «Ich wollte sagen, daß wir die meiste Zeit hier sind …» Der Vater entschloß sich, Andrew das Wort zu überlassen.
«Und manchmal fahren wir ins Ausland», schloß der Sohn lahm.
Laurence blickte auf seine Uhr und sagte hastig zu Andrew: «Wollen wir noch etwas trinken gehen? Die Lokale schließen erst in etwa fünfzehn Minuten.» Doch im selben Augenblick sah er ein, daß jetzt er einen groben Schnitzer gemacht hatte. Einen Moment lang hatte er völlig vergessen, daß der Junge ein Krüppel war.
«Nicht heute abend, danke. Ein andermal, falls Sie noch hierbleiben», antwortete Andrew, ohne sich etwas anmerken zu lassen.
«Laurence bleibt bis zum Wochenende», sagte Louisa.
Laurence ging rasch hinaus. Sie konnten seine Schritte hören, wie er die stille Straße überquerte und dann die Gasse zum Dorfgasthaus hinunterging.
«Charmanter Junge», brach Mr. Webster das Schweigen.
«Ja», meinte Louisa, «und so klug.»
«Ein interessanter Bursche», sagte Mervyn.
«Ich frage mich nur …», warf Andrew ein.
«Was denn, Lieber?» fragte Louisa.
«Sollten wir uns nicht lieber bis nächste Woche vertagen?»
Mr. Webster drehte sich auf seinem Stuhl herum, um der alten Dame ins Gesicht zu sehen. «Mrs. Jepp», sagte er, «ich hätte nicht gedacht, daß Sie ein Zusammentreffen von uns mit Ihrem Enkel gestatten würden. Ich glaubte annehmen zu dürfen, daß er heute abend nicht anwesend sein würde. Ich hoffe nur, daß er nicht auf dumme Gedanken kommt.»
«Du meine Güte!» erwiderte Louisa herablassend. «Er wird schon nicht auf dumme Gedanken kommen. Die jungen Leute denken heutzutage sehr großzügig.»
Das hatte Mr. Webster nun wieder nicht gemeint. Mervyn sprach als nächster.
«Wahrscheinlich wird er Fragen stellen. Das ist schließlich nur natürlich, Louisa, oder erwarten Sie etwas anderes?» Er zündete sich eine bulgarische Zigarette an.
«Was für Fragen sollte er denn stellen?»
«Es muß ihm doch sonderbar vorkommen …», sagte Andrew.
«Er wird bestimmt fragen, wer wir sind und was wir hier machen», sagte Mervyn.
Mr. Webster sah traurig zu Mervyn hinüber, schmerzlich berührt von einem gewissen schroffen Ton in dessen Worten.
«Du meine Güte!» entgegnete Louisa. «Sicher wird Laurence sich genau nach Ihnen erkundigen. Wollen wir nicht noch ein Spielchen machen, meine Herren?»
Mervyn blickte auf die Uhr.
«Wenn die Kneipe dicht macht, wird er zurückkommen, nicht wahr?» meinte Andrew.
Mr. Webster lächelte Louisa väterlich zu. «Die Sache ist nicht dringend», sagte er, «wir können unser Geschäft gut bis Ende der Woche aufschieben; oder Sie geben uns Nachricht, wenn Sie wissen, daß Ihr Enkel wirklich einmal nicht am Abend zu Hause ist.»
«Wir können ruhig vor Laurence darüber sprechen», erwiderte sie. «Laurence ist ein lieber Junge.»
«Daran zweifle ich nicht», sagte Mervyn.
«Das ist es ja eben», meinte Andrew. «Wir sollten dem lieben Jungen keinen Grund geben, sich Gedanken zu machen …»
Louisa blickte ein wenig ungeduldig drein. Sie war etwas enttäuscht. «Ich hatte wirklich gehofft», sagte sie, «daß wir zwischen Laurence und uns keinen Unterschied zu machen brauchten. Ich versichere Ihnen, daß wir, natürlich auf diskrete Art, in Laurences Gegenwart alles sagen können, was wir wollen. Er ist von Natur aus nicht mißtrauisch.»
«Ah, Diskretion», meinte Mr. Webster. «Diskretion, meine liebe Mrs. Jepp, ist stets erstrebenswert.»
Louisa schenkte ihm ein warmes Lächeln, da er ihre Gedankengänge wohl am besten verstanden hatte.
«Ich verstehe Sie, Louisa», sagte Mervyn. «Es ist für Sie unerträglich, in zwei so grundverschiedenen Welten leben zu müssen. Ihre Veranlagung verlangt nach Einheit, nach einer Koordination der unvereinbaren Erfahrungstatsachen; Sie besitzen eine Leidenschaft dafür, die unbedeutenden Vorgänge des Lebens herauszupicken und miteinander in Beziehung zu setzen. Das ist Ihr Wunschbild, und früher war es auch das meine. Die Wirklichkeit jedoch entspricht nicht den Vorstellungen der Idealisten. In Ihrem Alter ist es schwierig, eine Tatsache zu begreifen, die zu erkennen Sie nie Gelegenheit gehabt haben; aber …»
«Ich weiß nicht, was Sie meinen», sagte Louisa; «so alt, um etwas nicht zu begreifen, kann ich gar nicht werden.»
«Natürlich nicht.»
«Sie tippen völlig daneben», sagte sie, begehrte dann aber vollends auf: «Also, Mervyn, wenn Sie meinen, daß ich zu altmodisch eingestellt bin, verstehe ich das vollkommen. Sie können ja jederzeit von unseren Vereinbarungen zurücktreten.»
Mervyn, der inzwischen aufgestanden war, setzte sich wieder. Andrew lachte trocken auf, ohne das Gesicht zu verziehen, so daß Louisa ihm einen überraschten Blick zuwarf.
«Er redete doch davon, daß er sich als Detektiv betätigen wolle», antwortete Andrew darauf. «Er scheint mir gar nicht so dumm zu sein.»
«Laurence hat beim Rundfunk sein gutes Auskommen. Er würde sich nie mit etwas so Niedrigem wie Detektivarbeit abgeben.»
«Er würde einen guten Spitzel abgeben», entgegnete Andrew und sah ihr im Bewußtsein seiner privilegierten Lage als Insasse eines Rollstuhls herausfordernd ins Gesicht.
«Du meine Güte, Sie brauchen nicht weiter mitzumachen, mein lieber Andrew, wenn etwas Ihnen Sorgen bereitet. Natürlich sollten wir in diesem Falle auch aufhören, nicht wahr?» Sie blickte fragend Mervyn und Mr. Webster an, die jedoch nicht antworteten. Sie standen auf, um sich zu verabschieden.
Als er ihr die Hand gab, sagte Mr. Webster: «Sehen Sie, Mrs. Jepp, Ihr Neffe ist wirklich ein sehr guter Beobachter. Das war der einzige Grund, warum ich seine Anwesenheit bei unseren Besprechungen nicht ratsam fand.»
Louisa lachte. «Oh, ihm entgeht nichts. Ich hab’ noch keinen gesehen, der so wie er die unbedeutendsten Kleinigkeiten bemerkt. Aber wissen Sie, der liebe Junge kann zwei und zwei nicht zusammenzählen.»
«Meinen Sie», fragte Mervyn, «daß er nicht logisch überlegen kann?»
«Ich meine», erwiderte Laurences Großmutter, «daß er in gewisser Beziehung intelligenter sein könnte, als er ist. Aber er ist klug genug, um in der Welt voranzukommen, und er hat einen reizenden Charakter; das allein ist wesentlich.»
«Und wenn er nun Fragen stellt …?» meinte Andrew.
«Oh, bestimmt wird er Fragen stellen», erwiderte Louisa.
Man konnte einfach nichts mit ihr anfangen.
«Oh, Mrs. Jepp, Sie werden bestimmt nicht zuviel sagen, nicht wahr? Davon bin ich überzeugt», meinte Mr. Webster.
«Mein Enkel kann zwei und zwei nicht zusammenzählen – jedenfalls kommt bei ihm nicht vier dabei heraus.» Sie amüsierte sich offensichtlich köstlich, als mache es ihr Spaß, die anderen auf die Folter zu spannen.
«Er fährt am Freitag?» fragte Mervyn.
«Ja, leider.»
«Am Freitagabend also?» meinte Mervyn.
«Ja», antwortete sie melancholisch.
«Dann bis Freitag», sagte Andrew.
«Vielen Dank für den sehr unterhaltsamen Abend, Mrs. Jepp», sagte Mr. Webster.
Da Laurence begonnen hatte, mit einem Buch als Unterlage auf den Knien einen Brief zu schreiben, räumte Louisa einen Teil des Tisches für ihn ab und sagte: «Komm, Liebling, setz dich an den Tisch, das ist bequemer.»
«Aber nein, ich schreibe immer so.»
Louisa breitete ein weißes Tischtuch über die für Laurence reservierte Ecke.
«Du mußt immer ein weißes Tuch unter das Papier legen, wenn du einen Brief schreibst. Das ist gut für die Augen, weil es mehr Licht gibt. Komm, Lieber, setz dich an den Tisch.»
Laurence wechselte seinen Platz und schrieb am Tisch weiter. Nach ein paar Minuten sagte er: «Das weiße Tuch macht tatsächlich einen Unterschied. Viel angenehmer.»
Louisa hatte sich auf dem Sofa neben dem kleinen rückwärtigen Fenster langgelegt, wo sie am Nachmittag stets bis zum Tee zu ruhen pflegte; sie antwortete schläfrig: «Als ich Mervyn Hogarth von diesem kleinen Trick erzählte, begann er angestrengt nachzurechnen, so mit Lichtstrahlen und optischen Gesetzen, ob das überhaupt eine Wirkung haben kann oder nicht. ‹Versuch’s nur, Mervyn›, hab’ ich gesagt, ‹versuch’s nur, dann wirst du schon merken, daß ich recht habe.›»
«Natürlich», meinte Laurence, der mit seinen Gedanken nicht recht bei der Sache war, «kann es auch einen psychologischen Grund haben.»
«Oh, sicher ist es psychologisch bedingt», stimmte Louisa überraschend und unergründlich zu. Dann schloß sie die Augen.
Ein paar Sekunden später öffnete sie sie jedoch wieder und sagte: «Falls du an deine Mutter schreibst, grüße sie herzlich von mir.»
«Im Augenblick schreibe ich an Caroline.»
«Dann grüße sie herzlich von mir und schreib ihr, ich hoffe, daß es ihr besser geht als damals zu Ostern. Wie hat sie sich denn in letzter Zeit gefühlt?»
«Elend. Sie ist zu irgendeinem frommen Ort im Norden gefahren, um sich zu erholen und Ruhe zu finden.»
«An einem frommen Ort wird sie nicht viel Ruhe finden.»
«Das hab’ ich auch gedacht. Aber Mutter hatte diese Idee. Sie bespricht sich mit ihren Priestern und baut solche Häuser. Dann weihen sie die Gebäude einem Heiligen, und Mutter schickt ihre Freunde und Bekannten hin.»
«Aber Caroline ist doch nicht katholisch.»
«Sie ist es gerade geworden.»
«Deshalb sah sie so dünn aus! Und wie kommst du dir jetzt so vor, Lieber?»
«Nun ja, Caroline hat mich natürlich in gewisser Weise verlassen. Zumindest hat sie sich eine andere Wohnung genommen.»
«Na!» sagte die alte Frau, «das ist ja reizend!»
«Vielleicht heiraten wir eines Tages.»
«Ach, und wenn nicht?» Sie blickte ihn mit verhaltener Neugier an und fügte hinzu: «Weiß Caroline überhaupt, was sie tut? Für eine Frau ist es das einzige sichere Mittel, einen Mann zu halten, wenn sie ihn aus religiösen Gründen verläßt. Ich hab’ das schon geschehen sehn. Der Mann findet vielleicht ein anderes Mädchen, aber er wird nie mit einer anderen glücklich werden können, nachdem die erste ihn aus religiösen Gründen verlassen hat. Damit hat sie ihn für immer an der Leine.»
«Ist das wirklich wahr?» fragte Laurence. «Das ist ja prächtig. Das muß ich Caroline erzählen.»
«Nun, mein Liebling, es wird schon alles gut ausgehen. Ich hoffe, daß du sie bald heiraten kannst. Man wird nicht verlangen, daß du katholisch wirst; du mußt nur versprechen, daß du die Kinder katholisch erziehen läßt. Und letzten Endes treffen die Kinder heutzutage ihre eigenen Entscheidungen, wenn sie erwachsen werden. Und schließlich ist es auch nicht verkehrt, Katholik zu sein, wenn man es wirklich sein will.»
«Es ist ein bißchen kompliziert», meinte Laurence. «Der armen Caroline geht’s nicht gut.»
«Arme Caroline. Das hat man nun von der Religion. Grüße sie recht herzlich von mir und schreib ihr, sie soll herkommen. Ich werde sie hochpäppeln. Ich möchte wirklich annehmen, daß alles sich noch zum besten kehren wird.»
‹Großmutter ist gerade wieder eingeschlafen›, schrieb Laurence, ‹nachdem sie noch einmal herschaute, um sich nach Dir zu erkundigen. Bei der Neuigkeit von Deinem Glaubenswechsel machte sie ein ernstes Gesicht. Sie sah aus wie eine von den alten Frauen auf Rembrandts Gemälden, war jedoch rasch wieder ganz die vertraute alte Louisa. Sie möchte Dich hier haben, um Dir ihre Spezialkost zu verschreiben.
Ich war recht unglücklich, als Dein Zug den Euston-Bahnhof verließ, und auf dem Heimweg trug ich mich mit dem Gedanken, Dir mit dem Abendzug zu folgen. In der U-Bahn am Piccadilly traf ich den Baron, und während ich ihn zur Buchhandlung begleitete, ließ ich mich von ihm beeinflussen und entschied mich dagegen. Er machte geltend, daß ‚die Gegenwart eines Ungläubigen in einem katholischen Stift die anderen sehr beunruhigt, wenn er nicht daran interessiert ist, ihren Glauben anzunehmen. Diese Einrichtungen bekunden stets, daß sie die Ungläubigen willkommen heißen. Wenn Sie jedoch lediglich Caroline besuchen wollen, wird man verstimmt sein und Sie nicht willkommen heißen. Außerdem wird Caroline es ausbaden müssen, daß sie Ihnen offensichtlich begehrenswerter erscheint als ihr Glaube.‘ Jedenfalls kam ich letztlich zu der Überzeugung, daß ein Hereinplatzen meinerseits recht unpassend sein würde.
Da ich die Wohnung nicht sehen mochte, fuhr ich nach Hampstead. Vater war zu Hause, Mutter ausgegangen. Er ließ eine Bemerkung fallen, die mir Sorgen macht. Allem Anschein nach ist ein Weib namens Hogg in dem Verein, bei dem Du Dich augenblicklich aufhältst. Sie ist da so etwas wie eine Vorsteherin. Mutter hat ihr den Job verschafft. Gott weiß, warum. Wir können sie alle nicht ausstehen. Das ist auch der eigentliche Grund, weshalb wir uns ihretwegen immer so bemüht haben. Sie ist diese Georgina Hogg, von der ich Dir, glaube ich, schon einmal erzählt habe: sie war bei uns so eine Art Kinderfräulein, bevor wir zur Schule gingen. Sie heiratete dann, aber ihr Mann verließ sie. Kein Wunder, der arme Kerl. Wir pflegten ihn zu bedauern. Sie leidet an chronischer Rechtschaffenheit, die sich in einer Art moralischer Erpressung auswirkt. Mutter macht sich ihretwegen Vorwürfe – weil sie die Frau so verabscheut, meine ich; sie hat einen regelrechten Horror vor ihr, will es aber nicht zugeben. Vater nennt sie Manders’ Demütigung. Selbstverständlich ist sie völlig harmlos, wenn Du sie Dir nicht zu nahe kommen läßt. Ich glaube, daß Du mit dem Weib fertigwirst; mir wenigstens ist es stets gelungen. Aber am besten gehst Du ihr aus dem Weg, Liebling. Ich hoffe, daß Du nicht mit ihr aneinander gerätst. Ich habe Mutter wegen dieses verdammten Blödsinns zur Rede gestellt, Dich ausgerechnet jetzt, wo Du Dich überhaupt nicht wohl fühlst, an einen Ort zu schicken, wo Georgina sich aufhält. Sie blickte etwas schuldbewußt drein, sagte aber:, Oh, Caroline wird Georgina schon an ihren Platz zu weisen wissen.’ Hoffentlich tust Du das. Wenn sie Dir auf die Nerven geht, reise sofort ab, komm hierher und laß Dich mästen. Die aufregendsten Dinge tun sich hier!
Am Sonntagabend bin ich angekommen. Meine kleine Großmutter ist eine tolle Frau, aber das hab’ ich schon immer gewußt. Ich hab’ was ganz Verrücktes entdeckt! Sie leitet eine Bande. Um was für eine Bande es sich handelt, weiß ich nicht, da tappe ich noch völlig im dunkeln, aber möglicherweise sind es kommunistische Spione. Drei Männer. Ein Vater mit seinem Sohn. Der Sohn ist ein Krüppel, der arme Kerl. Der Vater macht entschieden den Eindruck eines Mannes, der im Leben zu kurz gekommen ist. Der dritte Gangster ist ein richtig lieber Kerl, ziemlich alt, sieht aus wie ein pensionierter Schiffer und tut schön mit Großmutter. Er besitzt die örtliche Bäckerei und bringt persönlich das Brot ins Haus.
Ich weiß nicht, wie tief Großmutter in ihre Machenschaften verwickelt ist, auf jeden Fall aber ist sie der Boß. Finanziell geht es ihr recht gut. Ich glaube, sie hebt ihre Pension nur ab, um Argwohn zu vermeiden. Weißt Du, wo sie ihr Vermögen versteckt? Im Brot! Sie steckt Diamanten ins Brot. Ohne ein Wort der Übertreibung, ich fand zufällig einen Laib Brot, der ganz unnatürlich an beiden Enden angeschnitten war, und in einem Ende steckten die Diamanten – richtige Diamanten. Zuerst war ich absolut nicht sicher und löste sehr vorsichtig einen Stein heraus. Diamanten sehen so ganz anders aus, wenn sie nicht als Schmuck gefaßt sind. Nachdem ich mich jedoch überzeugt hatte, steckte ich den Stein wieder ins Brot zurück. Großmutter hat natürlich keine Ahnung, daß ich hinter diese Sache gekommen bin. Ist sie nicht ein Wunder? Ich frage mich, was für ein Spiel sie eigentlich treibt. Natürlich glaube ich nicht ernstlich, daß sie Spione sind, aber irgend etwas Kriminelles steckt dahinter. Wesentlich aber ist, daß Großmutter nicht ausgenützt wird, sondern daß sie die Anführerin ist. Vor allen Dingen darf Mutter nichts erfahren; also sieh Dich vor, was Du sagst, mein Schatz.
Ich beabsichtige, alles herauszufinden, selbst wenn ich noch eine Woche hierbleiben muß und mir Weihnachten vermaßle. Ich habe begonnen, ein Dossier anzulegen.
Wenn Dir zu dieser Sache etwas einfällt, laß es mich wissen. Persönlich bin ich der Ansicht, daß Großmutter sich großartig vergnügt, aber es könnte ernste Folgen für sie haben, wenn die Männer geschnappt würden. Allerdings kann ich noch nicht einmal vermuten, wofür sie geschnappt werden sollten. Vielleicht sind sie Juwelenräuber, aber das entspräche nicht dem Charakter des lieben alten Mariners. Großmutter wäre alles zuzutrauen.
Großmutter bezeichnet sie offen als ‚meine Bande‘, nonchalant wie ein Edelganove. Sagt, sie kommen zum Kartenspielen. Ich habe sie neulich abend hier getroffen, und seitdem schnüffle ich. Ich wünschte, du könntest für ein paar Tage herkommen und mir helfen, ‚zwei und zwei zusammenzuzählen‘, wie Großmutter zu sagen pflegt. Hoffentlich geht Dir St. Philumena nicht zu sehr auf die Nerven. Glaub mir, die oberen katholischen Gesellschaftskreise in England sind nur mit Vorsicht zu genießen; wenn Du an die verkehrten Leute gerätst, können sie Dich zum Wahnsinn treiben. Mutter weiß, daß sie einen Fehler begangen hat, Dich dorthin zu senden. Ihre Leidenschaft, ‚Zentren‘ zu gründen und zu bevölkern, ist mit ihr durchgegangen. Vater ist überzeugt, daß sie damit noch einmal ein Schisma heraufbeschwören wird.
Ich nehme an, daß ich morgen einen Brief von Dir erhalten werde. Ich kann kaum erwarten, zu hören, daß Du Mrs. Hogg gezähmt hast. Eigentlich stelle ich es mir ganz spaßig vor, wenn Du eine Auseinandersetzung mit ihr hättest. Ich würde gern dabeisein. Dabei, aber heimlich.›
Louisa öffnete die Augen und sagte: «Setz den Teekessel auf, Lieber.»
Laurence legte den Federhalter hin. «Was glaubst du wohl, wer dieses fromme Haus leitet, in dem Caroline jetzt ist?» fragte er sie.
«Wer denn, Lieber?»
«Mrs. Hogg.»
«Mrs. Hogg?! Ich dachte, es sei ein Kloster.»
«Nein, nur ein Haus zur inneren Sammlung. Georgina ist dort Wirtschafterin oder so etwas.»