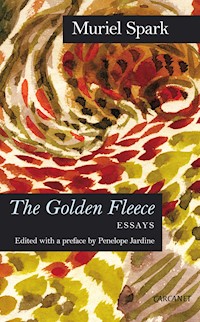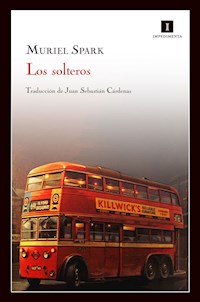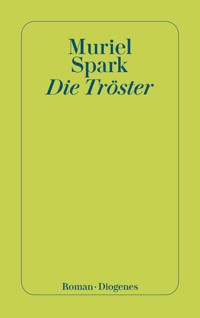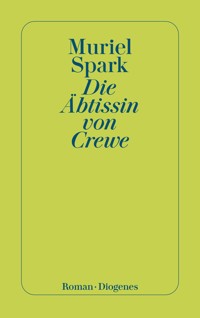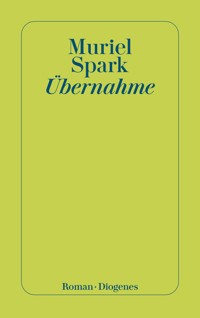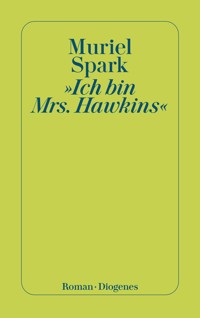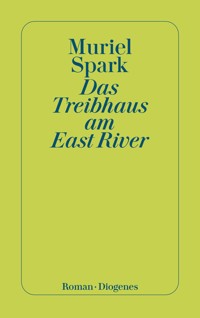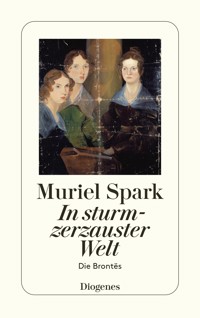
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
›In sturmzerzauster Welt‹: die Brontës, wie sie wirklich waren und wie sie sich selbst sahen – der Versuch einer Autobiografie in Briefen, Gedichten und Selbstzeugnissen, kongenial zusammengestellt und nacherzählt von Muriel Spark, der ›grande dame‹ der englischen Literatur. Sie begibt sich auf die Spuren ihrer Lieblingsschriftstellerin Emily Brontë und deren Schwestern, die allesamt Literaturgeschichte geschrieben haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Muriel Spark
In sturmzerzauster Welt
Die Brontës
Aus dem Englischen von Gottfried Röckelein
Diogenes
Vorwort
Mehr als die meisten anderen Schriftsteller, insbesondere jene des neunzehnten Jahrhunderts, begriffen sich die Geschwister Brontë als eigenständige Charaktere. Das dramatische Potential ihrer Situation war ihnen vollständig bewußt. Charlotte, die ›Sprecherin‹ der Sippe, versäumte es nie, dramatisch überhöhte Einsamkeit und landschaftliche Effekte zu beschwören, wann immer sie über ihre Familie schrieb. Es schien, als wüßte sie, daß familiäre Umstände und individuelle Begabungen die Brontë-Kinder auf ein Podest hoben, von dem aus sie nicht nur die eigene Generation in ihren Bann ziehen konnten, sondern vor allem auch die Nachwelt. Sogar wenn man ihr schriftstellerisches Wirken ausklammert, bilden ihre Lebensgeschichten für sich genommen autonome Kunstwerke. Vom Pfarrhaus in Haworth überblickte man den Friedhof. Die Grenze zwischen Leben und Tod verlief fließend. Drei vereinsamte Mädchen, ein grämlicher Witwer als Vater, ein verzweifelter Exzentriker als Bruder – das ergab in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts ein perfektes Szenario.
Im vorliegenden Buch habe ich eigene Texte über die Brontës zusammengestellt, dazu ausgewählte Briefe der Familie und Gedichte von Emily.
Charlottes Briefe wurden mit der erklärten Absicht ausgesucht, sie als eine Art »Brontë-Autobiographie« zu präsentieren. Schon als ich für mein Buch The Brontë Letters (1954) eine erste Auswahl aus den Briefen traf, stellte ich fest, daß sie sich wie eine zusammenhängende dramatische Erzählung lasen. Charlotte hatte in ihren Briefen, von denen die meisten an ihre Freundin Ellen Nussey adressiert waren, ihre ganze Familie beschrieben und typisiert.
Nur zwei Jahre nach Charlottes Tod erschien 1857 Elizabeth Gaskells The Life of Charlotte Brontë (Das Leben der Charlotte Brontë), und das Publikum verschlang die Biographie Charlottes genauso begierig wie zuvor deren Romane. Die Lebensgeschichte der Brontës wurde zur nationalen Legende.
Nachdem die zweite Auflage meiner Brontë Letters herausgekommen war, erhielt ich einen netten und zugleich merkwürdigen Brief, der dazu angetan war, mich in meiner Überzeugung zu bestärken, daß Charlotte als Literaturagentin in eigener Sache schon frühzeitig nicht nur das Brontë-Œuvre, sondern auch die Lebensgeschichte der Geschwister, ihre Schwermut, ihre Tragödien als romanhafte Darstellung energisch und erfolgreich vermarktete.
11. Dez. 1967
Liebe Muriel Spark,
Ihr Buch The Brontë Letters ist mir kürzlich zu Händen gekommen, & ich lese es mit großem Interesse.
Meine Mutter Elizabeth Dean, eine geborene Berridge, 1933 im Alter von 81 Jahren verstorben, war in Yorkshire zur Schule gegangen, & sie hatte mir erzählt, daß Ellen Nussey mehrmals zu ihnen gekommen sei & den Schülern Charlotte Brontës Briefe vorgelesen habe. Es ist eine faszinierende Vorstellung, daß vielleicht einige der Briefe in Ihrem Buch meiner Mutter von der Adressatin selbst vorgelesen worden waren.
Ich stehe nun im achtzigsten Lebensjahr, & ich danke Ihnen für das Vergnügen, das Sie mir bereitet haben.
Mit freundlichen Grüßen,
Dorothy D. Dean
Es ist immer ein bewegendes Gefühl, einem Menschen zu begegnen, dem selbst eine historische Begegnung zuteil geworden ist. Aber davon abgesehen, hat mich damals wie heute der erneute Beweis beeindruckt, daß sich Ellen Nussey der fesselnden erzählerischen Substanz der Brontë-Lebensumstände absolut bewußt war. So war es nur folgerichtig, daß sich Theaterstücke und Filme später des Sujets annahmen.
Bei der Sichtung des Materials für das vorliegende Buch habe ich mich entschlossen, alles wegzulassen, was ich ausschließlich über Anne Brontë geschrieben habe, wie Artikel aus den 50er Jahren zu den Gedichten Anne Brontës oder Besprechungen ihrer Romane Agnes Grey und The Tenant of Wildfell Hall (Die Herrin von Wildfell Hall); heute stehe ich aber nicht mehr zu meiner früheren Meinung über Anne Brontës Stellenwert als Romanautorin. Ich halte ihre Texte nicht für gut genug, als daß man sie in einen seriösen Kontext mit der Romanliteratur des neunzehnten Jahrhunderts stellen könnte. Ich sehe auch keinerlei literarische Gemeinsamkeit, die einen Vergleich mit den phantasievollen Schöpfungen von Charlotte und Emily rechtfertigte. Dennoch war Anne ein eigenständiger Charakter. In diesem Buch wird sie so vorgestellt, wie Charlotte sie darstellt: ein bleicher Schatten ihrer selbst; ein vereinsamtes, ewig kränkelndes und niedergeschlagenes Mädchen; ein bißchen religiös, aber ohne rechte Begeisterung. Sie war eine Schriftstellerin, die eine Geschichte leidlich gut »zu Papier bringen« konnte. Sie war das literarische Pendant zu einer jener handwerklich soliden Aquarellmalerinnen, wie es sie zu der Zeit dutzendweise gab.
1952 veröffentlichte ich eine Auswahl von Emily Brontës Lyrik mit einem einführenden Essay, woran ich anknüpfen möchte. Mein Kriterium war damals, jene Gedichte auszuwählen, die ich für Emilys beste hielt. Ich verspüre erneut, wie sich Emilys originäre geistige Kraft in ihrer Lyrik widerspiegelt. Sie tritt dort verdichteter und unmittelbarer auf als in Sturmhöhe, wo sie sich langatmig auf die unterschiedlichsten Charaktere verteilt.
Wie so vielen Künstlern fiel es Emily und insbesondere Charlotte schwer, sich in Gesellschaft zu bewegen. Wir wissen, daß sie während ihrer Lehrtätigkeit in Brüssel verschiedentlich von englischen Familien eingeladen wurden, aber ihren Gastgeberinnen gelang es schlechterdings nicht, die Schwestern zu irgendeiner Form von gesellschaftlichem Kontakt zu bewegen. Es hat den Anschein, als hätten sie ihre Vereinsamung, ihre nordenglische Melancholie mit Hingabe gepflegt. Um so mehr Herzblut findet sich in ihren schriftlichen Äußerungen, in denen sie ihre Gefühle offenbarten.
Der Tod schlug zu, als mein Vertrauen am größten
In meinen Glauben an die Lebensfreud
Aus Emilys anrührenden Zeilen – welche künstlerische Intention auch immer dahinterstehen mag (ihre Gedichte finden sich häufig in den Sequenzen der Gondal-Erzählungen) – lassen sich ganz klar authentische spirituelle Erfahrungen der Verfasserin heraushören.
S. Giovanni in Oliveto
Dezember 1992
Muriel Spark
1 Die Brontës: Lehrer und Gouvernanten
Die Brontës: Lehrer und Gouvernanten
Der allgemeine Eindruck, den man vom Ausflug aller vier Brontës ins Lehrfach gewinnt, ist der eines fast endlosen Martyriums. Charlottes Briefe, Annes Tagebücher und die Romane der beiden enthalten zahllose Indizien, daß der pädagogische Alltag für Charlotte, Branwell, Emily und Anne die reinste Qual gewesen sein mußte. Nichts, so lesen wir zwischen den Zeilen, konnte schlimmer sein, als mit solchen Schülern als Gouvernante, Hauslehrer oder Schullehrerin arbeiten zu müssen; nichts war schlimmer als solche Arbeitgeber, wie sie sie hatten.
Zwar neige ich durchaus zu der Ansicht, daß der ihnen von den Umständen aufgezwungene Broterwerb ein beklagenswertes Schicksal darstellte (wenn man davon absieht, daß sie daraus wunderbares Material für ihre Geschichten schöpften), und ich teile die allgemeine Begeisterung darüber, daß zumindest drei von ihnen noch rechtzeitig ihre eigentliche Berufung erkannten und ihre einzigartigen Bücher schrieben, die dem herrschenden Zeitgeschmack so gar nicht entsprachen. Aber waren denn die Brontës ahnungslose Schafe gewesen, die in dem Moment unter die Wölfe fielen, als sie sich der Erziehertätigkeit zuwandten? Ich halte die Idee für überlegenswert, ob nicht das Los der jeweiligen Schüler und Brotherren von Charlotte, Branwell, Emily und Anne mindestens ebenso beklagenswert war.
Charlotte war die erste, die unterrichtete. Nachdem sie eine Zeitlang das Stundengeben mit ihren Schwestern geübt hatte, verließ sie 1835 das Pfarrhaus von Haworth, zog nach Roe Head und nahm eine Stelle als Lehrerin am dortigen Internat an, das sie selbst als externe Schülerin besucht hatte. Ihre Schulbildung hatte damals aus etwas mehr als zwei Jahren regulären Unterrichts bestanden, ergänzt durch Privatstunden seitens ihrer unverheirateten Tante. Charlotte war neunzehn, als sie in Roe Head als Lehrerin anfing, und ihre wichtigste Qualifikation für die Unterweisung junger Mädchen war, daß sie eine behütete Jugend verbracht hatte. Die Direktorin (dieselbe Miss Wooler, die Charlotte später ein Leben lang freundschaftlich verbunden bleiben sollte) behandelte sie von Anfang an als Freundin. Charlotte blieb zwar mehr als zwei Jahre lang bei Miss Wooler, doch wie ihren Briefen und Tagebüchern zu entnehmen ist, fühlte sie sich die meiste Zeit elend, und das durchaus zu Recht. Einer ihrer Tagebucheinträge liest sich so:
Heute verbrachte ich den ganzen Tag wie in einem Traum, mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt … Fast eine Stunde lang habe ich mich abgerackert, um Miss Lister, Miss Marriot und Ellen Cook den Unterschied zwischen einem Artikel und einem Substantiv beizubringen. Und dann war die Grammatikstunde zu Ende, und im Klassenzimmer herrschte Totenstille, und ich saß da und versank vor Verärgerung und Erschöpfung in eine Art Lethargie. Mußte ich denn die besten Jahre meines Lebens mit dieser jämmerlichen Sklavenarbeit zubringen, ständig gewaltsam meinen Zorn unterdrücken, angesichts solcher Faulheit und Interesselosigkeit und der von Tag zu Tag sich steigernden Blödheit dieser schafsköpfigen, lümmelhaften Esel, und dies mit der geheuchelten Miene der freundlichen, geduldigen und beflissenen Lehrerin? Mußte ich denn wirklich Tag für Tag an diesen Stuhl gekettet hier drinnen hocken, eingekerkert zwischen diesen vier kahlen Wänden, während draußen die Sommersonne aufs herrlichste vom Himmel herabbrennt und die prachtvollste Zeit des Jahres vorübergeht? Von solchen Überlegungen ins Mark getroffen, stand ich auf und ging mechanisch zum Fenster hinüber. Ein wunderschöner Augustmorgen grüßte von draußen herein … Was für großartige Dinge hätte ich jetzt schreiben können … Hätte ich die Zeit gehabt, diesen Augenblick in seiner inspirierenden Ausstrahlung auszukosten, wäre daraus sicherlich eine der besten Erzählungen geworden, die ich jemals geschrieben habe. Aber just in dem Moment kommt so ein Schafskopf mit den Hausaufgaben daher.
All dies war ganz klar wider Charlottes Natur; sie wollte schreiben, nicht unterrichten. Doch was wir uns an dieser Stelle vor Augen halten sollten, sind die Auswirkungen ihrer Frustration, welche die Fräulein Lister, Marriot und Cook zu spüren bekamen, ganz zu schweigen von jenem unglückseligen »Schafskopf«, der Charlottes Träumereien störte. Waren sie alle so anders als normale Kinder? Waren sie alle solche »schafsköpfige Lümmel«, daß sie Miss Brontës Verachtung und Zorn nicht mitbekamen? Der Verdacht liegt nahe, daß Charlotte ihre Energie weniger auf die Unterweisung der Kinder verwandte als auf die »Unterdrükkung [ihres] Zorns«.
Aber Charlotte sollte es noch schlimmer ergehen. Im Jahr 1839 bewarb sie sich als Gouvernante für die Kinder einer gewissen Mrs. Sidgwick; die Ärmste hatte keine Ahnung, daß sie im Begriff stand, eine von viktorianischen Moral- und Wertvorstellungen völlig durchdrungene junge Dame bei sich aufzunehmen. Prompt übertrug Charlotte ihre Abneigung gegen das Unterrichten auf Mrs. Sidgwick und deren Kinder; an Mr. Sidgwick hatte sie hingegen nichts auszusetzen. Charlotte beklagte sich oft und bitter: Mrs. Sidgwick gewähre ihr keinen Moment der Muße, um sich auf dem weitläufigen Anwesen und in der angrenzenden Umgebung umzusehen; Mrs. Sidgwick verbitte sich jede Maßregelung der Kinder, bei denen es sich um »aufsässige, boshafte, bockige Rangen« handele (eine Anschuldigung, die Charlotte auch gegenüber ihrem nächsten Arbeitgeber vorbringen sollte, ebenso wie Anne gegenüber dem ihren, und die so gar nicht zu den im neunzehnten Jahrhundert vorherrschenden Ansichten von Kindererziehung paßt); Mrs. Sidgwick habe Charlotte wegen wiederholten Schmollens ins Gebet genommen, woraufhin Charlotte in Tränen ausgebrochen sei; Mrs. Sidgwick erwarte von ihr, daß sie die Kinder liebe; und – ultimative Demütigung –: Mrs. Sidgwick »überhäuft mich mit Bergen von Hand- und Näharbeiten, ganze Ellen von Batist sind zu säumen, Schlafmützen aus Musselin anzufertigen und, ganz besonders wichtig, Puppen anzuziehen«.
Das klingt schon recht drastisch. Man darf wohl davon ausgehen, daß Mrs. Sidgwick, die in anderen Quellen als sympathische Frau beschrieben wird, die offenkundige Freudlosigkeit der neuen Gouvernante nicht entgangen ist. Zweifelsohne hat sie Charlotte die Handarbeiten auch aufgebürdet, um sie vom Grübeln abzuhalten und auf andere Gedanken zu bringen, denn es ist auffallend, wie oft in jenen Tagen von Trübsinn immer im Zusammenhang mit Perspektivlosigkeit die Rede war und von Frohsinn mit einem ausgefüllten Alltag. So steht es uns nicht zu, Mrs. Sidgwick als gewöhnlich, mittelmäßig und geistlos zu kritisieren. Sie wollte nie mehr sein, als sie war. Falls überhaupt etwas zu kritisieren wäre, dann die damaligen Verhältnisse, in denen es sehr wohl üblich war, daß Gouvernanten auch zu Näharbeiten und anderen gehobenen Haushaltstätigkeiten herangezogen wurden. Sofern wir Charlotte nicht als berühmte Schriftstellerin betrachten (was wir an dieser Stelle nicht tun), kann von einem Skandal, nur weil sie nähen und sticken mußte, nicht die Rede sein. Und ob jene Arbeiten erniedrigender und geistloser waren als die Beaufsichtigung bei Klassenausflügen oder von Schulmahlzeiten für heutige Lehrer, sei dahingestellt.
Dieser Bericht über Charlottes kurzen Aufenthalt bei den Sidgwicks wäre unvollständig ohne das Zeugnis eines der Sidgwick-Söhne Jahre später, nachdem Elizabeth Gaskell die Abneigung Charlottes gegenüber seiner Familie publik gemacht hatte. Er beschrieb, wie »Miss Brontë, wenn man wünschte, sie möge die Kinder zur Kirche begleiten (›Oh, Miss Brontë, so beeilen Sie sich doch bitte, und ziehen Sie Ihre Sachen an, wir wollen los‹), gleich vor Wut kochte, weil sie sich wie eine Dienstbotin behandelt fühlte. Wenn man sie dann nicht mehr zum Mitkommen aufforderte, war sie abgrundtief enttäuscht, weil man sie als Verstoßene und von den anderen gemiedene Dienerin behandelte.« Da die Mehrzahl der Brontë-Opfer nie zu Wort kommt, sondern in den Brontë-Briefen und Romanen bis in alle Ewigkeit am Pranger stehen muß, finde ich diesen knappen Protest aus dem Munde eines ansonsten sprachlosen und als Schüler eher unrühmlichen Sidgwick-Kindes um so rührender.
Weil ihre Stelle zeitlich befristet war, mußte Charlotte lediglich ein Vierteljahr durchhalten. Bevor sie ging, warf ihr einer der kleinen Sidgwicks eine Bibel nach. Später wurde er Pfarrer.
Als nächste war Mrs. White an der Reihe. Charlotte fand bald heraus, daß »sie keine Skrupel hat, ihrem Ärger auf sehr rüde und wenig damenhafte Weise Luft zu machen«. Charlotte mochte Mr. White lieber, obwohl sie der festen Meinung war, er müsse »von sehr niederer Herkunft« sein. Gleichzeitig war sie nach eigenen Angaben außerordentlich bemüht, Mrs. White zu mögen. Ihre Anstrengungen waren von Erfolg gekrönt – ungeachtet des fehlerhaften Sprachgebrauchs von Mrs. White, der Charlotte unangenehm auffiel, sowie der Tatsache, daß Charlotte argwöhnte, Mrs. White sei die Tochter eines Steuereintreibers. Letztendlich errang Mrs. White doch die Sympathie der Pfarrerstochter, die dann auch zugab, das »dicke Kind« fasziniere sie, und die ihre Schüler als »gutmütig« beschrieb, wenn auch »verwöhnt«.
Betrachten wir Charlotte jetzt in ihrer letzten Lehrerstelle. Schauplatz ist das Mädchenpensionat Héger in Brüssel, und Charlotte, die zum Französisch- und Deutschlernen dorthin gekommen war, ist zwischenzeitlich zur Englischlehrerin avanciert. Ihre Arbeitgeberin, Madame Héger, mißtraut der Englischlehrerin mehr und mehr und spioniert ihr nach, wofür sich Charlotte offenbar keinen Anlaß vorstellen kann. Monsieur Héger gefällt ihr besser. Die Schülerinnen sind »egoistisch, animalisch und geistig minderbemittelt«. Des weiteren werden wir auf reizende Art davon in Kenntnis gesetzt, daß sie »moralisch durch und durch verkommen« sind. Im Lehrerkollegium haßt jeder jeden, und Charlotte haßt sie alle. Und so geht es in ihren Briefen in einem fort. Eine ihrer Kolleginnen ist schlimmer als alle anderen, agiert als Spionin für Madame Héger, ist eine falsche Schlange, verabscheuungswürdig und katholisch. Eigentlich sind sie dort alle katholisch, und eigentlich, so schreibt Charlotte an Branwell, »taugen die Leute hier rein gar nichts«.
Nach ein paar Monaten beginnt Charlotte, Monsieur Héger Englischunterricht zu geben. Dieser scheint sehr zufrieden mit ihrer Tätigkeit zu sein und schenkt ihr hin und wieder ein Buch. Für Charlotte entschädigt seine Güte sie für all die »Entbehrungen und Demütigungen«, die das Schicksal ihr auferlegt, die sie aber nicht näher erläutert.
Doch bald darauf fängt Monsieur Héger an, Charlotte zu meiden, nachdem er ihr kurz zuvor zum Thema »generelle bienveillance« die Leviten gelesen hat. Sie allerdings ist keine Generalistin; das Objekt ihrer bienveillance ist ganz klar der Hausherr, der, wie sie bemerkt, von seiner Frau »wundersam beeinflußt« wird. Auf Grund einer kuriosen Logik findet Charlotte, sie könne Madame Héger nun »nicht länger trauen«. Vom Argwohn besagter Dame zurück nach Haworth getrieben, beginnt sie sofort, denselben dadurch zu bestärken, daß sie eine ganze Reihe leidenschaftlicher Briefe an Monsieur Héger schreibt, bis dieser sie beschwört, damit aufzuhören.
Werfen wir nun einen Blick auf die pädagogische Laufbahn von Branwell Brontë. Mit zwanzig wurde er Mitglied des Lehrerkollegiums einer Schule am Ort und verließ diese nach sechs Monaten. Die Buben hatten sich über seine roten Haare lustig gemacht. Nachdem er seine Würde durch eine lange Schreibperiode, durch Malen, exzessives Trinken und Opiumrauchen wiederhergestellt hatte, wurde er 1840 Hauslehrer der Kinder von Mr. und Mrs. Postlethwaite. Branwells Arbeitsauffassung läßt sich am besten anhand seiner eigenen Beschreibung ermessen, wie er sie einem seiner alten Saufkumpane übermittelte:
Wenn Du mich jetzt sehen könntest, würdest Du mich nicht wiedererkennen, und Du würdest in Gelächter ausbrechen, könntest Du hören, wie mich die Leute hier einstufen … Ja, wer also bin ich? Soll heißen, wer oder was glauben sie, daß ich bin? – Ein höchst nüchterner, enthaltsamer, geduldiger, sanftmütiger, tugendhafter Gentleman-Philosoph, die Guten Werke in Person, eine Schatzkammer der Rechtschaffenheit. Spielkarten werden flugs unter die Tischdecke geschoben, Trinkgläser in der Kredenz verstaut, kaum daß ich den Raum betrete. Ich trinke weder Schnaps noch Wein, noch Bier. Ich kleide mich schwarz und lächle wie ein Heiliger oder Märtyrer. Alle sind der Ansicht: »Was ist Mr. Postlethwaites Hauslehrer doch für ein anständiger junger Herr.« Bei meiner Seele: Genauso ist es, und ich könnte mich über sie kaputtlachen, aber ich gedenke, mir ihre hohe Meinung weiterhin zu erhalten.
Branwell beendet den Brief mit der Bemerkung, daß, während er dies schreibt, eine der Postlethwaite-Töchter in seiner Nähe sitzt. …»Sie hat wohl keine Ahnung, wie nahe der Teufel ihr ist. …«
Branwells Haltung gegenüber diesen Menschen, was auch immer man sonst daraus entnehmen mag, ergibt einen willkommenen Kontrast zu jener, die seine Schwestern unter vergleichbaren Umständen zum Ausdruck brachten. Die Söhne der Familie beschreibt er als »prächtige, muntere Burschen« – wobei es sich vermutlich um Charlottes Kategorie der »aufsässigen, boshaften, bockigen Rangen« handeln dürfte, nur in einem günstigeren Licht betrachtet. Und Mr. Postlethwaite wird von Branwell als »richtig herzlicher, großzügiger Charakter« beschrieben und seine Gemahlin als »eine ruhige, stille, liebenswürdige Frau«. Doch dauerte es nur ein paar Monate, bis Branwell von seinem ruhelosen Ehrgeiz von den Postlethwaites fortgetrieben wurde, zuerst, um Hartley Coleridge zu besuchen, und dann zurück nach Haworth.
Seine zweite und letzte Stelle als Hauslehrer trat er drei Jahre später an. Anne stellte ihn der Familie vor, bei der sie selbst als Gouvernante angestellt war. Er sollte den Sohn des Hauses unterrichten. Sein Arbeitgeber Mr. Robinson war körperbehindert und fortgeschrittenen Alters; Mrs. Robinson war weitaus jünger. Branwell fand Mrs. Robinson attraktiver. »Diese Dame«, schrieb er später, »erwies mir (obwohl mich ihr Mann verabscheute) ihre Gunst in einem großen Ausmaß, was schließlich eines Tages, als ich mich sehr über das Verhalten ihres Mannes geärgert hatte, in Bekundungen mündete, die mehr waren als normale Gefühlsregungen.« Mr. Robinson benötigte zweieinhalb Jahre, bis er seinen Verdacht bestätigt fand, woraufhin er dem in den Ferien weilenden Branwell einen Brief schrieb, in dem er »zu verstehen gab«, wie Charlotte berichtete, »daß er sein Treiben durchschaut habe … und ihm hiermit befehle, augenblicklich und für immer jeglichen Kontakt mit allen Mitgliedern der Familie abzubrechen, ansonsten man ihn öffentlich bloßstellen werde«. Branwell legte Wert auf die Feststellung, daß Mrs. Robinson seine Liebe erwidert habe. Jahre später, als der Boom mit der Brontë-Biographie einsetzte, ergriff sie die Gelegenheit und dementierte.
Annes Stelle bei den Robinsons war ihre zweite. Die Jüngste der Brontës erwies sich als die geduldigste der vier, und obwohl es ihr durchaus nicht an schriftstellerischem Talent und dem Willen zum Schreiben mangelte, erduldete sie ihr Lehrerdasein am längsten von allen. Sosehr sie sich im Alltagsleben zurückhielt, sosehr offenbarten ihre Romane all das, was sich an unterdrücktem Groll in ihr aufgestaut hatte. Mit neunzehn übernahm Anne die Obhut über die beiden ältesten Kinder einer gewissen Mrs. Ingham. Es dauerte nicht lange, und Charlotte war emsig damit beschäftigt, Annes Meldungen weiterzugeben: Ihre Schüler seien »hoffnungslose kleine Schwachköpfe«, »total verzogen«, »böse und gewalttätig« und voll »neumodischer Flausen«. Anne verließ die Familie nach achtzehn Monaten, in denen sie ihrer Aufgabe so gut wie möglich gerecht zu werden versuchte. Sie hat die Erfahrung nicht ganz unbeschadet überstanden.
Als Anne zu den Robinsons kam, war sie 21. Charlotte, die zu Übertreibungen neigte, schilderte Anne als »duldsame, drangsalierte Fremde«, die unter »extrem unverschämten, eingebildeten und herrischen« Leuten lebe und arbeite. Mit Ausnahme von zwei Tagebuchfragmenten existiert keine direkte Aussage von Anne; im ersten läßt sie sich nur zu der knappen Feststellung herbei: »Mir gefällt meine derzeitige Stelle gar nicht, und ich will mich verändern.« (Ihre Romane liefern die üblichen gräßlichen Kinder nach.) Sie blieb vier Jahre, in denen ihre Schüler sie ausgesprochen liebgewannen. Die Robinson-Mädchen besuchten Anne sogar und schrieben ihr noch lange, nachdem sie die Familie verlassen hatte und Branwell mit Schimpf davongejagt worden war. Der zweite Kommentar zu ihrer Arbeitsstelle bezieht sich auf Annes anfängliche Abneigung: »Ich wollte damals schon unbedingt weggehen, und hätte ich seinerzeit gewußt, daß mir noch volle vier Jahre bevorstehen, hätte ich mich wirklich elend gefühlt. Allerdings habe ich während meines Aufenthalts einige sehr unangenehme Erfahrungen mit der menschlichen Natur gemacht, wie ich sie mir nicht hätte träumen lassen.« Diese letzte Klage wird gemeinhin auf Branwells Affäre mit Mrs. Robinson bezogen und kann explizit in Die Herrin von Wildfell Hall nachgelesen werden.
Wie ihre Schwestern war auch Emily neunzehn, als sie, an der Law Hill School, eine Stelle als Lehrerin antrat, und mit ziemlicher Sicherheit kehrte sie noch im selben Jahr der Schule vernünftigerweise wieder den Rücken. Alles, was wir über ihren Aufenthalt an der Law Hill School wissen, ist, daß sie einen Brief schrieb – laut Charlotte »ein haarsträubender Bericht über ihren Dienst: harte Arbeit von sechs in der Früh bis elf Uhr nachts und dazwischen nur eine halbe Stunde Pause. Es ist die reine Sklaverei«. »Ich befürchte«, schreibt Charlotte weiter, »das hält sie nie im Leben durch.« Emily hielt es tatsächlich nicht durch. Das Merkwürdige ist nur, daß Emilys schriftstellerische Arbeit während dieser Zeit produktiver war als zu jeder anderen Schaffensperiode, was man als Indiz dafür werten könnte, daß man ihre Freizeit doch nicht vollkommen beschnitten hatte.
Als Musiklehrerin im Héger-Internat hat es Emily nicht lange ausgehalten. Anläßlich des Todes ihrer Tante hatte man sie und Charlotte nach Haworth gerufen; danach zeigte Emily keinerlei Interesse, mit ihrer Schwester nach Brüssel zurückzukehren. Immer wieder wird die Tatsache hervorgehoben, daß sich Monsieur Héger (nachdem sie gestorben und berühmt geworden war) lobend über Emily geäußert und die – auch nach meiner heutigen Ansicht vieldeutige – Meinung vertreten habe, sie hätte Seefahrer werden sollen. Ein andermal glaubte er, sie hätte eine große Historikerin werden und überhaupt hätte sie als Mann zur Welt kommen sollen. Nirgendwo sagt er, daß Musiklehrerin das Richtige für sie gewesen wäre. Er hielt es damals lediglich für angebracht, Emilys Vater darüber zu informieren, daß seine Tochter »jeden Rest von Einfältigkeit und von der noch schlimmeren Schüchternheit verloren hat«.
Für die drei Schwestern war das Lehrerdasein eine Qual, für Branwell war es ein Spaß gewesen. Ihre gebrechliche Konstitution hatte Schaden genommen, und ein großer Teil ihrer schöpferischen Kraft war in den wenig einnehmenden Schulräumen vergeudet worden. Sie gaben ihr Bestes, um sich auf die einzige Weise, die ihnen möglich war, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber aus meiner Perspektive ist auch die Überlegung legitim, daß Menschen mit genialen Anlagen immer dann, wenn sie an deren Entfaltung gehindert werden, die grenzenlose Fähigkeit entwickeln, Ärger zu machen oder doch zumindest fortwährend zu nörgeln. Es wäre zuviel verlangt, wollte man das Genie bitten, seinen Charakter grundsätzlich außen vor zu halten. Das gelingt schon Menschen mit geringeren Talenten kaum.
Branwells Verhalten war seiner Tätigkeit unangemessen, um es vorsichtig auszudrücken. Charlotte war, um es ebenfalls vorsichtig auszudrücken, nicht gefeit gegen Gemütsverfassungen, vor denen sie auch eine noch so behütete Kindheit nicht behütete. Annes Reaktion auf ihre Umwelt bestand darin, ihren Unmut aufzustauen. Emilys Methode war die bei weitem erfolgreichste; sie befreite sich aus ihrer Zwangslage, indem sie, so schnell sie konnte, davonrannte. (In ihren Schriften fehlt die Obsession bezüglich des Gouvernanten-Sujets.) Jedoch wurde den Brontës reiche Genugtuung zuteil für alles Unrecht, das ihnen tatsächlich oder nur in ihrer Einbildung widerfahren war.
Man darf sich also berechtigterweise fragen, ob die Arbeitgeber der Brontë-Schwestern – die Sidgwicks und Inghams und Whites – sich in der Behandlung ihrer Angestellten tatsächlich etwas haben zuschulden kommen lassen. Oder war es nur ihr Pech, den Weg der Brontës zu kreuzen? Ich neige zu der Annahme, daß, falls es Pflichtverletzungen seitens der Herrschaft gegeben haben sollte, solche eher zu Lasten der eigenen Kinder geschahen. Diese Überlegung stützt sich auf andere als die Brontë-Quellen; wir erfahren, daß die wohlhabende englische Mittelschicht des neunzehnten Jahrhunderts ihre Kinder nur allzu bereitwillig jeder jungen Frau überantwortete, gleichgültig, ob neurotisch oder sonstwie kränkelnd, wenn sie nur aus einem Pfarrhaushalt stammte.
Einmal hatten die Brontës Pläne geschmiedet, eine eigene Schule aufzumachen. Aus dem Projekt, das sowohl für sie als auch für andere verdienstvoll gewesen wäre, wurde nichts. Branwells wüstes, nutzlos vertanes Leben war seinen Schwestern ein Warnsignal, und auf wundersame Weise gelang es ihnen, sich ihre schöpferischen Kräfte zu bewahren.
Für diesen Essay habe ich nicht auf ihre Romane zurückgegriffen, weil ich der Überzeugung bin, daß die Fiktion nur eine unzuverlässige Zeugin abgibt (und ist die Fiktion nicht sonderbarer als die Wahrheit, so sollte sie es doch sein). Aber selbstverständlich lassen sich auch eindeutig identifizierbare Ausgaben von Schülern und Arbeitgebern der Brontës in den Romanen von Charlotte und Anne finden.
Vielleicht sollte jeder Schriftsteller mit eisernem Willen, aber fehlender Gelegenheit zum Schreiben, daraus die Lehre ziehen, daß man sich immer zuerst selbst beweisen muß, daß man zu nichts sonst taugt.
M.S.
2 Briefe der Brontës
Einführung
Die Briefe namhafter Persönlichkeiten lassen sich in zwei Kategorien aufteilen. Erstens in solche Briefe, die allein schon wegen ihres geistreichen Inhalts, ihrer Einsichten oder ihres Stils wertvolle literaturgeschichtliche Dokumente sind. Zweitens in solche, deren Bedeutung hauptsächlich darin besteht, daß sie den biographischen Hintergrund ihres Verfassers erhellen. So sind zum Beispiel die Briefe von Coleridge und Keats eine vergnügliche Lektüre, zugleich aber auch biographische Zeitdokumente. Jane Austens Briefe hinwiederum, verfaßt in der Absicht, häusliche Begebenheiten auf möglichst amüsante Weise mitzuteilen, skizzieren den Rahmen äußerer Ereignisse in ihrem Leben und spiegeln ihre spezielle Art der Ironie.
Doch kommt es recht häufig vor, daß zu hochklassiger Prosa fähige Schriftsteller ihr ganzes Können eifersüchtig für fiktionale oder kritische Arbeiten aufheben. Ihre Briefe fallen zumeist in die zweite Kategorie ›biographisches Materiak‹, Die Mehrzahl der Brontë-Briefe gehört ebenfalls dorthin: Kuriositätenjäger und Reliquiensammler können darin nach Herzenslust schwelgen und interpretieren, und den Biographen liefern sie Material für ihre Theorien. Das soll nicht heißen, daß es dem Briefwechsel dieser bemerkenswerten Familie an stilistischer Eleganz, Humor oder Scharfsinn fehlen würde. Letztendlich geht es um die Unterscheidung zwischen einer notwendigen und einer oberflächlichen Verwendung solch biographischer Daten. Denn die Lebensläufe herausragender literarischer Persönlichkeiten sind dann am ergiebigsten, wenn man das Wirken des schöpferischen Geistes und die ihn motivierende Grundhaltung begreift. Fragen nach Umfeld, Herkunft und jenen intimen Einzelheiten – wie Liebesverhältnisse, Kleidung oder gar der Nahrung –, welche insbesondere die Brontë-Biographen bis zum Überdruß diskutieren, laufen ins Leere oder sind sekundäre Gedankenspiele, solange sie sich nicht an konkreten, eigenständigen Werken wie Jane Eyre, Villette, Sturmhöhe oder Die Herrin von Wildfell Hall festmachen lassen. »Sekundär«, nicht »irrelevant« sind diese Gedankenspiele insofern, als biographisches Material zu den Brontës in einer Hinsicht als außergewöhnlich gelten darf: Die Geschichte dieser Familie stellt eine dramatische Einheit und ein lebendiges Panorama dar, und ihr Stellenwert und emotionales Potential sind auf der gleichen Ebene anzusiedeln wie jeder ihrer Romane. So ist es auch leicht zu verstehen, warum immer wieder neue Brontë-Biographien geschrieben oder warum anhand der über tausend erhaltenen Brontë-Briefe die teilweise abstrusesten Theorien konstruiert werden.
Der dramatische Aspekt der Brontë-Lebensgeschichte drängt sich einem recht schnell auf, und damit wird scheinbar zwangsläufig eine Person zur Hauptfigur. Diese Hauptfigur ist Charlotte; ihre Briefe machen den Hauptteil der Familiendokumente aus, während Vater, Bruder und Schwestern eher Randfiguren bleiben. Dennoch ist eine solche Prämisse faktisch nicht haltbar. Zwar stammen die meisten Briefe aus Charlottes Feder, doch aus dem, was sie uns über ihre Familie mitteilen – Alltagsnöte, Ansichten, Freud und Leid –, geht hervor, daß es sich bei jedem einzelnen Mitglied dieses Haushalts um eine außergewöhnliche Persönlichkeit handelte, gleichgültig wie erfolgreich oder erfolglos sie letztlich waren. Erst bei genauerer Betrachtung erkennen wir hinter Emilys Unnahbarkeit und Ungeselligkeit eine zutiefst poetische Seele. Erst wenn wir die von Charlotte durchlittenen Frustrationen und Depressionen begreifen oder die ihrem Charakter eigentümlichen Sehnsüchte und Schwächen, entdekken wir die Autorin von Jane Eyre. Und nur in der Szenerie des Brontë-Alltags werden wir den Schlüssel zu Branwells Scheitern finden und zu der fortwährenden Herabsetzung von Annes Leistungen durch Charlotte.
Bei der folgenden Auswahl habe ich mich bemüht, jene Briefe zusammenzustellen, welche die meisten Informationen für die Brontë-Lebensgeschichten liefern, und mich von der Fülle an Korrespondenz freizumachen, die sich auf Ereignisse bezieht, welche mit den Grundstrukturen ihrer Lebenslinien nur am Rande zu tun haben. Wenn es im Brontë-Drama auch keinen Hauptdarsteller oder keine Hauptdarstellerin gibt, so gibt es doch ein durchgängiges, allen gemeinsames künstlerisches Motiv: der Sturm. Immer wieder beschreiben die Schwestern ein verheerendes Naturschauspiel als kongenialen Ausdruck für einen individuellen seelischen Aufruhr. Der Sturm taucht zum ersten Mal in einem Brief ihrer Mutter Maria Branwell auf, als sie das Schiffsunglück erwähnt, bei dem sie die Kiste mit ihrer ganzen Habe verliert. Der Vater als Geistlicher empfand sein heidnisches Walten und schrieb vom Tod seiner Frau: »… da brach der nächste Sturm los, noch fürchterlicher als der erste – einer, der an jedem Teil der sterblichen Hülle zerrte und immer wieder drohte diese völlig zu zerfetzen. Meine liebe Frau wurde sterbenskrank …« An anderer Stelle heißt es: »Eines Tages – ich erinnere mich genau, daß es ein düsterer Tag war, ein Tag voller Wolken und Dunkelheit – erkrankten drei meiner Kinder. …« Der Sturm, der durch das mit Steinplatten ausgelegte Pfarrhaus heulte, von dem aus man auf den Friedhof von Haworth blickte, kehrt wieder und fällt den Kastanienbaum von Thornfield in Jane Eyre; er beißt sich fest an der trostlosen Silhouette von Sturmhöhe und schlägt die abweisenden Türen von Wildfell Hall zu. Niemand von den Brontës konnte sich der Anschaulichkeit und Aussagekraft der Sturm-Metapher entziehen.
Patrick Brontë war. eines von zehn Kindern eines irischen Farmers und hatte sieben Pfund in der Tasche, als er sich auf den Weg zur Cambridge University machte. Dort erhielt er ein Stipendium, das teilweise von William Wilberforce finanziert wurde und zum anderen Teil daraus bestand, daß ihm das College seine Studiengebühren ermäßigte. So war er in der Lage, sich den akademischen Grad eines Bachelor of Arts zu erwerben, und 1806 wurde er ordiniert. Nachdem er mehrere Vikarstellen innegehabt hatte, lernte er Maria Branwell kennen, eine junge Pfarrerstochter aus Cornwall, die er 1812 heiratete. Ausgerechnet die Kinder aus dieser eher profanen irisch-kornischen Ehe sollten später zu anerkannten Größen der englischen Literaturgeschichte aufsteigen.
In der Familienkorrespondenz taucht Patrick Brontë häufig auf, obwohl nur wenige seiner eigenen Briefe erhalten sind. Diejenigen, die seine volle Unterschrift tragen, verraten einen energischen, von sich eingenommenen Mann von mitleiderregender und hohltönender Naivität, wie sie nach dem Tod seiner Frau im Heiratsantrag an Mary Burder zum Ausdruck kommt. Daß er wunderliche Angewohnheiten hatte, ist bekannt, doch waren diese seine Mittel zur Selbstdarstellung. Was die Menage in Haworth anbelangte, so verhielt er sich wie der normale viktorianische Paterfamilias. Wann immer es Diskussionen um häusliche oder familiäre Probleme gab, wann immer ein Kind das Haus verließ, um eine berufliche Laufbahn einzuschlagen, und sogar als es um Charlottes Eheschließung ging, stand immer »Papas« Seelenfrieden im Vordergrund. Dennoch war er nach den Maßstäben seiner Zeit kein übertrieben tyrannischer Vater. Er war ungeheuer stolz auf seine Kinder, und in ihrer Biographie Das Leben der Charlotte Brontë berichtet Elizabeth Gaskell, daß er schon sehr früh die außergewöhnlichen Geistesgaben seiner Kinder erkannt und manches unternommen hatte, sie zu fördern.
Falls das Talent der Brontës etwas dem Vater verdankt, dann ist es das Element des Phantastischen, das in seinem keltischen Blut steckte. Seine schriftstellerischen Versuche – ein paar traurige Gedichte und fromme Geschichten – lassen wenig mehr erkennen als den Willen zum Schreiben. Einige seiner Charakterzüge finden sich allerdings bei seinen Kindern wieder, wovon der hervorstechendste der Hang zur Gelehrsamkeit ist. Er kommt bei Charlotte und bei Branwell zum Vorschein, obwohl es letzterem am Durchhaltevermögen und an der Zielstrebigkeit seines Vaters und seiner Schwester mangelte, so daß er mit seinem erworbenen Wissen am Ende nicht viel anfangen konnte. Doch das bei weitem fruchtbarste Erbstück, das die Brontë-Kinder von ihrem Vater mitbekamen, war die Metapher des Sturms. Patrick Brontë war genau wie sie von den Naturgewalten fasziniert, und das wilde Moorland Yorkshires rund um Haworth gab solchen Phantasien reichlich Nahrung. Der Vater ließ ihnen sogar von der Kanzel herunter freien Lauf. Eine seiner Predigten hatte ein örtliches Erdbeben zum Gegenstand, und er war von dem Thema so hingerissen, daß er seine Predigt veröffentlichte und zum Preis von sechs Pence feilbot. Das Erdbeben lieferte ihm außerdem Stoff für ein Gedicht mit dem Titel The Phenomenon: or An Account in Verse of the Extraordinary Disruption of a Bog which took place in the Moors of Haworth (Das Naturphänomen, oder: Ein Bericht in Versen über das spektakuläre Auseinanderbersten eines Sumpfgebietes, wie es sich in den Mooren um Haworth zugetragen). Auch diesen Text publizierte er und verkaufte ihn für zwei Pence das Exemplar.
Um einen knappen Einblick in Maria Branwells Charakter zu erhalten, sind wir fast völlig auf die wenigen Briefe angewiesen, die sie Patrick Brontë vor der Hochzeit schrieb. Es ist offensichtlich, daß sie Freude am Schreiben fand und sorgfältig mit ihrer Prosa umging. So hölzern ihr Stil auch ist, so differenziert ist ihre Sprache. Von Natur aus zurückhaltend, wählte sie so gut wie nie eine scheinbar kühne Formulierung, ohne diese nicht sogleich wieder halb zurückzunehmen. Das heißt aber keinesfalls, daß sie keine charakterliche Substanz hatte. »Jahrelang«, so schrieb sie, »bin ich voll und ganz meine eigene Herrin gewesen, keiner irgendwie gearteten Beaufsichtigung unterworfen … Es ist schön, sich denen unterzuordnen, die wir lieben …« In diesen Sätzen gibt sie eine Definition der Liebe, wie sie später von ihrer Tochter Charlotte übernommen wurde, die ihre Romanheldinnen stets als unabhängige Frauen zeichnete, die selbständig ihre Frau standen und mit denen sich Charlotte mehr oder weniger identifizierte; aber sie verliebten sich immer in ihre Dienstherren, und für Charlotte bedeutete die Unterwerfung einer starken Persönlichkeit unter eine noch stärkere den höchsten Grad der Liebe. Sie selbst machte die Erfahrung von aufgezwungener Selbstbescheidung nur bei ihrem Dienstherrn im Brüsseler Pensionat; keinem anderen aus ihrem Bekanntenkreis hat sie sich jemals so unterworfen, wie sie es gegenüber Monsieur Héger in ihren Briefen tat. Hier haben wir auch einen wichtigen Unterschied zwischen Charlottes Romanen und denen ihrer Schwestern, der mitverantwortlich gewesen sein mag für die Popularität ihrer Texte schon gleich nach deren Erscheinen. Damals bemühten sich die Frauen, ihre emotionalen Bedürfnisse mit dem Wunsch nach mehr Unabhängigkeit in Einklang zu bringen. Charlottes Prosa stellte einen Verhaltenskodex auf, der für Mann und Frau gleichermaßen akzeptabel war. Obwohl es vierzig Jahre dauerte, bis Charlotte die Briefe ihrer Mutter zu lesen bekam, waren es doch die von Maria Branwell vererbten Grundsätze, die Charlottes Charakter und Geisteshaltung prägten.
Dem Ehepaar Maria und Patrick Brontë waren sechs Kinder geboren, bevor die Familie in das Pfarrhaus von Haworth zog, wo dann, nur ein Jahr später, die Mutter der Kinder qualvoll an Krebs starb. Ihre Funktion als Haushaltsvorsteherin und Behüterin der Kinder wurde von ihrer Schwester übernommen, die bei allen »Tante Branwell« hieß. Wie kalt und gefühlsarm diese Frau auch gewesen sein mag, so darf man doch getrost annehmen, daß die Brontë-Kinder von der Reserviertheit ihrer Tante eher profitiert als darunter gelitten haben. Trotz der zahlreich publizierten Lamentos über die lieblose Kindheit der Brontës ist es doch nur allzu wahrscheinlich, daß mütterliche Gefühle seitens ihrer Tante die Begabungen der Kinder eher erstickt hätten, die eine ausgeprägte Sensibilität für jede Art von emotionalen Schwingungen hatten. Mit anderen Worten: Die Galionsfigur der Tante Branwell stellte für die junge Familie die Inkarnation von Autorität dar, frei von jenem gefühlsmäßigen Wirrwarr, der oft die Mutter-Kind-Beziehung beeinträchtigt. Solange die Kinder ihre Verhaltensmaßregeln befolgten, solange sie regelmäßig zu den Andachten gingen, solange sie einen gesunden Eindruck machten, ließ Tante Branwell sie weitgehend in Ruhe. Selten erfreuten sich Kinder zu Beginn des Viktorianischen Zeitalters solcher Gedanken- und Handlungsfreiheit wie die Brontës. Paradoxerweise ist es relativ wahrscheinlich, daß die Kinder, hätte ihre Mutter länger gelebt, zu ganz »normalen« Menschen herangewachsen und ihr Talent verkümmert wäre. Zwar hätten sie vielleicht persönlich weniger zu leiden gehabt, aber ihre schöpferischen Fähigkeiten wären durch die Mutterliebe vielleicht auch erstickt worden.
Von den sechs Kindern überlebten nur vier ihre Kindheit: Charlotte, Branwell, Emily und Anne. Maria und Elizabeth, die beiden Ältesten, wurden von der Cowan Bridge School genommen und nach Hause geholt, wo sie nacheinander im Abstand von vier Wochen starben – schmerzliche Geschehnisse, die bei Charlotte einen nachhaltigen Eindruck hinterließen. Ihre älteste Schwester, und nicht Miss Branwell, war es gewesen, die in Charlottes Bewußtsein als Ersatzmutter fungiert hatte. Sie hatte sie abgöttisch geliebt, und in den ersten Kapiteln von Jane Eyre schreibt sie sich ungehemmt ihre Wut gegen die Schulleitung von der Seele, die das sterbenskranke Kind so schwerwiegend vernachlässigt hatte.
Eine detaillierte Analyse der außergewöhnlichen Kindheit der Brontës wäre an dieser Stelle genausowenig möglich wie eine der üppigen schöpferischen Produktion, in der sich Dimension und Lebhaftigkeit ihrer Vorstellungskraft widerspiegeln. Die Jugendwerke von Charlotte und Branwell füllen Bände. Aus dem Frühwerk der Kinder sticht besonders die Angria-Sage hervor, in der sie sich ein fiktives Land ausgedacht hatten, das sie mit ihren ganz persönlichen Helden, Verrätern und Exzentrikern bevölkerten. Emily und Anne schieden später aus der gemeinsamen Schriftstellerwerkstatt aus und erfanden die Legende von Gondal, die sogar noch phantastischer ausgestattet war als Angria. Die Liebesaffären, Wortbrüche, Leiden und Ausschweifungen des exotischen Gondal-Volkes finden sich auch in den letzten Dichtungen Emilys und Annes wieder. Die Schwestern spielten dieses Spiel bis zu Emilys Tod, und auch als sie längst erwachsen waren, finden sich noch immer Verweise auf Gondal in den wenigen Tagebuchfragmenten, die uns aus der Hand von Emily und Anne erhalten sind. Der einzige direkte Hinweis auf frühe literarische Aktivitäten der beiden jüngeren Mädchen besteht in einem Tagebucheintrag – Emily war damals sechzehn, Anne vierzehn Jahre alt –, aus dem hervorgeht, wie sehr die Welt von Gondal zu einem integralen Bestandteil ihres Alltags geworden war:
Ich habe [die Tauben] Rainbow, Diamond, Snowflake und Jasper (alias Fasan) gefüttert.
Heute morgen ging Branwell zu Mr. Driver und kam mit der Nachricht zurück, daß Sir Robert Peel aufgefordert werden soll, für Leeds zu kandidieren. Anne und ich haben Äpfel geschält, weil Charlotte einen Apfelpudding machen will, und für Tantes [… ] Charlotte sagte, daß sie perfekte Puddings macht und sie [… ] eine schnelle Auffassungsgabe, aber beschränkten Geist. Taby hat gerade gesagt Komm mal Anne zum Potatnpelln [d.h.Kartoffel schälen]. Jetzt ist die Tante in die Küche gekommen und sagt Wo sind deine Füße Anne. Anne antwortete Auf dem Boden Tante. Papa machte die Wohnzimmertür auf und gab Branwell einen Brief mit den Worten Da, Branwell, lies das mal und zeig’s dann deiner Tante und Charlotte. Die Gondals erkunden gerade das Innere von Gaaldine. Sally Mosley wäscht Wäsche in der hinteren Küche.
Es ist schon nach zwölf Anne und ich haben uns noch nicht zurechtgemacht, die Betten auch nicht und auch die Hausaufgaben nicht und wir wollen hinaus und spielen Zum Dinner soll es gekochtes Rindfleisch geben, Rüben, kartoffeln und apfelpudding. Die Küche befindet sich in einem recht unordentlichen Zustand Anne und ich haben unsere Musikübungen nicht gemacht nämlich die B-Dur-Tonleiter Als ich Taby eine Schreibfeder vor die Nase halte sagt sie Was pütscherst’n hier rum statt Potatn zu pelln. Ich antwortete Oje Oje Ojemineh mach ich sofort Damit steh ich auf, nehm ein Messer und fang an zu schälen. Habe sie alle geschält. Papa geht gleich spazieren. Mr. Sunderland angekündigt.
Anne und ich fragen uns wie wir mal sein werden und was wir sein werden und wo wir sein werden, wenn alles gutgeht, im Jahr 1874 – da werde ich dann 56 Jahre alt sein. Anne wird 54 Jahre alt sein, Branwell wird 57 werden und Charlotte 58 Jahre alt sein. Hoffentlich sind wir dann noch alle gesund Damit schließen wir unseren Bericht.
Emily und Anne,
24. November 1834
Wie es den vier Brontës als Erwachsenen erging, läßt sich mehr oder weniger aus der nachfolgenden Briefauswahl entnehmen. Sie bietet eine Lebensgeschichte im Originalton. Ich will mit meinen Ausführungen nicht vorgreifen, und deshalb liefere ich auch nicht mehr als ein erweitertes »Dramatis Personae«, eine Skizzierung der in diesen Briefen sprechenden und handelnden Personen.
Charlotte, deren Korrespondenz zwangsläufig stärker vertreten ist als die der anderen, änderte Stil und Ton ihrer Briefe je nach Adressaten. Die Briefe an Ellen Nussey, die lebenslange Freundin aus der Schulzeit, zeigen Charlottes inneres Wesen nur so weit, wie sie es enthüllen wollte, einige frühe Briefe ausgenommen, die zu einer besonderen Phase in der Beziehung der beiden gehören. Ellen bekam wenig Vertrauliches, dafür um so mehr Klatsch mitgeteilt; ihrem Vater gegenüber war Charlotte ehrerbietig, förmlich und nachsichtig; Emily gegenüber fröhlich und vertrauensvoll; und zu Branwell ist sie direkt, schwesterlich, manchmal salopp. In ihren Briefen an bedeutende Schriftsteller und Freunde aus dem literarischen Leben bemühte sich Charlotte, ihre Intelligenz möglichst vorteilhaft ins Bild zu setzen und gleichzeitig einen Eindruck von Bescheidenheit durchscheinen zu lassen. Gegenüber ihrem abgewiesenen Verehrer Henry Nussey war ihr Ton höflich und von oben herab und bei Monsieur Héger impulsiv, leidenschaftlich und beunruhigt. Charlottes facettenreiche Persönlichkeit hat allerdings zu manch übertriebener Deutung geführt, und nur wenn wir jeden Charakterzug als Teil eines Ganzen betrachten und ihm den gebührenden Stellenwert zuweisen, können wir uns ein stimmiges, ganzheitliches Bild von dieser komplexen Frau machen. Fest steht, daß sie eindeutig die Aktivste und Ehrgeizigste ihrer Familie war. Sie war es, die es bewerkstelligte, daß aus dem Plan, mit Emily nach Brüssel zu gehen, Wirklichkeit wurde; Charlotte war es, die für die erste Veröffentlichung von Arbeiten der drei Schwestern sorgte: Poems by Currer, Ellis and Acton Bell.
Charlotte, obwohl durchaus praktisch veranlagt, war keine Realistin. Hingebungsvoll konnte sie jede Banalität ihres täglichen Lebens dramatisieren. In ihren Romanen schlachtete sie noch das kleinste Erlebnis aus, das ihr irgendwo und irgendwann widerfuhr, und mit der Legitimation der Künstlerin prüfte sie unterschiedslos jede noch so zufällige Begegnung mit ihren engsten Freunden auf ihre Verwertbarkeit hin. Alle Menschen, die ihr Interesse weckten, alle Ereignisse, mit denen ihre künstlerischen Sensoren in Berührung kamen, wurden in ihren Büchern reproduziert bzw. karikiert. Es wäre falsch anzunehmen, daß Charlotte, während sie ihrer Phantasie frönte, sich selbst vernachlässigt hätte. So stellte es sich beispielsweise heraus, daß Elizabeth Gaskell nach dem ersten Zusammentreffen der beiden mit einem ziemlich herzzerreißenden Bericht über Charlottes bisheriges Leben zurückkehrte, wie ihr Brief an Catherine Winkworth vom 25. August 1850 belegt, der mit den Tatsachen nur schwer in Übereinstimmung zu bringen ist. So tragisch ihr Leben auch verlaufen war, Charlotte konnte es nicht unterlassen, die melancholische Seite ihres Daseins erzählerisch auszuschmücken. Sie zögerte auch nicht, die triste Realität im Brontë-Haushalt zu verdrehen, weil sie wußte, daß ihre Schilderungen die populäre Romanschriftstellerin in Mrs. Gaskell uneingeschränkt faszinierten. Wir dürfen diese Seite von Charlottes künstlerischer Einstellung durchaus positiv werten, denn schließlich macht sie ihre eigentliche Größe aus.
Wichtiger Bestandteil von Charlottes Charakter war das Bedürfnis nach Liebe. Ein erstes Betätigungsfeld dafür tat sich auf, als sie im Alter von zwanzig Lehrerin an einer Mädchenschule wurde. Ausgestattet mit einer weit überdurchschnittlichen Intelligenz, aber mit einem nur wenig attraktiven Äußeren, wurde sie mehrfach von düsteren Stimmungen heimgesucht, die sich in einer religiösen Melancholie und in ihrer gefühlsseligen Zuneigung zu Ellen Nussey ausdrückten. Sie hat nie gern unterrichtet. Andererseits war sie zu stolz und, zum damaligen Zeitpunkt, zu idealistisch, um den üblichen Ausweg durch Heirat zu wählen. Aufgrund der moralischen Zensur durch ihr ethisches Bewußtsein verkannte sie die wahre Natur ihrer verdrängten jugendlichen Emotionen, und in ihrer seelischen Not wandte sie sich oft an ihre engste Freundin außerhalb der Familie. Die Briefe, die sie 1836 an Ellen schrieb, sind durchzogen von kalvinistischen Zweifeln und Qualen, begleitet von flehentlichen Bitten um Trost und Beistand durch Ellen, für die sie eine Art spiritueller Liebe empfand, und von inbrünstigen Formulierungen imaginärer Schuldgefühle. Damit meine ich nicht, daß die Briefe finstere Abgründe in Charlottes Natur auftun; sie legen nur nahe, daß nervöser Streß aus einer wenig liebenswürdigen und nicht gleichgestimmten Umgebung, verbunden mit der Unterdrückung normaler Gefühle und dem vollständigen Fehlen männlicher Gesellschaft, eine höchst kreative und sensible Seele zwangsläufig in Aufruhr versetzen mußte. Ihr Ventil war ihre harmlose Korrespondenz mit Ellen Nussey, auch wenn diese Briefe morbide Inhalte hatten und nicht der damaligen Norm entsprachen.
Charlottes selbstquälerische Phase klang ab, als sie in einen (kurzen und unbefriedigenden) Briefwechsel mit dem seinerzeitigen Hofdichter Southey eintrat. Die Zurückweisung durch Monsieur Héger sublimierte sie dadurch, daß sie sich unverzüglich daranmachte, die Gedichte ihrer Schwestern zusammenzustellen und herauszugeben.
Der Umfang der vorhandenen Korrespondenz der anderen Mitglieder der Brontë-Familie ist vergleichsweise gering, und es stellt sich die berechtigte Frage, inwieweit ihre tatsächlichen Persönlichkeiten mit Charlottes Schilderungen übereinstimmen. Von Emily schrieb Charlotte mit Bewunderung, manchmal mit Verwunderung und später mit aufrichtigem Kummer. Auch wenn uns Sturmhöhe und die ausdrucksvolle lyrische Dichtung Emilys nicht zur Verfügung stünden, würde die monolithische und klar strukturierte Persönlichkeit ihrer Verfasserin aus Charlottes Briefen implizit aufscheinen. Die Briefe nach Emilys Tod zeigen, wie sehr Charlotte diesen stoischen, in sich gekehrten Geist liebte und achtete. Ihre Äußerungen über Anne dagegen hinterlassen den Eindruck latenten Grolls. Für Annes literarische Leistung findet sie kaum ein gutes Wort, sondern qualifiziert sie ungnädig ab. Zwar äußert sie sich besorgt zum Wohlergehen ihrer jüngsten Schwester, dann wiederum zögert sie nicht, in ihren Briefen und in den postumen Vorworten zu Annes Werken deren Defizite anzuprangern. Wären da nicht Die Herrin von Wildfell Hall und Annes nicht sehr umfangreichen doch einzigartige lyrische Ergüsse, erhielte man den Eindruck, die Jüngste der Brontës wäre nicht weiter der Erwähnung wert.
Emily hatte keine Zeit für Nebensächlichkeiten, und Briefe schreiben, Freundschaften von Frau zu Frau, Klatsch und gesellschaftliche Veranstaltungen waren für sie gleichermaßen belanglos. Sie gedieh ausschließlich in ihrer angestammten Umgebung der Moore und im Kreis ihrer Familie. Auswärts war sie so gut wie niemals glücklich, weil alle, die sie nicht kannten, sie für störrisch und schwierig hielten. Da es an Dokumenten aus ihrer Hand mangelt, wucherten die wildesten Theorien um ihre Persönlichkeit. Mit Bestimmtheit können wir über sie nur sagen, daß sie eine sonderbare Frau war. Andererseits ist Sturmhöhe auch ein sonderbarer Roman, der nie einem konventionell funktionierenden Geist hätte entspringen können. Ihre ausgeprägte Liebe zu Tieren legt die Vermutung nahe, daß sie zu jenen verschlossenen, eigenbrötlerischen Menschen gehörte, die man nicht ausfragen darf. Tatsächlich berichtet einer ihrer Bekannten, daß sie Tiere am meisten liebte, und Spuren dieser misanthropischen Neigung finden sich auch in ihrem Werk. Was menschliche Gefühle angeht, so hegte sie die tiefsten eindeutig für Anne – was Charlotte gewurmt haben dürfte. Emily und Anne entwickelten die Gewohnheit, sich gegenseitig periodisch Botschaften zu schicken, und zwar in Form von Memoranden, die nur alle vier Jahre zu öffnen waren. Vier dieser Dokumente existieren noch, je zwei von Emily und Anne. Sie sind so informativ in Hinsicht auf Gedanken, Zielsetzungen und die Beziehung zwischen den beiden, daß ich sie in die vorliegende Auswahl miteinbezogen habe, obwohl sie, strenggenommen, keine Briefe sind.
Emilys stolze Autonomie noch im Tode, ihre unbeugsame Weigerung, Trost anzunehmen, werden in Charlottes Briefen über Emily anschaulich geschildert. Zwei Jahre nach Emilys Tod schrieb sie ein Vorwort zu Sturmhöhe; darin findet sich eine Passage, die das Wesen ihrer Schwester so treffend einfängt wie keine der zahlreichen biographischen Schriften über Emily. »In Emilys Natur«, so schrieb sie, »schienen sich Kraft und Schlichtheit in ihren jeweiligen Extremen zu paaren.«
Hinter einer natürlichen Kultiviertheit, die keine Affektiertheit kannte, hinter einem unverfälschten Geschmack und einem unprätentiösen Äußeren steckte eine verborgene Kraft und loderte ein heimliches Feuer, die eines Helden Geist hätten formen und seine Phantasie entzünden können. Aber sie besaß keine Weltklugheit; ihre Fähigkeiten taugten nicht für die konkrete Lebenswirklichkeit. Nie kämpfte sie für ihre Rechte, auch wenn diese noch so eindeutig vorlagen; nie nahm sie einen Vorteil wahr, sei er auch noch so legitim. Sie hätte eigentlich einen ständigen Vermittler zwischen sich und der Welt gebraucht. Ihr Wille war zumeist eisern und stand in der Regel in Widerspruch zu dem, was sie interessierte. Von Natur aus war sie hochherzig, aber auch hitzig und unberechenbar; insgesamt war ihre Haltung unbeugsam.
Charlotte ging der Tod ihrer Schwester genauso nahe wie Anne, die Emily nicht lange überlebte.
Charlotte und Emily Brontë braucht man als Schriftstellerinnen nicht lange vorzustellen; ihr literarisches Werk wird von einer breiten Öffentlichkeit gerühmt und ist seit dem ausgehenden neunzehnten Jahrhundert Gegenstand der bedeutendsten literaturkritischen Essays. Bei Anne ist das anders. George Moore hat Anne Brontë einmal »eine Art Aschenbrödel der Literatur« genannt, und ihr literarischer Rang wird bis heute ignoriert und erst recht nicht bestimmt. Dafür gibt es hauptsächlich zwei Gründe: Erstens ist die Anzahl von Annes Arbeiten vergleichsweise gering und umfaßt zwei Romane und achtundfünfzig Gedichte. Anne erkrankte tödlich an Leib und Seele, ehe sie ihren Status als Schriftstellerin festigen konnte, und lebte nicht lange genug, um diese faszinierende, authentische Note, die nichtsdestoweniger aus ihrem Werk spricht, weiterzuentwickeln und wirksamer zur Geltung zu bringen. Ein weitaus gewichtigerer Grund für Annes schriftstellerische Blässe ist Charlottes Haltung und deren erster, vernichtender Kritik zu verdanken. Fairerweise sollte man vielleicht dazusagen, daß wir womöglich nie von den Schwestern Brontë gehört hätten, wäre da nicht Charlotte gewesen mit ihren tatkräftigen Bemühungen, ihrer Initiative im Umgang mit Verlegern und ihrer Entschlossenheit, zu dritt der englischen Belletristik einen Stempel aufzudrücken. Trotzdem läßt es sich nicht leugnen, daß Charlotte in ihren Äußerungen über Annes Schaffen als Schriftstellerin es quasi als ihre moralische Pflicht ansah, ihre Schwester als eine sanftmütige, fromme, gehorsame junge Frau hinzustellen, deren schöpferisches Wirken bestenfalls bescheidene Ergebnisse zeitige. In reiferen Jahren war Charlotte eine recht scharfe Kritikerin, und ihren ausgeprägten literarischen Geschmack bewies sie dadurch, daß sie Emilys überragendes poetisches Talent schon frühzeitig erkannte. Von Anne aber meinte sie, die anspruchslosesten und alltäglichsten Gedichte nehmen zu müssen, um sie der Öffentlichkeit als die besten aus dem Werk ihrer jüngeren Schwester zu präsentieren. Die folgende Passage aus Charlottes Vorwort ist nur deshalb gerechtfertigt, weil es sich um ihre subjektive, nicht repräsentative Auswahl handelt:
Ich erkenne traurige Indizien dafür, daß sie sich viel zu sehr von religiösen Empfindungen hat leiten lassen, ähnlich wie Cowper – aber natürlich in abgemildeter Form. Zwar war sie nicht von solchen Anfällen von Schwermut befallen, die sie nicht mehr hätte verheimlichen können, aber sie drückten ihr doch stark aufs Gemüt und versetzten sie in fortwährende Grübeleien.
Die Herrin von Wildfell Hall von Anne Brontë ist kein großer Roman. Er ist jedoch ein wichtiges Buch, weil sich darin fast nichts von jenem Humbug findet, der sich sogar in Charlottes Schriften breitmacht. Er wendet sich gegen anerkannte gesellschaftliche Normen; er stellt die damals sakrosankte Institution der Ehe in Frage. Anne behandelte Probleme wie Alkoholismus, moralische Verworfenheit und geistige Primitivität mit dem unerschrockenen Engagement, welches das Werk nachfolgender realistischer Autoren kennzeichnet. Außerdem verstand sie es, ihre Charaktere zu entwickeln. Charlotte erachtete es für nötig, über diesen Roman der Welt mitzuteilen: »Die Wahl des Themas war ein völliger Mißgriff. Sie läßt nur den Schluß auf einen total zerrissenen Charakter der Autorin zu. Zwar waren Annes Motive, die ihr dieses Thema aufdrängten, rein und lauter, aber, wie ich finde, auch leicht morbid. « Dazu muß man Annes eigene Begründung anfügen, sie habe diesen Roman aus einem Gefühl der Pflicht heraus geschrieben und als Warnung für andere verstanden. Und auch wenn man der Ansicht zuneigt, Anne habe angestrengt versucht, ihr Werk als künstlerische Aussage vor sich selbst und für die Kritiker zu rechtfertigen, darf man wohl kaum annehmen, daß Charlotte einer unbeabsichtigten Fehlinterpretation erlag. Hätte sie Wildfell Hall objektiv betrachtet, hätte sie dessen Vorzüge entdecken müssen.
Charlottes Urteil scheint für die Mehrzahl der nachfolgenden Kritiker Anne Brontës zum unumstößlichen Postulat geworden zu sein. Insbesondere ihre Lyrik, ihre besten poetischen Texte werden tendenziell nicht etwa unterschätzt, sondern gar nicht erst zur Kenntnis genommen. Zwar haben Annes Gedichte nicht die mitreißende Leidenschaftlichkeit von Emilys, doch finden sich bei ihr zahlreiche lyrische Passagen und eigenständige Formulierungen von hoher Qualität, besonders in den Gondal-Texten. Sie verstand es auch, diffizile Formen der Ballade geschickt zu handhaben.
Soweit sich aus den Brontë-Briefen ersehen läßt, hat sich Anne nie aktiv gegen Charlottes Haltung gewehrt; auch darf man nicht denken, Charlotte sei Anne gegenüber nur die gestrenge Schwester gewesen. Die offenkundige Voreingenommenheit der Älteren war subtiler und ihr möglicherweise nicht immer voll bewußt. Vielleicht meinte es Charlotte ja auch gut, vielleicht verdankten sich ihre heuchlerische Mißbilligung und der hinterhältige Refrain von der »lieben, sanften Anne« einem fehlgeleiteten Beschützerinstinkt. Charlotte hatte schließlich selbst unter dem moralischen Zeigefinger der Kritiker zu leiden und mochte sich daher verpflichtet gesehen haben, Anne als langweilige, aber tugendhafte Frau hinzustellen, die leider ein unnötiges Buch geschrieben habe.
Obwohl Anne zwangsläufig immer im Schatten ihrer talentierteren Schwestern stehen wird, nimmt ihr Werk dennoch keinen geringen Rang in der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts ein. Trotz ihres angeblichen Mangels an Schwung und Begeisterungsfähigkeit war es von den drei Schwestern ganz allein Anne, die unbeirrt ihre freudlose Gouvernantentätigkeit ausübte, denn sowohl Charlotte als auch Emily versuchten sich ohne Erfolg als Lehrerinnen und Erzieherinnen.
Aus dem vielversprechenden jugendlichen Start des Brontë-Sohns wurde letztlich nichts. Sein größtes Handikap bestand darin, daß er ein Mann war. Hätte er sich, wie seine Schwestern, vom damaligen Zeitgeist disziplinieren lassen müssen oder sich, mangels eines anderen Ventils, vor die Wahl gestellt gesehen: entweder er nimmt die Schreibfeder zur Hand, oder es zerreißt ihn, würde man ihn heute vielleicht nicht bloß als den liederlichen Bruder Leichtfuß der Brontës kennen. Und trotz ihres taktlosen Tons (den Branwells Kritiker unermüdlich betonen) offenbaren seine jugendlichen Briefe an das Blackwood’s Magazine doch ein Maß an Ehrgeiz und innerer Zuversicht, die ein Künstler haben muß. Da eine Ermunterung von Seiten Blackwood’s ausblieb, versuchte er es bei Wordsworth mit einem provokativen und mutigen, wenn auch viel zu impulsiven Brief, und es gereicht jenem Dichter nicht zur Ehre, daß er Branwells Bittschreiben ignorierte, das er nachweislich erhalten und in einer entstellten Version an Southey weitergeleitet hat.
Über sein wüstes Leben, wie es sich aus seinen Briefen erschließt, braucht man eigentlich kein weiteres Wort zu verlieren. Branwells Bericht über seinen Aufenthalt in Thorpe Green, wo er als Hauslehrer angestellt war, wurde lange nach dem Tod aller Brontë-Kinder zum Gegenstand massiver Gegenbeschuldigungen. Die Geschichte von Branwells Verführung durch die Hausherrin erfuhr Elizabeth Gaskell von Charlotte, die, wie der Rest der Familie, alles, was Branwell erzählte, für bare Münze nahm. Nachdem aber Mrs. Gaskell seine Version der Affäre in Das Leben der Charlotte Brontë wiedergegeben hatte, verlangte jene Dame, die ihn angeblich ruiniert hatte, die Einsetzung einer Untersuchungskommission. Sie war eine einflußreiche Frau, und obgleich es auch dem unparteiischsten Ermittler schwergefallen sein dürfte, zu einem so späten Zeitpunkt dieses oder jenes zu beweisen, wurde sie anscheinend von jeglichem Verdacht reingewaschen, und Elizabeth Gaskell ließ eine Entschuldigung in der Times abdrucken. Bis zum heutigen Tag bleibt offen, ob Branwells Darstellung der Wahrheit entsprach oder ob nicht, wie manche meinen, der gesamte Verlauf der Ereignisse ein Produkt seiner vom Opium entzündeten Phantasie war. Möglicherweise trifft beides zu.
Branwell fehlte die Beharrlichkeit seiner Schwestern; er war zu vielseitig interessiert, um es auf einem Gebiet zu etwas bringen zu können. Eine Zeitlang nahm er Malunterricht, doch erreichte er sein ehrgeiziges Ziel – die Aufnahme in die Royal Academy – nie. Orgel, Flöte, Militärmusik, Preisboxen, die neue Eisenbahn, Lyrik und Übersetzen zählen zu dem Sammelsurium erstaunlicher Dinge, die in seinem Kopf herumspukten und konkrete Zielsetzungen vereitelten. Verhätschelt vom Vater, umgeben von stolzen, begabten und selbständigen Schwestern, wandte er sich in seiner Verwirrung den ihn bewundernden Kumpanen im Black Bull zu, wo sich sowohl der Brandy der Freunde als auch seine eigenen Talente bei der Schulung seiner Beredsamkeit verflüchtigten.
Von seinen sporadischen und wenig durchdachten Schriften können nur die Horaz-Übersetzungen guten Gewissens empfohlen werden. Das erste Vorwort dazu schrieb John Drinkwater, und sie lassen einen Anspruch auf literarische Meriten erkennen, den Branwell nicht in der Lage war einzulösen.
Die Brontë-Briefe sind für mich stilistisch keine Vorbilder. Weder sind sie sonderlich elegant geschrieben noch überladen oder holperig. Kein Brontë war jenes vulgären Bombastes fähig, der sich in Briefen dieser Zeit allzu oft findet. Ihr Sprachgebrauch ist angemessen bis lebendig; ihr Aufbau ist konventionell bis geschickt.
In ihren Briefen an ihre Verleger oder anderen Freunde aus dem damaligen Literaturbetrieb übt Charlotte fundierte Kritik an Büchern, die sie gelesen hatte. Und in den wenigen Beweisstücken, die uns von Anne als Briefeschreiberin vorliegen, finden wir die gleiche Trefflichkeit der Wortwahl, wie wir sie eigentlich nur aus dem achtzehnten Jahrhundert kennen, gepaart mit einer beachtlichen Argumentationsfähigkeit.
So begrenzt der Horizont des Alltags in Haworth auch gewesen sein mag, so wenig banal sind diese Briefe, die Zeugnis ablegen von dem harten Los, den individuellen Qualen und dem Sturm, wogegen der Brontë-Genius ankämpfte und woran er sich entzündete.
M.S.
Die Briefe
1MARIA BRANWELL AN REVEREND PATRICK BRONTË
Wood House Grove, 26. August 1812
Mein lieber Freund,
diese Anrede reicht aus, um Euch davon zu überzeugen, daß ich die Eurige nicht nur gestatte, sondern auch gutheiße – ich betrachte Euch tatsächlich als meinen Freund; doch wenn ich mir ansehe, seit welch kurzer Zeitspanne ich das Vergnügen habe, Euch zu kennen, dann erschrecke ich über meine eigene Tollkühnheit, mein Herz setzt aus, und dächte ich nicht, Ihr wäret darüber enttäuscht und bekümmert, dann wäre ich vermutlich geneigt, mir die Aufgabe des Schreibens zu ersparen. Denkt nicht, ich wäre so wankelmütig, das zu bereuen, was ich bereits geäußert habe. Nein, glaubt mir, das wird niemals der Fall sein, es sei denn, Ihr gäbet mir Anlaß dazu. Ihr braucht nicht zu befürchten, Euch in meinem Charakter getäuscht zu haben. Wenn ich mich nur ein bißchen selbst kenne, dann weiß ich, daß ich unfähig bin, anders als freigebig auf den kleinsten Erweis Eurer Freundlichkeit zu antworten, noch viel weniger Euch gegenüber, dessen Aufmerksamkeiten und Benehmen mir in ganz besonderem Maße entgegenkommen. Ich kann freimütig bekennen, daß Eure Art und das, was ich von Eurem Charakter gesehen und gehört habe, bei mir die wärmste Wertschätzung und Hochachtung bewirkt haben, und seid versichert, Ihr werdet niemals Grund haben, das Vertrauen zu bereuen, das in mich zu setzen Ihr Euch veranlaßt fühlen könntet, und es wird stets mein Bestreben sein, mich der guten Meinung würdig zu erweisen, die Ihr Euch von mir gebildet habt, obzwar mir dies aus menschlicher Schwachheit im einen oder anderen Fall nicht immer gelingen mag. Indem ich Euch diese Versicherungen bekunde, verlasse ich mich nicht auf meine eigene Kraft, sondern schaue auf zu Ihm, der stets mein untrüglicher Lenker im Leben gewesen ist und auf Dessen Schutz und Hilfe ich auch weiterhin vertrauensvoll baue.
Ich habe am Sonntag viel an Euch gedacht und habe befürchtet, Ihr würdet dem Regen nicht entkommen. Hoffentlich verspürt Ihr keine schlimmen Nachwirkungen. Meine Cousine schrieb Euch am Montag und erhofft sich die Gunst einer Antwort für heute nachmittag. Euer Brief hat mir einiges an albernem Schabernack beschert, obwohl die anderen aus Mitleid mit meinen Gefühlen recht sparsam mit ihren Neckereien waren.
Ich möchte nun freimütig auf Eure Fragen eingehen. Die »Höflichkeit anderer« wird mich niemals die artigen Aufmerksamkeiten von Eurer Seite vergessen lassen, noch kann ich »unsere gewohnten Runden spazieren«, ohne an Euch zu denken und, warum sollte ich mich dieses Zusatzes schämen, mir Eure Gegenwart herbeizuwünschen. Würdet Ihr meine Empfindungen kennen, während ich dies schreibe, würdet Ihr mich bemitleiden. Ich möchte die Wahrheit schreiben und Eurem Anspruch darauf Genüge tun, fürchte aber, zu weit zu gehen und die Grenzen der Schicklichkeit zu überschreiten. Aber was immer ich sagen oder schreiben mag, ich werde Euch nie hintergehen oder über die Wahrheit hinausgehen. Solltet Ihr glauben, ich würde nicht das allergrößte Vertrauen in Euch setzen, dann zieht meine Situation in Betracht und fragt Euch, ob ich mich Euch nicht hinreichend anvertraut habe, vielleicht sogar zu sehr. Ich bedauere sehr, daß Euch diese Zeilen nicht vor übermorgen erreichen werden, aber es war jenseits meiner Möglichkeiten, früher zu schreiben. Ich setze auf Eure Güte, mit der Ihr alles verzeihen wollt, was in diesem Brief entweder zu freimütig oder zu steif klingen mag, und wünsche mir sehr, daß Ihr mich als warmherzige und treue Freundin betrachten möget.
Onkel, Tante und Cousine senden allesamt ihre herzlichen Grüße.
Jetzt muß ich schließen und verabschiede mich erneut als Eure ergebene
Maria Branwell
2MARIA BRANWELL AN REVEREND PATRICK BRONTË
Wood House Grove, 18. November 1812
Mein lieber Frechdachs Pat,
meint Ihr nicht auch, daß Ihr dieses Attribut viel eher verdient als ich das, welches Ihr mir gegeben habt? Ich weiß wirklich nicht, was ich vom Anfang Eures letzten Briefes halten soll; ich war von all den Winden, Wellen und Klippen ganz überwältigt. Ich dachte, Ihr würdet mir einen fürchterlichen Traum schildern oder daß Ihr eine Vorahnung vom Schicksal meiner armen Kiste hattet, denn woher sollte ich auch wissen, daß Eure lebhafte Phantasie ein solches Wesen um den leichten Tadel machen könnte, den ich in meinem letzten Brief aussprach? Was werdet Ihr erst sagen, wenn Ihr mal so richtig ausgeschimpft