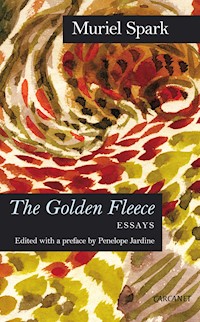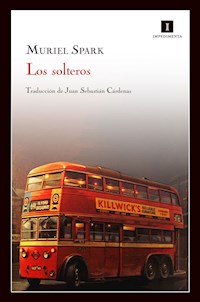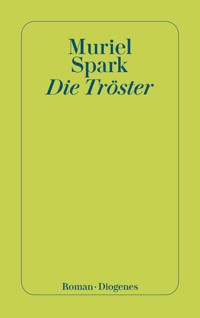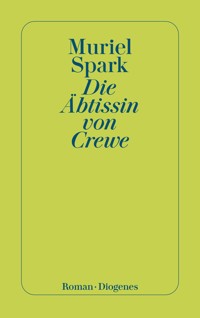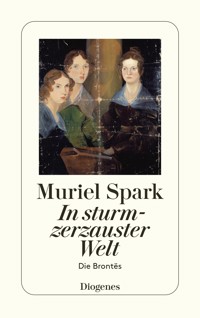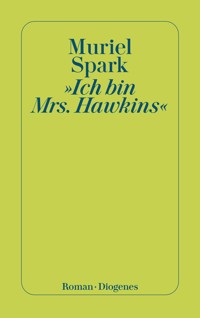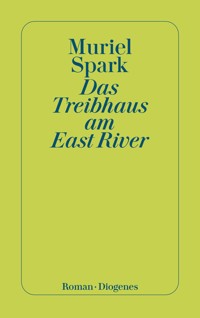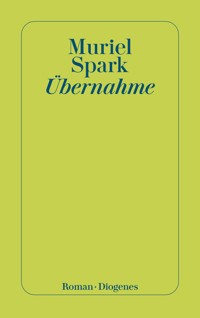
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Heldin oder eher Anti-Heldin dieses Romans ist Maggie, die drei prachtvolle Villen am Nemisee besitzt, dort wo einst das Heiligtum der Göttin Diana stand. Maggie möchte eine zweite Jagdgöttin sein, aber sie ist eher das Wild: Umgeben von Glücksrittern, Schmarotzern und Kriminellen, sucht sie nach Glück – das sie aber erst findet, als sie alles andere verloren hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Muriel Spark
Übernahme
Roman
Aus dem Englischen von Mechtild Sandberg-Ciletti
Diogenes
Erstes Kapitel
In Nemi entstanden in jenem letzten Sommer drei neue Häuser, die für die Umgebung von Bedeutung waren. Eines von ihnen war neu im strengen Sinn des Worts: auf einem Grundstück erbaut, auf dem noch kein anderes Haus gestanden hatte; es war mit einem Rechtsanwalt, aus dem nicht klug zu werden war, entworfen, geplant und besprochen und in einer Zeitspanne von drei Jahren und zwei Monaten erbaut worden. (»Und sieben Tagen, drei Stunden und zwanzig Minuten«, pflegte der derzeitige Bewohner hinzuzufügen. »Drei Jahre, zwei Monate, sieben Tage, drei Stunden und zwanzig Minuten von dem Moment an, als Maggie grünes Licht gab, bis zu dem Moment, als wir einzogen. Ich habe mitgezählt. Und wie ich mitgezählt habe!«)
Die anderen beiden Häuser waren Wiederaufbauten von Gebäuden, die bereits standen oder teilweise standen; beide hatten Grundmauern aus der römischen Antike und noch früheren Ursprungs, hieß es, wenn man nur tief genug danach grub. Maggie Radcliffe hatte diese beiden Häuser gekauft und dazu das Stück Land, auf dem sie das dritte errichtet hatte.
Eines, das Bauernhaus, war für ihren Sohn Michael gedacht. Er sollte dort leben, wenn er heiratete.
Maggie selbst war im Sommer zuvor nie dort, sollte angeblich da sein, wurde nie gesehen, würde bald kommen, war soeben nach Lausanne, nach London abgereist.
Hubert Mallindaine, im neu erbauten Haus, hatte Nachricht von Maggie; hatte Maggie gesehen, gerade verpaßt; hatte ein langes Gespräch mit Maggie geführt; war stets vorbereitet, Maggies Leben in seinen intimsten Einzelheiten mit Sachkenntnis zu erörtern. Seit Jahren war er Maggies bester Freund und erster Nachrichtenzuträger.
Das dritte Haus war eine große Villa, die in schlechtem Zustand gewesen war. Jetzt war sie in gutem Zustand, inmitten eines schönen Parks gelegen, komplett mit Tennisplatz und Swimming-pool. Der alte Goldfischteich war geklärt worden, und die Rasenflächen neu eingesät. Maggie schaffte alles. Doch es hatte Jahre gedauert. Das italienische Zeitgefühl und Maggies Konzentrationsmangel, der auf Schwierigkeiten und Komplikationen in ihren Familienangelegenheiten zurückzuführen war, hatten alles aufgehalten. Aber auch die Villa war im letzten Sommer fertig geworden. In einer Anwandlung finanziellen Moralgefühls, obwohl das ganz überflüssig war, hatte Maggie beschlossen, dieses Haus gegen einen monatlichen Betrag an einen reichen Geschäftsmann zu vermieten. Sie brauchte das Geld nicht, aber sie versetzte sich damit gewissermaßen in eine geregelte Position. Ihr derzeitiger Ehemann, Ralph Radcliffe, der ebenfalls Geld hatte und nie an etwas anderes dachte, hatte weniger Grund, das ganze Projekt zu mißbilligen, wenn man ihn daran erinnern konnte, daß Maggie aus einem der Häuser Miete bezog. Das war der Sommer, als es hieß, Maggies Ehe ginge in die Brüche.
Hubert Mallindaines Terrasse bot Blick auf den See und die jenseits wogenden Albaner Berge.
Hubert brauchte die beste Aussicht: Er hatte sich so in seine Legende eingesponnen, daß Maggie es gar nicht in Frage gestellt hatte, ob er auf die Aussicht ein Recht besaß. Seine Sekretäre hatten von ihren Zimmern aus ebenfalls einen prachtvollen Blick.
In jenem Sommer waren vier Sekretäre da: Damian Runciwell, Kurt Hakens, Lauro Moretti und Ian Mackay. Nur einer, Damian, erledigte die Sekretariatsarbeiten.
»Wir können nicht den ganzen Sommer bleiben, Darling.«
»Aber Darling, warum denn nicht? Ich hasse das Herumreisen.«
»Nimm die Ohrringe ab, ehe du dem Fleischer aufmachst.«
»Darling, warum denn?«
»Hast du an den Knoblauch gedacht?«
»Mein lieber Kurt, wir brauchen heute keinen Knoblauch.«
»O doch, Ian. – Denk an den Salat.«
»Lieber, wir haben eine Knoblauchzehe für den Salat. Mehr Knoblauch brauchen wir heute nicht.«
»Ach, verschwinde aus meiner Küche. Los. Du machst mich nervös.«
»In meiner Langeweile«, sagte Hubert Mallindaine, der Herr des Hauses, »erscheint ihr mir alle so flittrig.« Er wandte sich beim Mittagessen an sie. »Verzeiht mir, daß ich so empfinde.«
»Du kannst empfinden, was du willst«, sagte einer von ihnen, »aber du solltest es nicht aussprechen.«
»Die Champignons sind matschig. Sie sind in Öl gemacht. Noch dazu in zuviel Öl. Sie hätten in Butter und Öl zubereitet werden müssen. Sehr wenig Butter, sehr wenig Öl.«
Es kam eine so grimmige Hitzewelle, daß man hätte meinen können, jemand hätte die Hitze mit einem Hahn aufgedreht, zu stark aufgedreht, und wäre dann den ganzen Sommer lang verreist. Hubert lag auf dem Sofa in seinem Arbeitszimmer und beklagte Maggies Mangel an Noblesse. Es war Siestazeit, und sein Zimmer war verdunkelt. Hubert beschloß, mit Maggie über eine Klimaanlage zu sprechen. Doch dieser Entschluß verdroß ihn. Man sollte sich gar nicht in der Lage befinden, dachte er, fragen, auf eine Gelegenheit warten zu müssen, praktische Angelegenheiten mit einer Frau zu besprechen, die ein geregeltes Leben nicht kennt. Jeden Moment konnte sie blendend aussehend, ohne Vorwarnung in der Gegend auftauchen. Sie besaß keinen Sinn für Noblesse; eine vornehme Gönnerin hätte nicht zugelassen, daß er wegen kleiner Dinge von ihrer persönlichen Großzügigkeit abhängig war; Maggie hätte eine feste Regelung treffen sollen. Nicht einmal das Haus, dachte er, während er unter dem Hitzeansturm jenes letzten Sommers auf dem Sofa lag, ist auf den eigenen Namen eingetragen, sondern auf Maggies. Auf nichts hat man Anspruch. Maggie konnte etwas zustoßen, und dann hatte man keinerlei Rechte. Sie konnte bei einem Flugzeugunglück ums Leben kommen. Hubert starrte zur Decke hinauf und zupfte sich ein Haar aus dem Bart. Der stechende Schmerz bestätigte den Gedanken und beruhigte ihn seltsamerweise zugleich. Es war unwahrscheinlich, daß Maggie etwas zustoßen würde. Sie war unzerstörbar.
Zweites Kapitel
Miss Thin«, sagte Hubert, »ich wünschte, Sie würden nicht versuchen, Ihre Intelligenz zu gebrauchen. Sie haben so wenig davon. Tun Sie nur das, was ich sage. Sortieren Sie sie nach dem Datum.«
»Ich dachte, Sie würden die persönlichen von den geschäftlichen getrennt halten wollen«, erwiderte Pauline Thin kriegerisch. »Das wäre jedenfalls logisch.«
»Für mich gibt es da keinen Unterschied«, sagte Hubert und blickte mit Abscheu, der mit Pauline Thin in keinerlei Zusammenhang stand, auf die riesigen Mengen alter Briefe, die noch durchgesehen werden mußten. Es hat etwas sehr Aufwühlendes, alte Briefe zu betrachten, von denen jeder eine Welt vergangener Trivialitäten oder auf ewig ungelöster Leidenschaften enthält. Die Überraschung über einst überlesene Worte und neu erkannte Bedeutungen, die Erinnerung an unbezahlte oder zu hoch bezahlte Schulden, an ungelohnte Langeweile oder auf immer verlorene Süße stiegen aus den offenen Kisten zu Hubert auf.
»Ordnen Sie sie chronologisch«, sagte Hubert. »Ein Bündel für jedes Jahr. Unterteilen Sie jedes Bündel nach Monaten. Mehr brauchen Sie nicht zu tun. Lesen Sie sie nicht immer wieder durch, das ist eine Vergeudung von Arbeitszeit.«
»Na, es ist nicht meine Sache, über das Warum nachzudenken«, meinte Pauline und zog einen Stapel Briefe zu sich heran, den sie auf den Tisch gelegt hatte.
»Es ist Ihre Sache«, sagte Hubert. »Sie können nachdenken, soviel Sie wollen, wenn Sie wissen, wie man das macht. Sie haben ebenso die Freiheit wie ich, über alles nachzudenken. Nur behalten Sie Ihre Gedanken für sich. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Fragen Sie mich nicht nach den Gründen. Sortieren Sie die Briefe einfach dem Datum nach.«
Hubert ging zur Tür und trat auf die schattige Veranda, von der aus man den See überblicken konnte. Für März war es ein warmer Tag. Der Frühling war bereit. Er dachte, es wäre vielleicht besser zu versuchen, sich mit dem Mädchen gutzustellen und anzufangen, sie Pauline zu rufen. Sie nannte ihn bereits Hubert, ohne dazu aufgefordert worden zu sein. Seine Nerven waren flattrig, seit von Jahresbeginn an eine Serie finanzieller Mißgeschicke auf ihn niedergeprasselt war, unerwartet, Schlag auf Schlag. Hubert sah diese Rückschläge als ›sonderbar‹ und ›unerwartet‹ an; dabei waren sie, wie er sich gleich überlegen sollte, nicht eigentlich unvorhersehbar gewesen, weniger auf sonderbare Zusammentreffen zurückzuführen als vielmehr auf Maggies Scheidung und Wiederverheiratung mit einem wahrscheinlich eifersüchtigen italienischen Adeligen, auf den Verfall des Geldes im allgemeinen und den Zusammenbruch eines dubiosen Unternehmens in der Schweiz, in das Hubert, in der Hoffnung, ein Vermögen zu machen, einen Teil seines eigenen Geldes gesteckt hatte. Er wußte nicht recht, was er tun sollte. Aber ein Mittel blieb ihm. Die Art seiner Anwendung allerdings war noch nicht klar, trieb in seinem Hirn einsam wie eine Wolke, und inzwischen war er knapp bei Kasse.
Allein das Panorama von Nemi, mit dem See, der üppigsten Vegetation der Erde, der Szenerie, die die Phantasie Sir James Frazers zu Beginn seines umfassenden Werks zur vergleichenden Religion, Der goldene Zweig, angeregt hatte, diese ganze magische Eindruckskraft und Kulisse, die nie zuvor in all den Jahren, seit er diesen Ort kannte, und in den Monaten, seit er hier lebte, ihre Wirkung verloren hatte, war plötzlich zu teuer. Ich kann mir den Blick nicht leisten, dachte Hubert und kehrte ins Zimmer zurück.
Der Anblick Paulines, die die Papiere bündelte, schenkte ihm einen leicht euphorischen Moment. Dort unter den Briefen und Dokumenten seines Lebens hatte er jenes geheime Mittel, und er hatte beschlossen, es zu gebrauchen. Maggie konnte ihm Nemi niemals wegnehmen, weil das Gebiet von Nemi im spirituellen Sinn, wenn schon nicht im realen, das seine war.
Tatsächlich gehörte ihm natürlich nicht einmal das Haus. Maggie war … Maggie hatte … Maggie, Maggie …
Pauline Thin las gerade einen der Briefe. Manchmal, wenn einer undatiert war, mußte sie ihn lesen, um einen Anhaltspunkt zu finden, auf welchem der diversen Stapel von Korrespondenz, die auf dem Tisch ausgelegt waren, er seinen rechtmäßigen Platz hatte. Doch Pauline las mit lustvollem Interesse, und Hubert war sich nicht sicher, ob er sich Paulines Spaß an ihrer Arbeit leisten konnte, da sie schließlich stundenweise bezahlt wurde. Er war sich deshalb nicht sicher, weil sie einerseits sehr wenig pro Stunde bezahlt bekam, ferner höchst vertrauenswürdig war und er sich jetzt mehr denn je auf sie verließ; andererseits aber war er sich nicht einmal sicher, ob er sie sich überhaupt leisten konnte, weil er ihr überdies den Lohn für viele Arbeitsstunden schuldete und sich die Schuld jede Stunde in dem Maß erhöhte, wie sich die Wahrscheinlichkeit verringerte, daß er sie je begleichen würde.
Hubert blickte wieder auf Pauline mit ihrem kleinen Gesicht und dem lockigen Haar und empfand jetzt die Abwesenheit von Ian, dem Jungen aus Inverness, und von Damian, dem kleinen Armenier mit dem merkwürdigen Nachnamen Runciwell, der, als Sekretär, der beste Sekretär gewesen war; und ihm fehlten auch die beiden anderen mit ihrer Launenhaftigkeit und ihren Ansprüchen, mit ihren Kochkünsten oder ihrem Designergeschmack, mit ihren Ohrringen und Halsketten, den hautengen Blue jeans und den kleinen, apfelförmigen Hintern. Er empfand ihre Abwesenheit ohne spezifisches Bedauern; es war ihre Gattung, die ihm fehlte. Ihr Fortgehen war eine Tatsache, die ihn immer noch lähmte, gehörte einer Zeit an, die so nahe war und doch so endgültig letzter Sommer, Vergangenheit.
In den Morgennachrichten hatte man den Tod Noël Cowards gemeldet. »Das Ende einer Ära«, hatte man es genannt. Alles seit Maggies plötzlicher Scheidung und ebenso plötzlicher italienischer Heirat im vergangenen Jahr war für Hubert das Ende einer Ära gewesen. Äras enden eben, dachte Hubert. Sie enden jeden Tag. Er war niedergeschlagen. Er lebte auf. Er war wieder niedergeschlagen.
Er sah erneut zu Miss Thin hin. Sie hatte die Lektüre des anscheinend fesselnden Briefes beendet. Sie saß mit dem Rücken zu ihm und beugte sich über den Tisch, um säuberlich die Bündel von Unterlagen aufeinanderzustapeln. Sie hatte ein ausladendes Gesäß, zu breit. Wo ist die Poesie meines Lebens? dachte Hubert. In ihm hielt sich hartnäckig eine Ahnung, daß die Poesie noch da war und wiederkommen würde. Wordsworth definierte Poesie als »sich in Stille erinnerten Gefühls«. Hubert nahm eine Beruhigungstablette, eine ganz milde, die Mitigil hieß, und er wußte, daß er sich in etwa zehn Minuten wohler fühlen würde. Zur Sicherheit nahm er noch eine. Inzwischen bog ein bekannter weißer Wagen in die Auffahrt ein und hielt an, ehe er die Tür erreichte.
»Ach, du lieber Gott, der!« sagte Hubert und rief, sich Pauline zuwendend: »Miss Thin, das ist ein lästiger Mensch. Bitte bleiben Sie in der Nähe und stören Sie mich immer wieder mit Briefen, die ich unterschreiben muß. Erinnern Sie mich mit Nachdruck daran, daß ich heute abend zum Essen verabredet bin. Ich biete ihm einen einzigen Drink an. Dieser Mann ist eine pathologische Plage.«
Pauline kam heraus, um nachzusehen, wer angekommen war. Ein mittelgroßer, dünner Mann im Anzug eines Geistlichen war aus dem Wagen gestiegen, hatte die Tür zugeschlagen und kam lächelnd und winkend auf sie zu.
»Er ist ein Jesuit aus Milwaukee«, sagte Hubert.
»Ich kenne ihn«, erwiderte Pauline. »Er fällt jedem lästig.«
»Ich weiß«, sagte Hubert und fand Miss Thin plötzlich sehr nett. Er trat ein wenig vor, um den Priester zu empfangen.
»Ach, Hubert, wie schön, Sie anzutreffen«, sagte der Priester mit einer Stimme, die wie eine einsaitige Gitarre klirrte. »Ich bin extra aus Rom hergefahren, weil ich mit Ihnen sprechen wollte.«
»Guten Tag«, sagte Hubert höflich. »Leider ist meine Zeit ein wenig knapp bemessen. Wenn Sie mich angerufen hätten, dann hätten wir einen Tag vereinbaren und Sie hätten zum Abendessen herauskommen können.«
»Oh, Sie gehen aus …?«
»Gegen sieben«, antwortete Hubert und setzte ein schwaches Lächeln auf. Es war gerade gegen sechs. »Ich muß mich gleich umziehen.« Hubert deutete auf seine alten Sachen. »Kennen Sie Pauline Thin? – Pauline, das ist Pater Cuthbert Plaice.«
»Ach, ich glaube, ich kenne Sie, Pauline«, sagte der Priester, während er ihr die Hand reichte und versuchte, sie in seinem sozialen Gedächtnis ausfindig zu machen.
»Ich habe für Bobby Lester in Rom gearbeitet«, half ihm Pauline.
»Ach, natürlich. Und jetzt sind Sie hier?«
»Ja, jetzt bin ich hier.«
»Hubert, ich habe unten im Wagen einen befreundeten Jesuiten sitzen«, sagte der Priester, »mit dem ich Sie gern bekannt machen würde. Er studiert die alten ökologischen Kulte und hat sogar einige Bandaufnahmen moderner Naturkultler gemacht, die Sie unbedingt hören müssen. Es gibt da die Bewußten und die Unbewußten. Faszinierend. Ich dachte eigentlich, wir könnten zusammen essen, aber ich hole ihn auf jeden Fall herauf, und wir können ein Glas trinken. Ich wollte Ihnen nur sagen, ehe Sie mit ihm zusammentreffen, daß Sie beide dieselbe Wellenlänge haben.«
Der Priester eilte zum Wagen, einen Arm hinter sich ausgestreckt, als zöge Hubert am Ende einer unsichtbaren Schnur von ihm weg.
»Verdammte Brut«, sagte Hubert zu Pauline. »Wie komme ich dazu, ihnen meinen Alkohol zu geben? Er weiß – ich habe es ihm gesagt –, daß ich mir diese üppigen Einladungen nicht mehr leisten kann. Und Essen! Zum Abendessen wollte er mit seinem Freund bleiben! – Er marschiert herein, und schon gehört einem das eigene Haus nicht mehr. Priester können sehr rauhe Burschen sein. So was Lästiges!«
»Der hier ist gräßlich lästig«, meinte Pauline. »Bobby Lester konnte ihn nicht ausstehen.«
Pater Cuthbert kehrte mit einem jüngeren Jesuiten gleicher Größe zurück, auf den er eifrig einredete.
»Hubert«, sagte er, als er die Veranda erreichte, »ich möchte Sie mit Pater Gerard Harvey bekannt machen. Gerard betreibt Studien über ökologischen Paganismus, und ich habe ihm ausführlich von Ihnen erzählt. Ach, das ist Pauline Thin. Sie arbeitet für Hubert. Ich kenne Pauline von früher. Sie –«
»Kommen Sie herein und trinken Sie ein Glas«, sagte Hubert.
»Wir können doch gleich auf der Terrasse bleiben. Ich möchte, daß Gerard die Aussicht sieht. Was für ein prachtvolles Wetter! Das ist der Vorteil an Italien. Man kann im März im Freien sitzen und –«
Hubert ließ sie auf der Terrasse sitzen und ging hinein, um die Getränke zu holen. Pauline folgte ihm.
»Soll ich bei ihnen bleiben?« fragte sie.
»Ja, machen Sie sich lästig. Lungern Sie um sie herum und machen Sie ein dümmliches Gesicht, damit sie nicht ungestört reden können. Erinnern Sie mich daran, daß ich mich in einer halben Stunde ungefähr für das Abendessen fertigmachen muß. Diesen Leuten muß man Anstand beibringen.«
Pauline ging auf die Terrasse hinaus und setzte sich zu den beiden Männern.
»Sind Sie schon lange in Italien?« fragte sie den jüngeren der beiden.
»Ich bin seit sechs Monaten hier.«
Sie sah auf die Uhr. »Hubert muß sich bald umziehen. Er hat eine lange Fahrt vor sich und soll um acht dort sein. Vorher muß er mir noch ein paar Briefe unterschreiben.«
»Ach, wohin fährt er denn?« fragte Pater Cuthbert.
»Das fragt man nicht«, erwiderte sie.
»Aber hören Sie mal, das ist doch keine Art!« sagte Cuthbert mit verblüffter Miene.
»Sie ist wahrscheinlich nicht katholisch«, meinte Gerard beschwichtigend.
»Doch, ich bin katholisch«, sagte Pauline. »Aber das hat damit nichts zu tun. Man erzählt den Leuten nicht alles über die eigenen Angelegenheiten und die seines Arbeitgebers.«
Hubert erschien mit dem Tablett. Die Whiskyflasche war zu einem Drittel gefüllt, in der Ginflasche war etwas weniger. Außerdem standen noch ein Behälter mit Eis und eine Flasche Mineralwasser auf dem Tablett.
»So etwas ist Terrorismus«, sagte Pauline.
»Was denn?« fragte Hubert, während er das Tablett abstellte.
»Priester«, antwortete Pauline. »Sie sind Terroristen. Sie erpressen einen.«
Die Jesuiten blickten einander entzückt an. Dies war ein Gebiet, auf dem sie sich heimisch fühlten; Priester waren ja ihr Lieblingsthema.
»Die Zeiten haben sich geändert«, sagte Hubert zu Pauline, »seit Sie im Sacred Heart zur Schule gingen.«
»So lange ist es gar nicht her«, sagte Pauline, »daß ich noch zur Schule ging. Die letzten Jahre war ich in Cheltenham.«
»Und was ist in Cheltenham?« fragte Pater Gerard.
»Ein College für junge Damen«, erklärte Hubert. »Wenn Sie genau hinsehen, können Sie es ihr am Gesicht ablesen.«
»Was haben Sie gegen uns?« fragte Pater Cuthbert und rutschte unruhig in seinem Sessel hin und her, als wäre er sexuell ebenso wie seelsorgerisch erregt.
»Mir scheint es nicht gerade gastfreundlich«, wandte sich Hubert unsolidarisch gegen Pauline, »dieses Gespräch fortzusetzen.« Sein Mitigil hatte zu wirken begonnen. Er gab Eis in die Gläser. »Was trinken Sie?« fragte er die Gäste.
»Whisky«, antworteten die beiden Priester wie aus einem Mund.
Hubert warf einen traurigen Blick auf seine Whiskyflasche, hob sie hoch und goß ein.
»Hubert«, sagte Pauline, »das ist unser ganzer Whisky.«
»Ja«, erwiderte Hubert. »Ich nehme Gin. Und Sie, Miss Thin?«
»Tonic pur«, antwortete Pauline.
Der jüngere Priester schlürfte seinen Drink und blickte über den stillen See in seinem tiefen Krater und über die dichte Waldwildnis in der fruchtbaren Erde von Nemi.
»Tolle Ökologie!« sagte er.
»Sie meinen die Aussicht?« fragte Pauline.
Hubert saß in seinem Sessel, dem großartigen Panorama den Rücken kehrend, und seufzte. »Ich muß es aufgeben«, sagte er. »Es ist nicht zu ändern. Das Haus gehört nicht mir, und Maggie hat sich seit ihrer neuen Heirat sehr verändert. Sie besteht darauf, von mir Miete zu verlangen. Eine hohe Miete. Ich muß gehen.«
»Denken Sie an Ihre Verabredung zum Abendessen«, sagte Pauline. »Und, Hubert, würden Sie mir bitte noch einige Briefe unterschreiben?«
»Verabredung zum Abendessen …?« echote Hubert.
Seit Maggies Heirat, die der Heirat ihres Sohnes Michael gefolgt war, und seit dem Verdruß mit seinem Geld in der Schweiz war er immer seltener eingeladen worden. Er starrte in seinen kleinen Tropfen Gin, während Pater Cuthbert bei dem Zweifel über das Abendessen einhakte.
»Sie gehen zum Abendessen aus?«
»Das haben wir Ihnen bereits gesagt«, erinnerte Pauline.
»Oh, ich war mir nicht klar, ob es Ihr Ernst war«, erwiderte der Priester.
Hubert, der sich jetzt erinnerte, sagte: »O ja, ich gehe aus. Ich muß mich gleich umziehen. Diese Leute essen zeitig.«
»Was für Leute?« fragte Pater Cuthbert. »Kenne ich sie? Könnten wir vielleicht mitkommen?«
Sein Gefährte, der Ökologe, wurde nun langsam verlegen.
»Nein, nein, Cuthbert«, sagte er. »Wir können nach Rom zurückfahren. Wirklich, wir dürfen nicht so stören. So unerwartet. Wir müssen …« Er stand auf und blickte nervös zum Wagen, der auf halbem Weg in der Auffahrt stand.
»Warum besuchen Sie nicht Michael?« schlug Hubert vor. Er meinte Maggies Sohn, dessen Haus in der Nähe war.
Pater Cuthbert machte ein begieriges Gesicht.
»Wissen Sie, ob er zu Hause ist?«
»Sicher«, antwortete Hubert. »Sie sind im Moment beide in Nemi. Er hat selbst vor kurzem geheiratet. Die Ehe scheint tatsächlich ein Luxus zu sein, der den Reichen vorbehalten ist. Ich bin überzeugt, sie werden entzückt sein, Sie zu sehen.«
Während Hubert dem aufgeregten Priester erklärte, wie man mit dem Wagen dorthin kam, blickte Pater Gerard sich um und über den See hinweg.
»Diese Umgebung!« sagte er. »Das ist ein landschaftlich wunderschönes Gebiet.«
»Es ist wirklich Ihre Pflicht, Michael und Mary zu besuchen«, drängte Pauline. »Sie geben verschwenderische Diners. Es war ein Schock für sie, als Maggie sich scheiden ließ und wieder heiratete, wissen Sie. Die Radcliffes waren wie vor den Kopf geschlagen. Ihr neuer Mann ist ein Schwein.«
»Haben sie denn keinen Kontakt mit seinem Vater?«
»Oh, gewiß doch«, antwortete Hubert. »Radcliffe war Maggies zweiter Mann. Der neue ist der dritte. Aber es kam so plötzlich. Finanziell geht es der Familie natürlich gut. Aber ich muß sagen, ich bin dadurch schwer in die Klemme geraten, um ehrlich zu sein.«
Als die Priester abgefahren waren, ging Hubert mit Pauline in die Küche. Er öffnete eine Dose Thunfisch, während sie Kartoffelsalat machte. Dann setzten sie sich an den Küchentisch, schweigend und nachdenklich.
Es schien, als hätte Hubert die Priester vergessen. Und als läge ihr viel daran, daß er nicht eine Episode vergaß, die sie einander nähergebracht hat, sagte Pauline nachhakend: »Diese Priester …«
Zunächst reagierte er nicht auf den winzigen Anstoß. Er sagte nur träumerisch: »Es geht wohl nicht zu weit, sich zu fragen, ob sie es nicht ein bißchen zu weit treiben«, und schob einen Bissen in den Mund.
»Aber so aufdringlich, so unerträglich anmaßend«, sagte Pauline, womit sie Hubert zur Zustimmung ermunterte, die er ihr auf freundschaftlich vertraute Art gab.
»Es ist eine bemerkenswerte Tatsache«, sagte er, »daß genau in dem Moment, wo man am Ende seiner Weisheit ist, immer die Leute auftauchen, die man als letzte auf der Welt sehen möchte; immer sind sie überzeugt von ihrer eigenen Wichtigkeit und verlangen ungeteilte Aufmerksamkeit. Immer sind es die ganz besonders lästigen, die in einem ganz besonders schwierigen Moment hereinplatzen. Können Sie sich vorstellen, daß es einmal eine Zeit gab, als ein Jesuit ein Gentleman war, wenn Sie diesen altmodischen Ausdruck verzeihen wollen?«
Pauline reichte ihm den Kartoffelsalat. Er war mit Zwiebeln und Mayonnaise angemacht.
»Vergessen Sie sie, Hubert«, sagte sie, unverkennbar mit der Absicht, daß er genau das nicht tun sollte.
Doch Hubert lächelte. »Miss Thin«, sagte er, als er ihr die Salatschüssel aus der Hand nahm, »in mir sitzt ein Lachkobold, ohne den ich eingehen würde.«
Drittes Kapitel
Dämonen bevölkerten diese Wälder, Beschützer der Götter, Nymphen und Dryaden bewohnten den Ort. Haben Sie die Überreste vom Tempel der Diana dort unten gesehen? Er ist ganz schrecklich überwachsen, und die Ausgrabungen sind alle zugeschüttet, aber es gibt da eine Menge mehr zu sehen, als man glauben möchte.«
»Nein, ich habe ihn nicht gesehen«, sagte Mary und verschränkte ihre langen Beine, um sich im Schneidersitz auf einem Kissen auf dem Pflaster der Terrasse niederzulassen. Sie war eine junge, langhaarige, blonde Frau aus Kalifornien. Frisch verheiratet mit Michael Radcliffe. Die Priester fand sie ungeheuer unterhaltend. Sie wollte nicht, daß sie gingen, und drängte sie, zu einem späten Abendessen zu bleiben. Michael war nach Rom gefahren und würde erst um neun zurückkommen.
»Er hat neun gesagt, aber höchstwahrscheinlich bedeutet das zehn«, sagte sie.
»Pius der Zweite«, bemerkte Pater Gerard, »sagte, als er durch diese Gegend kam, daß Nemi das Heim von Nymphen und Dryaden war.«
»Tatsächlich?«
Ein italienischer Diener, jung und dunkelhäutig, in einem weißen Jackett mit glänzenden Knöpfen und pompösen Epauletten, brachte ein Tablett mit belegten Brötchen und Nüssen, das er auf den Terrassentisch neben die Flaschen stellte. Mit einem Ausdruck des Wiedererkennens sah er Pater Cuthbert an, der, ohne den Diener anzublikken, eine Handvoll Nüsse nahm, genau wie Pater Gerard. Das Eis klirrte in den Gläsern, und sie bedienten sich selbst, als ihre Gläser leer waren; füllten auch Marys Glas auf. Sie waren Amerikaner, die im Ausland lebten, und zeigten das unbekümmerte Benehmen von Leuten derselben Nation, die gewisse Erfahrungen teilen, wenn es auch nur wenige sind.
»Ich habe Sozialwissenschaften studiert«, sagte Mary, die in Kalifornien aufs College gegangen war.
»Waren Sie früher schon einmal in Italien?« fragte Pater Gerard.
»Nein, nie. Ich habe Michael in Paris kennengelernt. Dann haben wir uns hier niedergelassen. Ich finde es herrlich.«
»Wie steht es mit Ihrem Italienisch?« erkundigte sich der andere Priester, vergnügt strahlend – und wer strahlte nicht nach zweimonatigem ununterbrochenen Aufenthalt im tristen Priesterheim in Rom, das so anonym ist und in seinen Gesetzen so lebensfremd?
»Ach, mein Italienisch macht sich. Ich habe an einem Intensivkurs teilgenommen. Ich denke, es wird nach und nach besser werden. Wie steht es bei Ihnen?«
»Gerards Italienisch ist recht gut«, antwortete Pater Cuthbert. »Er hat nur nicht genug Übung. Es leben natürlich Italiener im Haus, aber wir unterhalten uns nur mit den Amerikanern. Oder manchmal mit den Franzosen. Sie wissen, wie das ist.«
»Cuthbert spricht fast perfekt Italienisch«, erklärte Pater Gerard. »Er ist mir eine große Hilfe, wenn ich mit den Einheimischen auf dem Lande über ihre Legenden und ihren Volksglauben spreche.«
»Gerard«, sagte Pater Cuthbert, »arbeitet an einer Studie über heidnische Ökologie.«
»Tatsächlich? Ich dachte, die Italiener wären größtenteils alle Katholiken.«
»Oberflächlich gesehen, ja, aber unter der Oberfläche gibt es noch ein großes Gebiet heidnischer Überreste zu erforschen, die vom Christentum aufgesogen wurden. Ein sehr reiches Feld.«
»Hm«, meinte das Mädchen. »Ich weiß nicht, ob Sie sich darüber schon mit Hubert Mallindaine unterhalten haben …«
Hubert war ein ganz neues Thema, das unbedingt erörtert werden mußte. Die Priester begannen wie aus einem Munde zu sprechen, fragten und antworteten, und das Mädchen unterbrach mit lachenden Einwürfen und Ausrufen, bis schließlich Pater Cuthberts Stimme, die höchste und erregbarste, sich Gehör verschaffte. Der Diener lehnte an der Terrassentür, die Augen auf sie gerichtet, und wartete, daß er gebraucht werden würde. Mary streckte ihre schönen, langen, sonnengebräunten Beine aus und hörte zu.
»Wir kamen heute abend an«, sagte Cuthbert, »ohne ihm vorher Bescheid gegeben zu haben. Aber das ist nichts Neues. Als ich ihn das letztemal vor ungefähr sechs Wochen in Rom sah, sagte er: ›Sie können jederzeit zum Abendessen kommen. Klar, Mann, bringen Sie einen Freund mit, Sie sind immer willkommen. Sie brauchen mich nicht anzurufen. Ich gehe nie aus. Steigen Sie einfach in den Wagen und kommen Sie.‹ Das hat er gesagt. Nun, heute abend kamen wir – nicht wahr, Gerard?«
»Ja, wir kamen«, bestätigte Gerard.
Jemand mit einem scharfen Ohr hätte die Richtigkeit von Cuthberts Bericht vielleicht mit der Begründung in Zweifel gezogen, daß Hubert, der kein Amerikaner war, wohl kaum eine Wendung wie ›Klar, Mann, bringen Sie einen Freund mit‹ gebraucht hätte. Doch es schien wirklich, als hätte der Priester die Gewohnheit gehabt, von Zeit zu Zeit einfach bei Hubert hereinzuschneien, ob er willkommen war oder nicht. Offensichtlich betrachtete er es als sein Recht, das überall zu tun.
»Es war mir Gerards wegen peinlich«, sagte Cuthbert. »Besonders, da dies sein erster Besuch war, wissen Sie. Er hatte eine gräßliche Sekretärin da, ein Mädchen, das für einen anderen Bekannten von mir in Rom gearbeitet hat. Ein schreckliches –«
Hier schaltete sich Gerard ein, dann auch Mary. Als sie damit fertig waren, sich über Pauline aufzuregen, fuhr Cuthbert fort: »Ich glaube, sie hat Probleme. Dann erinnerte sie Hubert ständig daran, daß er zum Essen weg müßte, was bestimmt nicht wahr war, nach der Art, wie es gesagt wurde, wissen Sie.«
Er trank sein Glas aus, und der Diener kam aus dem Schatten, um es aufzufüllen. Diesmal erkannte Cuthbert das Gesicht des Mannes, wußte aber nicht gleich, wo er es unterbringen sollte.
Der Diener hob das Glas mit gut bezahlter und routinierter Höflichkeit und lächelte.
»Ich kenne Sie, nicht wahr?« sagte Cuthbert zu ihm.
»Das ist Lauro«, sagte Mary. »Er war im letzten Sommer einer von Huberts Sekretären.«
»Ach, Lauro, in der Uniform habe ich Sie gar nicht erkannt!« Der Priester schien verwirrt, da ihm klar wurde, daß der Mann ihre Unterhaltung verstanden haben mußte.
Lauro antwortete in ungezwungenem Englisch mit italienischem Akzent.
»Sie sind überrascht, mich hier zu sehen? Ich habe meine Stellung bei Hubert verloren und war dann in einer Bar in der Via Veneto. Danach kam ich nach Nemi zurück, um für Mary und Michael zu arbeiten.«
»Lauro nennt uns beim Vornamen«, sagte Mary. »Die Botschaftsclique ist schockiert. Aber uns ist das gleich.«
Lauro lächelte und glitt wieder in seine Türnische.
»Lauro könnte Ihnen über Hubert alles erzählen, was Sie wissen wollen«, sagte Mary.
Lauros schattenhafte Gestalt beugte sich vor, um eine Rose in einer Vase aufzurichten. Cuthbert sah Mary aufmerksam an, als wollte er ergründen, was sie mit ihren Worten wohl hatte sagen wollen; doch sie hatte offensichtlich weit weniger sagen wollen, als sie vielleicht hätte sagen können.
»Ach, ich habe Hubert gern, mißverstehen Sie mich nicht«, sagte Cuthbert und blickte zu Gerard hin, der seinerseits die Meinung äußerte, daß Hubert sehr sympathisch gewirkt hätte.
»Hm, ich hatte ihn früher auch gern«, sagte Mary. »Und ich habe ihn immer noch gern. Aber als Maggie und ihr Ehemann Nummer drei dann auf ihn böse wurden, mußten wir ihre Partei ergreifen; schließlich ist sie Michaels Mutter. Was kann man da tun? Seit Maggie sich in diese Ehe gestürzt hat, gibt es zwischen den Häusern böses Blut. Sie möchte, daß Hubert geht. Er sagt, es fällt ihm nicht ein und er kann keine Miete zahlen. Sie will ihn hinaussetzen. Die Möbel gehören Maggie auch. Aber sie hat Schwierigkeiten. Die Gesetze in diesem Land … Da kann Hubert womöglich bis in alle Ewigkeit Lücken finden.«
Kurz nachdem Marys Mann Michael eingetroffen war, setzten sie sich zum Abendessen. Die meiste Zeit sprachen sie von Hubert. Hubert war ein Thema, das ihnen genügend naheging, um ihnen täglich neue Spannung zu liefern, ohne daß sie davon dank ihres Wohlstands zu tief berührt wurden. Hubert selbst war, seit das junge Paar aufgehört hatte, ihn zu besuchen, ein anderer geworden. Er war nicht mehr der aus dem vollen lebende, wortgewandte alte Freund, den sie gekannt hatten, als er Maggies Günstling war. Jetzt, wo Maggie sich von ihm abgewandt hatte, war er, in ihren Augen, ein Parasit der Gesellschaft.
»Er ist gar nicht mehr der alte Hubert«, sagte Michael. »Etwas hat ihn verändert.«
»Mir graut davor, ihm eines Tages im Dorf in die Arme zu laufen«, bemerkte Mary. »Ich wüßte nicht, was ich sagen sollte.«
Erst bot der eine Jesuit, dann der andere guten Rat an, wie diese Eventualität zu meistern wäre. Der dunkle, ziemlich kleine, aber auf seine Art so blendende Lauro servierte, von einer gutaussehenden Hausangestellten unterstützt, das Essen. Die Frühlingsnachtluft von der Terrasse umhegte sie wie ein weiterer, allgegenwärtiger Diener, der ihnen hin und wieder einen Hauch schweren Dufts von einer Kletterpflanze zufächelte. Den Wein hatte Maggies neuer Ehemann von seinem eigenen Weingut im Norden geschickt.
»Hubert«, sagte Michael, »ist natürlich der Ansicht, ein direkter Nachkomme der Göttin Diana von Nemi zu sein. Er ist der Ansicht, daß er im mystischen und spirituellen Sinn, wenn auch nicht tatsächlich, ein Recht auf dieses Gebiet hat.«
»Allen Ernstes«, sagte Gerard.
»Allen Ernstes«, bestätigte Mary. »Das glaubt Hubert. Es ist eine Familienüberlieferung. Alle Mallindaines haben es immer geglaubt. Michael und ich lernten in Paris eine Tante von ihm kennen. Sie war auch überzeugt davon. Aber ich glaube, sie war nicht ganz gesund.« – »Sie war alt«, sagte Michael.
»Nun«, meinte Gerard, »ich sollte dieser Geschichte für meine Forschungsarbeit nachgehen.«
Der andere Jesuit sagte: »Ich dachte immer, wissen Sie, die Mythologie der Diana wäre nur ein Hobby von ihm. Ich wußte nicht, daß es in der Familie liegt. Wir müssen ihn wieder besuchen.«
Eine der Geschichten, die man bei den alten Historikern des kaiserlichen Rom lesen kann, besagt, daß der Kaiser Caligula sich sexueller Beziehungen zur Göttin Diana von Nemi erfreute. Tatsächlich hat man zwei römische Prunkschiffe, die jahrhundertelang im See versunken lagen, in neuerer Zeit geborgen, und es blieb unklar, ob sie kaiserlichen Orgien auf dem Nemisee oder der Abhaltung von Gottesdiensten zur Verehrung der Diana gedient hatten. Diese Schiffe wurden in wiederherstellbarem Zustand an Land gebracht, nur um im Zweiten Weltkrieg von irgendwelchen deutschen Soldaten zerstört zu werden. Das jedoch, was von ihrer Einrichtung übrigblieb, bestätigte den Eindruck, daß rituelle Zeremonien sich bis in christliche Zeiten hinein an Bord abspielten, obwohl die Verehrung der Diana in Nemi in die mythologische Kindheit der Menschheit zurückreicht. Huberts Vorfahren …
Doch jetzt ist der Moment gekommen, Hubert an diesem Frühlingsabend näher in Augenschein zu nehmen; schließlich hatte er ergiebigen und interessanten Gesprächsstoff für die kleine Gesellschaft drüben im anderen Haus geliefert, wo die Offenheit mit der Stimmung wuchs, Lauro im Schatten erglühte und Mary, mit ihrem goldenen, kalifornischen Teint, ihren dunklen, blauen Augen und weißen Zähnen, so weit angeregt wurde, daß sie eine neuere Redensart von Maggie wiederholte: »Die Göttin Diana erbittet mit freundlicher Empfehlung die Gesellschaft ihres Verwandten, Mr. Hubert Mallindaine, beim Jagdball in Nemi …«
Hubert sah Pauline Thin beim Geschirrspülen zu. Er trug ihren Kaffee durch den Salon auf die Terrasse hinaus.
»In meinem Alter«, verkündete er, »sollte ich abends keinen Kaffee mehr trinken. Aber, Miss Thin, es lohnt nicht, immer daran zu denken, was man trinken oder nicht trinken sollte. Alles hat seine Grenzen.«
»Das sehe ich«, sagte Pauline und blickte auf den herrlichen See hinaus.
»Miss Thin«, sagte Hubert, »ich habe meinen Entschluß gefaßt. Ich werde dieses Haus nicht verlassen.«
Hubert hatte, kurz nachdem er von Maggies Scheidung im vergangenen Jahr, im Dezember 1972, gehört hatte, seinen Bart abgenommen. Dann, eine Woche nachdem er im folgenden Januar erfahren hatte, daß sie den Marquis aus dem Norden geheiratet hatte, nahm er sich auch seinen Schnurrbart ab. Nicht, daß er gefunden hätte, dies stünde in irgendeinem Zusammenhang mit Maggies Handlungen. Auf dunkle Art und Weise jedoch scheint es, daß er mit diesen beiden Rasuren irgendeine Reaktion auf ihre Scheidung und ihre Heirat ausdrückte oder, was wahrscheinlicher ist, sich auf etwas vorbereitete, eine Schicksalsprüfung vielleicht, die klare Züge erforderte.
Er sah jetzt jünger aus. Pauline Thin, die in diesem Februar angefangen hatte, bei ihm zu arbeiten, hatte ihn nie mit seinem behaarten Maestrogesicht gesehen. Sie schilderte ihn ihrer besten Freundin in Italien, einer Engländerin, die in Rom arbeitete, als »tollen Mann«.
Hubert war jetzt fünfundvierzig. Sein im allgemeinen gutes Aussehen wechselte von Tag zu Tag. Manchmal, wenn Pauline nach Rom zum Einkaufen fuhr und mit ihrer Freundin zu Mittag aß, beschrieb sie ihn als »ein bißchen schwul«. Wie dem auch sei, Hubert sah zweifellos gut aus, besonders, wenn er Seelenqualen litt. Dank eines Systems von Panikmaßnahmen, das in Kraft trat, sobald er Übergewicht bekam, war es ihm gelungen, sich eine gute Figur zu erhalten. Das Paniksystem, das aus totalem Fasten über eine hinreichende Anzahl von Tagen bestand – niemals aber mehr als zwölf –, um ihn gründlich abzumagern und untergewichtig zu machen, gestattete es ihm dann, ruhigen Gewissens zuzunehmen und beim Essen und Trinken Genüssen zu frönen, die er sich sonst nicht hätte gönnen können. Viel früher in seinem Leben schon hatte man Hubert gesagt, daß diese Lebensweise irgendwann einmal seine Gesundheit ruinieren würde; doch das war nie eingetreten. Tatsächlich war der größte Teil seines Lebens von Panikmaßnahmen bestimmt, und in den Zwischenzeiten träumte er gern oder regte sich auf oder genoß einfach das süße Leben. Eine dieser Zwischenperioden neigte sich gerade ihrem Ende zu; dies war die Erklärung für die besonders attraktive Wirkung seines gequälten Gesichts. Er war ziemlich dunkelhäutig, mit hellen, blauen Augen und sandgrauem Haar. Einzeln betrachtet hatten seine Züge nichts Besonderes, aber sein Gesicht und die Art, wie sein Kopf auf seinem Körper saß, übten eine gewisse Wirkung aus. Recht häufig war er sich seiner physischen Vorzüge bewußt; doch noch häufiger vergaß er sie einfach.
Dieses Haus, das von Maggies drei Häusern in der Gegend die beste Aussicht hatte, war luxuriös eingerichtet. Da es erst ein Jahr bewohnt wurde, hatte es noch das Flair des Neuen. Selbst die Antiquitäten, wie sie da waren, waren neu. Aus einer hochgelegenen Wohnung auf der Ostseite von Manhattan hatte Maggie große Mengen vielgereister europäischer Möbelstücke und Bilder über das Wasser zurückgebracht. Das Mobiliar im Salon war Louis Quatorze. Ursprünglich waren es sechs edle Sessel gewesen, im Moment nur fünf; einer befand sich in einer kunstfertigen kleinen Werkstatt in der Via di Santa Maria dell’Anima in Rom und wurde dort gerade mit Emsigkeit kopiert. Hubert war knapp bei Kasse, und da er beinahe sicher war, daß es Maggie zumindest gelingen würde, die Möbel aus dem Haus zu entfernen, traf er angemessene Vorkehrungen für seine Zukunft. Der neue Sessel war fast fertig; nur die Polsterung des Originals mußte noch sorgfältig entfernt und in die Kopie eingepaßt werden, ehe Pauline beordert werden konnte, nach Rom zu fahren und den Sessel zu holen. Ihr war nur gesagt worden, daß er repariert wurde. Das Original würde eine Zeitlang zu Huberts Verfügung in Rom bleiben. Wie Geld auf der Bank. Hubert spielte mit dem Gedanken, eventuell noch einige Gegenstände auszutauschen und zu verwandeln, wenn Zeit blieb, vielleicht noch einen Sessel. Maggie hatte auf den Boden des Salons einen Teppich aus dem siebzehnten Jahrhundert gelegt, einen Isfahan. Hubert grübelte darüber nach: ausgeschlossen, ihn erstklassig zu kopieren. Er benutzte den Salon in diesen Tagen nicht viel; er hatte die Freude daran verloren.
Maggies Rückzug von Hubert war ganz langsam vor sich gegangen. Nur ihm schien er abrupt gekommen zu sein. Er sah darin das unbeabsichtigte Nebenprodukt der Launen einer allzu reichen Frau oder die Auswirkung des Einflusses ihres neuen Ehemanns, der ebenfalls reich war. Doch Huberts Erinnerung war ungenau. Wie wir gesehen haben, beklagte er schon im vorhergehenden Sommer im stillen Maggies Mangel an Noblesse. Seine Gönnerin hatte sogar noch früher angefangen, sich von ihm zurückzuziehen. Sie hatte ihm erlaubt, das neue Haus zu bewohnen, wie jemand, der stillschweigend einen schlechten Handel einhält; das Haus war drei Jahre vor seiner Fertigstellung nach seinem Geschmack in Auftrag gegeben worden. Doch schon während dieser mehr als drei Jahre des Hausbaus hatte sie allmählich aufgehört, sich ihm anzuvertrauen, und vielleicht sogar noch früher hatten für Maggie die Ernüchterung und die Langeweile in dieser Freundschaft eingesetzt.
Im Grunde hatte sich Hubert viel länger, als er jetzt zugab, wenn er an Maggie dachte oder von ihr sprach, in seiner Position unsicher gefühlt. »Wie viele andere verwöhnte Geldsäcke hat sie sich meiner bedient, als sie mich brauchte, und dann hat sie mir plötzlich befohlen zu gehen, aus ihrem Haus und ihrem Leben zu verschwinden. Alle meine Pläne basierten auf ihren Versprechungen. Wir hatten eine Abmachung …« So dramatisierte er es kurz und bündig, zuerst sich selbst und dann Pauline Thin gegenüber.
Pauline vermutete, daß da eine Liebesbeziehung bestanden hatte; bis er eines Abends aus reinem Mangel an besserer Gesellschaft, der er von sich selbst hätte erzählen können, bemerkte: »Ich habe nie eine Frau angerührt. Ich liebe die Frauen, aber ich bin nie einer nahegekommen. Das hätte den Zauber gebrochen. Es ist da etwas Magisches – Frauen sind magisch. Ich kann nicht leben, ohne Frauen um mich zu haben. Sex kommt mir, was Frauen angeht, gar nicht in den Sinn.«
Das hatte Pauline verwirrt. Eilig hatte sie ihre Vorstellungen neu geordnet und war im Geist der Missionare von ehedem, die den Grundsatz vertraten, daß Bekehrung nur eine Frage der Enthüllung der wahren Lehre ist, am Ende zu der Überzeugung gelangt, daß er eben einer wahrhaft betörenden, treuen Frau noch nicht begegnet war. Sie hatte deshalb beschlossen, mehr denn je gerade in diesen schwierigen Tagen zu Hubert zu halten.
Viertes Kapitel
Ha, Nemi! –
Tief in wald’ge Höhn versenkt,
So daß der Sturm, der Eichen niederschlägt,
Empört aus seiner Bahn den Ozean lenkt
Und peitschend seinen Schaum gen Himmel fegt,
Kaum dein ovales Spiegelbett erregt, –
Kristallner See, der stumm sich selbst genügt,
Des stillgenährten Hasses Aussehn trägt,
Tief, kalt und unerschüttert ruhig liegt
Und wie die Schlange schläft,
Rund in sich selbst geschmiegt!«
»Es ist eine vollendete Beschreibung«, sagte Nancy Cowan, die englische Privatlehrerin. »Können Sie sich vorstellen, was Byron mit ›calm as cherished hate‹ meinte? – Es ist geheimnisvoll, nicht wahr? – Und doch vollkommen zutreffend. Man kann sehen, daß in der Vergangenheit, dem historischen ›Es war einmal‹, etwas Böses unter dem Spiegel des Sees verborgen war. Vielerlei Böses wahrscheinlich. Die heidnischen Bräuche waren grausam. ›Cherished hate‹ ist jedenfalls etwas sehr Böses.«
Ihre Schüler sannen nach, vielleicht, weil sie wirklich spürten, daß sie das Wesentliche nicht verstanden hatten. Letizia, ein Mädchen von achtzehn, war nicht recht sicher, was die Wendung bedeutete.
»Haß«, erklärte die Privatlehrerin, »der verborgen gehalten worden ist, geheim, der sich hinter seinem stillen Gesicht nie ausgedrückt hat. Deshalb schrieb der Dichter ›calm as cherished hate‹.«
»Es ist sehr gut«, sagte Pietro. Er war zwanzig.
Beide, Letizia und Pietro, paukten für die Aufnahmeprüfung an amerikanische Universitäten.
Die Villa in Nemi, wo sie im Frühsommer mit der englischen Lehrerin saßen, bot überhaupt keine Aussicht auf den See. Von einem Fenster aus konnte man lediglich den Schloßturm erspähen. Es war dies das dritte von Maggies Häusern, das restaurierte, das vor kurzem an die Familie vermietet worden war. Letizia, eine leidenschaftliche italienische Nationalistin mit einer Begeisterung für Folklore und freiwillige Hilfsaktionen zur Rettung junger Rauschgiftsüchtiger, nahm die Tatsache, daß ihr Vater das Haus von einer Amerikanerin gemietet hatte, sehr übel. Sie war gegen die ausländische Eigentümerschaft an italienischem Grundbesitz, vertrat die Ansicht, daß die Jugend Italiens von den Ausländern verdorben wurde, besonders was Drogen betraf, und erhob Anspruch darauf, mit ihrer hellen Haut und ihrem hellen Haar, ihrer grobknochigen, athletischen Formlosigkeit und ihrem Atheismus eine Vertreterin des neuen, jungen Italien zu sein. Der Vater, von der Mutter geschieden, war sehr reich. Sie hatte überhaupt keine Lust für die Aufnahme an eine amerikanische Universität zu lernen, und hatte Miss Cowan, die Privatlehrerin, fast schon zu ihren Ansichten bekehrt. Ihr Bruder Pietro, dunkeläugig, mit langen Wimpern und bleichem, ovalem Gesicht, hätte sehr gern in einem Film mitgespielt und später selbst einmal Regie geführt; seine freie Zeit verbrachte er unter den Höflingen berühmter Filmregisseure, raste bei Tag und bei Nacht in seinem Porsche, das Medaillon des heiligen Christophorus auf der Brust, die Schnellstraßen entlang, den ganzen italienischen Stiefel hinauf und hinunter, nur um mit irgendeiner Gruppe junger Leute zusammen sein zu können, die sich um den Regisseur scharten, wo immer der Film gerade gedreht wurde. Italien ist eine Gegend, wo man sehr zum Hofhalten neigt. Wenn Pietro nicht gerade an diesem oder jenem Hof weilte, so war er jetzt zu Hause glücklicher als in den letzten Jahren, und das war der Gegenwart Nancy Cowans zu danken.
Sie war sechsunddreißig, ziemlich dünn, langnasig, gutherzig gegen jeden, der sich gerade in ihrem Gesichtskreis befand, und wußte viel. Sie war auf eine Anzeige in der »Times« gekommen, hatte ihre englische Art mitgebracht, ihre bläßlichen Sommerkleider, ihren Sinn für fair play