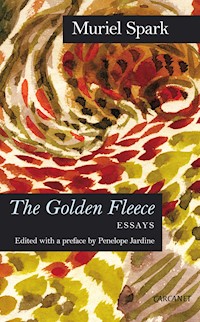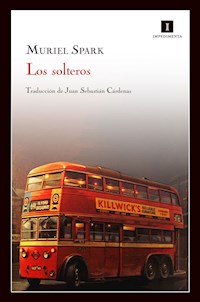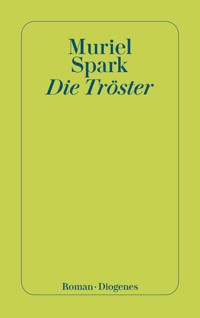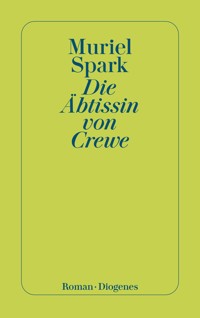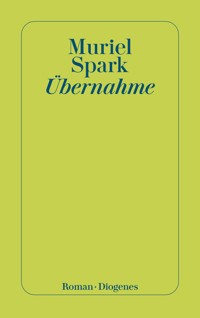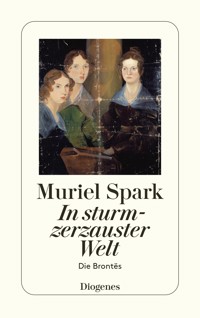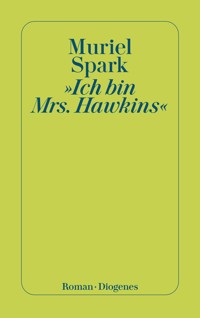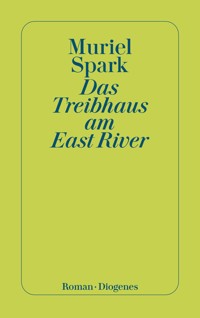6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit ihren Romanen wurde Muriel Spark zu einer der am meisten bewunderten Autorinnen der angelsächsischen Welt. Aber schon vor der Veröffentlichung ihrer bemerkenswerten Romane war sie eine anerkannte Geschichtenerzählerin. Im vorliegenden Band finden sich Erzählungen aus über dreißig Jahren, soweit sie nicht bereits in ›Portobello Road‹ (detebe 20894) veröffentlicht wurden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Muriel Spark
Päng päng, du bist tot
und andere Geschichten
Aus dem Englischen von Matthias Fienbork
Diogenes
Der Vorhang im Wind
Jedesmal, wenn an einem offenen Fenster im leichten Wind ein Vorhang weht, muß ich an jenen dünnen weißen Vorhang denken, ein Stück aus feiner Gaze, der bei den Van der Merwes vor dem Schlafzimmerfenster hing. Ich habe den ursprünglichen Vorhang nie gesehen, der, eines Nachts vor drei Jahren, so sorglos zugezogen war, daß ein Spalt blieb, und jener zwölfjährige Negerbub, der hindurchgespäht und zugesehen hatte, wie Mrs. Van der Merwe ihrem Baby die Brust gab, war von Jannie, ihrem Mann, erwischt und erschossen worden. An die Stelle des ursprünglichen Vorhangs war inzwischen dieser feinere getreten, und Jannie hatte noch fünf Jahre abzusitzen, und Mrs. Van der Merwe hatte angefangen, ihren Charakter zu verändern.
Sie hielt sich nicht mehr so krumm. Sie verlor das Abgehärmte einer Bauersfrau. Sie räumte die alten Benzinkanister aus dem Hof, und das war erst der Anfang. Sie wurde ein hoher Leuchtturm, der freundliche Lichtsignale aussandte, die von einigen als Einladung und nicht als Warnung vor dem Riff verstanden wurden. Sie kaufte das beste Porzellan, bewahrte die Geldscheine nicht mehr im Strumpf auf, nannte sich Sonia anstatt Sonji und führte ein gastliches Haus.
Es war dies ein Land, wo man in dem gemächlichst dahinfließenden Fluß nicht baden konnte, ohne daß ein Bazillus in die Niere eindrang und einem für immer den Körper ruinierte, wo man vor sechs Uhr abends keinen Spaziergang machen konnte, ohne sich einen Sonnenstich zu holen. Und in diesem entlegenen Teil des Landes, überwiegend bewohnt von armen Weißen inmitten einer Eingeborenenbevölkerung mit überwältigender Geburtenrate, konnte eine unverheiratete Frau keine Katze halten, ohne daß die weißen Junggesellen aus der Nachbarschaft sich das Tier nicht eines Tages geschnappt und es erbärmlich geschoren hätten. Das hohe Gras in diesem Landstrich war wegen der Schlangen gefährlich und der Boden wegen der Skorpione. Die Weißen reagierten auf die belangloseste Äußerung mit dem gleichen fanatischen Ernst, mit dem die Natur auf den leichtesten Schritt reagierte. Die englischen Krankenschwestern stellten fest, daß sie bei einem Dinner nicht neben einem Mann sitzen und freundlich sein konnten – vielleicht langweilen sie sich und bitten ihn daher, von seinen Erlebnissen zu erzählen –, ohne daß er dies als großen Flirt auffassen und anderntags nach dem Frühstück zum Schäferstündchen auftauchen würde. Es war ein Ort, wo, außer in der Regenzeit, auch nicht das leiseste Lüftchen ging und wo die Vorhänge sich nur dann im Wind bewegten, wenn gleich darauf ein Gewitter kam.
Den englischen Krankenschwestern wurde oft empfohlen, die Versetzung in einen anderen Distrikt zu beantragen.
»Im Norden ist es doch viel schöner! Städte, Leben. Kultur, Geschäfte. Es ist viel kühler – der Norden liegt höher. Die Pferderennen.«
»Im Osten würde es Ihnen bestimmt gefallen – diese Orangenplantagen. Alles ist grüner, es gibt ein riesengroßes Tal. Und die Jagd.«
»Warum hat man euch Krankenschwestern nur an diesen ungesunden Ort geschickt? Ihr solltet euch an einen gesünderen Ort versetzen lassen!«
Einige der Krankenschwestern verließen Fort Beit zwar, doch wer sich auf Tropenkrankheiten spezialisiert hatte, mußte bleiben, da unser Krankenhaus, das größte in der Kolonie, zugleich Forschungszentrum für Tropenkrankheiten war. Diejenigen von uns, die bleiben mußten, pflegten einander darauf hinzuweisen: »Ist es nicht herrlich hier? Jede Menge Diener. Billige Drinks. Vögel, wilde Tiere, Blumen.«
Die Gegend war nicht ohne ihre fremdartigen Reize. Ich habe mich nie an ihre Technicolor-Farbigkeit gewöhnen können, außer in der Trockenzeit, wenn der Staub alles real werden ließ. Auf dem großen Hof hinter der Klinik lag dicker Staub; dort hockten oder standen die Schwarzen herum, rufend oder lachend – was auf dasselbe hinauslief –, es wurde gekocht und gegessen, während man auf seine Behandlung wartete oder auf das Ergebnis einer Röntgenuntersuchung oder auf die Ergebnisse einer Röntgenuntersuchung eines entfernten Verwandten. Die Leute verströmten einen stechenden Geruch und wirbelten den Staub auf. Fliegen klebten auf den entzündeten Augen der Babys, die auf den Rücken der Mutter festgebunden, aber unbekümmert weiterschliefen und die Brust bekamen, wenn sie aufwachten und losplärrten.
Für die armen Weißen aus Fort Beit und Umgebung gab es im Innern des Gebäudes einen eigenen Aufenthaltsraum, hier verzehrten sie, was sie an Lebensmitteln mitgebracht hatten, räkelten sich herum, schwiegen die meiste Zeit, und manchmal kam es in irgendeiner Ecke zu einer Schlägerei. Der Rest der Gesellschaft von Fort Beit hat die Klinik nie aufgesucht.
Der Rest, das war der Apotheker, der Pfarrer, der Tierarzt, die Polizeioffiziere mit ihren Familien. Sie führten ein bescheidenes, provinzielles gesellschaftliches Leben, kamen mit den armen weißen Kleinbauern nur geschäftlich in Berührung. Ihnen lag daran, die Mitarbeiter der Klinik zu Gast zu haben, die ihre Freizeit aber meist woanders verbrachten – an den Wochenenden fuhr man meilenweit weg, in die Hauptstadt, in den Norden oder an einen der großen Stauseen, wo man sich als Segelsportler ausgeben konnte. Doch gelegentlich verbrachten die Schwestern und Ärzte zur Abwechslung einen Abend im Dorf – im Hause des Apothekers, des Pfarrers, des Tierarztes oder im Quartier der Polizeioffiziere.
In diese Gesellschaft kam Sonia Van der Merwe, als ihr Mann schon drei Jahre im Gefängnis saß. Seiner Strafe haftete ein gewisser Makel an, da allgemein die Ansicht herrschte, daß er im Eifer des Gefechts zu weit gegangen sei und daß derartige Dinge dem Renommee der Kolonie in Whitehall schadeten. Aber niemand machte Sonia deswegen Vorwürfe. Das Hauptproblem bei ihren Bemühungen, in die Gesellschaft des Tierarztes, des Apothekers und des Pfarrers aufgenommen zu werden, war der Umstand, daß sie gesellschaftlich noch nie mit ihnen zu tun gehabt hatte.
Die Farm der Van der Merwes lag ein paar Meilen außerhalb von Fort Beit. Sie war eine der wenigen Farmen im Distrikt, denn die Region war einzig der Bergwerke wegen erschlossen worden, und die hatte man erst kürzlich stillgelegt. Die Van der Merwes hatten das provisorische, harte Leben burischer Siedler geführt, die von Südafrika aus nordwärts gezogen waren. Ich glaube nicht, daß Sonia jemals auf den Gedanken gekommen war, ihre Tage könnten aus etwas anderem bestehen als aufzustehen, sich draußen am Bottich das Gesicht zu waschen, Brot zu backen, den Kindern irgendwelche Reste vorzusetzen, die Schwarzen auszuschimpfen und nachts mit Jannie in das Federbett zu sinken. Herausgekommen war sie immer nur zur Osterversammlung der Reformierten Kirche, wenn die Buren mit ihren Planwagen die Hauptstraße hereinfuhren und eine Woche blieben.
Erst als der Anwalt kam, um irgendeine Angelegenheit zwischen der Farm und der Bank zu regeln, wurde Sonia klar, daß sie das Vermögen, welches sie von ihrem Vater geerbt hatte, tatsächlich auch ausgeben konnte, denn in ihrer Vorstellung besaßen nur die Geldscheine, die sie im Sparstrumpf verwahrte, reale Kaufkraft. Ihr Vater hatte sein Geld nie für sichtbare Dinge ausgegeben, sondern es angelegt, und Sonia glaubte, daß auf ein Bankkonto eingezahltes Geld eine Art Tribut an die Bankmenschen sei, den zu entrichten patriarchalische Farmer wie ihr Vater aufgrund der strengen Moralvorschriften der Niederländisch-Reformierten Kirche gezwungen seien. Jetzt wurde ihr klar, über wieviel Geld sie verfügte, und sie verspürte heftigen Zorn auf ihren Mann, weil er ihr dieses Wissen vorenthalten hatte. Sie schrieb ihm einen Brief, was keine leichte Sache war. Ich sah die Endfassung, zu deren Beratung sie eine Konferenz von Schwestern aus der Klinik zusammengetrommelt hatte. Wir waren gemein genug, den Brief durchgehen zu lassen, doch es war wohl so, daß er uns eigentlich gar nicht interessierte. Ich erinnere mich, daß wir bis tief in die Nacht über ihre Möglichkeiten sprachen – ihren Tennisplatz, ihre beiden Badezimmer, ihr in Schwarz-Weiß gehaltenes Schlafzimmer –, was alles erst ein schwacher Schein am Ende des Tunnels war. Jedenfalls glaube ich nicht, daß wir sie dazu hätten überreden können, es sich noch einmal zu überlegen mit dem Brief, der es später, als Bestandteil von Jannies Aussage, zu ein paar Zeilen in der Lokalzeitung brachte. Er lautete wie folgt:
Lieber Jannie ein paar Dinge werden sich ändern Ich habe herausgefunden was Vati hinterlassen hat ist bahres Geld ich muß nur unterschreiben dann kann ich es haben Glaubst du ich will immer nur schuften schuften schuften und auf dem Feld die Meisehren zehlen Bei Gott wie arme Weiße Wann habe ich mal ein Kleid geschenckt bekommen Du hast nie was gesagt das ist eine Schande und dein Jehzorn hat dich ins Gefengnis gebracht du hättest auf die Beine zielen sollen. Mr. Little hat die Papiere zum unterschreiben gebracht er sagt, das Essen im Gefengnis ist gut den Kindern geht es gut, aber Hannah ist gebissen worden aber ich werde sie jetzt herausnehmen dort und sie auf eine Klosterschule schicken für Geld. Deine dich liebende Frau S. Van der Merwe
Im sommerlichen Worcestershire muß ich nachmittags oft auf meinem Bett gelegen haben, denn zu jener Zeit war ich Rekonvaleszentin. Meine Schulzeit war vorbei, und meine Ausbildung zur Röntgentherapeutin sollte erst im Herbst beginnen.
Ich weiß nicht mehr, an wie vielen Nachmittagen ich auf meinem Bett lag und den monotonen Tennisgeräuschen zuhörte, die von dem Platz rechts unterhalb meines Fensters kamen, wo meine beiden Brüder spielten. Manchmal, um mir mitzuteilen, daß es Zeit sei, aufzustehen, schlug mein älterer Bruder Richard einen Tennisball durch das geöffnete Fenster. Dann raschelte der Tüllvorhang und teilte sich, und der Ball landete mit einem dumpfen Plopp auf dem Fußboden und rollte irgendwo hin. Ich habe immer gedacht, eines Tages wird die Fensterscheibe noch zu Bruch gehen oder der Ball wird mir ins Gesicht fliegen oder irgendeinen Gegenstand im Zimmer in Stücke springen lassen. Doch dazu ist es nie gekommen. Vielleicht ist die Anzahl dieser Vorfälle in meiner Erinnerung übertrieben hoch, und in Wahrheit sind sie nur ein-, zweimal passiert.
Ich bin allerdings sicher, daß sich der Vorhang im leichten Wind bewegt hat, während ich an diesen sorglosen Nachmittagen dalag und die Rufe und das Hin und Her der Tennisbälle registrierte, und es war bestimmt ein schöner Anblick. Daß eine leichte Bewegung des Vorhangs auf eine Sommerbrise hindeutet, dürfte der Wahrheit ziemlich nahe kommen, denn für mich hat Wahrheit immer etwas Luftiges, Lebendiges und Lyrisches. Und wenn aus einer unbedeutenden Ursache etwas Dramatisches wird, dann beweist das nur, daß etwas Grundsätzliches nicht stimmt.
Genaugenommen kann ich mich nicht daran erinnern, daß die Vorhänge meines Zimmers vom Sommerwind berührt wurden, obgleich ich sicher bin, daß dem so war. Wann immer ich versuche, dieses Detail jener nachmittäglichen Stimmung mir in Erinnerung zu rufen, taucht es weg, und das Bild kenne ich bloß wie jemand, der vom Baum der Erkenntnis gegessen hat – die Erinnerung daran ist überlagert von Mrs. Van der Merwes Fenster und von den Vorhängen, die in der Regenzeit von einem leichten Wind durcheinandergebracht werden, was verrückterweise einen Gewittersturm ankündigt.
An jenen erholsamen Nachmittagen war ich zuweilen von Sorge erfüllt. Es war fraglich, ob ich aufgrund der Unterbrechung in meiner Schulzeit zur Ausbildung als Röntgentherapeutin zugelassen würde. Eines Tages kam mit der zweiten Post der Zulassungsbescheid. Erleichtert und froh las ich den Brief und beschloß im selben Moment, das Angebot nicht wahrzunehmen. Ich neige zu derartigen Dingen, und zu maßvollen und ruhigen Bewegungen fühle ich mich eben deswegen hingezogen, weil sie mir fehlen. Ich beschloß, statt dessen Krankenschwester zu werden und später meinem Bruder Richard, der seinerzeit Medizin studierte, nach Afrika zu folgen und mich mit ihm auf Tropenkrankheiten zu spezialisieren.
Es war etwa ein Jahr nach meiner Ankunft in Fort Beit, als ich Sonji Van der Merwe begegnete und gemeinsam mit den anderen Schwestern jenen Brief las, der für ihren Mann bestimmt war, welcher in vierhundert Meilen Entfernung im Gefängnis der Kolonie saß. Sonji nahm am darauffolgenden Nachmittag ihre Sonntagshandschuhe und brachte den Brief feierlich zur Post. Weder erwartete sie noch bekam sie eine Antwort. Drei Wochen später begann sie, sich Sonia zu nennen.
Unsere Besuche auf der Farm traten an die Stelle der abendlichen Zusammenkünfte beim Tierarzt, Apotheker und Pfarrer, in deren Gesellschaft aufgenommen zu werden Sonia nun gute Aussichten hatte. Und jedesmal, wenn wir zu ihr kamen, gab es etwas Neues. Sonia wußte, oder war, gleichsam über Buschfunk, dahintergekommen, wo sie anzufangen hatte. Noch kannte sie sich mit Eisenbahnfahrten nicht aus und hätte Angst davor gehabt, allein eine Reise in die weitere Umgebung zu unternehmen, doch über die eine oder andere Krankenschwester besorgte sie sich aus Südafrika Einrichtungsgegenstände, Kataloge, Bücher über Innenausstattung und Modejournale. Angestiftet von uns, ließ sie sich Möbel kommen, die in staubbedeckten Transportern herbeigeschafft wurden. Ihr erster Schritt freilich bestand darin, sich von dem Niederländisch-Reformierten Glauben ihrer Ahnen zu lösen und in die Anglikanische Kirche einzutreten. Wir mußten ihr zugestehen, daß sie auf diese Idee ganz allein gekommen war.
Von Woche zu Woche bearbeiteten wir sie. Wir brachten ihr Großzügigkeit mit den Drinks bei, denn sie hatte sich einen exotischen Vorrat angelegt. Anfangs hatte sie die Flaschen in der Speisekammer eingeschlossen und die Gläser in der Küche gefüllt, ehe sie sie vom Boy servieren ließ. Dem setzten wir ein Ende. Ein Bauunternehmer war schon mit der Erweiterung des Hauses beauftragt, und die Zimmer wurden, eines nach dem anderen, renoviert und eingerichtet. Daß sie sich nicht nur ein Badezimmer bauen lassen sollte, sondern zwei, war mein Vorschlag gewesen. Sie brauchte lange, um sich an die Innentoiletten zu gewöhnen, und wir mußten sie immer wieder daran erinnern, die Spülung zu betätigen. Eine von uns brachte aus der Hauptstadt ein Benimm-Handbuch mit, das sie, obwohl es schon achtundzwanzig Jahre alt war, eifrig studierte, mit dem Zeigefinger von Wort zu Wort gehend. Ich glaube, ich war es gewesen, die – in leicht angeheitertem Zustand – das schwarz-weiße Schlafzimmer angeregt hatte, und es war faszinierend zuzusehen, wie es Gestalt annahm. Innerhalb eines Monats war es fertig – sie hatte es geschafft, schwarze Tapete aufzutreiben und sie angeklebt zu bekommen, obwohl Tapete in der Kolonie als völlig indiskutabel galt und alle Leute sie gewarnt hatten, Tapete würde an der Wand nicht haften. In diesem Schlafzimmer lag ein weißer Teppich und ein mit schwarz-weiß gestreiftem Satin bezogener Diwan. Kaum ein Jahr später waren die Beardsley-Reproduktionen hinzugekommen, aber da führte sie schon ein gastliches Haus und erfreute sich der Gunst des Tierarztes, der einst, als junger Mann, in London gelebt hatte.
Eines Tages, sie lag auf dem Diwan und sah in ihrem Morgenmantel aus schwarzem Chiffon, ihr dünnes Haar modisch hochgesteckt, sehr dramatisch aus, erzählte sie uns die Geschichte des Negerkindes, die wir alle bereits kannten:
»Durch das Fenster dort hat er reingesehen. Ich saß dort auf dem Bett und stillte das Baby, und ich sehe zum Fenster, und, so wahr mir Gott helfe, da draußen stand ein verdammter Nigger, das Gesicht direkt am Fenster. Ihr hättet hören sollen, wie ich geschrien habe. Jannie holte also das Gewehr und erwischte den Kleinen, und ich höre den Knall. Er ist zu weit gegangen in seinem verdammten Jähzorn, was kann man da schon erwarten. Jetzt werde ich keine Probleme mehr mit diesen Jungs haben. Genau das Fenster dort. Ich hatte dummerweise den Vorhang nicht zugezogen. Also haben wir ihnen gezeigt, was Sache ist, und uns neue Boys beschafft. Auf der Farm hatten wir keine Boys, sie hauen immer ab.«
Durch das Fenster wehte in sanften Stößen ein warmes Lüftchen. »Wir sollten uns auf den Weg machen«, sagte eines der Mädchen, »es wird ein Gewitter geben.«
Bei einem Gewitter in der Kolonie war es so, daß die ganze Gegend vorher unruhig zuckte wie ein bloßliegender Nerv, und wenn alles vorbei war, kehrte die Welt, von Horizont zu Horizont, benommen zu ihrem gewohnten Gang zurück. Vor dem Ausbruch kam ein leiser Wind auf, dann ein perlenfarbiges Licht, dann Erdgeruch, die Vögel schrien und wurden plötzlich still, und die Insekten verschwanden. Hinterher wanden sich die fliegenden Ameisen völlig betäubt aus den Mauerritzen heraus, fanden ihre Flügel und flogen in verrückten Richtungen davon. Die extremeren Farben des Gewitterhimmels verblaßten wieder, als seien sie besiegt worden, und die Möbel fühlten sich nach der Zerreißprobe ganz klamm an. Eines Tages saß ich bei Sonia fest, als ein Gewitter ausbrach. Zu dieser Zeit hatte sie sich schon an ihre neue Rolle gewöhnt, die Erweiterungen ihres Hauses waren abgeschlossen und alle Zimmer eingerichtet. Nachdem das Gewitter vorbei war, brach rasch die Nacht herein, und wir saßen in ihrem sehr europäisch wirkenden Salon – die Veranda hatte sie ja abreißen lassen – und nippten an Pink Gin. Die Drinks wurden von einem Schwarzen serviert. Er umklammerte das Tablett mit ungeheuer großen Affenhänden, die aus den Ärmeln seiner grün-weißen Uniform hervorragten, welche eben noch im Gewitterlicht gefunkelt hatte. Sonia sagte immer wieder: »Ich glaube, ich habe mir mit diesem Haus einen zivilisierten Winkel geschaffen.« Das war ihre Variante eines jener Komplimente, die ihr der Pfarrer bei einem seiner Besuche beiläufig gemacht hatte. Sie hatte das als Wahrheit erkannt und allen ihren Gästen davon erzählt: »Ich muß mich dessen ja würdig erweisen, Mann!« sagte sie. Ich war immer wieder erstaunt, wie rasch sie neue Ausdrücke und höchst nützliche Wendungen aufgriff.
Die Geräusche der Nacht draußen kehrten allmählich wieder zurück. Wenn Sonia nicht gerade redete, konnte man hören, wie die wilden Tiere durch ihr Rufen wieder zueinander fanden. Und in noch größerer Entfernung die Trommeln, die, nach allem, was wir über ihren Zweck wußten, meldeten, welcher Kral überflutet und zerstört worden war, oder vielleicht auch gar nichts meldeten. Direkt vor dem Fenster draußen war gelegentlich das Geräusch nackter Füße auf dem Schotterweg zu hören, den Sonia hatte anlegen lassen. Sie erhob sich und zog die dünnen Vorhänge zurecht und zog dann die großen Vorhänge vor. Es ging ihr jetzt besser. Während des Gewitters hatte sie mit hängenden Schultern auf dem Teppich gehockt wie eine Schwarze in ihrer Hütte, die Schall- und Lichtwellen über sich ergehen lassend. Allgemein wurde eine Spur farbigen Blutes in ihren Adern vermutet, was aber, da sie inzwischen begonnen hatte, so offensichtliche Beweise ihres großartigen Vermögens und Charakters vorzulegen, ihre Aufnahme in die Gesellschaft des Tierarztes, des Apothekers und des Pfarrers nicht verhindern konnte. Zahlreiche Ärzte aus der Klinik besuchten sie, waren hingerissen von ihrer Exzentrizität und fühlten sich zum Dämmertrunk in der schwülen Regenzeit in ihrer Gesellschaft sehr viel wohler als bei der Tierarztgattin oder der musikbegeisterten Pfarrersfrau. Mein Bruder Richard war fasziniert von Sonia.
Wir Krankenschwestern waren verblüfft darüber, daß die Männer sich so sehr hinters Licht führen ließen. Sie war unsere Schöpfung, unsere Tollheit, unser Jux. Wir hatten unsere Phantasie ganz allein auf sie, die bereitwillig alle Anregungen aufnahm, verwandt, wir hatten ihre langen »Nachmittags«-Roben aus Voile selber entworfen und ihr nahegelegt, sich einen Pfad hinunter zum Fluß anlegen zu lassen und sich ein Boot für den kleinen Fluß zu besorgen und, passend zu dem Boot, einen rosafarbenen Sonnenschirm. Die ganze Gegend hatte etwas, das auf Männer wirkte, sogar auf diejenigen, die frisch aus England gekommen waren, und das ihre Urteilsfähigkeit beeinträchtigte. Ein Mann aus der Forschungsabteilung der Klinik war schon länger mit einer unangenehm lauten Bardame aus Johannesburg verheiratet, ein anderer mit einer neurotischen Schneiderin aus Kapstadt, die Dutzende von Ellbogen zu besitzen schien, so sehr wedelte sie mit ihren langen, knochigen Armen in der Luft herum. Auch wir konnten uns dem Bann dieser Gegend nicht entziehen, doch daran dachten wir nicht, als wir völlig darin aufgingen, Sonia zu kultivieren und in eine todschicke Garderobe zu stecken. Damals sahen wir nur, daß die Männer unser Phantasiegebilde völlig ernst nahmen, guckten einander an, lächelten und sahen weg.
In dem Jahr vor Jannie Van der Merwes Entlassung aus dem Gefängnis verbrachte ich einen großen Teil meiner Freizeit mit meinem Bruder Richard bei Sonia. Ihr Haus war mittlerweile ein allgemeiner Treffpunkt des Distrikts, und jeden Spätnachmittag fand sich eine größere Gesellschaft bei ihr ein. Etwa in dieser Zeit verlobte ich mich mit einem Mann, der in der Forschungsabteilung der Klinik arbeitete.
Ich weiß nicht, ob Richard mit Sonia schlief. Er war sehr verliebt in sie und verbat sich, in seinem Beisein, jede spöttische Bemerkung über sie.
Eines Tages sagte sie: »Warum willst du diesen Frank eigentlich heiraten? Mann, er sieht wie dein Bruder aus! Du mußt dir wen suchen, der nicht wie jemand aus der Familie aussieht. Ich könnte dir wen besorgen, der besser zu dir paßt!«
Ich war verärgert und suchte Frank davon abzuhalten, sich so oft wie möglich mit ihr zu treffen. Es war unmöglich. Außerhalb der Klinik schien sich unser ganzes Leben um Sonia zu drehen. Als Frank anfing, Sonia zu verspotten, wurde mir klar, daß er sich, in einer Weise, die einzugestehen ihm unangenehm war, von ihr angezogen fühlte.
Sie plapperte ohne Unterlaß, ihre Stimme hatte eine burische Färbung. Ich mußte bewundern, wie rasch sie jede Situation erfaßte, denn inzwischen war sie vertraut mit den internen Verhältnissen an der Klinik, und sie schaffte es, das eine oder andere Wort einzulegen bei durchreisenden Regierungsvertretern, die wie selbstverständlich davon ausgingen, daß sie den Distrikt schon jahrelang lenkte und sich, als jemand, der über die Masse herausragte, bloß etwas eigenwillig kleidete und verhielt.
Ich hörte, wie sie mit einem leitenden Beamten der Gesundheitsbehörde über unseren unangenehmen Chefröntgenologen sprach: »Mann, ist der vielleicht temperamentvoll! Ich kann Ihnen sagen! Jeden Morgen reitet er an meinem Haus vorbei, und ich kann sehen, wie er seinem Pferd die Sporen gibt. Er reitet, um sich abzureagieren. Aber ich sag’ Ihnen eines: er versteht was von seiner Arbeit. Er ist erstklassig, Mann!« Bald darauf wurde unser übellauniger Röntgenologe, der keineswegs oft ausritt, in einen anderen Distrikt versetzt. Erst als ich mitbekam, daß der hohe Vertreter der Gesundheitsbehörde ein fanatischer Pferdeliebhaber war, wurde mir das ganze Ausmaß von Sonias Fähigkeiten bewußt.
»Mein Gott, was haben wir getan?« fragte ich meine beste Freundin.
Sie sagte: »Schon gut! Sie verhilft uns zu einem Anbau!«
Sonia beabsichtigte, Richard auf den Posten eines Obermedizinalrats im Norden zu hieven. Meine Befürchtung war, Sonia werde, im Falle seiner Versetzung, ihm dorthin nachfolgen, denn sie hatte eines Tages gesagt, daß sie sich ans Reisen werde gewöhnen müssen, es sei bestimmt leicht. »Mann, alle tun es! Trink aus! Prost!«
Frank hatte sich ebenfalls um den Job beworben. Er sagte, mit seinen kurzsichtigen Augen in die Weite blickend, was seinen Worten etwas Gleichgültiges gab: »Ich habe die besseren Qualifikationen dafür als Richard.« Das war richtig. »Richard ist der bessere Forscher«, sagte Frank. Das stimmte. »Richard sollte hierbleiben, und ich sollte in den Norden gehen«, sagte Frank. »Dir würde es dort gefallen«, sagte er. Das alles war nicht zu leugnen.
Sehr bald zeigte sich, daß Frank mit Richard um Sonias Aufmerksamkeit konkurrierte, offenbar ohne es selber zu merken, als führte er eine medizinische Routinearbeit durch, an der ihn nicht die Methode, sondern einzig das Ergebnis interessierte. Ich fand das lächerliche Betragen der beiden Männer ziemlich unbegreiflich.
»Meinen die denn, Sonia hat, was diesen Job angeht, wirklich Einfluß?«
»Ja«, sagte meine beste Freundin, »und sie wird ihn geltend machen.«
Jener hohe Vertreter der Gesundheitsbehörde befand sich wieder im Distrikt. Er wollte das verlängerte Wochenende beim Angeln verbringen. Es war verrückt. In Fort Beit gab es nicht viel zu angeln.
Allmählich wünschte ich mir, daß Richard den Job bekam. Frank gegenüber wurde ich kühler. Er merkte es nicht, aber ich wurde kühler. Richard war sehr nervös geworden. Kaum hatte er frei, warf er sich in sein Auto und raste hinaus zu Sonia. Frank, der es mit der Arbeitszeit nicht so genau nahm, war gewöhnlich als erster da.
Ich war auf der Tea-Party, als der nicht mehr ganz junge, scharfzüngige, klarsichtige Chef der Gesundheitsbehörde auftauchte. Richard und Frank saßen auf einem Sofa, jeweils ganz außen. Richard wirkte verlegen. Ich wußte, daß er an den Job dachte, dabei aber den Eindruck zu vermeiden suchte, als wollte er seine Verbindung zu Sonia ausnützen. Ich saß in der Nähe. Mit einer langen Formel aus ihrem Benimm-Buch stellte Sonia uns dem hohen Beamten vor. Dabei fiel mir auf, daß diese Formel auf manche Menschen wie eine liebenswürdige Geste gegen die zunehmende Unverbindlichkeit unserer Epoche wirken konnte. Sonia bat den Mann, zwischen Richard und Frank Platz zu nehmen, und offensichtlich wollte sie zum Geschäftlichen übergehen.
Sie stand daneben. Sie hatte eine wunderschöne Figur, die von uns Schwestern allerdings nicht geschaffen, sondern bloß aus ihrer nachlässig-krummen Haltung erweckt worden war. Sie sagte zu dem alten Mann: »Richard hier möchte mit Ihnen sprechen, Basil!« und tippte auf Richards Schulter. Frank blickte in die Weite. Mir kam der Gedanke, daß Frank der Schreibtischtyp war. Von den Leuten in der Forschungsabteilung, die ich kannte, war keiner leidenschaftslos. Sie waren allesamt verwundbar und nervös.
Richard war nervös. Er sah den Mann nicht an, sondern blickte hoch, in Sonias modisch geschminktes Gesicht.
»Beworben für den Job im Norden?« sagte dieser Basil zu Richard.
»Ja«, antwortete Richard und lächelte erleichtert.
»Wollen Sie ihn?« sagte der Mann beiläufig, im Bewußtsein seiner großen Bedeutung.
»Ja, gerne«, antwortete Richard.
»Na schön, hier haben Sie ihn«, sagte der Mann und schnipste mit dem Zeigefinger den unsichtbaren Job weg, als wäre er ein Pingpong-Ball.
»Äh, lieber nicht«, sagte Richard.
»Wie bitte?« rief der Mann.
»Wie bitte?« rief Sonia.
Mein Bruder und ich sind in den meisten Dingen zwar sehr verschieden, doch in ein paar Punkten besteht eine grundsätzliche Ähnlichkeit. Es muß irgendwie im Blut liegen.
»Nein, danke«, sagte Richard. »Wenn ich es recht bedenke, glaube ich, daß ich mit der Erforschung der Tropenkrankheiten weitermachen sollte.«
Über Sonias Gesicht huschte nur eine Andeutung von Wut. Ihr erster Gedanke galt dem alten Herrn, der irritiert und plötzlich verunsichert dasaß. »Mann, Basil!« sagte sie, und dabei beugte sie sich über ihn, so daß ihre Brüste ihm um die Ohren hingen, »Sie haben den Falschen erwischt. Dieser Frank hier ist der, von dem ich Ihnen erzählt habe. Frank, gestatten Sie, daß ich Sie diesem Gentleman hier …«
»Ja, wir haben uns schon mal gesehen«, sagte der Mann, zu Frank gewandt.
Frank kehrte aus seiner Abwesenheit zurück. »Ich habe mich um die Stelle beworben«, sagte er, »und meine Qualifikationen sind wohl …«
»Verheiratet?«
»Nein, aber hoffentlich bald.« Er drehte sich, wie es sich gehört, zu mir um, und ich lächelte überaus giftig zurück.
»Wollen Sie den Job?«
»Ja, gerne.«
»Bestimmt?«
»Ja, ganz bestimmt.«
Der alte Mann würde sich nicht ein zweites Mal hereinlegen lassen. »Ich hoffe, Sie sind an dem Job wirklich interessiert. Es gibt sehr viele hervorragende Bewerber, und wir wollen einen tüchtigen …«
»Ja, ich möchte den Job haben.«
Sonia rief: »Na schön, da hast du ihn!« und in dem Moment dachte ich, sie hat ihren Einfluß überreizt, hat die ganze Sache vermasselt.
Doch der alte Mann strahlte sie an, nahm ihre hübsch manikürten Hände in die seinen, und mir war, als liefe in seinem schlaffen Mund das Wasser zusammen.
Andere Leute drängten sich heran, um mit dem Chef der Gesundheitsbehörde sprechen zu können. Sonia behandelte Richard mit ostentativer Gleichgültigkeit. Frank sprach mit ihr, an die Wand gelehnt. Plötzlich wollte ich Frank nicht verlieren. Ich blickte mich unter den Anwesenden um und überlegte, was ich dort verloren hatte, und sagte zu Richard: »Komm, gehen wir!«
Richard sah zu Sonia hinüber, die ihm den Rücken zukehrte. »Warum willst du schon gehen?« fragte er. »Es ist doch noch früh. Warum?«
Weil sich der Vorhang am offenen Fenster bewegte und dabei das wilde Land hereinwehte, das außerhalb dieses absurden Salons lag. Die Menschen erregten sich immer mehr. Ich dachte, bald werden sie schreien, ein- oder zweimal, wie die Vögel, und dann wieder still sein. Ich dachte sogar, Richard würde es sich mit dem Job noch anders überlegen und Sonia davon erzählen und es ihr überlassen, die ganze Geschichte für ihn in Ordnung zu bringen. Es war Sonias Faszinationskraft, die ihn zögern ließ, aufzubrechen. Sie zupfte gerade Franks Krawatte zurecht und sagte zu ihm, er brauche jemand, der für ihn sorge, in jeder Hinsicht, als ob sie nach dieser altmodischen Vorstellung erzogen worden sei. Wir müssen sie darauf hinweisen, dachte ich, so etwas in der Öffentlichkeit nicht zu sagen. Und ich wäre gern bis in den Abend geblieben, um Frank aus seiner Gleichgültigkeit mir gegenüber herauszureißen. Aber ein Gewitter kündigte sich an, und in einem Gewitter nach Hause zu fahren war kein Vergnügen.
Richard ist willensstärker als ich. Nach dieser Party ging er Sonia aus dem Weg und vergrub sich in seine Arbeit. Ich löste meine Verlobung. Ich konnte nicht erkennen, ob Frank erleichtert war oder nicht. Seine Stelle im Norden mußte er erst in drei Monaten antreten. Die meiste Zeit verbrachte er bei Sonia. Ich war nicht sicher, wie es zwischen ihnen stand. Manchmal fuhr ich noch hinüber zu Sonia und traf Frank dort an. Von ihnen und ihrer Situation fühlte ich mich abgestoßen und angezogen. Wenn ich bei schönem Wetter kam, waren sie oft in dem Boot auf dem Fluß, und ich wartete dann auf die Rückkehr des rosaroten Sonnenschirms, über dessen Anblick ich mich jedesmal freute. Ein- oder zweimal, als wir uns in der Klinik sahen, sagte Frank sachlich: »Wir können noch immer heiraten!« Einmal sagte er: »Die alte Sonia ist doch ’n Witz!« Aber mir war, als fürchtete er, ich könnte ihn beim Wort nehmen, ihn womöglich zu früh beim Wort nehmen.
Sonia sprach wieder vom Reisen. Sie lernte gerade, wie man mit Straßenkarten umgeht. Zu einer der Krankenschwestern sagte sie: »Wenn Frank sich oben im Norden eingerichtet hat, werde ich mal hochfahren und mich darum kümmern, daß er’s gemütlich hat.« Einer anderen Schwester sagte sie: »Mein Alter kommt aus dem Gefängnis, diesen Monat, nächsten Monat, was weiß ich. Er wird ein paar Veränderungen vorfinden. Er wird sich daran gewöhnen.«
Eines Nachmittags fuhr ich hinüber zu der Farm. Ich hatte Sonia sechs Wochen nicht gesehen, weil ihre Kinder während der Ferien nach Hause gekommen waren und ich ihre Kinder nicht ausstehen konnte. Sie hatte mir gefehlt, sie langweilte einen nie. Der Boy sagte, sie sei mit Dr. Frank unten am Fluß. Ich ging den Pfad hinunter, aber sie waren nicht zu sehen. Ich wartete etwa acht Minuten und ging dann zurück. Alle Eingeborenen mit Ausnahme des Boys hatten sich in ihre Hütten verzogen, um zu schlafen. Es dauerte eine Weile, bis ich den Boy entdeckte, aber als ich ihn sah, erschrak ich über den Ausdruck von Angst auf seinem Gesicht.
Ich kam gerade hinter den alten Viehställen hervor, die jetzt verwaist dalagen – Sonia betrieb keine Landwirtschaft mehr, nicht einmal mit einem Traktor, geschweige denn mit einem Ochsengespann –, da erschien der Boy und flüsterte mir zu: »Baas Van der Merwe wieder da. Er sehen durch Fenster.«
Ich schlich mich um die Stallungen, bis das Haus in meinem Blickfeld lag. Ich sah einen etwa fünfzigjährigen, unterernährt wirkenden Mann in Khakishorts und Hemd. Er stand vor dem Wohnzimmerfenster auf einer Kiste. Seine Hand lag auf dem Vorhang, er teilte ihn und blickte unverwandt in das leere Zimmer.
»Lauf hinunter zum Fluß und warne sie!« sagte ich zu dem Boy.
Er wandte sich zum Gehen, doch da rief der Mann schon: »Boy!« Der Junge in seiner grün-weißen Uniform eilte auf die Stimme zu.
Ich erreichte den Fluß in dem Moment, als sie das Boot gerade festbanden. Sonia trug ein blaßblaues Kleid. Ihr neuer Sonnenschirm war blau. Sie sah ausgesprochen phantastisch aus, und mir fielen ihre blendend weißen Zähne auf, ihre runden braunen Augen und ihre märchenhafte Positur – wie sie, mitten in Afrika, unter der gleißenden Sonne, dickblättrige Pflanzen zu ihren Füßen, so elegant gekleidet dastand. Frank, der in seinem Tropenanzug eine gute Figur machte, band gerade das Boot fest. »Dein Mann ist zurückgekommen«, rief ich und lief angsterfüllt zu meinem Auto zurück. Ich ließ den Motor an und fuhr los, und während ich auf dem Schotterweg an dem Haus vorbeischoß, sah ich, wie Jannie Van der Merwe, hinter ihm der Boy, gerade das Haus betrat. Er drehte sich um und sah meinem Auto nach und sagte etwas zu dem Eingeborenen; zweifellos wollte er wissen, wer ich war.
Wie der Eingeborene später zu Protokoll gab, lief Jannie durch das ganze Haus und untersuchte alle Veränderungen und die neuen Möbel. Er benutzte die Toilette und zog die Spülung. In beiden Badezimmern probierte er die Wasserhähne aus. In Sonias Zimmer stellte er ein herumliegendes Paar Schuhe ordentlich hin. Dann prüfte er, ob alle Möbel abgestaubt waren, im ganzen Haus, wobei er mit dem rechten Mittelfinger über die Möbel fuhr, den Finger umdrehte und nachsah, ob Staub daran war. Der Boy folgte ihm überall nach, und als Jannie zu einer alten Eichentruhe kam, die in eine Ecke eines der Kinderzimmer gestellt worden war – Sonia hatte das alte Mobiliar ihres Vaters plötzlich nicht mehr sehen können –, fand er etwas Staub darauf. Er befahl dem Eingeborenen, ein Tuch zu holen und den Staub abzuwischen. Nachdem dies geschehen war, setzte Jannie seine Inspektionsrunde fort, und als alles untersucht war, trat er hinaus und ging den Pfad zum Fluß hinunter. Bei den Viehställen stieß er auf Sonia und Frank, die sich darüber stritten, was sie tun und wohin sie gehen sollten, holte einen Revolver aus seiner Tasche und schoß beide nieder. Sonia war sofort tot. Frank quälte sich noch zehn Stunden ab. Das war ein schweres Verbrechen, und Jannie wurde gehenkt.
In den nächsten Wochen wartete ich immer darauf, daß Richard als erster den Vorschlag machen würde, daß wir abreisen sollten. Ich hatte Bedenken, den Vorschlag zuerst zu machen, da ich nicht wollte, daß er diesen Schritt vielleicht sein Leben lang bedauern würde. Bis zum nächsten Heimaturlaub war es noch ein Jahr. Schließlich sagte er: »Ich halte es hier nicht mehr aus!«
Ich wollte nach England zurück. Ich hatte an nichts anderes mehr gedacht.
»Hier können wir nicht bleiben«, sagte ich, als spräche ich eine Bühnenrolle.
»Sollen wir packen und abreisen?« fragte er, und ich empfand eine ungeheure Erleichterung.
»Nein«, sagte ich.
Er sagte: »Es wäre schade, alles aufzugeben, jetzt, wo wir beide auf dem Gebiet der Tropenkrankheiten schon so weit gekommen sind.«
Tatsächlich reiste ich in der darauffolgenden Woche ab. Richard hat seitdem auf dem Gebiet der Tropenkrankheiten große Fortschritte erzielt. »Es ist ein Jammer«, sagte er vor meiner Abreise, »daß wir uns von dem, was passiert ist, auseinanderbringen lassen.«
Ich packte meine Sachen zusammen und fuhr ab, ehe die Trockenzeit einsetzen und die Regenzeit folgen würde und alles vorhersehbar wäre.
Päng päng, du bist tot
Zu jener Zeit sahen viele Männer wie Rupert Brooke aus, dessen Konterfei noch immer in jedermann fortlebte. Es war jenes scharfgeschnittene ›typisch englische‹ Gesicht, dem man im eigentlichen England nur selten begegnet, dafür um so eher in den afrikanischen Kolonien.
»Ich muß schon sagen«, rief Sybils Gastgeberin, »die Männer sehen fabelhaft aus!«
Sie sind alle fabelhaft, hatte Sybil damals festgestellt, bis man sie näher kennt. Sie saß in dem verdunkelten Zimmer und sah zu, wie der achtzehn Jahre alte Film über die Leinwand lief, als hätte sich infolge der Hitze, die der Projektor erzeugte, die Erinnerung an diese spezielle Szene verfestigt. Sie sagte sich, ich war jung, für mich mußte alles perfekt sein. Nein, dachte sie dann, das stimmt nicht ganz. Aber es läuft auf dasselbe hinaus. Für mich waren die Männer nie sehr lange fabelhaft.
Die erste Rolle war zu Ende. Jemand schaltete das Licht an. Der Gastgeber nahm den nächsten Film aus seiner tropensicheren Verpackung.
»Es muß doch interessant sein«, sagte die Gastgeberin, »sich nach all den Jahren wieder zu sehen.«
»Hat Sybil denn diese Filme vorher noch nie gesehen?« fragte ein verspätet gekommener Gast.
»Nein, noch nie, stimmt’s, Sybil?«
»Nein, noch nie.«
»Wenn es meine Filme gewesen wären«, sagte die Gastgeberin, »dann hätte ich meine Neugier nicht achtzehn Jahre zügeln können.«
Die Schachteln mit den Kodachrome-Filmen hatten im Dunkel von Sybils Schiffskoffer gelegen. Warum sich Umstände machen, wenn man eine so deutliche Erinnerung hat!
»Sybil kannte niemand mit einem Projektor«, sagte ihre Gastgeberin, »solange wir unseren noch nicht hatten.«
»Das war wunderbar«, sagte der später gekommene Gast, eine ältere Dame, »jedenfalls, was ich noch mitgekriegt habe. Sind die anderen auch so gut?«
Sybil überlegte kurz. »Die Aufnahmen sind wahrscheinlich gut«, sagte sie. »Hinter der Kamera stand ein Koch.«
»Ein Koch! Wie drollig! Was soll denn das heißen?« fragte die Gastgeberin.
»Der Küchenboy konnte mit einer Filmkamera umgehen«, sagte Sybil.
»Er hat sein Sache gut gemacht«, meinte der Gastgeber, der gerade eine neue Rolle einlegte.
»Wunderschöne Farben!« rief die Gastgeberin. »Ach, ich bin ja so froh, daß Sie die Filme hervorgekramt haben! Wie gesund und braungebrannt und sportlich doch jedermann aussieht! Und diese glänzenden Eingeborenen überall, wirklich allerliebst!«
Die ältere Dame sagte: »Mir gefiel die Stelle, wo Sie in Shorts auf die Veranda treten und in der Hand ein Gewehr halten.«
»Fertig?« rief Sybils Gastgeber. Die neue Rolle war eingelegt. »Macht das Licht aus«, sagte er.
Da war wieder die Veranda. Durch die Flügeltür trat eine Brünette in Shorts, hinter ihr ein ausgelassener junger Schäferhund.
»Reizender Hund«, meint Sybils Gastgeber. »Er scheint Sybil um ein Spielchen zu bitten.«
»Das ist jemand anderes«, sagte Sybil hastig.
»Das Mädchen dort mit dem Hund?«
»Ja, genau. Seht ihr nicht, daß ich dort bei den Bäumen über den Rasen gehe?«
»Ach ja, richtig. Sie hat wirklich wie du ausgesehen, Sybil, dieses Mädchen mit dem Hund, findet ihr nicht? Ich meine, in dem Moment, als sie auf die Veranda trat.«
»Ja, mir war auch so, als sei es Sybil gewesen, bis ich sie im Hintergrund sah. Jetzt kann man den Unterschied aber sehen. Schaut mal, jetzt dreht sie sich um. Dieses Mädchen sieht wirklich nicht wie Sybil aus, es muß an den Shorts liegen.«
»Zwischen uns bestand eine gewisse Ähnlichkeit«, bemerkte Sybil.
Der Projektor schnurrte vor sich hin.
»Schau mal dort, das kleine Mädchen, wie ähnlich es dir ist, Sybil!« Sybil, zwischen Mutter und Vater laufend, von beiden an der Hand genommen, hatte sich schon umgesehen. Das andere Kind, das ebenfalls spazierengeführt wurde, hatte sich auch umgesehen.
Das andere Kind trug einen schwarzen Velourshut mit ringsum hochgebogener Krempe, einen beigen Mantel aus Kammgarn und um den Hals einen schmalen weißen Hermelinschal. Es hatte weiße Seidenhandschuhe an. Sybil war genauso angezogen, und obwohl das an sich auch nichts Erstaunliches war, da sehr viele kleine Mädchen in dieser Weise gekleidet waren, wenn sie in den Parks und öffentlichen Anlagen englischer Domstädte des Jahres 1923 spazierengeführt wurden, so verstärkte es doch die auffallende Ähnlichkeit, die in Physiognomie, Körperbau und Größe zwischen den beiden Mädchen bestand. Sybil hatte plötzlich das Gefühl, an ihrem eigenen Spiegelbild vorbeizugehen, wie sie es von dem hohen Spiegel kannte. Da war das spitze Kinn, unter dem Hütchen der schwarze Bubikopf, der Pony, der fast die Augenbrauen berührte. Die weit auseinanderstehenden Augen und die Nase, so winzig wie eine Katzennase. »Hör auf, sie anzustarren!« flüsterte ihre Mutter. Sybil hatte gerade noch Zeit, den Schimmer von weißen Söckchen und schwarzen, geknöpften Lackschuhen zu sehen. Ihre eigenen Söckchen waren auch weiß, ihre Schuhe allerdings braun und geschnürt. Zuerst fand sie, daß dieser eine Unterschied sich nicht gehörte, in dem Sinne, wie es nicht in Ordnung war, auf eine der Ritzen der Bürgersteinplatten zu treten. Doch dann fand sie, daß dieser Unterschied zu Recht bestand.
»Die Colemans«, sagte Sybils Mutter zu ihrem Vater. »Ihnen gehört dieses Hotel in Hillend. Das Kind muß etwa in Sybils Alter sein. Sind einander sehr ähnlich, nicht?« Und dann sagte sie, so daß Sybil es hören mußte: »Und bestimmt ist sie ein genauso braves Mädchen wie Sybil.« Die letzten Worte mit ihrem leisen Zwang zur Vollkommenheit gefielen der aufgeweckten Sybil überhaupt nicht.
Auch bei späteren Sonntagsspaziergängen begegnete man der Coleman-Tochter. Im Sommer trugen die Kinder Panamahüte und dezent gesmokte Kleider aus Tussahseide. Gelegentlich wurde die Coleman-Tochter von einem jungen Kindermädchen in grauem Kleid und schwarzen Strümpfen spazierengeführt. Sybil fiel auf, in welch unterschiedlicher Begleitung sie waren. »Dreh dich nicht um und starr nicht so!« flüsterte ihre Mutter.
Erst als sie in die Schule kam, stellte sie fest, daß Désirée Coleman ein Jahr älter war als sie. Désirée war eine Klasse über ihr, doch zuweilen, wenn sich die ganze Schule auf dem Rasen oder in der Turnhalle versammelt hatte, wurde Sybil einige Momente für Désirée gehalten. Im lauen Frühsommer saßen die Klassen oft in einzelnen Gruppen unter den Platanen, bis die Lehrerinnen, wie aus einem gemeinsamen Instinkt heraus, gleichzeitig das Pausenzeichen gaben. Dann vermischten sich die Gruppen, und eine Lehrerin rief vielleicht: »Sybil, deine Schnürsenkel!« und dann, während Sybil noch ihre ordentlich geschnürten Schuhe betrachtete: »Nein, nicht Sybil, ich meine Désirée!« Wenn die Lehrerin in der Musikstunde rief: »Viel besser als gestern, Sybil!« dann schlug Sybil den Triangel voller Triumph, doch es folgte dann immer ein »Désirée, vielmehr!«
Lediglich die Erwachsenen konnten die beiden Kinder zuweilen nicht auseinanderhalten. Keiner ihrer Spielkameraden irrte sich. Nach dem Schulkonzert sagte Sybils Mutter: »Einen Moment habe ich geglaubt, du warst Désirée im Chor. Merkwürdig, daß ihr einander so ähnlich seid. Ich sehe überhaupt nicht wie Mrs. Coleman aus, und dein Daddy hat mit ihm nicht die geringste Ähnlichkeit.«