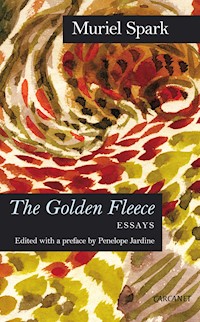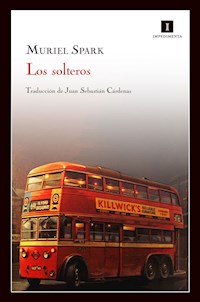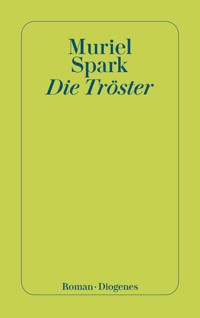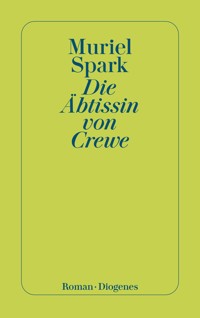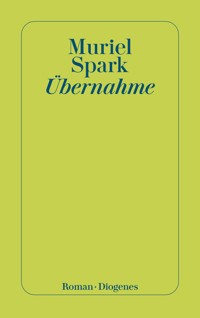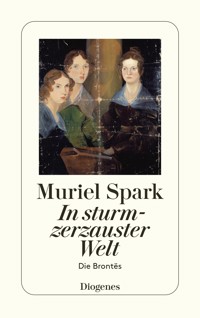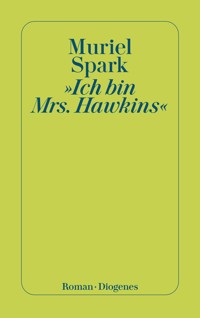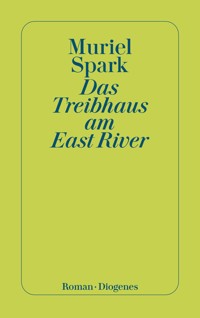5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was tun, wenn die von einem selbst erfundene Figur plötzlich empört an der Haustür klingelt? Und wie kann es passieren, daß man im eigenen Haus zum Butler wird? Was, wenn ein Gespenst als Patient in die Praxis kommt? Und wenn der eigene Chef einem immer weniger geheuer wird? Muriel Spark kennt wie keine andere die Tücken des Alltags und der Phantasie. Pointiert und präzise fängt sie den leichten Wahn ein, der überall lauert, in öffentlichen Verkehrsmitteln, Aufzügen, alten Schlössern und verhockten Dörfern. »Ich kann mir keine geistlosere Beschäftigung vorstellen, als ein Gespenst zu sein und einfach so post mortem aufzutauchen und zu verschwinden. Warte nur, bis ich dich weganalysieren lasse«, so wehrt sich ein Verfolgter gegen den Geist, der ihn bedroht. Und er ist nicht allein: Die »Helden« bei Muriel Spark greifen zu höchst ungewöhnlichen Mitteln, um mit der Wirklichkeit fertig zu werden. Immer genau dann, wenn man verheerende Ironie erwartet, passiert noch etwas viel Verrückteres und viel Echteres. In einzigartig lakonischem Stil lässt Muriel Spark ihre Geschichten voller Vergnügen ins Komische, Unheimliche, Groteske kippen. Die Geschichten von Muriel Spark erschüttern unsere Gewohnheiten auf höchst unterhaltsame Weise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Muriel Spark
Hundertundelf Jahre ohne Chauffeur
Geschichten
Aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser
Diogenes
Die Snobs
Snob [engl.] der, Person, die durch Lebensstil, Verhalten, Kleidung und Umgang den Anschein zu erwecken sucht, einer anderen, höheren Gesellschaftsschicht anzugehören, oder aber auch den Kontakt mit sozial tiefer Gestellten vermeidet. (dtv Brockhaus Lexikon)
Die obige Definition mußte ich einfach anführen, trifft sie doch haargenau auf das Ehepaar Ringer-Smith zu, das ich in den fünfziger Jahren kannte. Seitdem sind mir erstaunlich viele Spielarten und Varianten der Ringer-Smiths untergekommen. Snobs sind wahrhaft frappierend. Hauptsächlich irren sie sich in einem: Es gelingt ihnen nicht, den Kreisen, von denen sie akzeptiert zu werden hoffen, denen sie unbedingt angehören, zu denen sie gerechnet werden wollen – diesen Kreisen etwas vorzumachen. Sie mögen in einer demokratischen Gesellschaft leben, aber das nützt ihnen nichts. Gar nichts.
Von den beiden Ringer-Smiths war er, Jake, der größere Snob. Doch auch sie, Marion, legte von Haus aus eine kaltlächelnde Überheblichkeit an den Tag, die sie selbst nie in Frage stellte. Ja, sie war ziemlich blasiert. Sie kam aus einem Milieu kleiner grundbesitzender Landwirte und untergeordneter Beamter und war knickerig wie sonst was. Jake entstammte ebenfalls der Beamtenschicht sowie, mütterlicherseits, einer Familie von Obst-Ex- und Importeuren, die der Mutter nicht viel hinterlassen hatten, da das Erbe den männlichen Familienangehörigen zugefallen war. Jake und Marion paßten recht gut zusammen. Er war um ein weniges der kleinere von beiden. Beide waren dünn. Sie hatten keine Kinder.
Leichen im Keller einer Familie können einen wahren Snob nicht schrecken, ja sie lösen einen gewissen Hochmut aus, und dies war bei Jake der Fall. Ein Familienskandal von nationaler Größenordnung hatte internationale Dimensionen angenommen. Ein von einem Bruder verübter spektakulärer Banküberfall in Tateinheit mit Mord hatte dazu geführt, daß der Familienname in allen Haushalten zu einem festen Begriff geworden war. Der straffällige Ringer-Smith hatte sich mit seinen Spießgesellen ins sichere Exil nach Südamerika geflüchtet, so daß Jake und seine alternde Mutter vor Presse- und Fernsehreportern für ihn geradestehen mußten. Niemand hätte es an ihnen ausgelassen, hätten sie Polizei, Journalisten, die Vernehmungsbeamten, die Vertreter der Gerichtsbarkeit und die Öffentlichkeit im allgemeinen nicht so von oben herab behandelt. Sie kehrten die Vornehmen heraus, beriefen sich darauf, eine »anständige Familie« zu sein, und führten sich durchweg so auf, als seien sie Grafen und Herzöge statt ganz gewöhnlicher Kleinbürger. Kein Graf, kein Herzog, der heute noch lebt, würde sich derart hochnäsig gehaben, es sei denn, er wäre nicht ganz bei Trost oder so etwas wie ein unglücklicher Drogenabhängiger oder ein Hasardeur, der stets nur verliert.
Ich wohnte bei Freunden in einem Château bei Dijon, als die Ringer-Smiths aufkreuzten. Das war in den Neunzigern. Ich erkannte sie kaum. Die Ringer-Smiths waren nicht einfach im Château aufgekreuzt; Anne hatte sie vor dem Dorfladen aufgelesen, wo sie, verwirrt über eine Landkarte gebeugt, vergeblich versuchten, sich zurechtzufinden. Anne hatte, wie sie es immer tat, wenn jemand in der Klemme saß, sich wegen ihrer Not für sie erwärmt und die orientierungslosen Engländer auf ein Täßchen Tee ins Château eingeladen, wo sie ihre Route ausknobeln könnten.
Anne und Monty, selbst Engländer, lebten seit acht Jahren in dem Château. Das Erbe, das ihnen das letzte Mitglied eines entfernten Zweiges von Montys Familie vermacht hatte, kam völlig unerwartet. Zu seiner ungeheuren Überraschung fiel Monty, der Anfang Fünfzig war, das Haus mitsamt einem kleinen Vermögen zu. Er hatte sich unter anderem als Schuhverkäufer und Busfahrer betätigt. Anne war Sekretärin eines Börsenmaklers gewesen. Ihre zwei Kinder, beides Mädchen, waren verheiratet und glücklich aus dem Haus. Die märchenhafte Geschichte ihres Erbes hatte einen Tag lang in den Zeitungen gestanden, aber nicht jeder hatte die kurze Meldung gelesen.
Monty war ausgegangen, als Anne die Ringer-Smiths ins Haus brachte. Ich sah gerade fern – eine Sendung, deren Name mir aufgrund der Erschütterung, die ich empfand, als ich diese Leutchen erblickte, völlig entfallen ist. Anne, die sich für sechzig gut gehalten hat – hochgewachsen, blondiert, fröhlich –, begab sich in die Küche, um Teewasser aufzusetzen. Sie hatte das Wohnzimmer, sosehr es irgend ging, in ein Stück England verwandelt.
»Wem gehört denn das Schloß?« erkundigte sich Jake bei mir, sobald Anne das Zimmer verlassen hatte. Offensichtlich hatte er mich in dieser Umgebung nicht erkannt, obwohl ich spürte, wie Marions Augen auf mir ruhten – ein durchdringender Blick voller Ratlosigkeit und vager Erinnerung. »Es gehört«, antwortete ich, »der Dame, die Sie zum Tee eingeladen hat.«
»Oh!« sagte er.
»Kennen wir uns nicht?« sprach Marion mich an.
»Ja, wir kennen uns.« Ich stellte mich vor.
»Was führt Sie hierher?« erkundigte sich Jake rundheraus.
»Das gleiche wie Sie. Man hat mich eingeladen.«
Anne kam mit dem Tee zurück, den sie in einer silbernen Kanne und hübschen Porzellantäßchen servierte. Das Tablett trug sie selbst, während ein junges Mädchen, das im Haushalt half, mit heißem Wasser und einem Teller Kekse folgte.
»Sie sprechen aber gut Englisch«, bemerkte Jake.
»Oh, wir sind Engländer«, entgegnete Anne. »Aber jetzt leben wir in Frankreich … Mein Mann hat das Château von seiner Familie mütterlicherseits geerbt, von den Martineaus.«
»Ach ja, natürlich«, sagte Jake.
Der Gutsverwalter kam vom Gehöft herein und nahm im Stehen eine Tasse Tee zu sich. Er redete Anne mit »Madame« an.
Anne bereute schon ihre spontane Regung, das Paar zum Tee gebeten zu haben. Sie sagten sehr wenig, blieben aber weiterhin sitzen. Anne hatte Angst, daß sie den letzten Bus zum Bahnhof verpassen würden. Den Blick auf mich gerichtet, fragte sie: »Der letzte Bus geht um sechs, nicht wahr?«
Ich sagte zu Marion: »Den letzten Bus dürfen Sie nicht verpassen.«
»Könnten wir uns im Château umschauen?« fragte Marion. »Im Reiseführer steht, daß es aus dem 14. Jahrhundert stammt.«
»Nun ja, nicht alle Flügel«, erwiderte Anne. »Aber heute wird es etwas schwierig. Wissen Sie, das Haus ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Wir wohnen darin.«
»Ich bin sicher, daß wir uns von irgendwoher kennen«, sagte Marion zu Anne, als sei die Frage, ob sie den letzten Bus noch erwischen würden, damit aus der Welt geschafft – eine Spitze, die Anne nicht entging. So gutherzig sie auch war, ich wußte, daß sie es haßte, Leute mit dem Auto zum Bahnhof kutschieren oder anderweitige Pflichten auf sich nehmen zu müssen, auf die sie nicht vorbereitet war. Ich konnte sehen, wie sich bei Anne der Gedanke einstellte: Ich muß diese Leute abschütteln, sonst bleiben sie womöglich noch zum Abendessen und dann die ganze Nacht. Es sind »Schloßschranzen«.
Anne hatte sich oft bei mir über die Schloßschranzen der letzten Jahre beklagt. Leute, die sie ignoriert hatten, als sie noch die unbekannte Frau eines Busfahrers war, wollten sich jetzt bei ihr einschmeicheln. Monty hatte nichts weiter dagegen. Aber die Last, Mahlzeiten vorzubereiten und Gäste stilvoll zu bewirten, oblag eher Anne als Monty, der einen Großteil seiner Zeit damit verbrachte, dem Gutsverwalter auf den Feldern zur Hand zu gehen, das Wild zu hegen und den Wald zu roden.
Anne ahnte, daß es sich bei dem englischen Paar, das sie »auf ein Täßchen Tee« eingeladen hatte, um Kletten handelte, um Aufsteiger und Nervensägen, und als Marion Ringer-Smith sagte: »Ich bin sicher, daß wir uns von irgendwoher kennen«, warf sie mir einen besonders verzweifelten Blick zu.
»Glauben Sie?« fragte Anne. Sie war aufgestanden und ging zur Hintertür voran. »Das ist die Cour des Adieux«, sagte sie, »so kommen Sie schneller zu Ihrer Bushaltestelle.« Marion beugte sich vor und nahm noch einen Keks, als sei es die letzte Chance in ihrem Leben, einen Keks zu verzehren.
Ich war in diesen Tagen gerade mit der Fertigstellung eines Romans beschäftigt. Anne hatte mir die Beschaulichkeit französischen Landlebens und die Ungezwungenheit ihres eigenen Lebensstils angepriesen – ein ideales Arrangement. Außerdem hatte sie sich anerboten, mein handgeschriebenes Romanmanuskript in den Computer zu tippen. Aber jetzt, um Viertel vor sechs, begriff ich, daß uns unsere restlichen Pläne für den Nachmittag entglitten.
Ich bezweifelte, daß Marion Anne wirklich schon einmal gesehen hatte. Daß sie auf Anne abzielte, war eher eine Art geistiger Übertragungsprozeß. In Wahrheit war ich es, der sie schon einmal begegnet war, doch war sie sich dessen nicht recht bewußt. Da es schon vierzig Jahre her war, konnte sie sich kaum noch an mich erinnern.
Jake Ringer-Smith fragte, ob er das Badezimmer benutzen dürfe. Du Klette, dachte ich. Warum gehst du nicht einfach? Die ganze Auffahrt entlang gibt es Bäume und dichtes Buschwerk, wo du ungestört pinkeln kannst. Aber nein, er mußte sich das Badezimmer zeigen lassen. Bis zur Abfahrt ihres Busses waren es nur noch zehn Minuten. Jake schob seinen Rucksack seiner Frau zu und sagte: »Nimm du ihn, ja?«
»Wo wir schon einmal hier sind, würde ich mich wirklich gern im Château umschauen«, sagte Marion, »schließlich sind wir so weit gereist.«
Ich hatte diese Situation schon einmal erlebt. Es gibt Leute, die eine Gruppe erschöpfter und ermatteter Mitreisender aufhalten, nur weil sie unbedingt eine Kanzel besichtigen wollen. Es gibt Leute, die eine Stunde zu spät zum Abendessen erscheinen mit der Ausrede, daß sie sich unterwegs unbedingt eine Kunstgalerie ansehen mußten. Marion gehörte eindeutig zu ihnen. Hätte man sie zur Rede gestellt, hätte sie, ohne zu zögern, darauf hingewiesen, daß sie schließlich ein Flugzeugticket bezahlt habe, um dorthin zu gelangen, wo sie jetzt war. Ich erinnere mich noch an Marions unförmiges Gazekleid und ihre abgetragenen Sandalen, an Jakes ausgebeulte, demonstrativ geflickte, schmuddelige Hose, an ihre Gier, mit der Dame des Hauses auf vertrautem Fuß zu stehen, sich zum Abendessen einladen zu lassen und zweifelsohne über Nacht dazubleiben. Anne tat mir aufrichtig leid. Ich sah, daß sie sich selber leid tat und vor allem ihre plötzliche Eingebung bedauerte, die beiden auf ein Täßchen Tee zu sich einzuladen.
In einem Gebäude hinter einem Gemüsegarten, ein Stück weit vom Haus entfernt, unterhielt Anne eine Armenküche. Ich wußte, sie hatte versprochen, jeden Abend um halb sieben dort zu sein und, wann immer möglich, auszuhelfen. Mühsam setzte sie dies den Ringer-Smiths auseinander. »… andernfalls würde ich Ihnen das Haus mit dem größten Vergnügen zeigen – nicht, daß es viel zu sehen gibt.«
»Eine Armenküche!« rief Jake aus. »Dürfen wir uns mitanstellen, um ein Schälchen Suppe? Danach können wir unsere Schlafsäcke vielleicht unter einem Ihrer reizenden Torbögen ausbreiten und morgen das Haus besichtigen.«
Hört sich das wie ein Alptraum an? Es war ein Alptraum. Diese Leute ließen sich durch nichts abwimmeln.
Als ich an diesem Abend unten in der Armenküche Brot- und Käsescheiben sowie Schälchen mit Tomatensuppe austeilte, war ich nicht weiter überrascht, als ich die Ringer-Smiths auftauchen sah.
»Wir gehören zu den unteren Ständen«, sagte er zu mir mit einem übertrieben unterwürfigen Grinsen, welches bedeutete: »Wir gehören durchaus nicht zu den unteren Ständen, sehen Sie nur, wie distinguiert wir in Wahrheit sind – wir scheren uns nicht darum, wie wir aussehen oder welchen Umgang wir pflegen. Wir sind wir.«
Dabei wirkten sie unter all den echten ausgemergelten Pennern, den langhaarigen Aussteigern und dickbäuchigen Stadtstreicherinnen ausgesprochen zwielichtig. Ohne zu lächeln, teilte ich ihnen ihre Portionen zu. Sie hatten den letzten Bus verpaßt. Wohl oder übel würden Anne und Monty ihnen für die Nacht ein Schlafzimmer zur Verfügung stellen. Ich hörte sie schon zu ihren Freunden sagen: »Wir haben im Château Leclaire de Martineau bei Dijon genächtigt!«
Vor dem Frühstück gab ich Anne und Monty den Ratschlag, sich rar zu machen. »Sonst werdet ihr sie nie los«, sagte ich. »Überlaßt sie nur mir.«
»Ich bin sicher«, sagte Marion, »daß ich Anne schon einmal begegnet bin. Aber ich weiß nicht mehr, wo.«
»Sie hat in vielen Häusern als Köchin gedient«, sagte ich. »Und Monty ist Butler gewesen.«
»Eine Köchin und ein Butler?« fragte Jake.
»Ja, die Herrschaften sind zur Zeit außer Haus.«
»Aber sie hat mir doch gesagt, sie sei die Besitzerin«, sagte Marion und wies mit dem Kopf zur Eßzimmertür.
»O nein, da irren Sie sich.«
»Aber ich bin mir sicher, daß sie gesagt …«
»Durchaus nicht«, sagte ich. »Wie schade, daß Sie sich im Château nicht umschauen können. Wunderbare Gemälde. Aber die Comtesse kann jeden Augenblick zurückkommen. Ich weiß nicht, wie Sie sich erklären wollen. Soviel ich weiß, sind Sie nicht eingeladen.«
»O doch«, versetzte Jake. »Die Hausangestellten haben uns geradezu angefleht dazubleiben. Typisch, sich als die Herrschaften selbst auszugeben! Aber es wird spät, wir verpassen noch den Bus.«
Binnen vier Minuten waren sie auf und davon und stapften mit ihren prall gefüllten Rucksäcken die Auffahrt hinab.
Anne und Monty waren hocherfreut, als ich ihnen erzählte, wie ich vorgegangen war. Anne war überzeugt, daß die Eindringlinge, früheren Erfahrungen nach zu urteilen, vorgehabt hatten, eine ganze Woche zu bleiben.
»Wie sonst kann man mit solchen Leuten verfahren?« fragte sie.
»Ich kann sie in einer Geschichte unterbringen«, antwortete ich. »Und die Geschichte verkaufen.«
»Könnten sie dich nicht verklagen?«
»Laß sie doch«, sagte ich. »Sollen sie ruhig vor Gericht ziehen und sagen: Ja, das waren wir.«
»Ein exzentrisches Paar. Sie haben die Seife mitgenommen«, sagte Anne.
Lächelnd ging Monty seiner Arbeit nach. Anne ebenfalls. Und ich nicht minder. Vermeinte ich jedenfalls.
Es war halb zwölf, zwei Stunden später, als ich, wie ich es oft tue, wenn ich an einem Roman arbeite, aus dem Fenster meines Zimmers schaute. Da sah ich sie wieder unter einem der Bäume, die den Rasen säumten. Sie spähten zum Haus herüber.
Ich hatte keine Ahnung, wo Monty und Anne sich in diesem Augenblick aufhielten, und wußte auch nicht, wie ich Raoul, den Gutsverwalter, oder seine Frau Marie-Louise aufspüren sollte. Es störte zwar meinen morgendlichen Arbeitsrhythmus, doch ich beschloß, hinunterzugehen und nachzuschauen, was es mit der Sache auf sich hatte. Sobald sie mich sahen, sagte Marion: »Oh, hallo. Wir sind zu dem Schluß gekommen, daß es unhöflich von uns war, aufzubrechen, ohne die Dame des Hauses zu sehen und unsere Aufwartung zu machen.«
»Wir warten, bis die Comtesse zurückkehrt«, erklärte Jake.
»Das trifft sich schlecht«, sagte ich. »Ich glaube, sie hat gerade die Nachricht hinterlassen, daß sie eine Woche lang wegbleiben wird.«
»Das ist schon in Ordnung«, entgegnete Marion. »Eine Woche können wir erübrigen.«
»Ein Gebot der Höflichkeit …«, sagte Jake.
Es gelang mir, Anne zu warnen, bevor sie sie zu Gesicht bekam. Als sie schließlich vor die beiden hintrat, waren sie sehr kühl zu ihr. »Die Comtesse wäre gewiß gekränkt, wenn wir ohne ein Wort des Dankes abreisen würden«, sagte Jake.
»Keineswegs«, erwiderte Anne. »Sie müssen sogar abreisen.«
»Nicht doch«, sagte Marion.
Raoul, im Verein mit Monty, nahm sich ihrer an. Marion hatte ihr Schlafzimmer bereits wieder für sich reklamiert. »Da die Betten ohnedies frisch bezogen werden mußten«, sagte sie, »können wir ebensogut bleiben. Wir haben nichts dagegen, unten im Schuppen zu essen.« Damit meinte sie die Armenküche. »Wir sind uns nicht zu gut dafür, mit dem Proletariat zu speisen«, sagte Jake.
Raoul und ich durchsuchten sämtliche Schubladen im Haus nach einem Schlüssel zur Schlafzimmertür. Endlich fanden wir einen, der paßte, und es gelang uns, sie auszusperren. Monty bemächtigte sich ihrer Rucksäcke und setzte sie vor den Toren des Châteaus ab. All das ging vonstatten, während sie sich in der Armenküche verköstigten. Wir traten ihnen zu fünft entgegen (Marie-Louise hatte sich zu uns gesellt) und teilten ihnen mit, was wir getan hatten.
Was danach aus ihnen geworden ist, weiß keiner von uns genau. Wir wissen nur, daß sie noch einmal vorbeikamen, um ihre Rucksäcke abzuholen, und feststellen mußten, daß der Gutsverwalter sie ausgesperrt hatte. Anne erhielt einen korrekt an sie als Comtesse adressierten Brief von Jake, in dem er sich empört über die Behandlung beschwerte, die ihm die »Bediensteten« hatten zuteil werden lassen.
»Ich wußte gleich, daß ich ihre Einladung nicht hätte annehmen dürfen«, schrieb Jake. »Ich wußte instinktiv, daß sie nicht zu unsereinem gehören. Ich hätte meinem Instinkt folgen sollen. Entsetzliche Snobs – solche Leute.«
Der hängende Richter
D