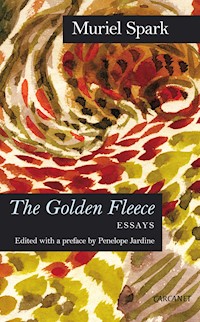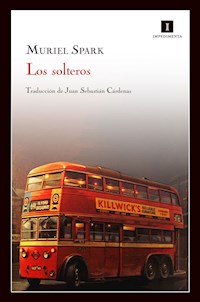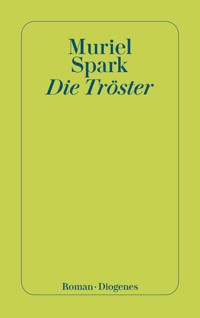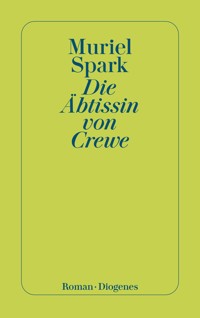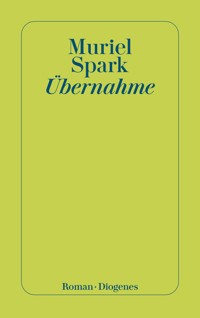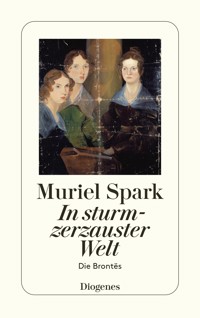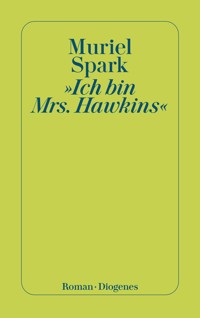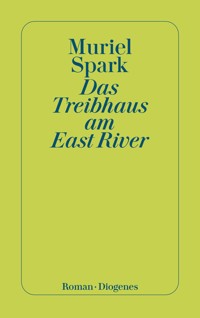6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es gab drei Überlebende bei der Flugzeugkatastrophe. Die Lissabon-Maschine war über Robinsons kleiner vulkanischer Insel abgestürzt, tausend Meilen fern von jeder Zivilisation. Robinson führte dort ein Einsiedlerleben. Während die drei Überlebenden gesundgepflegt werden, zeichnen sich nach und nach ihre verschiedenen Charaktere immer deutlicher ab, was zu verhängnisvollen Konflikten führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Muriel Spark
Robinson
Roman
Aus dem Englischen von Elizabeth Gilbert
Diogenes
Erstes Kapitel
Wenn Sie mich fragen, welche Erinnerungen ich an die Insel habe und was für ein Gefühl es war, infolge eines Missgeschicks fast drei Monate lang dort gestrandet gewesen zu sein, würde ich darauf antworten, dass diese Zeit und diese Landschaft nur Hirngespinste gewesen seien, hätte ich nicht deutliche Beweise dafür, mir ihre Realität vor Augen zu führen: Mein Tagebuch, die Katze, die Zeitungsausschnitte, die neugierige Anteilnahme meiner Freunde und meiner Schwestern – wie die mich immer ansehen, denke ich bei mir, als sei ich von den Toten auferstanden.
Sicher haben Sie in den Zeitungen über diesen Fall gelesen, in denen auch einige Flugaufnahmen von der Insel abgebildet waren, die, als ich sie später zu sehen bekam, nur schwer als der Schauplatz aller Vorkommnisse wiederzuerkennen war, von denen ich Ihnen im folgenden erzählen will. Und zwar ist es vor allem das Tagebuch, auf das ich mich dabei stütze. Es ruft mir lebhaft wieder das Spiel der Gedanken und Kräfte hinter den dort verzeichneten Fakten ins Gedächtnis zurück. Durch mein Tagebuch wäre ich beinahe ums Leben gekommen.
Drei von uns wurden aus dem brennenden Flugzeug geschleudert, als es auf Robinsons Insel abstürzte. Wir waren die einzigen Überlebenden von neunundzwanzig Passagieren, einschliesslich der Besatzung, und waren, wie Sie wissen, längst aufgegeben, bis wir plötzlich zwei Monate und neunundzwanzig Tage später aufgefunden wurden. Ich hatte eine Gehirnerschütterung und eine verrenkte linke Schulter. Jimmie Waterford kam mit ein paar Schnittwunden und Prellungen davon. Tom Wells hatte die Rippen gebrochen. Meine Genesung machte schnelle Fortschritte, und ich war noch keine zehn Tage auf der Insel, als ich in einem etwas feuchten Schulheft, das mir Robinson zu diesem Zwecke gegeben hatte, mit meinen Tagebuchaufzeichnungen begann. Wie ich sehe, habe ich als erstes meinen Namen, den Ort und das Datum folgendermassen eingetragen:
JANUARY MARLOW,
Robinson
20. Mai 1954
Ich heisse January, weil ich im Januar geboren bin. Ich möchte hiermit feststellen, dass ich niemals Jan genannt worden bin, obgleich verschiedene Sonntagsblätter diesen Namen in ihren Schlagzeilen verwendet haben, als die Nachricht durchkam, dass wir aufgefunden worden seien.
Robinson glaubte damals, ein Tagebuch zu führen wäre eine geistige Beschäftigung für mich, und ich stellte mir vor, ich könnte es vielleicht später mal in einen Roman umarbeiten. Das war höchst unvorsichtig, wie sich herausstellen sollte; denn ich konnte damals noch nicht voraussehen, auf welche Weise mir das Tagebuch zum Verhängnis und beinahe die Ursache meines Todes werden sollte, nachdem ich die Flugzeugkatastrophe glücklich überlebt hatte.
Manchmal bin ich mir über die Einzelheiten der vergangenen Tage nicht ganz klar, bis irgendein Wort oder ein Gegenstand, fast wie eine Eingebung, meine Erinnerung berührt, und plötzlich kommt die Vergangenheit über mich, als wandle ein Engel über unser Grab, wie man sagt, und ich stehe in der Vergangenheit wie im Lichtkegel eines Scheinwerfers.
Als ich ganz kürzlich wieder einmal in meinem Inseltagebuch blätterte, stiess ich auf die Worte »Robinson hat uns auf seinem Grammophon Rossini vorgespielt«. In diesem Augenblick fiel mir nicht nur Robinsons Leidenschaft für Rossini wieder ein, sondern auch alles, was mir an jenem Abend durch den Sinn ging. Das war am fünfundzwanzigsten Juni gewesen, kurze Zeit, bevor Robinson verschwand. Ich erinnere mich, in jener Nacht – es war meine siebente Woche auf der Insel – trat ich aus Robinsons Haus und kletterte den Bergpfad zwischen den blauen Gummibäumen zur Küste hinunter. Es war eine warme, nebellose, vom Mondlicht erfüllte Nacht. Ein Verlangen erfasste mich, weit meine Arme auszubreiten und den Mond anzubeten. »Aber«, dachte ich bei mir, »ich bin doch eine Christin.« Dennoch hatte ich dieses süsse und zugleich schreckliche Verlangen nach dem Mond, und ich kehrte leicht verstört ins Haus zurück.
Als ich in jener Nacht schlaflos auf meiner Matratze lag, erinnerte ich mich, dass meine Grossmutter aus Hertfordshire einen kurzen Vers an den Neumond herzusagen pflegte, ganz gleich, wo sie sich gerade befand und wie belebt die Strasse auch sein mochte. Ich sah sie, und ich sehe sie auch heute noch vor mir, wie sie auf dem Wege beiseite trat, ganz in den Anblick der blassen Mondsichel am dunkler werdenden nördlichen Himmel versunken:
Neumond, Neumond, mir gnädig sei,
Und bring mir Geschenke, eins, zwei, drei.
Dann verneigte sie sich dreimal. »Eins«, wiederholte sie. »Zwei. Drei.« Als Kind habe ich mich immer geniert, wenn ich zufällig bei Neumond mit ihr unterwegs war. Ich hatte die entsetzliche Vorstellung, dass jeden Augenblick eine meiner Schulfreundinnen zufällig vorbeikommen und mich vielleicht mit diesem seltsamen Getue in Zusammenhang bringen könnte. Ich bin etwas vom Thema abgekommen, aber mir ist noch immer ein bisschen unheimlich zumute bei der Erinnerung, wie ich zwischen den hohen blauen Gummibäumen und schlafenden Bougainvilleas, das Rauschen des Meeres in den Ohren, plötzlich den unwiderstehlichen Wunsch empfunden hatte, den Mond anzubeten. Ich war die einzige Frau auf der Insel, und man sagt ja, dass das heidnische Element bei den Frauen sowieso schon sehr stark entwickelt sei, geschweige denn auf einer Insel, und dann noch auf einer solchen Insel. Und zwar denke ich dabei nicht nur an den Mond und meine seltsame Reaktion. Ich sehe erst jetzt, wie überhaupt alle meine Wahrnehmungen während dieser ganzen Periode durch atavistische Rudimente bestimmt wurden. Das war eine Entrücktheit, eine primitive Triebhaftigkeit, die uns anscheinend alle erfasst hatte.
Manchmal sagen Leute zu mir: »Hättest du doch bloss diese Reise nicht gemacht …«, »So ein Pech, dass du nicht das frühere Flugzeug erwischt hast …« oder »Wenn man sich vorstellt, dass du beinahe mit dem Schiff gefahren wärst!«
Ich neige sehr dazu, die Einstellung zurückzuweisen, die sich hinter solchen Bemerkungen verbirgt; genauso, wie ich die Einstellung zurückweise, es sei am besten, gar nicht erst geboren zu werden.
Das Flugzeug stürzte am 10. Mai 1954 ab. Sein ursprüngliches Reiseziel waren die Azoren gewesen, aber im Nebel hatte es den Flughafen von Santa Maria verfehlt. Ich wachte am Rande eines blaugrünen Bergsees auf, und mein erster Gedanke war: »Der Bananenfrachter muss Schiffbruch erlitten haben.« Dann fiel ich wieder in Ohnmacht.
Ich hätte tatsächlich beinahe einen Bananendampfer genommen, der nach Westindien bestimmt war und auf den Azoren anlegen sollte. Aber nach und nach war ich durch meine Freunde immer mehr davon abgekommen, nachdem wir uns nämlich die verschiedenen indischen, dänischen und irischen Frachter angesehen hatten, die in den Ostindiendocks herumlagen. So kam es, dass ich in meinen Träumen noch auf dem Bananenfrachter war, während ich mich doch zum Schluss für die teure Flugstrecke über Lissabon entschieden hatte.
Als ich zum zweiten Mal zu mir kam, geschah es in Robinsons Haus. Ich lag auf einer Matratze am Boden, und als ich mich bewegte, fühlte ich einen entsetzlichen Schmerz in der Schulter. Mir gegenüber sah ich durch eine halbgeöffnete Tür im milchigen Sonnenlicht einen Zipfel des blaugrünen Sees. Wir schienen uns ziemlich weit oben an einem Berghang zu befinden.
Ich hörte, dass sich in einem Nebenzimmer links von mir jemand bewegte. Kurz darauf hörte ich zwei Männerstimmen.
»Hallo«, rief ich laut. Die Stimmen verstummten. Die eine der beiden murmelte etwas.
Gleich darauf öffnete sich links von mir eine Tür. Ich versuchte mich umzudrehen. Das tat aber furchtbar weh, und ich wartete, während ein Mann ins Zimmer trat und zu mir herum kam.
»Wo bin ich eigentlich?«
»Robinson«, sagte er.
»Wo?«
»Robinson.«
Er war klein und vierschrötig, hatte ein braunes Gesicht und graumeliertes Haar.
»Robinson«, wiederholte er. »Im Nordatlantik. Wie fühlen Sie sich?«
»Wer sind Sie?«
»Robinson«, sagte er. »Wie fühlen Sie sich?«
»Wer?«
»Robinson.«
»Ich scheine eine Gehirnerschütterung zuhaben«, sagte ich.
»Ich bin froh, dass Sie das annehmen«, meinte er. »Es stimmt nämlich. Zu merken, dass man eine Gehirnerschütterung hat, wenn man sie tatsächlich hat, bedeutet schon ein Drittel der Heilung. Man sieht, Sie sind intelligent.«
Als ich das hörte, war ich überzeugt, dass ich Robinson gern hatte, und wollte weiterschlafen. Er rüttelte mich wach und setzte einen Becher mit einer warmen, scharfriechenden Milch an meine Lippen. Während ich sie gierig trank, sagte er zu mir:
»Schlaf ist das zweite Drittel der Heilung, und das restliche Drittel besteht in der Nahrung.«
»Die Schulter tut mir so weh«, sagte ich.
»Welche Schulter?«
Ich berührte meine linke Schulter. Sie war fest einbandagiert.
»Welche Schulter?« fragte er.
»Diese«, sagte ich, »sie ist doch bandagiert.«
»Welche Schulter? Zeigen Sie nicht. Denken Sie nach. Bezeichnen Sie sie genauer.«
Ich überlegte angestrengt. »Meine linke Schulter«, sagte ich kurz darauf.
»Stimmt. Sie werden bald wieder in Ordnung sein.«
Eine kleine weichhaarige, blaugraue Katze kam und setzte sich in die Türöffnung. Sie schielte zu mir herüber, während mir die Augen zufielen.
Das war zwanzig Stunden nach dem Absturz gewesen. Als ich wieder erwachte, war es dunkel, und ich hatte Angst.
»Hallo!« rief ich laut.
Keine Antwort. Darum rief ich nach ein paar Minuten noch einmal: »Hallo, Robinson!«
Etwas Weiches, Lebendiges sprang mir auf die Brust. Ich schrie auf und fuhr in die Höhe, trotz der Schmerzen, die mir die Bewegung in meiner Schulter verursachte. Meine Hand fühlte das weiche Fell, als die Katze von der Matratze heruntersprang.
Robinson kam mit einer Petroleumlampe ins Zimmer und sah bei ihrem Schein neugierig auf mich herunter.
»Ich dachte, es sei eine Ratte«, sagte ich, »aber es war nur die Katze.«
Er stellte die Lampe auf einen polierten Tisch. »Hatten Sie Angst?« sagte er.
»Ach, ich bin sonst eigentlich ziemlich couragiert. Aber erst diese Dunkelheit und dann die Katze – ich dachte schon, es sei eine Ratte.«
Er beugte sich hinunter und streichelte die Katze, die buckelnd um seine Beine herumstrich. »Sie heisst Bluebell, Glockenblume«, sagte er und ging hinaus.
Ich hörte ihn draussen herumhantieren, und schon war er wieder da, mit einer heissen, scharfgewürzten Suppe. Er sah müde aus und seufzte leise, als er sie mir gab.
»Wie heissen Sie?« fragte er.
»January Marlow.«
»Denken Sie nach«, sagte er, »versuchen Sie zu denken.«
»Woran soll ich denn denken?«
»Wie Sie heissen.«
»January Marlow«, sagte ich und stellte den Becher mit der Suppe neben mich auf den Fussboden.
Er nahm den Becher auf und gab ihn mir in die rechte Hand.
»Trinken Sie die Suppe und denken Sie dabei nach. Sie haben mir Ihren Geburtsmonat und Ihren Geburtsort genannt. Wie heissen Sie?«
Ich war sehr froh über seinen Irrtum, denn das machte mich sicherer.
»Ich habe den ausgefallenen Namen January bekommen, weil ich im Januar geboren –«
Er begriff sofort. »Ach so, natürlich, ich verstehe.«
»Sie haben wohl gedacht, das sei die Gehirnerschütterung«, sagte ich.
Er lächelte ein bisschen.
Plötzlich sagte ich: »Es muss etwas passiert sein. Ich war doch in diesem Lissabon-Flugzeug.«
Ich trank die Brühe und versuchte inzwischen, mir darüber klarzuwerden, was diese Feststellung enthielt.
»Denken Sie nicht zu angestrengt nach«, sagte Robinson. »Lassen Sie sich Zeit.«
»Ich erinnere mich an das Lissabon-Flugzeug«, fuhr ich fort.
»Waren Sie mit Freunden oder Verwandten?«
Die Antwort darauf wusste ich. »Nein«, sagte ich sofort mit ziemlich lauter Stimme.
Robinson stand schweigend da und seufzte.
»Aber ich muss gleich morgen früh nach London telegraphieren«, sagte ich.
»Auf Robinson gibt es kein Postamt. Es ist ja nur eine ganz kleine Insel.«
Ich muss sehr entsetzt ausgesehen haben, denn er fügte hinzu: »Sie sind ausser Gefahr. Ich glaube, Sie werden morgen aufstehenkönnen. Dann werden Sie sehen, was passiert ist.«
Er nahm mir den leeren Becher ab und setzte sich in einen hohen Korbstuhl. Die Katze sprang auf seinen Schoss. »Bluebell«, murmelte er ihr leise zu. Ich lag da und starrte vor mich hin. Teils war ich noch schlafsüchtig, und es fiel mir schwer, einen Gedanken festzuhalten und ihn in Worte zu fassen. Schliesslich sagte ich: »Könnten Sie mir vielleicht sagen, ob hier irgendwo eine Pflegerin oder sonst eine Frau zu bekommen ist?«
Er sah mich mit vorgestrecktem Kopf an, als wolle er meine Aufmerksamkeit erzwingen. »Das dürfte Ihnen sehr schwer fallen. Es gibt gar keine Frauen auf der Insel. Aber es macht mir wirklich nicht das geringste aus, Sie zu pflegen. Es ist ja sowieso nur für kurze Zeit. Ausserdem ist es notwendig.« Er setzte die Katze auf den Boden. »Betrachten Sie mich einfach als so etwas wie Ihren Arzt.«
Eine Männerstimme rief aus dem Innern des Hauses.
»Das ist einer der anderen Patienten«, sagte Robinson.
»Wie viele sind … in dem Unglück? – Wie viele?«
»Ich komme gleich wieder«, sagte er.
»Er sieht erschöpft aus«, dachte ich bei mir, während er sich aus meinem Blickfeld entfernte. Bluebell machte einen Buckel und stakte steifbeinig auf meine Matratze, rollte sich zusammen und fing an zu schnurren.
Wir waren auf zirka sechzehnhundert Kilometer im Umkreis von jeder Verbindung mit der Aussenwelt abgeschnitten. Ich glaube, ich litt noch unter den Nachwirkungen der Gehirnerschütterung, als ich am vierten Tage nach dem Absturz morgens aufstand. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich alle Einzelheiten von Robinsons Haushalt in mich aufgenommen hatte, und erst eine Woche später begann ich, mir über seinen eigenartigen Hang zu dieser völligen Isolierung Gedanken zu machen.
Unterdessen war die Hoffnung auf unsere unmittelbare Befreiung zunichte geworden. Viele von Ihnen werden sich noch erinnern, dass alles im und um den Atlantik unseretwegen alarmiert worden war, wie Militär- und Verkehrsflugzeuge nach uns fahndeten und alle Schiffe an der Suchaktion nach Überlebenden oder Teilen des Wracks teilnahmen. Inzwischen sassen wir mit den Trümmern und den Toten auf Robinson. Als das erste Erkundungsflugzeug kurz nach dem Absturz über die Insel flog, war Nebel gewesen. Jede Nacht setzte Robinson Notsignale in Brand; doch als die Rettungsexpedition zwei Nächte später wiederkam, hatte ein Wolkenbruch die Flammen erstickt. Beide Male hatte sich der Flieger schnellstens wieder davongemacht, aus Angst vor unserem Berg. Es blieb uns also nichts weiter übrig, als auf den Granatapfeldampfer im August zu warten.
Mein linker Arm schmerzte in der Schlinge, als ich mich, wie betäubt, von meinem Lager auf dem Fussboden erhob. Aber schwindlig, wie ich war, musste ich auf Robinsons Anordnung sofort die Pflege von Tom Wells übernehmen, der mit gebrochenen Rippen in einem ganz festen, korsettähnlichen Verband dalag, den Robinson erfunden und geschickt aus Segeltuchstreifen fabriziert hatte. Sie waren diagonal vom Rücken nach vorn um den Körper gewickelt, wobei jeder Streifen den darunterliegenden zu zwei Dritteln deckte. Robinson erklärte mir das Anlegen dieses Verbandes sehr genau, bevor er mir im selben Atemzug sagte, ich dürfe ihn aber dem Patienten unter keinen Umständen abnehmen. Mein Dienst dauerte von acht Uhr morgens bis drei Uhr nachmittags; dann löste Robinson mich ab.
Ein langer, dünner Mann, dessen Kopf kunstgerecht verbunden war, hatte den Nachtdienst, und ich glaube, auch er wurde während der Nacht von Robinson abgelöst, so dass immer jemand in Bereitschaft war, wenn Tom Wells etwas brauchte.
Robinson hatte mich mit dem grossen Mann bekannt gemacht. Ich entsinne mich, dass er mich immer »Miss January« nannte, aber ich hatte seinen Namen nicht verstanden, obwohl mir der Mann bekannt vorkam. In jenen ersten Tagen hatte ich Robinson einige Male gefragt: »Wer ist denn der andere Pfleger? Wie heisst er?« Aber eine volle Woche verging, bevor ich seinen Namen, Jimmie Waterford, behalten konnte. Dieser Jimmie war reizend zu mir. So, als hätten wir uns früher schon gekannt. Erst nach einer ganzen Weile erinnerte ich mich plötzlich, dass ich ihn ja im Lissabon-Flugzeug kennengelernt hatte. Das einsilbige »Tom Wells« hingegen war mir sofort im Gedächtnis haften geblieben.
Ungefähr zur gleichen Zeit bemerkte ich einen kleinen, mageren Jungen, schätzungsweise neun Jahre alt, sehr braun und mit grossen Augen. Ich hatte ihn bereits gesehen, als ich zum ersten Mal aufgestanden war, hatte aber tagelang nicht bewusst von ihm Notiz genommen. Er folgte Robinson auf Schritt und Tritt. Er hatte gewisse Pflichten, wie kleine Vorräte von Feuerholz ins Haus zu schaffen und Tee zu kochen. Sein Name war Miguel.
Jeden Morgen pflegte Robinson mir gewisse Anweisungen zu geben. Ich befolgte sie mit peinlicher Genauigkeit, wie jemand, der nicht ganz bei sich und unfähig ist, nach Gründen zu fragen. In der Zwischenzeit verschwanden Robinson und der grosse Mann zusammen gewöhnlich auf zwei, drei Stunden.
Tom Wells war ein schwieriger Patient, ganz abgesehen davon, dass er der am schwersten Verletzte war. Fast den ganzen Tag stöhnte er oder gab irgendwelche Laute von sich, trotz der Injektionen, die ihm Robinson gab. Er schien unsere Lage erfasst zu haben und war in Wirklichkeit klarer bei Bewusstsein als ich zu jener Zeit. Ich war von jeher gegen Krankenpfleger, die keinerlei Gejammer von ihren Patienten hören wollen. Aber ich merkte, wie ich selber immer gereizter und strenger mit Tom Wells wurde, weil er sich so gehenliess. Robinson lächelte nur in seiner müden Art, wenn er zufällig hörte, wie ich mit diesem Mann umging: »Hören Sie endlich auf zu stöhnen!«, »Nehmen Sie sich gefälligst zusammen!«, »Trinken Sie das jetzt!« und so weiter. Und das alles, noch bevor mir meine neue Umgebung auch nur halbwegs bewusst geworden war. Mit unmenschlicher Gleichgültigkeit nahm ich zur Kenntnis, dass ein Unglück passiert war. Ich hatte begriffen, dass es an einem Ort geschehen war, der unter Robinsons Obhut stand, und dass ich mich zu gewissen Zeiten um Tom Wells zu kümmern hatte.
Genau eine Woche nach dem Unglück sagte Robinson beim Frühstück zu mir: »Versuchen Sie bitte so wenig zu essen wie möglich. Unsere Lebensmittel bestehen grösstenteils aus Konserven, und mit Gästen hatte ich nicht gerechnet.«
Da fiel mir überhaupt erst auf, dass ich ass. Robinson hatte die Mahlzeiten zubereitet, und ich hatte sie, wie ich jetzt annehmen musste, gegessen. Ich sah meinen Teller vor mir auf dem runden hellen Holztisch stehen. Gerade hatte ich eine Portion gelblicher Bohnen verzehrt. Neben meinem Teller lag noch ein halber von den dicken, harten, ganz trockenen Keksen, die ich, wie ich mich jetzt erinnerte, während der vergangenen paar Tage immer in starken, heissen Tee getunkt hatte.
Danach sah ich alles viel bewusster. Als ich anfing, unabhängig von Robinson zu handeln, schien er erleichtert aufzuatmen. Und zwei Tage später gab er mir dann das Schulheft als Tagebuch.
Ich sehnte mich danach, wieder zu Hause zu sein und mit Agnes und Julia herumzualbern, wenn sie an kalten Nachmittagen zum Tee zu mir kamen. Uns über die blödesten Kindheitserinnerungen halb totzulachen, war das Hauptvergnügen für mich und meine Schwestern. Und wie wunderte ich mich dann hinterher immer über meine eigene Infantilität!
Aber dennoch machten mir diese kindischen Zusammenkünfte in solchen Momenten einen Heidenspass. Nach meinem Ausrücken von zu Hause noch als Schulmädchen, der Geburt meines Sohnes und meiner Witwenschaft im selben Jahr war es eine Zeitlang zu einer Entfremdung zwischen mir und meinen Schwestern gekommen, und zwar von Agnes aus, weil sie die Älteste, plump und noch unverheiratet war und mir mein Abenteuer missgönnte. Sie führte unserer Grossmutter den Haushalt. Als Grossmutter starb, heiratete Agnes Grossmutters Arzt, heiratete also letzten Endes doch noch. Wir freundeten uns wieder an, soweit man mit Agnes befreundet sein kann, die obendrein auch noch beim Essen schmatzt.
Julia, meine jüngere Schwester, ging noch zur Schule, als ich daraus wegrannte, um zu heiraten. Sechs Monate später war mein Mann tot. Ich versuchte, mich Julias anzunehmen, die ein grosses, hübsches Mädchen war. Aber sie galt als leichtsinnig, und war es meiner Meinung nach auch. »Julia hat tatsächlich weiter nichts im Kopf als Männer, Männer, Männer«, sagte ich eines Tages zu Agnes.
»Ach, halt doch den Mund«, sagte Agnes.
Jahre später heiratete Julia einen Buchmacher.
Sie wurden nur standesamtlich getraut. Ich war nicht eingeladen. Den Buchmacher hatte ich auf Grossmutters Beerdigung gesehen und ihn zuerst für den Leichenbestatter gehalten.
»Du«, hatte ich Agnes zugeflüstert, »ich habe ihn für den Leichenbestatter gehalten.«
»Ach, halt doch den Mund«, hatte Agnes gesagt. Sie hatte mir damals nicht erzählt, dass sie beabsichtigte, einen Monat später den Doktor zu heiraten.
Danach hatten wir uns langsam wieder versöhnt, und Julia und Agnes kamen oft zum Tee zu mir, obwohl ich sie fast nie besuchte. Agnes wohnte in Chiswick und Julia in Wimbledon, und von Chelsea dort hinzukommen, ist furchtbar umständlich. Wir hatten bald herausgefunden, dass uns im Grunde nur eins verband: unsere Kindheit. Wir kicherten und lachten zusammen, bis kurz vor sechs, wenn mein Sohn Brian mit hochroten Wangen vom Spielen in der Schule nach Hause kam. Meine Schwestern gingen nie weg, ohne ihn gesehen zu haben. Ich bildete mir ein, sie beneideten mich um Brian, denn die Jahre vergingen, und beide blieben kinderlos.
Als ich damals als Schulmädchen von zu Hause ausgerückt war und Brian geboren wurde, hatte Agnes keinerlei Interesse für das Kind gezeigt. Ihre Neugierde galt vielmehr meiner Person. »Du bist eigentlich noch viel zu jung für derartige Dummheiten«, sagte sie damals im Vollgefühl ihrer bevorzugten Stellung als Besucherin im Entbindungsheim – nämlich sie in der Senkrechten und ich in der Horizontalen. »Es hiess doch immer, du seist so klug«, sagte sie.
Aber als sie dann Brian in späteren Jahren sahen, waren meine beiden Schwestern, glaube ich, vom Fehlen jeglicher Anormalität ganz überrascht. Irgendwie hatten sie sich vorgestellt, das Kind eines so jungen Mädchens könne einfach nicht normal sein.
»Mein Gott«, sagte Julia nach der Beerdigung, »was sagt man bloss zu Januarys Buben. Das ist ja ein richtiger Junge!«
Dabei hatten sie Brians phantastische Begabung, mit Menschen umzugehen, noch nicht einmal entdeckt. Diese Seite seiner Persönlichkeit war nämlich bei ihm bereits im ganz jugendlichen Alter, weit über seine Jahre hinaus, entwickelt.
»Mein Gott«, sagte Julia, »der hat ja einen Charme!«
Ich habe mich oft gefragt, ob Agnes und Julia im Grunde gar nicht mich, sondern Brian besuchten, dass sie diese lange, umständliche Fahrerei von Chiswick und Wimbledon so klaglos auf sich nahmen, dazu noch an kalten Nachmittagen. Sogar als ich während der ersten Phase meines Konfessionswechsels versuchte, auch meine Schwestern zu bekehren, liessen sie sich dadurch nicht abschrecken zu kommen.
Der Flächeninhalt von Robinson beträgt nur etwas über zweihundertsiebzehn Quadratkilometer, falls man etwas mit Quadrat bezeichnen kann, das sich in derartig merkwürdigen Windungen erstreckt. Robinson hat die Insel vor fünfzehn Jahren von einem Portugiesen gekauft und sich nach dem Kriege dort niedergelassen. Vorher hiess sie Ferreira. Robinson hat mir einen Plan davon gezeigt. Wenn man ihn so dreht, dass der östliche Teil der Insel nach oben zeigt, ähnelt sie einem menschlichen Körper. Sie hat verschiedene Halbinseln, die Robinson den Nord- und den Südarm und das Nord- und das Südbein nennt. Robinsons Haus liegt auf einem Plateau, etwa dreihundert Meter über dem Meer. Der Berg ist vulkanisch. Auf seinem Gipfel gibt es nichts als Asche und Lava. Aber Robinson sagt, beim Abstieg käme man durch alle bekannten Vegetationsgürtel. Robinson hat sich da oben mal den Fuss verstaucht, weil er in einem Büschel Heidekraut hängengeblieben war. Im Juli ist das obere Drittel des Berges mit blühendem Thymian bedeckt. Alle diese Einzelheiten habe ich von Robinson. Er hat mir dieses Heft gegeben und dabei zu mir gesagt: »Halten Sie sich an Tatsachen, das ist die gesündeste Methode.« Ich bin immer müde.
Während ich mir jetzt so die zerknitterte Seite meiner ersten Tagebucheintragung ansehe, fällt mir ein, dass die Idee, so klein zu schreiben und keine Absätze zu machen, von Robinson stammte, um Papier zu sparen. Trotzdem hat das Schreibheft nicht bis zum Ende meines Aufenthaltes auf der Insel ausgereicht. Ich musste zum Schluss noch lose Blätter dazu nehmen, die ich auf Robinsons Schreibtisch fand.
Ich erinnere mich, dass Robinson mir mehr als einmal riet: »Halten Sie sich nur an Tatsachen!« Er hatte mich dringend davor gewarnt, in der Hoffnung auf ein Schiff oder ein Flugzeug aufs Meer hinaus oder in den Himmel hinaufzustarren – eine sehr deprimierende Gewohnheit, wie er es nannte. In jenen ersten Wochen konnte ich meine Blicke kaum von Meer und Himmel losreissen, obgleich der Dampfer, der Robinsons Proviant bringen und die Granatäpfel abholen sollte, nicht vor der zweiten Augustwoche fällig war. Ich war hinter Robinson her gewesen, wegen der Möglichkeit, einen Radiosender zu bauen. Er sagte, dazu fehle das Material. Als ich meine erste Eintragung niederschrieb, dachte ich: »Jetzt wird Brian mich bestimmt schon für tot halten.« Aber das habe ich nicht hingeschrieben, weil ich ja nicht wusste, ob es den Tatsachen entsprach.
Zweites Kapitel
Robinsons Haus stammte aus dem frühen neunzehnten Jahrhundert und war in einem noch früheren spanischen Stil gebaut. Es war ein einstöckiges Steinhaus, das auf einer breiten, natürlichen Bergterrasse lag. Ringsherum zog sich eine niedrige Mauer. Dahinter konnte ich morgens von meinem Zimmer aus den blaugrünen See sehen, falls kein Nebel war. Während der ersten vierzehn Tage wagte ich mich nicht weiter weg als bis zu dem grossen, geschweiften, schmiedeeisernen Tor. Hingegen ging ich, als mein Kopf schon etwas klarer war, und wenn ich Tom Wells versorgt hatte, in dem kleinen verwahrlosten Garten spazieren; oder ich sass im vernachlässigten Innenhof, rieb mir die verletzte Schulter und blickte unverwandt zum Springbrunnen hinüber, der nicht plätscherte.
Die meisten Zimmer waren anscheinend schon seit Monaten nicht mehr benutzt worden. Ich fegte sie aus. Drei Zimmer und die grosse Steinfliesenküche stellten Robinsons Wohnung dar. Miguel schlief in einem kleinen Raum, umgeben von lauter Fischereigeräten. Die übrigen Zimmer waren ganz merkwürdig möbliert: jedes hatte drei Schlafgelegenheiten auf dem Fussboden, einfache Strohsäcke, die mit einem seidigen Material gefüllt waren, das aus einem auf der Insel wachsenden Farn hergestellt wurde, einen Korbstuhl und einen polierten Holztisch. In jedem Zimmer hing ein geschnitztes Kruzifix an der Wand. Sobald ich meine Sinne wieder besser beisammen hatte, fragte ich Robinson über diese Zimmer aus.
»Wer schläft denn eigentlich dort?«
»Die Granatapfelleute«, antwortete er. »Das sind die Plantagenarbeiter, die jedes Jahr im August mit dem Frachter kommen. Sie bleiben drei bis vier Wochen hier auf der Insel, arbeiten in der Granatbaumplantage drüben im ‚Kopf‘ und bringen die Ernte ein. Der Dampfer fährt inzwischen weiter und geht seinen Geschäften auf den Kanarischen Inseln und an der Westküste Afrikas nach.«
»Und die übrige Zeit des Jahres leben Sie hier ganz allein auf der Insel?«
»Ja.«
»Mit Miguel«, fügte ich hinzu, um ihn über den Jungen auszuhorchen.
»Miguel ist erst seit fünf Jahren bei mir. Und dieses Jahr kommt er in die Schule. Dann bin ich wieder ganz allein.«
Selbstverständlich erkundigte ich mich gleich: »Wessen Kind ist denn Miguel?«
»Sie wollen aber, weiss Gott, alles ganz genau wissen«, sagte er rätselhafterweise.
Da war ich still. Ich war nicht so angeschlagen, um nicht zu merken, dass Robinson mich irgendwie provozieren wollte, meine Vermutungen zu äussern. In diesem Augenblick kam mir plötzlich die Erleuchtung, dass Miguel nicht, wie ich im stillen angenommen hatte, Robinsons eigenes, wahrscheinlich illegitimes Kind war.
»Äusserst mysteriös, wie?« sagte Robinson und wartete begierig auf meine Zustimmung.
»Durchaus nicht mysteriös«, sagte ich. »Ich kann mir schon ungefähr denken, wo er herkommt.« Dabei war ich mir selber gar nicht im klaren, was ich eigentlich damit meinte.
»Also wo kommt er her? Was glauben Sie?«
»Er ist eine Waise, das Kind von einem der Granatapfelpflücker, der gestorben ist, und Sie haben den Jungen adoptiert«, sagte ich auf gut Glück.
»Das müssen Sie von Waterford gehört haben«, sagte Robinson.
»Ich bin nie in Waterford gewesen.«
»Jimmie Waterford«, sagte er. »Der grosse Mann, der mit Ihnen im Flugzeug war. Er muss Ihnen von Miguels Adoption erzählt haben. Er kennt meine persönlichen Verhältnisse ein bisschen.« So, wie er es sagte, klang es wie ein Vorwurf gegen mich.
»Nein«, sagte ich, »es war nur eine Vermutung. Irgendwie war es naheliegend.«
Er schien erleichtert. »Soll ich Ihnen etwas verraten? Eigentlich hatte ich erwartet, Sie würden mir die Vaterschaft zuschieben«, sagte er.
»Nein«, erwiderte ich, »auf die Idee wäre ich nie gekommen.«
»Na, hören Sie mal!« sagte Robinson und sah mich an. »Ich muss schon sagen«, fuhr er fort, »Frauen bringen manchmal Sachen heraus …«
Heute geht unsere zweite Woche auf Robinson zu Ende. Die Schulter tut mir noch immer weh. Ich werde wohl elektrische Behandlungen haben müssen, wenn ich wieder nach Hause komme – falls überhaupt. Ich sitze draussen vor meiner offenen Zimmertür. J[immie] W[aterford] ist eben zurückgekommen und melkt gerade die Ziege. Robinson ist noch nicht zurück. Jetzt weiss ich auch, wo sie so stundenlang gewesen sind, während ich Tom Wells pflegte. Sie haben zuerst die Toten begraben. Als nächstes haben sie begonnen, das Wrack Zu untersuchen, und sind jetzt dabei, das Bergungsgut auszusortieren. Miguel sitzt schon den ganzen Morgen irgendwo und angelt. Robinson hat eine Totenliste zusammengestellt. Es sind sechsundzwanzig Eintragungen, aber nur vier Namen, bei denen er sicher ist. Die übrigen hat er durch irgendwelche Dinge gekennzeichnet, die noch an der Leiche gefunden wurden – eine Armbanduhr an einem wahrscheinlich verkohlten Handgelenk, ein Ring an einem Fingerknochen, oder ein Amulett, das man um den Hals trägt. Robinson hat das ganz fachmännisch gemacht. Ich habe die Liste gesehen, Jetzt, nachdem die Toten begraben sind, hindert mich nichts mehr, auf der Insel herumzugehen. Jimmie singt, während er die Ziege melkt. Ich glaube, ein holländisches Lied. Er ist nämlich zum Teil holländischen Ursprungs. Sein Name war nicht immer Waterford. Ich erinnere mich jetzt, dass ich ihn schon im Flugzeug kennengelernt habe, kurz bevor wir abgestürzt sind. Seine englische Aussprache ist recht gut, aber sein Vokabular ist höchst eigenartig. Ich habe den Eindruck, als sei Robinson sehr besorgt wegen Jimmie, und zwar auf eine ganz persönliche Art, als wäre er kein Fremder. Jimmie sieht Robinson ein bisschen ähnlich, so um die Nase herum. Aber das ist einfach eine Beobachtung von mir. Und Robinson hat gesagt, ich solle mich an Tatsachen halten und nur Tatsachen aufschreiben. Also gut, dann nehmen wir eben das Benehmen von Tom Wells heute früh mir gegenüber – das ist eine Tatsache. Ich werde mich bei Robinson deswegen beschweren müssen.
An dem Tage hatte ich Tom Wells mittags eine Schüssel Tomatencremesuppe aus einer Dose gebracht, die wir eigens für ihn aufgemacht hatten. Sie stand auf einem Tablett, mit ein paar von unseren harten, dicken Keksen daneben. Ich balancierte es auf meiner rechten Hand, denn die linke trug ich noch in der Schlinge.
Tom Wells sass aufrecht im Bett. Sein Zustand hatte sich seit der vergangenen Woche zusehends gebessert. Als ich auf sein Bett zukam – es war ein richtiges Bett und nicht, wie meins, einfach eine Matratze auf dem Fussboden – fragte er: »Sind alle begraben?«
»Ja.«
Er streckte seine Hand nach mir aus und berührte mich.
»Sie sind ein reizendes Tierchen«, sagte er.
Wahrscheinlich hätte ich die Supperetten können. Wirklich, ich weiss es nicht mehr, vielleicht habe ich das Tablett auch absichtlich fallen lassen. Die Suppe ergoss sich über ihn, vorn über sein Hemd und über die Leintücher, wie Blut in einem Farbfilm.
Ohne mich im geringsten um ihn zu kümmern, ging ich in die Küche zurück, wo Robinson gerade einen entenähnlichen Vogel tranchierte, den er gebraten hatte. Jimmie stand mit dem Rücken zur Tür und sprach schnell und leise in seiner holländischen Muttersprache, als ich hereinkam. Robinson sah mich und warnte Jimmie ganz unverblümt:
»Miss January ist hier.«
Die Szene mit Tom Wells hatte mich irritiert.
»Ich heisse nicht Miss January, ich heisse Mrs . Marlow.«
»Gut, gut«, sagte Robinson.
»Ich habe die Suppe über Tom Wells verschüttet«, sagte ich.
Robinson ging hinaus und war gleich wieder da, um eine neue Schüssel Suppe zu holen. Ich sass am Küchentisch und verzehrte meine Mahlzeit. Dabei starrte ich finster vor mich hin.
Jimmie Waterford griff mit seinem langen Arm vor mir über den Tisch nach dem Brot. Sein blonder Kopf war jetzt ohne Verband.
Als Robinson sich zu uns setzte, wandte Jimmie sich an mich:
»Ha!« sagte er. »Kein Mann ist eine Insel.«
»Manche schon«, sagte ich. »Wenn Worte einen Sinn haben und es Inseln gibt, sind manche Männer Inseln.«
»Da könnten Sie recht haben«, sagte Robinson.
»Ist so«, sagte Jimmie, »kann sein.«
An jenem Nachmittag hatte ich die Tagebucheintragung gemacht, und am Abend sagte ich zu Robinson:
»Wegen Wells müssen Sie eine andere Lösung finden. Ich pflege ihn nicht mehr.«
»Ich bin doch nicht dazu da, für irgend jemanden irgendeine Lösung zu finden«, sagte er. »Haben Sie doch Vernunft«, fügte er hinzu, indem er Jimmie imitierte, der oft zu sagen pflegte: »Haben Sie doch Vernunft.«
»Ich will mit diesem Menschen nicht allein im Hause bleiben.«
»Seien Sie doch vernünftig«, sagte Robinson.
»Sie müssen mit ihm reden«, sagte ich, »und ihn warnen. Drohen Sie ihm.«
»Ich werde ihm sagen, Sie tragen ein Messer im Strumpf.«
Strümpfe hatte ich natürlich nicht. Ich konnte froh sein, dass ich noch Beine hatte.
»Hören Sie sich doch bloss diese Frösche an«, sagte ich, denn ich hatte mich inzwischen wieder beruhigt, und die Frösche in den Binsen des Bergsees machten wirklich einen Höllenlärm.
»Wie lange waren Sie denn verheiratet?«
»Ich bin Witwe«, entgegnete ich, »und ausserdem Journalistin.« Letzteres schien mir zwar eine Untertreibung, aber zumindest konnte man sich alles mögliche darunter vorstellen: eine Dichterin, eine Kritikerin, auch eine grosse Schriftstellerin. Nachdem ich jetzt wieder meine Sinne beisammen hatte, gingen mir die ewigen Ratschläge Robinsons allmählich auf die Nerven: »Führen Sie regelmässig Tagebuch. Halten Sie sich nur an Tatsachen. Beschreiben Sie die Landschaft«, als könnte ich normalerweise keinen vernünftigen Satz zustande bringen.