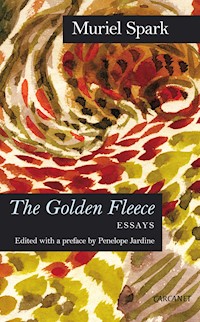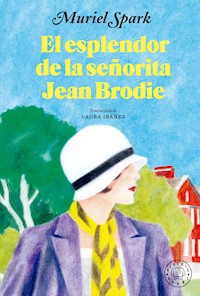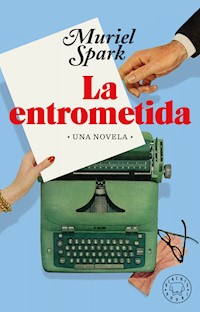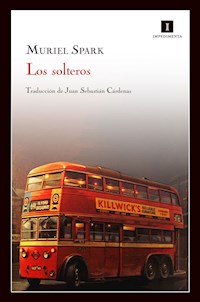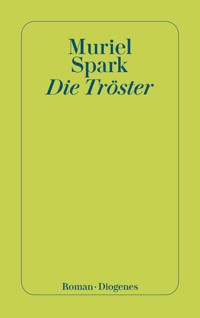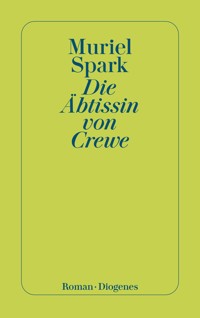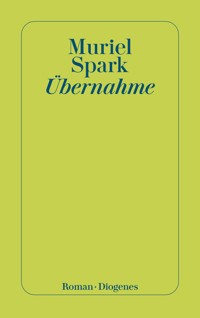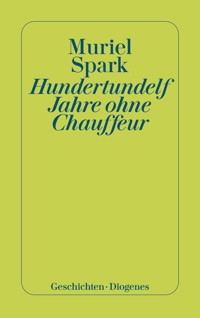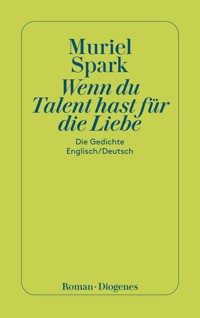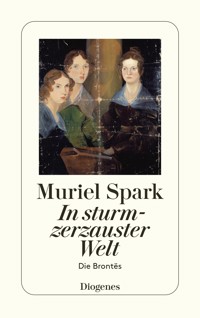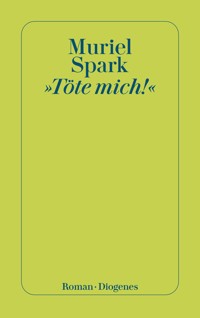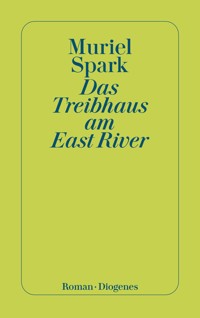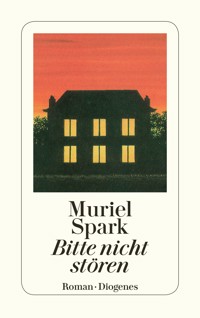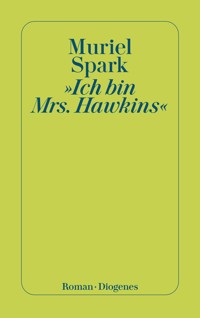
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die junge Mrs. Hawkins ist eine wunderbare Frau, die Ruhe in Person und stets für alle da. Mit ihrer mütterlichen und lebensfrohen Opulenz gibt sie dem erfolglosen Londoner Verlagshaus, bei dem sie arbeitet, Halt und Kraft. Genauso verlässlich wehrt sie aber auch mit wohlgezielter Garstigkeit nervtötende Schreiberlinge ab. Jahrzehnte später ist Mrs. Hawkins zur schlanken Nancy geworden und nimmt uns mit zurück ins Kensington der Fünfzigerjahre, das voller raffinierter, ja sogar böser Überraschungen steckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Muriel Spark
»Ich bin Mrs. Hawkins«
Roman
Aus dem Englischen von Otto Bayer
Diogenes
Erstes Kapitel
So groß war der Lärm am Tag, daß ich bei Nacht oft wach dalag und der Stille lauschte. Endlich schlief ich, von Lautlosigkeit erfüllt, zufrieden ein, doch solange ich wach war, genoß ich es, die Dunkelheit zu erleben, die Gedanken und Erinnerungen, die süßen Vorfreuden. Ich konnte die Stille hören. Schon damals, zu Beginn der fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts, war mir die Schlaflosigkeit zur Gewohnheit geworden. Schlaflosigkeit ist nichts Schlechtes an sich. Man kann in der Nacht wach liegen und denken; die Qualität der Schlaflosigkeit hängt ganz davon ab, woran man zu denken beschließt. Kann man Denken beschließen? Ja, man kann. Meist kann man sein Denken richten, worauf man will. Man setzt sich etwa friedlich vor den dunklen Fernseher und schaut sich einfach gar nichts an; und früher oder später macht man sich sein eigenes Programm, viel besser als die Massenproduktionen. Das macht Spaß, Sie sollten es versuchen. Sie können sich dann auf die Mattscheibe holen, wen Sie wollen, allein oder in Gesellschaft, ihn sagen und tun lassen, was Sie möchten, und selbst mitten dazwischen sein, wenn es Ihnen so lieber ist.
Bei Nacht lag ich wach und betrachtete die Dunkelheit, lauschte der Stille, malte mir die Zukunft aus, pflückte mir aus der Vergangenheit die Stückchen heraus, die ich übersehen hatte, jene verschmähten Ereignisse, die jetzt in den Vordergrund traten, groß und wichtig, so daß die Schwere des Schicksals nicht mehr auf den derzeitigen Problemen meines Lebens lastete, worin sie auch immer bestanden (denn wer lebt schon alle Tage ohne Probleme? Warum die Nächte auf sie verschwenden?).
Oft ist es ein weiter Weg von Kensington und den frühen Fünfzigern, diesem Schauplatz meiner Wachträume. Doch selbst wenn ich jetzt nach London, nach Kensington, zurückkehre und das Taxi bezahlt habe und von den Menschen, die dort warten, begrüßt worden bin und Freunde angerufen und die Post geöffnet habe, finde ich in dieser Nacht wieder meine Stunden süßer Schlaflosigkeit und weiß, daß es ein weiter Weg von jenem Kensington der Vergangenheit ist, jener Old Brompton Road, jener Brompton Road, jenem Brompton Oratory; ein weiter Weg. Meine Nachtgedanken verweilen oft bei jenen Nachtgedanken der Vergangenheit, wie ja auch mein damaliger Alltag eine Beziehung zu meinem Tun von heute hat.
Es war 1954. Ich wohnte möbliert in einem hohen Haus in South Kensington. Vor ein paar Jahren erschrak ich einmal, als ein Freund von »dieser Pension unweit der U-Bahn-Station South Kensington, wo du früher gewohnt hast« sprach. Milly, die Hausbesitzerin, hätte die Bezeichnung »Pension« empört zurückgewiesen, aber es wird wohl doch eine gewesen sein.
Milly war sechzig Jahre alt und Witwe. Jetzt ist sie schon weit über neunzig und immer noch die alte Milly.
Das Haus war eine Doppelhaushälfte, und nur ein Meter trennte die freistehende Seite vom Nachbarhaus. Es standen je achtzehn Häuser gleicher Art auf beiden Straßenseiten. Hinter schmiedeeisernen Törchen führte jeweils ein kurzer Weg zwischen Kiesstreifen und Blumenbeeten, von fleckigen Rhododendren gesäumt, zu einer Haustür mit zwei Scheiben aus gemustertem Glas. Milly Sanders’ Mieter hatten alle einen Schlüssel zu dieser Haustür, die in eine kleine Eingangsdiele führte. Milly selbst bewohnte das Erdgeschoß. Wenn man hereinkam, war rechts eine Flurgarderobe mit Spiegel, Kleiderhaken und Schirmständer; auf einer ihrer Ablageflächen stand das Telefon. Links war Millys gute Stube mit Erkerfenster, die nur für Besuch da war. Weiter hinten begann die Treppe, die zu den Mieteretagen führte, und links von dieser Treppe führte ein kurzer Gang in Millys Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer mit angrenzendem Wintergarten und in den Garten hinterm Haus, der für Londoner Verhältnisse recht schön und groß war. Diese Straßen waren für Kaufmannsfamilien des vorigen Jahrhunderts angelegt worden.
Im ersten Stock waren ein Bad und möblierte Zimmer, vermietet an zwei Alleinstehende und ein Ehepaar. Im vorderen Wohnschlafzimmer, das auch ein Erkerfenster und eine angebaute Küche hatte, wohnte das Ehepaar, Basil Carlin und seine Frau Eva, beide auf die Vierzig zugehend und kinderlos. Eva arbeitete halbtags als Kindergärtnerin. Basil war nach eigener Definition technischer Buchhalter. Die Carlins waren außergewöhnlich stille Leute. Kaum hatten sie die Tür hinter sich zu, drang von dort nie ein Laut heraus, selbst nicht nach Mitternacht, wenn die natürlichen Geräusche des Hauses bis zum Morgen verstummt waren.
Neben den Carlins kam ein großes Zimmer mit Blick auf den Garten. Es hatte ein Waschbecken und einen Gaskocher mit dem üblichen schwarzen Blechkasten daneben, mit Schlitzen für Shillings und Pennies. Hier wohnte und arbeitete Wanda, die polnische Schneiderin, deren Leidensfähigkeit an Gier grenzte. Aber Wanda Podolak war eine großmütige Seele, obwohl sie sich nie zu einem Augenblick des Glücks bekennen konnte. Sie hatte viel Besuch, teils Kundinnen – ihre Damen, wie sie sagte –, die sich redselig ihre Kleider anmessen ließen, teils Landsleute, darunter einige, die sie als Feinde bezeichnete. Die meisten Besucher kamen ab sechs Uhr abends, wobei nach Feierabend die Kunden den Vorzug vor Freunden und Feinden bekamen, die auf dem Flur warten mußten, bis die Anproben vorbei waren. Wenn Wanda Gäste hatte, blieb ihre Arbeit nicht liegen; immer wieder summte ihre Nähmaschine in die volltönenden polnischen Männerstimmen hinein, das Kreischen der Frauen und das Klappern der Tassen und Untertassen, wenn Tee gemacht wurde. Auf Polnisch klang die Unterhaltung um so lauter, als niemand, der an Wandas Tür vorbeikam, ein Wort verstehen konnte.
Nach hinten hinaus befand sich in diesem ersten Stock noch ein kleineres Zimmer, in dem Kate Parker wohnte, die fünfundzwanzigjährige Bezirksschwester, klein, dunkel, dicklich, mit runden schwarzen Vogelaugen und blitzenden weißen Zähnen. Sie war eine echte Cockney. Sie vibrierte förmlich vor Energie, und sicher war sie sehr couragiert. Kate war häufig abends dienstlich unterwegs, aber an den wenigen Abenden, die sie zu Hause war, putzte sie ihr Zimmer. Sie nahm es sehr gründlich und genau mit dem Putzen, nicht nur dem eigenen; wenn sie zu jemandem ins Zimmer kam, egal ob zum Fiebermessen oder nur zum Tee, sagte sie oft höflich: »Sie haben ein hübsches, sauberes Zimmer.« Sagte sie das nicht, dann war das Zimmer eben nicht sauber. Kate haßte Bakterien, sie waren Teufelswerk. Wenn sie also abends zu Hause war, schleifte sie ihre Möbel auf den Flur und schrubbte ihr Linoleum mit Dettol. Sie hätte auch die Möbel desinfiziert, wären sie nicht Eigentum unserer Wirtin gewesen. Bei aller Langmut hatte Milly sich denn doch dagegen aufgelehnt, daß ihr Tisch, Stühle und Bett auch nur mit einem Lappen abgewischt wurden, der mit diesem Zeug getränkt war; es reiche ja wohl, meinte sie, wenn nach Kates Geschrubbe jedesmal das ganze Haus nach Klinik rieche. Zum Reinigen der Möbel gab sie Kate Lavendelöl. Am Rumpeln und Schleifen des Mobiliars und den gemischten Desinfektions- und Lavendeldüften erkannte man jedenfalls unfehlbar, an welchen Abenden Kate zu Hause war. Wenn sie erst das Geld zusammengespart und eine eigene Wohnung habe, schwor Kate, so komme ihr da nur weißlackiertes, abwaschbares Holz hinein. Kate war eisern mit ihren Spargroschen und sehr stolz darauf; sie brachte alles auf die Post. In ihrem Zimmer hatte sie etliche Schächtelchen im Regal stehen, die das benötigte Kleingeld enthielten. »Strom« stand darauf, und »Gas« und »Bus« und »Essen«, »Telefon« und »Sonstiges«. Nach dem Putzen und Möbelrücken manikürte Kate sich, bevor sie zu Bett ging, sehr sorgfältig die Fingernägel. Dann legte sie mit besonderer Akkuratesse ihre Kleider für den nächsten Morgen zurecht. Manchmal ließ sie sich vor dem Zubettgehen noch zu einem Sherry oder Whisky überreden, doch stets mit einem ernsten Seufzer, als wollte sie zu verstehen geben, daß sie dieses Zeug ja eigentlich nicht trinken dürfe, es könne einen Menschen ruinieren.
In dem Stockwerk darüber wohnte ich in einem Dachzimmer mit schräger Decke. Es hatte einen Herd und ein Spülbecken; in einer Ecke war eine Einbaudusche; unter die schräge Wand war ein niedriger, tiefer Geschirrschrank eingebaut.
Auf dieser Etage befanden sich noch ein Gemeinschaftsbad und zwei weitere Zimmer, und in einem von ihnen wohnte Jung Isobel, die ein eigenes Telefon im Zimmer hatte, damit sie allabendlich ihren Daddy in Sussex anrufen konnte; nur unter dieser Bedingung hatte Isobel nach London kommen und hier als Sekretärin arbeiten dürfen. Manchmal telefonierte Isobel einen ganzen Abend lang, nicht nur mit ihrem Daddy, auch mit ihrem großen Bekanntenkreis, und ihre Stimme sang und trällerte durch die dünnen Wände die Rezitative und Arien ihrer Tageswerke.
Das andere, noch kleinere Zimmer im Dachgeschoß hatte ein Fenster zum Garten. Ein Medizinstudent wohnte darin, William Todd, dessen akustische Daseinsäußerungen aus seinem Radio stammten, das oft auf die klassische Musik des Dritten Programms eingestellt war. So könne er besser lernen, behauptete er.
Manchmal gab ich eine Party, und das legte dann wohl Zeugnis für mein Dasein ab. Davon abgesehen war ich ziemlich ruhig, sofern ich nicht überhaupt den Abend außer Haus verbrachte. Im allgemeinen aber ging ich, wenn ich zu Hause war, nach unten und unterhielt mich mit Milly. Sogar in Millys Erdgeschoßwohnung ging es oft sehr laut zu, denn Reparaturen und sonstige Arbeiten am Haus wurden abends von einem Mr. Twinny erledigt, der ein paar Häuser weiter wohnte. Daß Mr. Twinny nach getaner Tagesarbeit zum Hämmern und Schaben hierherkam, hatte seinen Grund darin, daß reguläre Firmen und Handwerker in Millys Etat nicht drin waren. Wenn Mr. Twinny tapezierte, breitete er die Tapeten auf einer aufgebockten Arbeitsplatte aus, und Milly rührte derweil mit Mehl und Wasser den Kleister an und brachte ihn zu Mr. Twinny, der ihn dann auf das Papier schmierte. Oder er machte mit viel Getöse einen Abfluß frei, während Millys Fernseher dröhnte und ich mit einer Tasse Tee dabeisaß und zuschaute.
Wie alle im Haus oder auch im Verlag, nannte Milly mich nie beim Vornamen. Obwohl ich mit achtundzwanzig noch eine junge Frau war, kannte man mich überall nur als Mrs. Hawkins. Es schien mir so natürlich und war auch meiner Umgebung offenbar so natürlich, daß ich damals gar nicht auf die Idee kam, es anders zu wollen. Ich war Mrs. Hawkins, eine Kriegswitwe. Als Mrs. Hawkins hatte ich etwas an mir, was Zutraulichkeit weckte. Ich war mir dessen im Übermaß bewußt, und Übermaß bestimmte auch den Eindruck, den ich allenthalben machte. Ich hatte einen gewaltigen Umfang, mächtige Muskeln, einen Riesenbusen, breite Hüften, stämmige lange Beine, einen ballonförmigen Bauch und ein ausladendes Hinterteil; ich schleppte mit meinen einsachtundsechzig ein enormes Gewicht herum und war dabei kerngesund. Natürlich lag es zum Teil an dieser äußeren Erscheinung, daß Leute sich mir anvertrauten. Ich wirkte so beruhigend. Auf Fotos aus dieser Zeit sieht man mich mit Mondgesicht, üppigem Doppelkinn und verschlafenen Augen. Es sind Schwarzweißbilder. Als Farbfotos würden sie zeigen, daß meine Formen, Augen und Teint eines Rubens würdig gewesen wären. Und ich war Mrs. Hawkins. Erst später, als ich abzunehmen beschloß, bekam ich sofort zu spüren, daß mir die Leute, Männer wie Frauen, nicht mehr so ohne weiteres ihre Gedanken anvertrauten. Bei der Gelegenheit will ich Ihnen verraten, daß Abnehmen ganz leicht ist, wenn man außer dem Fett nicht noch andere Probleme hat. Essen und trinken Sie, was Sie immer essen und trinken, aber nur halb soviel. Stellt man Ihnen einen vollen Teller hin, so lassen Sie die Hälfte darauf; wenn Sie sich selbst auftun, nehmen Sie gleich nur die Hälfte. Sind Sie ein Perfektionist, so können Sie nach einiger Zeit auch davon wieder nur die Hälfte nehmen. Die Willenskraft, sofern sie eine Rolle spielt, sollten Sie sich als etwas vorstellen, was nie in der Gegenwart, nur in Zukunft und Vergangenheit existiert. Eben noch haben Sie beschlossen, etwas zu tun oder zu lassen, und im nächsten Augenblick haben Sie es schon getan oder gelassen; einzig so geht man mit Willenskraft um. (Nur unter unmenschlichem Streß existiert Willenskraft auch in der Gegenwart, aber das ist ein anderes Thema.) Ich gebe Ihnen diesen Rat gratis; er ist im Preis für dieses Buch mit inbegriffen.
Wie dem auch sei, ich fühlte mich im Jahre 1954 jedenfalls wohl in meinem Fett und galt allgemein als »wunderbare Frau«, obwohl ich noch niemals irgend etwas Wunderbares getan hatte. Man verehrte mich ob meiner Fülle und der rundum mütterlichen Erscheinung. Einmal stand eine junge Frau, die vermutlich älter war als ich, im Bus auf und bot mir ihren Platz an. Sie bestand darauf. Ich merkte, daß sie mich für schwanger hielt, und nahm huldvoll an. Ich erfreute mich allseitiger Zuneigung. Ich war Mrs. Hawkins.
Zwischen elf und zwölf Uhr nachts wurde das Haus allmählich stiller und verstummte schließlich ganz. Hin und wieder gefiel es den Leuten von nebenan, einem jungen Zyprioten, der sich als »Händler« bezeichnete, und seiner englischen Frau nebst Schwägerin, in ihren Garten hinauszugehen und einen Familienkrach zu veranstalten, oder wie sie selbst es nannten, wenn sie sich anderntags entschuldigten, eine kleine Meinungsverschiedenheit auszutragen. Das ging dann immer die ganze Nacht, aber es kam selten vor. Im allgemeinen wurde um Mitternacht zum letztenmal die Toilettenspülung betätigt – »Das war Basil«, sagte Milly –, dann schlief das Haus.
Ich lag im Bett und sog die Stille in mich hinein. Das Schweigen war wirklich, es tat meinen Ohren wohl, zumal ich in meinem inneren Ohr noch einmal die Geräusche des vergangenen Tages vernahm. Nun, da sie verstummt waren, konnte ich mir ihren Sinn zusammenreimen. Und so begann einer dieser vielen Nachtgedanken, an die ich mich jetzt erinnere, damit, daß ich aufwachte und diese Stille, mit der ich meine Erzählung begonnen habe, richtiggehend genoß, sie geradezu hören konnte. Meine Arbeitsstelle war die lauteste, die ich je gekannt habe, und ich werde sie zu gegebener Zeit beschreiben. Jetzt will ich nur sagen, daß die Stille, die mir beim Aufwachen ins Bewußtsein drang, mir eine andere Stille aus meiner Kindheit in Erinnerung rief, als ich bei Verwandten in Afrika zu Besuch war: Wir waren mit dem Auto von Bulawayo zu den Victoria-Fällen gefahren. Die Natur lag stumm in der Hitze des Tages. Als wir uns dem wuchernden Wald am Sambesi näherten, senkte sich an einem bestimmten Punkt eine noch tiefere Stille herab und machte mir bewußt, daß die bisherige Stille nur Illusion gewesen war.
Milly hatte John Sanders, ihren Mann, Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts in ihrem heimischen Cork kennengelernt, wo er als Soldat stationiert war. Millys Mutter war Witwe und hatte einen Kramladen mit zwei Marmortischen, an denen auch Ginger Ale und Limonade serviert wurden. Hierher kam der junge Sergeant John Sanders oft, um Zigaretten zu kaufen und ein Schwätzchen zu halten. Eines Tages lud er Milly zum Tanz ein. Milly hinterm Ladentisch sah ihre Mutter an, die nickte. »Ja, du darfst«, hieß dieses Nicken, wie Milly mir erklärte.
Milly hatte eine große Erzählgabe. Einmal sagte ich ihr das; da sah sie mich so bestürzt, so zweifelnd an, ob ich das wohl ernst meinte oder nur sagen wollte, ihre Geschichten seien gewiß nicht wahr, daß ich nie mehr ihre Erzählkunst lobte. Ich hörte nur noch zu und registrierte, wie sie mit einer kleinen, am rechten Platz eingefügten Nebensächlichkeit und durch die bildhafte, treffende Wortwahl, in der fast alle Iren Meister sind, eine Szene lebendig machen konnte. Sie verzichtete auf irische Flunkerei, sie übertrieb nie. Ich konnte Milly stundenlang zuhören.
Als ich sie kennenlernte, war sie eine bildhübsche Frau von sechzig und hatte dichtes, schimmerndes Silberhaar und ein feines Gesicht. Sie war bestimmt einmal eine Schönheit gewesen, aber jedes Kompliment wegen ihres Aussehens machte sie verlegen.
Ihr Schlafzimmer war ungeheizt, weshalb sie sich gern vor dem Feuer in ihrem Wohnzimmer, einem abgetrennten Teil der Küche, auszog und fürs Zubettgehen fertig machte; dazu schaltete sie jedoch stets den Fernseher ab; um nichts in der Welt hätte sie sich vor einem Schauspieler, Ansager oder einem jener Geistlichen, die zum Tagesausklang immer ein paar ermutigende Worte sprachen, ausgezogen.
Und man sah Milly auch nie in Begleitung eines Mannes gehen. Zwar blieb sie wohl einmal auf der Straße stehen, um sich mit einem Nachbarn zu unterhalten, auch wenn es ein Mann war, und sie mochte einen Mann, den sie kannte, auch von der Haustür zu seinem Wagen begleiten und ihm nachwinken. Nie aber würde sie mit ihm auch nur ein Stück über die Straße gehen. Sie war seit zehn Jahren Witwe. Ich denke mir, daß sie da irgendeiner Regel aus Kindertagen gehorchte.
Einmal ging mir während eines Gesprächs auf, daß Milly, die drei Kinder geboren hatte, fest davon überzeugt war, man könne kein Kind empfangen, wenn man keinen Orgasmus gehabt habe – »dieses Gefühl«, sagte sie dazu. Ich widersprach nicht. Ich zog nicht einmal Schlüsse auf Millys Eheleben und mochte an die Frage, ob Milly umgekehrt auch glaubte, ein Orgasmus führe unweigerlich zu einem Kind, lieber nicht rühren.
Der Verlag, in dem ich arbeitete, befand sich in einem umgebauten Queen-Anne-Gebäude, das mittlerweile abgerissen wurde, um einem kahlen Betonklotz abseits der St. James’s Street Platz zu machen. Es war die Ullswater and York Press, gemeinhin Ullswater Press genannt, einer dieser kleinen Verlage, die sich über die Widernisse des Krieges, namentlich Papierrationierung, Mangel an englischen Druckereien, fehlende Transportmöglichkeiten, um die Bücher von Druckereien im Ausland abzuholen, nur knapp hinweggerettet hatten; der Verlag hatte sich nur deshalb über Wasser gehalten, weil die Öffentlichkeit ganz versessen auf Bücher war, besonders jene ernsthaften Bücher, die man bei Ullswater Press feilbot. Damals wie heute waren Stellen in Verlagen sehr begehrt und, vielleicht eben deshalb, schlecht bezahlt. Dort also, im Parterre, wo sich das Gemeinschaftsbüro befand, lief aller Lärm des Tages ab. Dieser Raum, von dem ich mir vorstellen könnte, daß es früher zwei ineinander übergehende Salons gewesen sein müssen, beherbergte am einen Ende das Lektorat und am anderen eine Sortier-, Pack- und Versandabteilung. Dazwischen standen drei Schreibtische und eine Reihe Aktenschränke, und dort wurde getippt und abgelegt; die beiden jungen Mädchen, die das besorgten, bekamen manchmal Gesellschaft von Cathy, der Buchhalterin, die mit ihren Rechnungsstapeln von oben aus der Buchhaltung kam, wenn der Chefbuchhalter allein sein oder mit einem Besucher unter vier Augen reden wollte.
In diesen Monaten, den letzten vor dem Zusammenbruch des Verlages Ullswater and York, wollte der Chefbuchhalter oft ungestört sein. Wenn er Cathy zu uns herunterschickte, spekulierten wir unter uns, wer wohl der Besucher war. Jemand, der nichts Gutes verhieß. Cathy, die schon viel länger im Verlag war als wir alle, verriet es uns nicht. »Ist es endlich der Gerichtsvollzieher, Cathy?« Keine Antwort. Sie war irgendwo zwischen fünfzig und siebzig Jahre alt und hatte ein runzliges, rötliches Gesicht, schütteres Haar, was vielleicht vom dauernden Färben kam, und so dicke Brillengläser, wie ich sie davor und danach nie mehr gesehen habe. Cathy senkte den Kopf mit den spärlichen Haaren, die an den Wurzeln rötlich und grau, an den Spitzen schwarz waren, über ihre Rechnungen und murmelte vor sich hin, bis wir ihr eine Tasse Tee mit einem Keks auf der Untertasse brachten, worauf sie mit einem dankbaren Lächeln aufsah, das zum Anlaß in keinem Verhältnis stand. Wenn Cathy mit fremdländischem Akzent in den allgemeinen Lärm hinein sprach, krächzte ihre Stimme. Sie war in den dreißiger Jahren in einem deutschen Konzentrationslager gewesen und davongekommen.
Der Name des Verlags, Ullswater and York, hatte keine geographische Bedeutung. Die beiden Gesellschafter waren eben ein Mr. Ullswater und ein Mr. York. Zwei weitere Vorstandsmitglieder und Anteilseigner waren in das Unternehmen eingetreten. Mr. Ullswater, mit Abstand der ältere der beiden Gesellschafter, lebte mittlerweile fast im Ruhestand. Er verbrachte seine Zeit auf dem Lande und kam einmal monatlich zu einer Vorstandssitzung. Er trug Bowler und Tweedanzug, im Winter einen grauen Mantel. Dann kam er, groß und weißhaarig, mit breitem Gesicht und stets liebenswürdig, im Taxi vorgefahren und stieg gemächlich die Treppen empor. Nur wenn er wieder ging, hatte er es immer eilig und marschierte, so schnell er konnte, um die Ecke in seinen Club. Martin York war ein rundgesichtiger, vierschrötiger Mann um die Vierzig.
Mein letztes Wochengehalt habe ich nie bekommen. Die Firma schuldet mir sieben Pfund im Geldwert von 1954. Daß in unserem großen Gemeinschaftsbüro ein solcher Lärm herrschte, konnte durchaus daher rühren, daß wir nach Art primitiver Stämme die bösen Geister fernhalten wollten. Sie kamen dann doch, und Martin York mußte wegen vielfacher Fälschungen und anderer Betrügereien ins Gefängnis, aber wir Angestellten sahen, obwohl wir wußten, daß die Firma wackelte, die nähere Zukunft noch nicht ganz so dramatisch. Wir dachten nur, daß wir uns wohl demnächst nach anderen Stellen umsehen müßten, und bis dahin machten wir eben unsere Arbeit weiter.
Unsere Stenotypistin hieß Ivy, ein hochgewachsenes Mädchen frisch von der Sekretärinnenschule. Mary, die Bürogehilfin, war sechzehn Jahre alt und von der Schule geradewegs zu uns gekommen. Packer und Sortierer war ein junger Mann namens Patrick, und ich war, wie üblich, Mrs. Hawkins: Mädchen für alles, Korrekturleserin, Gutachterin und Sekretärinnenersatz, als Mr. Yorks und Mr. Ullswaters jeweilige Sekretärinnen durch Heirat ausschieden und nie ersetzt wurden.
Zweites Kapitel
Der zypriotische Ehemann und seine englische Frau im Haus neben Millys hatten Streit. Es war zwei Uhr morgens. Sie hatten ihren Krach im Garten angefangen, waren dann aber, um ihn fortzusetzen, nach drinnen gegangen.
Nun führte die erste Halbtreppe in Millys Haus auf einen kleinen Treppenabsatz mit Fenster, durch das man über einen trennenden Meter hinweg in das gerade gegenüberliegende Fenster des Nachbarhauses sehen konnte; wenn man in Millys Haus auf der zweiten Halbtreppe saß, sah man im Haus nebenan das exakte Gegenstück der Halbtreppe samt Absatz.
Ich hatte schon im Bett gelegen, aber der Lärm war dieses Mal so furchterregend, daß ich zu Milly hinunterging, die auch schon aufgestanden war und ihren Morgenmantel anhatte. Nebenan schrie die Ehefrau. Sollten wir etwas unternehmen? Sollten wir die Polizei anrufen? Wir setzten uns auf die Treppe und sahen durchs Fenster zu. Unser Treppenlicht war aus, aber ihres war an. Außer dem leeren Stück Treppe sahen wir aber noch nichts. In unserem Haus war es ansonsten still, alle schliefen oder ignorierten schlicht den Lärm.
Im Haus nebenan war heute nachmittag Kindstaufe gewesen. Bei dem Krach ging es um die wahre Vaterschaft, nachdem ein Freund des Ehemannes diesen während der Party in einem Nebensatz auf das Thema angesprochen hatte. Ich glaube ja nicht, daß der Mann in Wirklichkeit bezweifelte, der Vater des Kleinen zu sein; es bot nur einen rationalen Anlaß für das beiderseitige Bedürfnis des Paares nach Streit, der dann lautstark in den Garten überquoll; die Gäste waren darauf alle nach Hause gegangen.
Das Baby verschlief anscheinend das Pandämonium, denn wir hörten nur das Gekreisch der Frau und die Wutschreie des Mannes: Lärm hinter der Szene.
Plötzlich erschienen sie auf der Treppe, der zweiten Halbtreppe, genau vor unseren Augen, wie auf einer Bühne. Milly, stets mit Sinn fürs Angemessene, rannte in ihr Schlafzimmer hinunter und kam mit einer noch fast vollen Schachtel Pralinen zurück. Wir saßen nebeneinander, aßen Pralinen und sahen das Stück. Bisher kein Schlag, kein Handgemenge; dafür viel Fuchteln und Drohen. Jetzt packte der Mann seine Frau bei den Haaren und zerrte sie ein paar Stufen höher, dieweil sie auf ihn einschlug und zeterte.
Zuletzt rief ich doch die Polizei an, denn die Prügelei wurde ernster. Zehn Minuten später stand ein Polizist vor unserer Tür. Er schien das Spektakel im Haus nebenan nicht ganz so dramatisch zu sehen und zögerte, einzuschreiten. Statt dessen setzte er sich zu uns auf die Treppe, von wo wir jetzt die Füße der Ringkämpfer sahen. Der Polizist mußte sich neben uns quetschen, denn ein bequemerer Sitzplatz für ihn war nicht vorhanden. Meine Hüften beanspruchten allen freien Raum. Endlich aber kamen unsere Nachbarn wieder die Treppe herunter, so daß wir sie ganz im Blick hatten.
»Können Sie das nicht abstellen?« fragte Milly, indem sie die Pralinen reichte.
Der Polizist bediente sich. »Man soll nicht zwischen Mann und Frau gehen«, meinte er. »Empfiehlt sich nicht. Man kriegt keinen Dank, und sie wenden sich nur beide gegen einen.«
Wir mußten seinen Einwand gelten lassen. Milly erbot sich, ein Täßchen Tee zu kochen, wozu sie ja stets bereit war. Endlich sagte der Polizist: »Ich gehe jetzt doch mal ein Wörtchen mit den beiden reden. Um diese nachtschlafende Zeit – das ist ja Ruhestörung.«
Wir hörten ihn an der Haustür klingeln. Es war ein langes Klingeln, und gleichzeitig löste sich die Szene vor unseren Augen auf. Das Ehepaar fuhr auseinander, sie ordnete ihre Frisur, er stopfte sich das Hemd in die Hose. Beide verschwanden aus dem Blickfeld. Jetzt hörte man von der Straßenseite her ihre Tür aufgehen, dann die sanft tadelnde Stimme des Polizisten. Die Stimme der Frau scholl hoch und klar durch die leere Nacht, bittend, entschuldigend, versöhnlich. »Wir hatten doch nur eine kleine Meinungsverschiedenheit, Herr Wachtmeister.«
Gegenüber ging das Treppenlicht aus. Ende der Vorstellung. Milly und ich tranken in der Küche noch eine Tasse Tee und redeten über etwas anderes.
Als ich am nächsten Morgen das Haus verließ, um zur Arbeit zu gehen, sah das lächelnde, haselnußbraune Gesicht unseres zypriotischen Nachbarn von dem Rad an seinem Wagen, an dem er gerade arbeitete, zu mir auf. »Guten Morgen, Mrs. Hawkins«, sagte er.
Woher kannte er meinen Namen? Ich kannte den seinen nicht. Immer wußten die Leute in jenen Tagen, wer ich war, noch ehe ich sie kannte. Als ich später schlank wurde, mußte ich es, wie alle anderen, darauf ankommen lassen; und das bestätigt meinen Eindruck, daß ein großes, stattliches Mädchen jemand ist, mag ihr an Romantik auch viel entgehen. »Guten Morgen«, sagte ich.
Im allgemeinen traf ich morgens zwischen halb und Viertel vor zehn im Verlag ein. Die Uhr im großen Gemeinschaftsbüro war unzuverlässig und würde es mangels flüssiger Mittel wohl auch bleiben. Ich finde ja, wenn eine Uhr nicht pünktlich ist, kann man von den Menschen, die mit ihr leben, auch keine Pünktlichkeit verlangen. Wir nahmen es alle immer weniger genau mit der Zeit, je mehr es mit dem Geschäft abwärtsging. Patrick, der Packer und Sortierer, war meist als erster da, und so nahm er dann auch die ersten Anrufe an. Ich weiß nicht, ob mein Gedächtnis übertreibt, aber im Rückblick will mir scheinen, daß ich Patrick fast jeden Morgen am Telefon antraf, mit lautem Brüllen seine Verlegenheit und ebenso sein Unvermögen überspielend, die Probleme des Anrufers zu lösen. Um diese Stunde war der Anrufer meist ein Autor, und sein Problem war Geld. Am späteren Vormittag, kurz vor Mittag, hatten dann die Drucker und Buchbinder ihre Stunde; auch ihr Problem war Geld, die unbezahlte Rechnung. Und ehe die Rechnungen bezahlt waren, bestand gewiß keine Hoffnung, weitere Bücher an den Drucker zu geben.
Telefon: »Würde es Ihnen etwas ausmachen, später noch einmal anzurufen? Mrs. Hawkins ist noch nicht hier.« Diesmal wimmelte Ivy einen ab. Wieder das Telefon: »Ullswater Press«, sagte Ivy.
Kaum ein Vormittag, an dem Patrick nicht Besuch von seiner armen Frau Mabel bekam. Und sie ging unfehlbar mit dem Vorwurf auf mich los, daß ich ihren Mann verführe.
»Mabel! Mabel!« – Patrick, ein hochgewachsener junger Mann mit Brille und dünnem blondem Haar, hatte mit seinem frühreifen Ernst viel Ähnlichkeit mit einem Kaplan; er war etwas jünger als ich. Da Bücher und Lesen seine Leidenschaft waren, hoffte er im Verlagswesen Karriere zu machen. Es stimmte, daß er an mir hing, denn er glaubte sich mir anvertrauen zu können. Oft hörte ich ihm in der Mittagspause zu, wenn wir uns ein paar Sandwichs holen ließen und diese zum Bürokaffee verzehrten, weil es zu kalt und regnerisch war, um in den Park zu gehen. Soviel ich weiß, hatte er Mabel geheiratet, weil sie schwanger war. Nun verdiente Patrick sehr wenig, aber Mabel arbeitete ebenfalls, und um ihr Kindchen kümmerte sich tagsüber Mabels Mutter. Ob nun Patrick zu sehr in seine Bücher vertieft war, um sich mit seiner Frau zu befassen, oder ob er gut von mir gesprochen hatte oder beides, jedenfalls hatte Mabel sich in den Kopf gesetzt, ich wolle ihr Patrick ausspannen. Sie war furchtbar mit den Nerven herunter, und ich glaube, wenn wir nicht alle so nachsichtig gewesen wären, wenn sie auf dem Gang zur Arbeit mit ihren Vorwürfen in unser Büro gestürmt kam, hätte sie einfach nicht mehr den Weg in das nahe Malereigeschäft gefunden, wo sie im Büro arbeitete. So konnten wir sie immer beruhigen, und sie ging, nicht ohne ihr schmales, spitzes Gesicht noch ein paarmal vorwurfsvoll nach mir umzuwenden.
»Mabel! Mabel!« sagte ihr Mann.
Ivy, die Stenotypistin, hämmerte derweil ununterbrochen auf ihrer Schreibmaschine. Cathy, die Buchhalterin mit den vorquellenden Augen hinter dicken Brillengläsern, stand dann auf und krächzte, während sie mit den Händen fuchtelte: »Mrs. Hawkins ist unsere Cheflektorin und tut so etwas nicht.«
Patrick war immer ganz zerknirscht, nachdem seine Frau wieder fort war. »Es ist lieb von Ihnen, daß Sie es so aufnehmen, Mrs. Hawkins«, sagte er manchmal, dabei hatte ich nichts getan und nur in meiner Drallheit dagestanden. Ein andermal sagte er auch wieder gar nichts und betrachtete nur hingebungsvoll die Bücher, die er so sorgsam, so gekonnt und schnell verpackte.
Einer unserer Gläubiger, ein kleiner Drucker, hatte die Schwierigkeiten der Ullswater Press so persönlich genommen, daß er eigens einen Mann im Regenmantel engagierte, der auf der anderen Straßenseite Aufstellung bezog und den ganzen Vor- und Nachmittag zu unseren Fenstern hochstarrte. Mehr tat er nicht, nur starren. Das sollte uns in Verlegenheit bringen. In der Kaffeepause starrten wir dann gehörig zurück, wozu wir uns zu dritt oder viert mit der Kaffeetasse in der Hand ans Fenster stellten. Ein seltsamer Anblick, dieser Mann im Regenmantel; er war so fehl am Platz in diesem schicken, teuren Londoner Viertel; aber er sollte ja eben durch seine Schäbigkeit auffallen. In dem Teil South Kensingtons, wo ich von Montag bis Freitag allmorgendlich das Haus verließ, wäre er nur der berühmte Mann-von-der-Straße gewesen, den die Politiker so gern zitierten: einer von vielen. Aber hier im West End schauten alle auf den Mann, dann zu unseren Fenstern herauf, dann wieder auf ihn.
In Millys Haus in South Kensington bezahlten alle ihre Wochenmiete, und wenn sie dafür noch so sehr knausern und sparen mußten, verrechneten die Shillings und Pence jener Tage gegen winzigste Einsparungen bei Lebensmitteln und Strom; in Millys Haus addierten und subtrahierten, multiplizierten und dividierten die Leute unablässig; und da war Kate mit ihren bewährten Schächtelchen für »Bus«, »Gas« und »Sonstiges«. Hier im West End dachte man in größeren Maßstäben und hatte nur Verachtung für lästige Gläubiger, als ob sie bloß den Blick auf Höheres verstellten. Wir in unserem lauten Gemeinschaftsbüro fühlten uns nicht sonderlich angesprochen: schließlich waren wir nicht zuständig, die Verantwortung lag bei Ullswater Press, bei Mr. Ullswater und Martin York und den anderen Namen, die den Vorstand bildeten; vor allem bei Martin York, denn er war der Geschäftsführer. Er war es auch, der mir immer die Manuskripte ehemaliger Kriegskameraden oder Schulfreunde anschleppte. »Ob das einen Bestseller gibt? Lesen Sie es mal, und sagen Sie mir, ob es ein Bestseller werden könnte. Wir brauchen ein paar Bestseller.« Auf meinem Schreibtisch stapelten sich die Korrekturfahnen von Büchern, die ihrer Veröffentlichung harrten, warteten lange, daß die Reihe an sie kam. Ich bearbeitete sie gewissenhaft: Wörter, Sätze, Absätze, Interpunktion. Aber sie lagen auch noch lange auf meinem Schreibtisch, wenn sie längst wieder in die Druckerei hätten gehen können. Neuer Kredit war von Druckern und Buchbindern schwer zu bekommen. »Mrs. Hawkins, halten Sie mir diese Autoren vom Leib.«
Die Autoren – sie wollten wissen, warum der Erscheinungstermin immer wieder verschoben wurde. Das Telefon klingelte, und Ivy antwortete in ihrem affektiertesten Ton, mit dem sie die Geräuschkulisse des Gemeinschaftsbüros übertönte: »Mrs. Hawkins ist leider in einer Besprechung. Kann ich ihr etwas ausrichten? Nein, ich weiß nicht, wann sie wiederkommt. Nein, ich kann sie nicht stören, sie ist in einer Besprechung.« Ich erfuhr auf Nachfrage, daß es eine alte, von Martin York eingeführte Tradition im Verlag sei, »in« einer Besprechung, nicht »bei« einer Besprechung zu sagen. »In« klang wahrscheinlich mehr nach Unabkömmlichkeit und bitte nicht stören. Ivy verstand es, dieses »in einer Besprechung« von vornherein so empört klingen zu lassen, als sei der bloße Gedanke, jemanden am Telefon zu verlangen, der so beschäftigt war, schon eine Unverschämtheit. Ivy hatte den Ullswater-Geist erfaßt. Bald stapelte sich um Ivys Schreibtisch herum das Papier, denn Mary, die Bürogehilfin, verließ uns und begründete das mit der »Atmosphäre«, die durch Mabels tumultuöse Besuche erzeugt werde. Ein Ersatz wurde nicht eingestellt.
Meist nach der Teepause rief dann Martin York über die Sprechanlage: »Haben Sie einen Moment Zeit, Mrs. Hawkins?« Der Moment war jedesmal eine Stunde, manchmal mehr. Er wollte reden, sich jemandem anvertrauen. Dann stand er am Fenster, sah hinunter in den Hof hinterm Haus und redete. Oder er setzte sich mir gegenüber in den Ledersessel und redete.
»Sherry? Whisky?« fragte Martin York.
Ich nahm nur dann einen Sherry, wenn er mich länger als bis halb sechs, meinem normalen Feierabend, bei sich festhielt. Ich war an Überstunden gewöhnt, vor allem seit die