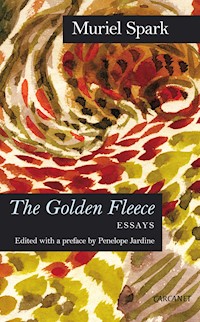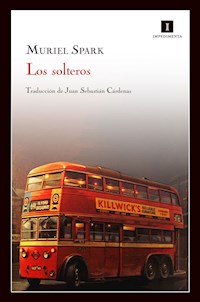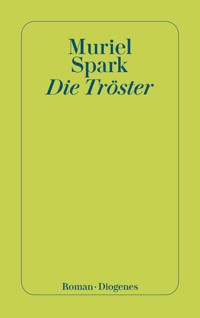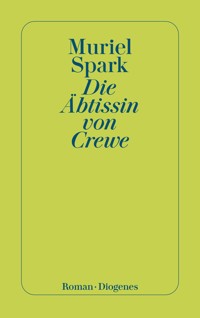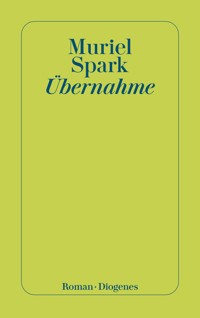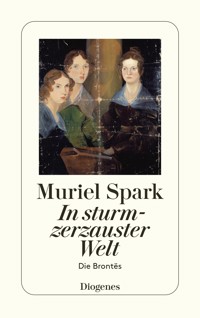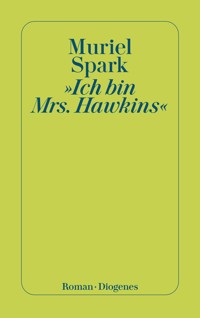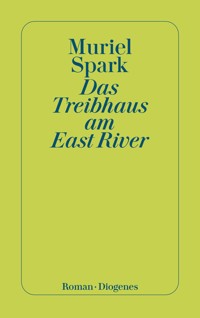6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Skurrile Junggesellen auf der Suche nach ihrem ganz persönlichen Glück: Patrick Seton etwa versucht, als Medium die Mitglieder eines spiritistischen Zirkels zu beeinflussen. Ronald Bridges, dessen epileptische Anfälle ihn am Priesteramt gehindert haben und der sich nun als Graphologe durchschlägt. Die Wege überkreuzen sich. Ob Seton hinter Gitter kommt, hängt von Bridges' graphologischem Gutachten ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Muriel Spark
Junggesellen
Roman
Aus dem Englischen von Elisabeth Schnack
Diogenes
Erstes Kapitel
Über London, der großen Junggesellen-Stadt, erschien allmählich das Tageslicht. Auf die Vordertreppen der Häuser von Hampstead Heath bis Greenwich Park und von Wanstead Flats bis Putney Heath wurden kleine Milchflaschen gestellt, vor allem aber in Hampstead, vor allem in Kensington.
In Queen’s Gate, Kensington, und in der Harrington Road, in The Boltons, Holland Park und in der King’s Road in Chelsea und deren rückwärtigen Gefilden regten sich die Junggesellen zwischen ihren Leintüchern, griffen nach den aufgezogenen Taschenuhren und stellten mit erwachender Intelligenz die Zeit fest; dann fiel ihnen ein, daß es Samstagmorgen war, und sie drehten sich auf die andere Seite. Doch gerade, weil es Samstag war, waren die meisten von ihnen bald draußen auf der Straße, wo sie ihre Einkäufe an Eiern und Speck tätigten, fürs Frühstück der ganzen Woche und gelegentlich für ein Nachtessen; und die Junggesellen machten sich rechtzeitig auf die Beine, noch vor viertel nach zehn, um nicht von den Frauen, den legitimen Kundinnen, herumgeschubst zu werden.
Viertel nach zehn blieb Ronald Bridges, siebenunddreißig Jahre alt und während der Wochentage als Hilfs-Kurator in einer kleinen Handschriften-Sammlung der City of London beschäftigt, auf der Straße stehen, um mit seinem Freund Martin Bowles, einem fünfunddreißigjährigen Juristen und Barrister, zu sprechen.
Ronald hob seine alte Plastik-Markttasche ein paarmal in die Höhe, um Martin vorzumachen, sie sei schwerer, als sie’s wirklich war, und daß der ganze Kram ihn anöde.
»Wo hast du die gefrorenen Erbsen her?« fragte Ronald und deutete auf ein Paket, das zuoberst auf Martins vollgestopfter Tasche lag.
»Von Laytons.«
»Wieviel?«
»Ein Schilling sechs. Soviel kostet ein kleines Paket; es reicht für zwei. Ein großes kostet zwei Schilling sechs, das reicht für sechs Personen.«
»Gräßlich teuer«, sagte Ronald teilnahmsvoll.
»Ewig muß man’s Portemonnaie zücken«, sagte Martin.
»Was hast du sonst noch gekauft?« fragte Ronald.
»Kabeljau. Muß man in Yoghurt backen, mit Majoran bestreut, dann schmeckt’s wie Heilbutt. Meine alte Ma ist für vierzehn Tage verreist, zusammen mit ihrer alten Haushälterin.«
»Majoran? Wo bekommt man denn Majoran?«
»Oh, bei Fortnums. Bei denen bekommt man sämtliche Kräuter. Ich hol mir da jeden Monat eine Tüte voll Zeugs. Ich mach fast alle Einkäufe und besorge auch den größten Teil der Kocherei, seit meine alte Ma die Operation gehabt hat. Und die alte Carrie ist nicht sehr auf der Höhe – sie war nie eine besondere Köchin.«
»Aber du scheinst es in dir zu haben, wenn du den ganzen Weg bis nach Piccadilly gehst, bloß um Kräuter zu besorgen«, sagte Ronald.
»Meistens verbinde ich’s mit was anderem«, erwiderte Martin. »Wir lieben Kräuter, Ma und ich. – Komm hier mit rein!«
Er meinte eine Kaffeestube. Sie saßen neben ihren Markttaschen und nippten mit zufriedener Faulheit von ihrem Espresso.
»Ich habe Tide1 vergessen«, sagte Ronald. »Muß daran denken, Tide zu besorgen.«
»Machst du dir denn keine Liste?« fragte Martin.
»Nein. Ich verlaß mich auf mein Gedächtnis.«
»Ich mach mir eine Liste«, sagte Martin, »wenn meine Ma nicht da ist. Ich erledige die Besorgungen immer am Wochenende. Und wenn Ma zu Hause ist, macht sie die Liste. Aber dann ist sie immer unleserlich.«
»Zeitverschwendung«, sagte Ronald, »wenn man ein gutes Gedächtnis hat.«
»Erlauben Sie?« fragte ein Mädchen, das gerade in die Kaffeestube gekommen war. Sie deutete auf Ronalds Markttasche auf der Sitzbank, die an der Wand entlanglief.
»Oh, Verzeihung!« sagte Ronald, nahm die Tasche weg und stellte sie derb auf den Fußboden.
Das Mädchen setzte sich, und als die Kellnerin kam, um sie zu bedienen, sagte sie: »Ich warte auf einen Freund.«
Sie hatte schwarzes Haar, das straff nach hinten frisiert war, und dunkle Augen und das Gesicht einer Ballett-Tänzerin. Sie gab den schläfrigen Routine-Blick der beiden Junggesellen zurück, zündete sich dann eine Zigarette an und behielt die Tür im Auge.
»’s gibt neue Kartoffeln in den Geschäften«, sagte Ronald.
»Die gibt’s jetzt ständig in den Geschäften«, entgegnete Martin. »Wenn’s die Saison dafür ist, und auch sonst. So ist’s mit allem: man kann jetzt das ganze Jahr über neue Kartoffeln und neue Karotten bekommen und jederzeit Erbsen und Spinat und im Frühling sogar Tomaten!«
»Zu Preisen!« seufzte Ronald.
»Zu Preisen!« bestätigte Martin. »Was für Speck kaufst du dir?«
»Ich behelfe mich mit durchwachsenem. Beim Frühstück knausere ich«, erwiderte Ronald.
»Wie ich.«
»Ewig muß man’s Portemonnaie zücken«, sagte Ronald, bevor Martin es sagen konnte.
Ein kleiner, schmächtiger Mann kam zur Türe herein und trat auf das Mädchen zu, das er mit einem süßlich verzückten Ausdruck anlächelte.
Er setzte sich neben das Mädchen auf die Wandbank. Er hob die Speisekarte hoch und sprach in ihrem Schutz auf das Mädchen ein.
»Gerechter Gott«, murmelte Martin.
Ronald blickte zu dem Mann hinüber, dessen Körper jetzt durch das neben ihm sitzende Mädchen verdeckt war. Ronald sah nur den Kopf und konnte zuerst nicht feststellen, ob das Haar blond oder silberweiß war, doch bald sah er, daß es meliert war. Der Mann war mager, hatte ein sehr spitzes, ängstliches Gesicht, eine spitze Nase und eine grauweiße, faltige Haut. Er mochte etwa fünfundfünfzig sein. Er trug einen dunkelblauen Anzug.
»Sieh nicht hin!« flüsterte Martin. »Er steht unter Anklage, und ich vertrete die Klage. Nächste Woche kommt er wieder vor den Untersuchungsrichter. Er muß sich jeden Tag bei der Polizei melden.«
»Weswegen?«
»Betrügerische Aneignung fremden Eigentums und möglicherweise noch andere Beschuldigungen. Einer meiner Kollegen hat vor Jahren den Seton verteidigt. Nicht etwa, daß es einem oder dem andern was genützt hätte. Komm, wolln gehen!«
Ronald legte die Zeitung, die er in der Hand gehalten hatte, auf den Tisch.
»Tide«, sagte Ronald auf der Straße draußen. »Ich darf Tide nicht vergessen.«
»In welcher Richtung gehst du?«
»Zu Claytons rüber.«
»Ich auch. Ich hab nicht sehr viel beim Kaufmann zu besorgen, weil ich nächste Woche viermal auswärts esse. Wohin gehst du denn sonntags immer?«
»Oh, mal hierhin und mal dorthin«, antwortete Ronald. »’s ist immer irgend jemand.«
»Ich geh nach Leighton Buzzard, falls jemand zu uns kommt und Ma Gesellschaft leistet«, erzählte Martin. »Meistens ist’s ganz nett in Leighton Buzzard, und es ist eine Abwechslung. Aber wenn Isobel in London bleibt, geh ich zu ihr.« Sie hatten die Straße überquert.
»Ich habe meine Zeitung im Café liegenlassen«, entschuldigte sich Ronald ziemlich unbeholfen. »Ich kehr lieber um und hol sie. Also ein andermal!«
»Geht’s dir auch gut?« fragte Martin, als Ronald sich noch vor dem Prellstein umdrehte, um die Straße ein zweites Mal zu überqueren.
»Doch, doch, ja – es ist nur wegen der Zeitung!«
»Bestimmt?« Martin dachte nämlich besorgt an Ronalds Epilepsie.
»Wiedersehn!« Ronald war schon auf der andern Straßenseite.
Er fand die Zeitung. Er setzte sich wieder hin, jedoch diesmal auf einen Stuhl gegenüber von seinem alten Platz, so daß er den silberblonden Mann besser beobachten konnte, wie er mit leiser Stimme auf das schwarzhaarige Mädchen einsprach und sich bemühte, ihr etwas klarzumachen. Ronald bestellte Kaffee und einen Sahnekuchen. Er schlug die Zeitung auf, und von Zeit zu Zeit blickte er daran vorbei auf den Mann, der sich eindringlich vor dem Mädchen rechtfertigte. Ronald konnte sich nicht besinnen, wo er den Mann schon gesehen hatte; er war nicht einmal ganz sicher, ihn überhaupt gesehen zu haben. »Ich werde eine neugierige alte Jungfer«, sagte er sich beim Fortgehen, um damit seine Rückkehr zum Café vor sich selbst zu rechtfertigen. Er wollte sich lieber eine neugierige alte Jungfer nennen, als den wahren Grund offen zuzugeben: daß er einfach wieder einmal sein Gedächtnis geprüft hatte. Denn er konnte keine Gelegenheit vorübergehen lassen, ohne an sich selbst ein Experiment vorzunehmen, ob die Epilepsie eines Tages seine Geisteskräfte schädigen würde.
»Nein«, hatte der amerikanische Spezialist gesagt und war verärgert gewesen, weil er sich bemühen mußte, einen medizinischen Gesichtspunkt in der Umgangssprache auszudrücken, »es besteht kein Grund, weshalb Ihr Verstand geschädigt werden sollte, abgesehen natürlich davon, daß Sie ihn nicht im gleichen vollen Ausmaß gebrauchen können, wie es Ihnen möglich wäre, wenn Sie sich einer normalen Laufbahn widmen und es darin zu einer Höchstleistung bringen könnten. Ihre gegenwärtigen geistigen Fähigkeiten sollten Sie sich jedoch bewahren und sie sogar entwickeln. Die Attacken sind intermittierend. Vielleicht darf ich es so ausdrücken, daß die Attacken das Gehirn, aber nicht den Geist berühren. Bis zu einem gewissen Grade werden Sie es erlernen, sich körperlich auf sie vorzubereiten, jedoch nicht, um sie zu unterdrücken. Den Geist berühren sie nicht, das heißt, nur soweit, wie die emotionellen psychologischen Störungen ihn berühren. Das gehört nicht in mein Fach.«
Während der letzten vierzehn Jahre hatte Ronald jedes einzelne dieser Worte als wichtig in seinem Gedächtnis behalten, aus der Überzeugung heraus, daß der Spezialist sich vielleicht nur an das Hauptsächlichste erinnern würde, und auch dann nur mit Hilfe der Kartothek. Ronald jedoch bewahrte sie fest im Gedächtnis, und von Zeit zu Zeit unterwarf er die Worte jeder nur erdenklichen Auslegung. »Vielleicht darf ich es so ausdrücken, daß die Attacken das Gehirn, aber nicht den Geist berühren.« Doch er glaubt ja, so überlegte Ronald im Laufe der Jahre hin und wieder, der Geist sei ein Teil des Gehirns: weshalb hat er dann gesagt »Vielleicht darf ich es so ausdrücken …« Was hat er damit gemeint? Und überhaupt, dachte Ronald, komme ich schon durch. Und überhaupt hätte ich’s vielleicht ohnehin niemals geschafft, mich einer normalen Laufbahn zu widmen und es darin zu einer Höchstleistung zu bringen. Was wäre eine normale Laufbahn? Jurisprudenz? Mir verschlossen; – zwar hatten seine Freunde gesagt, du brauchst dich ja nicht gleich um den Lord-Chancellor-Posten zu bewerben; du könntest ein erfolgreicher Anwalt sein. – Oh, glaubt ihr das? Ihr habt mich nicht erlebt, wenn ich einen Anfall habe. – Beamter? Mir verschlossen. – Oh, aber durchaus nicht, hatten seine Berater erwidert. In der Medizin oder im Lehrfach … du könntest dich an einem College anstellen lassen, du bist der geborene Akademiker; du weißt doch, wie manche Universitätslehrer sind … du würdest gar nicht auffallen …
»Ich könnte nie erstklassig sein.«
»Ach was, erstklassig …«
Er war damals vierundzwanzig, mitten im Studium, als die Anfälle begannen: ohne Warnung und drei Monate, nachdem er sich der Theologie zugewandt hatte. Das Priesteramt: mir verschlossen. – Ja, hatten seine Freunde gesagt, das kommt nicht mehr in Frage; und, sagten seine theologischen Ratgeber, etwas Gutes wäre doch nicht dabei herausgekommen, du bist nicht berufen.
»Woher wollt ihr das wissen?«
»Weil du in dem Falle nicht Priester werden kannst.«
»Das ist genau die Art retrospektiver Logik, die uns Katholiken in Mißkredit bringt.«
»Eine Berufung für das Priesteramt ist der Wille Gottes. Gottes Wille kann durch nichts umgestoßen werden. Du bist Epileptiker. Kein Epileptiker kann Priester werden. Ergo hattest du keine Berufung. Aber du kannst sonst etwas tun.«
»Ich könnte nirgends erstklassig sein.«
»Das ist der reinste Hochmut« – ein alter Priester sagte es – »du bist nicht zum erstklassigen Karriere-Macher bestimmt.«
»Wohl nur zum erstklassigen Epileptiker?«
»Ja, allerdings. Doch, ganz im Ernst«, sagte der alte Priester.
Zu einer Zeit, als er dreimal wöchentlich Krämpfe bekam, hatte er eingewilligt, daß ihn ein durchreisender Spezialist nach Kalifornien zu einem Forschungs-Institut mitnahm, wo er sich einer zwei Jahre währenden klinischen Erprobung eines neuen Heilmittels unterziehen sollte. Er war einer von sechzig freiwilligen Patienten, die im Alter zwischen fünf und achtundzwanzig Jahren standen. Ronald wohnte in einem riesigen Heim mit lauter Sonnenbalkonen. Ein paar von den andern neunundfünfzig waren schwachsinnig. Die meisten waren neurotisch. Kein einziger war hochintelligent. Von den sechzig Patienten sprachen nur drei nicht auf das neue Heilmittel an, und Ronald war einer von ihnen. Von diesen dreien erlag Ronald dem gefürchteten status epilepticus und erlitt – schon vier Tage nach Beginn der Behandlung – in fast ununterbrochener Folge einen Anfall nach dem andern.
»Das ist auf nervöse Voreingenommenheit zurückzuführen«, erklärte Doktor Fleischer, als er nach einer Woche mager und erschöpft und wieder teilweise genesen in einem kühlen grünweißen Zimmer mit heruntergelassenen Sonnenjalousien lag. »Sie können von dem Experiment zurücktreten, wenn Sie es wünschen«, sagte Doktor Fleischer. »Oder Sie können zu Ihrem eigenen Nutzen damit fortfahren.« Doktor Fleischers Zeit und Denken gehörte vor allem den siebenundfünfzig Epileptikern, die schon begonnen hatten, auf das neue Heilmittel günstig anzusprechen.
Als Ronald außer Bett war und von den Nebenwirkungen seines gewohnten Mittels halbbetäubt und schwankend herumlief, versuchte er sich den Preis einer vielleicht möglichen Heilung klarzumachen. Er lebte inmitten von jenen Patienten, die auf Doktor Fleischers Behandlung ansprachen, und sie schienen ihm noch schläfriger und betäubter, als er selber es war – aber, so fand Ronald, damit sind sie nicht weit entfernt von ihrem Normalzustand: sie sind von Geburt nur halbwach.
»Das neue Heilmittel schlägt an«, erzählte ihm die schicke junge Dame mit den stets frisch geschminkten Lippen, die im Forschungs-Institut arbeitete. »Versuche haben ergeben, daß das Mittel eine krampfstillende und beruhigende Wirkung auf Ratten ausübt, und jetzt sieht es ganz so aus, als ob es auch bei den meisten unserer Patienten anschlägt.« Sie lächelte, und hinter ihren randlosen Brillengläsern hervor blickte sie in die Ferne, auf dem Posten, tüchtig, Pfirsichhaut, erstklassig.
»Aber bei Ihrem Mittel geht’s mir schlechter«, widersprach Ronald und merkte, daß er ein höchst unangenehmer junger Mann sein konnte.
Als es ihm glückte, noch eine kurze Unterredung mit Doktor Fleischer herbeizuführen, fragte er ihn: »Begreifen Sie, was Sie von mir verlangen, wenn Sie darauf bestehen, daß ich durchhalte? Dann muß ich vielleicht wieder die pausenlosen Anfälle über mich ergehen lassen!«
Doktor Fleischer erwiderte: »Ich bestehe nicht darauf, daß Sie durchhalten. Aber wie ich schon sagte, sprechen Sie einzig aus einem nervösen Widerstand heraus nicht auf das Mittel an.«
»Können Sie sich vorstellen«, fragte Ronald, »wie lang einem die paar Sekunden geistiger Klarheit zwischen den Anfällen vorkommen, und was man in jenen paar Sekunden wachen Bewußtseins denkt?«
»Nein«, erwiderte der Arzt, »ich kann es mir nicht vorstellen, wie es sich mit diesen lichten Augenblicken verhält. Ich empfehle Ihnen, nach England zurückzukehren. Ich empfehle … Ich rate … Nein, es besteht kein Grund, weshalb Ihr Verstand geschädigt werden sollte, abgesehen natürlich davon, daß Sie ihn nicht im gleichen vollen Ausmaß gebrauchen können, wie es Ihnen möglich wäre, wenn Sie sich einer normalen Laufbahn widmen und es darin zu einer Höchstleistung bringen könnten …«
»Vielleicht werde ich ein erstklassiger Epileptiker«, entgegnete Ronald. »Vielleicht ist das meine Karriere.«
Doktor Fleischer lächelte nicht. Er griff nach Ronalds Krankengeschichte und trug etwas ein.
Ehe Ronald abreiste, wurde sein Gehirn mittels eines Apparates untersucht, der ihm jetzt vertraut war: er verzeichnete die durch seine Krämpfe ausgelösten elektrischen Ströme und wurde bereits in den Kriminalgerichtshöfen einiger amerikanischer Staaten benutzt, um eine verdächtige Aussage auf ihre Wahrheit hin zu prüfen, so daß er im Volksmund den Namen ›Lügendetektor‹ erhielt.
Während Ronald auf den Mann wartete, der ihn nach England zurückbegleiten sollte, bemühte er sich nach Kräften, seine Umgebung zu ignorieren. Die andern Patienten beschäftigten sich Woche für Woche mit Tennis, Bettenmachen, Spielzeug-Basteln und ihrer eigenen Jazz-Kapelle. Erst viel später kehrten diese Bilder, die Ronald absichtlich übersah, immer wieder zurück, und stets im Zusammenhang mit Doktor Fleischers Worten, die der Spezialist wahrscheinlich längst vergessen hatte – und meistens in Augenblicken, wenn Ronald, seiner Ich-Versponnenheit überdrüssig, am lebhaftesten sowohl sich selbst, wie auch die Kliniken und Krankenhäuser, die Ärzte und all die wichtigtuerischen Begleitumstände seiner Krankheit zu vergessen wünschte. Gerade in solchen Augenblicken innerer Ablehnung überwältigten ihn die Zwangsvorstellungen seiner ersten epileptischen Jahre, und er empfand sich nicht als den liebenswürdigen Peter, der zu sein er – aus reiner Gutmütigkeit und aus Schutzbedürfnis vor der Welt – damals vorgegeben hatte, sondern als einen von Dämonen Besessenen, über den die Untersuchungs-Inquisitoren des Lebens zu Gericht sitzen – eine unbefriedigende Versuchsratte, die nicht auf das richtige Heilmittel ansprach. Im Laufe der Zeit schärfte diese Erfahrung seinen Verstand, und wenn er sich insgeheim in der Welt seiner Bekannten umsah, dann wurde er in bestimmten, hochgespannten Augenblicken zum Lügendetektor, vor dem seine Freunde einen dämonisch-heuchlerischen Aspekt annahmen. Doch da er ein vernünftiger Mensch war, ließ er solche Anwandlungen kommen und gehen, ja im Grunde hatte er seine Freunde eigentlich sehr gern und beriet sie aufs beste, wenn sie ihn in den folgenden Jahren um Rat zu bitten begannen.
Nach der Rückkehr aus Kalifornien entdeckte er überrascht, daß er während seiner Anfälle – obwohl er sie nicht beeinflussen konnte – in gewissem Grade und mittels einer geheimen, undefinierbaren Methode fähig war, das Bewußtsein nicht zu verlieren; wenn er es aber seinen Ärzten zu beschreiben versuchte, konnte er sicher sein, daß es ihm beim nächsten Anfall mißlang.
»Ich finde es nützlich«, hatte Ronald anfänglich seinem Arzt erzählt, »wenn ich zu versinken beginne, in mir selbst ein Gefühl heraufzubeschwören – ein Gefühl, daß alles Geschehen in der Welt vorübergehend zum Stillstand kommt, solange mein Anfall dauert …«
»Die Attacke«, verbesserte der Arzt.
»Die Attacke«, sagte Ronald. »Und das macht es mir seltsamerweise möglich, sogar während des schlimmsten Teils eine Art Bewußtsein zu behalten. Ich finde es leichter, meine Reaktionen während eines Anfalls mit diesem gewissen Bewußtsein über mich ergehen zu lassen, als mit allen Sinnen nachzugeben – obwohl es ein schmerzhaftes Erlebnis ist.«
Kaum hatte er es geäußert, da kam er sich schon töricht vor und wußte, daß seine Erklärung unzureichend war. Der Doktor bemerkte dazu: »Es ist so, wie ich sagte: immer tritt eine Besserung ein, sobald sich der Patient an die Attacken gewöhnt hat. Zuerst spürt er die Aura2, und dadurch wird es ihm möglich, rechtzeitig Vorsichtsmaßnahmen für seine körperliche Sicherheit während der Attacke zu treffen. Er lernt …«
»Nein, das habe ich gar nicht gemeint«, unterbrach ihn Ronald. »Was ich meine, ist etwas ganz anderes. Es ist so, als ob ich während des Anfalles …«
»… während der Attacke«, warf der Arzt ein und zerbrach sich stirnrunzelnd den Kopf.
»… als ob ich während der Attacke zuschaue, jedoch nicht ganz, nur teilweise Zuschauer bin.«
»Ganz recht«, sagte der Arzt. »Der Patient lernt es, während des Petit-Mal-Stadiums eine Kontrolle auszuüben, die ihm während der Krämpfe des Grand-Mal sehr zustatten kommt.«
»Stimmt«, bestätigte Ronald, begab sich auf den Heimweg und hatte auf der Straße einen schweren Anfall, bei dem seine Methode nicht funktionierte, so daß er erst in der Ambulanz-Abteilung des St. George’s Hospitals zu sich kam, als ihm ganz übel vom Inhalieren des Chloroforms war, mit dem man ihn behandelt hatte, um sein Toben zu beschwichtigen.
Bald sah sich Ronald gezwungen, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Sein Vater, ein ehemaliger Gartenarchitekt, der noch immer den frühen Tod seiner Frau beklagte, war furchtbar erschrocken, als er begriff, daß Ronald unheilbar war. Ronald beruhigte ihn, riet ihm, sich in eine Rentenversicherung einzukaufen und fortan in Kew3 zu leben; der Vater lächelte und tat es.
Ronald fand einen Posten in einer kleinen Handschriften-Sammlung in der City, die von Leuten verschiedener Berufe wie auch von merkwürdigen Typen aus dem Publikum aufgesucht wurde. Selbst Kriminologen aus dem Ausland kamen in das kleine Museum, Männer, die das Datum von Manuskripten oder die Handschrift von Dokumenten begutachten lassen wollten, deren Echtheit fragwürdig war. Einige Leute kamen in der Hoffnung, eine »Deutung« zu erhalten, worunter sie eine Expertise verstanden, die den Charakter und die Zukunftsaussichten einer Person klarlegen sollte, deren Handschrift sie vorwiesen – doch sie wurden fortgeschickt. Ronald erwarb sich allmählich den Ruf, Fälschungen aufdecken zu können, und nach etwa fünf Jahren wurde er gelegentlich von Rechtsanwälten und Kriminalisten zu Rate gezogen und wiederholt vom Verteidiger oder Kronanwalt als Zeuge vor Gericht geladen.
Im Museum hatte er ein Zimmer für sich allein, und es war vereinbart worden, daß er dort ungestört Anfälle haben konnte, ohne daß jemand ihm aufgeregt »zu Hilfe kam«. Er wußte, wie er sich auf einen Anfall vorbereiten mußte. Er bediente sich seiner geheimen Methode, während der Krämpfe das Bewußtsein nicht gänzlich zu verlieren, und nie wieder erwähnte er sie vor den Ärzten, um die Fähigkeit ja nicht einzubüßen. Er hatte stets ein keilförmiges Korkstückchen bei sich, das er zwischen die Zähne steckte, wenn ihn die ersten Anzeichen überfielen. Er wußte, wie viele Sekunden es erforderte, um die Gasflamme in seinem kleinen Zimmer abzustellen, die richtige Dosis seiner Tabletten einzunehmen, sich flach auf den Rücken zu legen, den Kopf auf die Seite zu drehen, auf das Korkstück zu beißen und den »Sturm« zu erwarten. Es galt als abgemacht, daß keiner, der unter solchen Umständen Ronalds Zimmer betrat, ihn anfassen durfte, es sei denn, daß ihm Blut aus dem Mund floß. Blut war nie auf seiner Lippe zu bemerken, nur Schaum, denn Ronald gab stets gut auf das Korkstückchen acht. Seine beiden alten Kollegen und die zwei jungen Angestellten gewöhnten sich an ihn, und die Schreibmaschinen-Hilfe, eine umfangreiche, fromme Frau, gab den Versuch auf, ihn zu bemuttern.
Nach fünf Jahren war Ronald soweit, daß seine Anfälle durchschnittlich einmal im Monat auftraten. Dank des Mittels, das er regelmäßig und – bei der ersten Ankündigung eines Anfalls – in doppelter Dosis einnahm, gelang es ihm allmählich, seine Bewegungen immer besser zu kontrollieren, so daß er häufig das heftigste Stadium eines Anfalls so lange hinausschieben konnte, bis er einen passenden Platz gefunden hatte, an dem er sich niederlegen konnte. Zweimal innerhalb von vierzehn Tagen wurde er wegen Trunkenheit verhaftet, weil er die Straße entlangtorkelte, auf dem Weg zu einem Apotheker. Zweimal hatte er sich einfach dicht vor die Hausmauer auf den Bürgersteig gelegt und sich von einem Krankenwagen fortschaffen lassen. Sooft wie möglich benutzte er ein Taxi oder ließ sich von einem Freund in dessen Wagen mitnehmen.
Einmal hatte ihn der Portier seines Mietshauses gefunden, als er zusammengekrümmt und heftig um sich schlagend auf dem Boden des Fahrstuhles lag, und hinterher hatte Ronald die üblichen Erklärungen in geduldiger Reihenfolge papageienhaft heruntergeplappert. Nach derartigen Attacken außerhalb seiner Wohnung, einerlei, wo sie sich ereigneten, pflegte Ronald nach Hause zu gehen und zwölf bis vierzehn Stunden hintereinander zu schlafen. Doch in den letzten Jahren hatten sich seine Anfälle meistens zu Hause in seiner Wohnung abgespielt, in einem Einer-Apartment in der Old Brompton Road, und daher glaubten seine Freunde, er leide weniger häufig an Anfällen, als es tatsächlich der Fall war.
Ronald war allmählich zu einem freundlichen Menschen mit schlaksiger Haltung, eingezogenen Schultern, etwas vernachlässigten Zähnen und frühzeitig ergrauten Haaren geworden.
»Sie können heiraten«, meinte sein Arzt.
»Kann ich nicht«, erwiderte Ronald.
»Sie könnten Kinder haben. Die Gefahr der Vererbung ist äußerst zweifelhaft. Das Risiko ist sehr gering. Sie könnten heiraten. Wirklich. Sie sollten …«
»Ich kann nicht«, erwiderte Ronald.
»Warten Sie nur, bis die Richtige kommt! Wenn jemand ein Leiden wie das Ihre hat, dann kann die rechte Frau etwas ganz Wunderbares und Verständnisvolles sein. Es geht nur darum, daß man die Richtige kennenlernt.«
Fünf Jahre nach seiner Rückkehr aus Amerika hatte Ronald »die Richtige« kennengelernt. Ihr wunderbares Verständnis für seine Anfälle fand er ebenso entsetzlich, wie er ihre Schönheit rührend fand. Es war eine in England geborene Tochter deutscher Emigranten. Sie war gesund, brünett, strahlend, noch keine zwanzig und von herrlichem Wuchs. Zwei Jahre lang wusch und stopfte sie seine Socken, zählte sie seine Wäsche, besorgte sie seine Samstags-Einkäufe, schlief sie mit ihm und ging sie mit ihm ins Theater.
»Ich bin durchaus imstande, die Theaterkarten selbst zu besorgen«, sagte er.
»Mach dir keine Gedanken, Darling, ich hole sie während meiner Mittagspause!« sagte sie.
»Hör mal, Hildegarde, es ist nicht nötig, daß du mich bemutterst. Ich bin kein Idiot.«
»Weiß ich, Darling. Du bist ein Genie!«
Daß es zwischen ihnen nicht geklappt hatte, hing jedoch irgendwie mit der Graphologie zusammen. Hildegarde hatte angefangen, sich mit der Sache zu beschäftigen, um ihren Geliebten in seinen beruflichen Interessen um so besser verstehen zu können. Hildegarde nahm an einem kurzen Kursus teil, und allein dank ihres guten Gedächtnisses gelang es ihr, sich all jene Tatsachen zu eigen zu machen, die Ronald sich nicht merken konnte und die er in jedem Falle aus Gewissenhaftigkeit in Lehrbüchern nachgeschlagen hätte, wenn er sie hätte anwenden müssen.
Aber Hildegarde war damit wohlversehen und kramte häufig ihr Wissen hervor.
»Du hast ein besseres Gedächtnis als ich«, sagte Ronald eines Sonntagmorgens, als sie in Hausschuhen in Ronalds Zimmer herumschlurften.
»Ich kann mir alles für uns beide merken«, antwortete sie.
Am gleichen Nachmittag fragte sie ihn: »Hast du jemals ein Gehörleiden gehabt?«
»Ein Gehörleiden?«
»Ja – schlimme Ohren?«
»Nur als Kind«, entgegnete er. »Ohrenschmerzen.«
Sie stand neben seinem Schreibtisch und blickte auf ein paar handschriftliche Notizen, die er sich gemacht hatte.
»Die Bildung deiner großen I deutet auf ein Gehörleiden«, sagte sie. »Es sind auch Anzeichen dafür vorhanden – hier, in der Verschiedenheit der Winkel –, daß du gern nach deinem eigenen Kopf handelst, wahrscheinlich eine Folge des frühen Todes deiner Mutter, und weil dein Vater sich nicht genügend um dich gekümmert hat. Der Gefühls-Rhythmus ist unregelmäßig, und das bedeutet, daß dein Verhalten deiner Umgebung manchmal unverständlich erscheint.« Sie blickte lachend zu ihm auf. »Und vor allem zeigt deine Handschrift, daß du eine Art Genie bist.«
»Wo hast du das denn alles her?« fragte Ronald.
»Ich hab ein paar Lehrbücher durchgearbeitet. Es muß schon etwas dran sein – schließlich gehört es auch zur Handschriftenkunde.«
»Hast du dich damit beschäftigt, die Charaktere verschiedener Menschen aus ihrer Handschrift zu deuten, und hast du die Ergebnisse mit deiner Erfahrung verglichen?«
»Nein, noch nicht. Ich hab’s nur in den Büchern gelesen. Ich hab alles auswendig gelernt.«
»Dein Gedächtnis ist besser als meins«, wiederholte Ronald.
»Ich kann mich für uns alle beide erinnern.«
Und er dachte, wenn wir verheiratet sind, wird sie auch alles für uns beide tun. Als er daher Einwendungen erhob, weil sie die Theaterkarten besorgen wollte, und ihr erklärte, er könne es sehr gut selber tun – »ich bin kein Idiot« – und als sie erwiderte: »Weiß ich, Darling. Du bist ein Genie!«, da beschloß er, das Verhältnis mit dieser wundervollen Frau zu einem Ende zu bringen. Denn ihre Stimme nahm einen nachsichtigen Tonfall an, wenn sie ihm erklärte, er sei ein Genie, und er sah es bereits, wie sie in den kommenden Jahren für ihn kochen, einkaufen, denken und verdienen würde, bis er ganz zunichte geworden war. Wie in einer Vision sah er sich, aus einer seiner tierischen Rasereien erwachend, noch mit zuckenden Gliedern und Schaum vor dem Mund – und sie mit leuchtenden braunen Augen über ihm, und ihre schönen Lippen formten gönnerhaft und liebevoll ihre Lügen: »Gleich ist’s wieder gut, Darling, ’s kommt bloß daher, weil du so ein Genie bist.« Was nicht etwa ihren Glauben an seine geistigen Fähigkeiten andeutete, sondern ihren heimlichen Glauben an ihre eigene Überlegenheit.
Als es mit dem Verhältnis vorbei war, gewöhnte sich’s Ronald allmählich an, sein Gedächtnis zu prüfen, ob es ihn auch nicht in Folge seiner Krankheit im Stich lassen könnte. Am Samstagmorgen, als ihm im Café Patrick Seton gezeigt worden war, der kleine magere Mann, der am Dienstag zur Voruntersuchung antreten mußte, begann Ronald, nachdem er sich schwach an ihn zu erinnern vermeint und das Café verlassen hatte und nach Hause gegangen war, von neuem über ihn nachzudenken. Doch er konnte sich nicht an ihn oder an etwas erinnern, das mit ihm zu tun gehabt hätte. Er wünschte, daß er Martin Bowles nach dem Namen gefragt hätte. Leicht verärgert packte er seine Einkäufe aus und sortierte sie in ihre Fächer im Schrank. Dann ging er in die Kneipe hinüber.
Dort saßen bcim dunklen Glas Stout: der weißhaarige Kunstkritiker Walter Prett mit dunklem Gesicht, der eine Diättabelle studierte, der Londoner Korrespondent des Irish Echo, Matthew Finch, mit seinem lebhaften Lächeln und dem krausen schwarzen Haar, und dann noch Ewart Thornton, der dunkelhäutige Gymnasiallehrer mit der tiefen Stimme, der zum Spiritismus neigte. Es waren Junggesellen, mehr oder weniger überzeugte Junggesellen.
Alkohol war Ronald eigentlich nicht erlaubt, aber er hatte herausgefunden, daß die geringe Menge, die er gerne trank, bei seiner Epilepsie keinen Unterschied ausmachte, und daß gerade die Möglichkeit, einen Drink bestellen zu können, ihm ein Gefühl von Freiheit gab.
Er nahm sein Bier in Empfang, setzte sich zu seinen Freunden an den Tisch und trank stumm. Nach etwa fünf Minuten sagte er: »Nett, euch zu sehen.«
Matthew Finch fuhr sich mit dem Finger durch seine schwarzen Locken. Manchmal wurde Ronald vom Verlangen gepackt, mit seinen Fingern durch Matthews schwarze Locken zu fahren, doch fragte er sich jetzt nicht mehr, ob er, einzig auf Grund dieses Verlangens, vielleicht ein verkappter Homosexueller sei. Er hatte nämlich mal gesehen, wie ein Ehepaar mit einer impulsiven Geste gemeinsam Martins Haar zerwühlt hatte.
»Nett, euch alle hier zu sehen«, sagte Ronald.
»Eier: nur gekochte oder verlorene«, las Walter Prett mit betrübter Stimme von seinem Diätzettel ab. »Saure Gurken, aber keine süß-sauren Gürkchen. Keine Graupen, kein Reis, keine Makkaroni …«, er las es ruhig; dann wurde seine Stimme lauter, und selbst Ronald, der an Walter Pretts wechselnde Stimmenstärke gewöhnt war, schreckte zusammen. »Alle Arten frisches Obst, einschließlich Bananen, auch in Wasser eingemachtes Kompott«, bemerkte Walter maßvoll. »Keine Butter«, kreischte er, »kein Fett oder Öl«, brüllte er.
»Ich hab Berge von Heften zu korrigieren«, erzählte Ewart Thornton, »weil die schriftlichen Arbeiten für die Zeugnisse begonnen haben.«
Matthew ging zur Bar hinüber, brachte zwei marinierte Zwiebeln auf einem Teller an und aß sie.
Zweites Kapitel
Es war um sechs Uhr am Abend des gleichen Samstags in einem Doppelzimmer im dritten Stock eines Hauses in der Ebury Street. Patrick Seton saß in einem engen Sessel, den er aber, weil er schmal in den Hüften und Schultern war, nicht so ausfüllte, wie es andere Leute zu tun pflegen. Alice Dawes lag, noch halb angekleidet und mit Kopfkissen gestützt, in dem einen Couchbett. Ihre Freundin Elsie Forrest saß auf dem andern Couchbett und legte Alices Rock der Länge nach zusammen.
»Wenn du wenigstens etwas essen würdest«, sagte Elsie, »dann würdest du es mit andern Augen betrachten.«
»O Gott, wie könnte ich essen? Warum sollte ich essen?« rief Alice.
»Damit du zu Kräften kommst«, sagte Patrick Seton mit seiner eigentümlichen Stimme, die am Ende jeden Satzes zu versickern schien.
»Warum soll sie denn zu Kräften kommen, wenn sie doch dadurch wieder geschwächt wird?« meinte Elsie.
»Es war nur ein Vorschlag«, erklärte Patrick so leise, daß sie die letzte Silbe kaum hören konnten.
»Also ich tu’s jedenfalls nicht«, sagte Alice. »Du mußt dir was anderes ausdenken.«
»Nächste Woche ist dann noch der unselige Vorfall …«
»Ich sehe nicht ein«, sagte Elsie, »wie sie dich vor Gericht bringen können, wenn überhaupt kein Grund zur Anklage vorliegt.«
»Nicht der leiseste Grund«, rief Patrick – diesmal etwas kühner als sonst. »Sie müssen mich freisprechen. Es ist einfach wegen einer unbefriedigten Frau, die versucht, sich an mir zu rächen.«
»Du mußt doch was mit ihr gehabt haben«, sagte Elsie.
»Ich hab sie nie auch nur angerührt, darauf geb ich dir mein Ehrenwort«, erwiderte Patrick. »’s besteht alles nur in ihrer Einbildung. Während einer Sitzung hat sie sich plötzlich für mich interessiert, und mir tat sie leid, weil sie einsam war, und darum hab ich mich bei ihr eingemietet und ihr gute Ratschläge gegeben. Und jetzt hat sie sich ein vollkommen erdichtetes Lügengewebe ausgedacht. Das kann ich zu meiner Verteidigung anführen. Ein vollkommen erdichtetes Lügengewebe.«
»Komisch, daß die Polizei es verfolgt, wenn sie keine Beweise haben!« rief Elsie.
Alice ließ sich vom Bett her vernehmen: »Ich glaube felsenfest an Patrick, Elsie! Die Polizei ließe ihn nicht auf freiem Fuß, wenn sie glaubten, er wäre schuldig. Dann hätten sie ihn in Haft genommen.«
»Aber wenn er so überzeugt ist, daß er freigesprochen wird, warum muß er’s dir dann noch erzählen? Es ist schändlich, dich in deinem jetzigen Zustand so aufzuregen.«
»Ich wollte Alice nur vorschlagen«, entgegnete Patrick leise und strich mit seiner mageren grauen Hand über sein silberblondes Haar, während er Alice aus blassen, knabenhaften Augen anblickte, »daß wir vom Dienstag an, und sobald wir den unseligen Vorfall hinter uns haben, ein neues Leben beginnen können, wenn sie nur einen Spezialisten aufsuchen wollte und etwas machen ließe, ehe die Natur ihren freien Lauf nimmt, und …«
»Ich will keine Abtreibung«! sagte Alice. »Ich tue alles für dich, Patrick, das weißt du, aber sowas – nein! Mir graust es davor!«
»Es ist überhaupt nicht gefährlich«, entgegnete Patrick. »Heutzutage nicht mehr!«
»Ich würde mich nie getrauen«, erwiderte Alice. »Nicht mit meiner Krankheit!«
»Vielleicht hat er Pech am Dienstag«, warf Elsie ein.
»Ausgeschlossen«, sagte Patrick.
»O Elsie, du kennst Patrick nicht«, sagte Alice zu ihr.
Elsie fragte: »Warum verschwindet ihr nicht beide übers Wochenende ins Ausland, solange noch Zeit ist?«
Alice blickte Patrick an und fuhr sich mit der Hand an die Kehle, denn sie hatte früher eine Theaterschule besucht, und wenn sie auch kein unaufrichtiger Mensch war, so kam es ihr doch manchmal in den Sinn, gewisse Gemütsbewegungen, die sie verraten wollte, durch theatralische Gesten mit dem Kopf, den Händen, Schultern, Füßen, Augen und Lidern auszudrükken. Deshalb fuhr sie sich mit der Hand an die Kehle und blickte Patrick an, um ihre Angst vor seiner Antwort kundzutun.
Seine Antwort war so leise, daß Elsie fragen mußte: »Was?«
»… Schwierigkeiten mit den Pässen, wenn man auffällt.« Seine Stimme wurde lauter bei seiner nachdrücklichen Erklärung. »… sieht aus wie ein Eingestehen einer Schuld.«
»Patrick hat recht.« Alices Hände sanken wieder auf die Couchdecke, wo sie schlaff und mit offener Handfläche liegenblieben.
»Und wenn es schlecht für dich ausgeht, dann läßt du Alice in einer schönen Klemme!« sagte Elsie. »Wieviel würdest du im Höchstfall bekommen?«
»O Elsie!« rief Alice. »Laß das doch!«
Patrick blickte Elsie an, als wären Alices Worte eine hinreichende Antwort.
»Und wann«, fragte Elsie, »ist dein Scheidungsprozeß an der Reihe?«
»In ein paar Monaten«, antwortete Patrick, schlug die Beine übereinander und betrachtete seine Knie.
»An welchem Tag?«
»Am fünfundzwanzigsten November«, entgegnete Alice. »Das Datum werd ich nie vergessen, denn am sechsundzwanzigsten können wir heiraten.«
Patricks blaue Augen ruhten zärtlich auf ihr.
»Am sechsundzwanzigsten«, flüsterte er und schloß einen Augenblick die Augen, um sein Glück auszukosten.
»Ich habe Hunger«, sagte Alice.
»Zieh deinen Rock an«, schlug Elsie vor, »dann gehen wir und besorgen etwas. Iß nur ja nichts Fettes, das mußt du bloß wieder von dir geben.«
Alice erhob sich matt.
»Ich bin ganz ausgehungert«, sagte sie.
Elsie fragte: »Hast du heute früh an deine Spritze gedacht?«
»Natürlich«, erwiderte Alice. »Frag nicht so dumm! Patrick gibt mir regelmäßig jeden Morgen meine Spritze.« Sie deutete auf das Gefäß, in dem die Injektionsnadel steckte.
»Ach, ich dachte ja nur – weil du gesagt hast, du bist so hungrig. Diabetiker werden immer hungrig, wenn sie ihre Spritze nicht bekommen haben.«
»Sie ist hungrig, weil sie ihr Mittagessen erbrochen hat«, entgegnete Patrick, um Alice in Schutz zu nehmen.
Elsie sah ihn mißtrauisch an. »Ich will bloß hoffen, daß du ihr die Spritze regelmäßig gibst«, sagte sie. »Es ist lebenswichtig, daß jemand sie pflegt.«
Und das war’s, was Patrick auf einen neuen Gedanken brachte.
Doch erwiderte er nur sehr freundlich: »Gib ihr was Gutes zu essen!« Er streichelte Alices Wange. »Arbeite heute abend nicht zu viel, Liebling!«
»Ich weiß gar nicht, ob ich hingehen kann«, entgegnete Alice, die zitternd dastand und den Reißverschluß an ihrem Rock nach oben zog. »Elsie wird wohl anrufen müssen.«
»Sie muß einen leichteren Posten bekommen«, sagte Elsie. »Die Arbeit an der Kaffee-Bar ist für eine Frau in ihrem Zustand einfach zu schwer.«
»Was findest du eigentlich an ihm?« fragte Elsie.
Alice steckte ihren Bissen Omelette im Zeitlupen-Tempo in den Mund, um Nachdenklichkeit anzudeuten, obwohl sie die Antwort schon wußte.
»Oh«, sagte sie, »ich liebe ihn eben. Er hat etwas an sich. Du kannst dir nicht vorstellen, wie wunderbar er ist, wenn wir allein sind. Er ist so vergeistigt. Und er kann so herrlich Gedichte vortragen. Er ist wirklich eine Art Künstler.«
»Ich gebe zu, daß er ein erstklassiges Medium ist«, sagte Elsie. »Darin kann ich dir recht geben.«
»Und er hat eine Seele.«
»Ja, ja, das seh ich«, sagte Elsie. »Aber weißt du, er ist ein bißchen zu alt für dich.«
»Ich liebe ältere Männer. Ich finde, ein älterer Mann hat etwas Besonderes an sich.«
»Ja – aber man kann ihn kaum einen richtigen Mann nennen. Ich meine, wenn du ihn nicht kennen würdest, wenn du ihn einfach so auf der Straße sehen würdest, ohne zu wissen, daß er ein Medium ist, dann würdest du denken, er ist nichts Ganzes und nichts Halbes.«
»Aber ich kenn ihn eben. Für mich bedeutet er alles. Er liebt Gedichte und betet die Schönheit an.«
»Ich will dir mal was sagen«, warf Elsie ein. »Ich hab ihm eigentlich nie richtig getraut. Er hat kein Scheckbuch, wie du mir selbst gesagt hast. Das ist mal mindestens seltsam.«
»Er ist nicht knauserig mit seinem Geld. Und ich habe nie gesagt …«
»Ja, ja, aber die Tatsache bleibt doch bestehen, daß er kein Scheckbuch hat.«
»Ich finde, ’s ist materialistisch, einen Menschen so zu beurteilen. Patrick ist kein Materialist.«
»Ich sag ja auch nicht, daß er einer ist«, fuhr Elsie fort, »aber ich glaube, seine Phantasie geht oft mit ihm durch, und dann erfindet er die Geschichten, die er immer …«
»O Elsie, ein Mann wie Patrick hat bestimmt ein erstaunliches Leben geführt. Er hat was durchgemacht. Das sieht man ihm doch an. Und seine Frau muß ein Drachen gewesen sein. Weißt du, daß sie …«
»Mit der Scheidung, das ist auch seltsam«, wurde sie von Elsie unterbrochen. »Er scheint sich deswegen gar keine Gedanken zu machen.«
»Stimmt, er wartet einfach, bis es soweit ist, und damit fertig!«
»Man sollte meinen, er hätte ein bißchen häufiger mit den Anwälten zu tun. Und sie könnte noch Ansprüche erheben …«
»Sie hat überhaupt nicht die leisesten Aussichten. Er läßt sich von ihr scheiden, und nicht umgekehrt.«
»Wie heißt sie?«
»Ich weiß es nicht. Möchte auch gar nicht danach fragen. Das wäre taktlos.«
»Hast du mal ne Photographie von ihr gesehen?«
»Nein, Elsie. Patrick ist nicht so, wie du’s dir vorstellst.«
»Und wegen der Geschichte im Polizeigericht am Dienstag«, sagte Elsie, »da weiß ich wirklich nicht, was ich denken soll.«
Alice begann zu weinen.
»Reg dich nicht auf«, bemerkte Elsie und aß in aller Gemütsruhe weiter, wie jemand, der die unantastbare Vernunft seiner Worte dadurch beweisen will, daß er weiter ißt, während der andere verzweifelt. Und als Elsie nach einem neuen Brötchen griff, gestattete sie sich sogar zu sagen: »Wo es um Patrick geht, da machst du dir was vor. Ich glaube nicht die Hälfte von dem, was er erzählt. Ich vermute, er steckt in Schwierigkeiten. Wenn du auf meinen Rat hören wolltest, dann würdest du dich jetzt auf und davon machen, das Baby in einem Heim bekommen, es adoptieren lassen und wieder von vorn anfangen.«
Alice entgegnete: »Das tu ich nie, niemals! Ich hab Vertrauen zu ihm.«
»Er wollte aber, du solltest das Baby wegmachen lassen.«
»So sind die Männer nun mal.«
»Hör doch auf zu weinen«, flüsterte Elsie, »die Leute sehen schon zu dir hin.«
»Ich kann nicht anders, wenn du ihn einen Lügner nennst! Und die Botschaft, die er dir von Colin ausgerichtet hat? Neulich abend in der Größeren Unendlichkeit? Da hast du nicht gesagt, es wäre gelogen. Du hast gesagt …«
»Oh, er ist ein gutes Medium. Wenn er unter Kontrolle ist, dann muß er eben einfach sagen, was von drüben zu ihm kommt.«
Um acht Uhr ging Patrick Seton die Bayswater Road entlang, bog um eine Ecke und dann abermals in eine Sackgasse, an deren Ende er die Stufen des Hauses emporstieg, das in ein Mietshaus umgebaut worden war, und dort drückte er auf den obersten Klingelknopf auf der linken Seite.
Gleich darauf öffnete ein langer, magerer junger Mann von etwa dreiundzwanzig Jahren mit fröhlichem Lächeln die Tür.
»O Patrick«, sagte er und trat höflich beiseite, um Patrick in den Flur treten zu lassen.
»Abend, Tim«, sagte Patrick und stieg die Treppe hinauf. »Wie geht’s im Haupt-Nachrichten-Büro?«
»Im Haupt-Nachrichten-Büro ist alles in Ordnung«, sagte Tim, »besten Dank!« Mit einem weißen Taschentuch putzte er seine Brille und folgte Patrick die Treppe hinauf zu einer modern ausgebauten Wohnung. Aus der offenen Tür eines Zimmers drang geselliges Stimmengewirr. An der Tür eines andern Zimmers hing eine Karte, auf der in blauen gotischen Lettern zu lesen stand:
Die Größere Unendlichkeit
In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen
(Joh. 14, 2).
An diesem Zimmer ging Tim auf Zehenspitzen tänzelnd vorüber, um sich nicht anmerken zu lassen, wie er darüber dachte, und führte Patrick zu dem ersten Zimmer, in dem die Gesellschaft versammelt war. Patrick blieb einen Augenblick auf der Schwelle stehen und sah rasch auf die Anwesenden, um festzustellen, wer da war. Bei seinem Erscheinen brach das Geplauder ein Weilchen ab und hub dann von neuem an. Mehrere Leute machten schüchterne Versuche, Patrick zu grüßen, während Tim mit den zurückhaltenden Gebärden eines Mannes, der sich nicht zu fein dünkt, auch einmal den Lakai zu spielen, von einem Seitentisch eine Tasse mit chinesischem Tee für Patrick holte.
Eine vornehm aussehende Frau mit weißem Haar und Fältchen in einem Gesicht, dessen Züge vollkommen ebenmäßig waren, erschien im Zimmer. Patrick setzte ehrerbietig seine Teetasse ab und ergriff schweigend – bis auf das eine Wort »Marlene« – die Hand der Hausfrau.