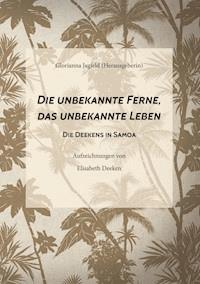
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Die unbekannte Ferne, das unbekannte Leben« erzählt ein Stück deutsche Kolonialgeschichte anhand von Aufzeichnungen und Briefen Elisabeth Deekens, die 1902 mit ihrem Ehemann Richard Deeken in die damalige deutsche Kolonie Samoa auswanderte und dort bis 1910 auf einer Kakaoplantage lebte. Richard Deeken war Gründer der Deutschen Samoa-Gesellschaft und ihr Pflanzungsdirektor auf Samoa. Dadurch stellte er eine politisch wichtige Figur in der jungen deutschen Kolonie dar. Sein Ziel war es, den Kakaoanbau auf Samoa für deutsche Auswanderer attraktiv zu gestalten. Die Aufzeichnungen bieten einen Einblick in das kolonialpolitische Geschehen, die gesellschaftlichen Verhältnisse zwischen Einwanderern und der indigenen Bevölkerung sowie den Alltag einer Auswandererfamilie in der jungen deutschen Kolonie. Die Originaltexte werden durch über 50 Schwarz-Weiß-Fotos aus Familienbesitz ergänzt. »Nun war Abschied genommen. Da standen sie alle, alle die Lieben, auf dem Bahnsteig und winkten. Alle hielten sich tapfer, nur lächelnde Gesichter sollten mir in Erinnerung bleiben. Was sie gekostet, konnte ich nicht mal an mir selber ermessen, die ich auszog in die unbekannte Ferne, das unbekannte Leben, in die neue Heimat! Ich hatte das alles doch selbst gewählt!«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Familie
INHALT
Vorwort
Kurze Einführung in die Geschichte Samoas
Familie Deeken
Richard Deeken
Else Deeken
Else Deeken: Aufzeichnungen über die erste Zeit in Samoa
Die Reise von Deutschland nach Samoa
Das erste Halbjahr in Samoa (August 1902 – März 1903)
Hausmädchen Martha (Juli 1903 – März 1905)
Besuch von Herrn und Frau Zieschank
Auf Tapatapao- April 1908
Auf Malololelei- Juni 1908
Else Deeken: Oma erzählt ihrem kranken Hannele
VORWORT
Den Stein des Anstoßes für dieses Werk gab die Veröffentlichung von Else Deekens Kindheitserinnerungen in Form eines gebundenen Büchleins, veranlasst durch eine ihrer Enkelinnen, Marianne Wesselburg. Mein Großvater und ebenfalls ein Enkel Else Deekens, Peter Jagfeld, hatte je ein Exemplar für seine drei Kinder bestellt, sodass dieses Büchlein von meinem Vater an mich weitergereicht wurde. Mit großer Begeisterung las ich die Erinnerungen meiner Ururgroßmutter, die vor über hundert Jahren gelebt hatte. Ihre Aufzeichnungen berührten mich sehr und ich fühlte mich nach der Lektüre meiner Geschichte und Familie viel stärker verbunden. Im Gespräch mit meinem Großvater erfuhr ich, dass Else Deeken auch ihre Erlebnisse während ihrer Zeit in Samoa schriftlich festgehalten hatte. Mein Interesse wurde sofort geweckt und ich beschloss, diese Aufzeichnungen ansprechend aufzubereiten.
Im November 2014 erhielt ich die von Trudi Peikert, einer weiteren Enkelin Else Deekens, mit der Schreibmaschine abgetippte Abschrift des Originalmanuskripts. Ich scannte sie zunächst ein, verwendete dann eine automatische Texterkennung, um den Text aus den Scans zu extrahieren, und korrigierte anschließend den erkannten Text von Hand. Diese Aufzeichnungen bilden in Form des Kapitels »Else Deeken: Aufzeichnungen über die erste Zeit in Samoa« den Hauptteil dieses Werkes. Sie werden durch einige von meinem Großvater vorgeschlagene Ergänzungen erweitert: Die beiden aus dem Buch »Ein Jahrzehnt in Samoa« entnommenen Kapitel von Frieda Zieschank sowie den Rückblick Elses im Alter auf die Zeit in Samoa in Form des Kapitels »Oma erzählt ihrem kranken Hannele«. Zusätzlich beschloss ich das Werk um einige Hintergrundinformationen zu erweitern und mit Fotos aus dem privaten Familienbesitz (sofern nicht anders gekennzeichnet) zu illustrieren.
Während der Arbeit an diesem Buch wuchs meine Bewunderung für meine Ururgroßmutter: Als junge Frau reist sie wenige Tage nach ihrer Hochzeit mit ihrem Ehemann um die halbe Welt, um dort im Urwald ein Haus aufzubauen. Später zieht sie als junge Witwe ihre sechs Kinder alleine groß und schafft es, während Kriegs- und Hungerszeiten für ihre große Familie zu sorgen.
Die Informationen in diesem Werk habe ich nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen und geprüft. Einige Geschehnisse ließen sich jedoch von mir nicht eindeutig rekonstruieren. Dies betrifft insbesondere die genauen Umstände des Konfliktes zwischen Gouverneur Wilhelm Solf und Richard Deeken. In dieser Hinsicht möchte ich diese Arbeit als neutral verstanden wissen, die keine abschließende Wertung über die Rolle Solfs bzw. Deekens in diesem Konflikt vornimmt.
Das Anliegen dieses Werkes ist es, die Eindrücke und Gefühle Elses möglichst unverfälscht für ihre Nachkommen zugänglich zu machen. Daher habe ich ihre Aufzeichnungen unkommentiert übernommen, auch Passagen, die eine Einstellung der Deekens gegenüber anderen Völkern und insbesondere Samoanern nahelegen, die ich ausdrücklich nicht teile. Ich bitte darum, diese Äußerungen in ihrem historischen Kontext zu sehen, jedoch nicht zu verkennen. Die Aufzeichnungen wurden an die neue Rechtschreibung angepasst und um erklärende Fußnoten ergänzt.
An der Arbeit zu diesem Werk waren viele Familienmitglieder beteiligt, denen ich allen herzlich danke. Besonders danken möchte ich meinem Großvater, Peter Jagfeld, der die Idee und den Großteil der Materialien für dieses Werk lieferte, mich zu diesem Projekt ermunterte und mir stets mit Rat und Tat zu historischen und familiären Fakten zur Seite stand. Dank gebührt auch Rosemarie Vespermann-Deeken für die Veröffentlichung einer Biografie Richard Deekens auf »www.deeken-samoa.de«, die ich mit ihrer freundlichen Genehmigung in großen Teilen übernehmen konnte. Weiterhin danke ich Hermann Jagfeld für das Einscannen von fast hundert Bildern der Deekens auf Samoa und meiner Mit-Ururenekelin Beatrice May für Tips zum Urheberrecht und zur Titelei. Unschätzbar dankbar bin ich meinem Partner, Alexander Geisler, für die Unterstützung beim Satz, der Bildbearbeitung und in allen technischen Fragen.
Ich wünsche allen Lesern – insbesondere allen interessierten Nachfahren der Deekens – viel Spaß dabei, ein Stück Geschichte anhand der Erlebnisse Richard und Else Deekens zu entdecken!
Amsterdam, April 2016
Glorianna Jagfeld
KURZE EINFÜHRUNG IN DIE GESCHICHTE SAMOAS1
Samoa ist ein Inselstaat im südwestlichen Pazifik, der aus vier bewohnten und sechs größtenteils unbewohnten Inseln besteht. Die beiden größten Inseln sind Savai’i und Upolu, auf der die Hauptstadt Apia liegt. Der heutige Staat Samoa umfasst den westlichen Teil der Samoainseln, daher wurde er bis 1997 offiziell Westsamoa genannt. Der östliche Teil der Inseln ist Amerikanisch-Samoa, ein Außengebiet der USA. Es umfasst einige Vulkaninseln und zwei kleine Atolle, darunter als größte Insel Tutuila mit der Hafenstadt Pago Pago.
Die früheste Besiedlung Samoas datiert wahrscheinlich auf etwa 1000 v. Chr. Seit 200 v. Chr. existierten intensive Kontakte zu den Nachbarinseln Tonga und Fidschi. Von 940 bis 1250 wurde Samoa von Tonga beherrscht. 1722 erreichte der erste Europäer, der Niederländer Jakob Roggeveen, die Inseln. Es folgten französische Seefahrer, die die Küsten kartographierten und die Bewohner studierten. Keines der Länder beanspruchte jedoch die Inseln. Erst im 19. Jahrhundert erwachte das Interesse der drei Kolonialmächte USA, Großbritannien und Deutschland an Samoa. 1830 begannen Missionare der britischen London Missionary Society die samoanische Bevölkerung zu christianisieren. 1839 installierten die USA einen Konsul auf Samoa, (wahrscheinlich) 1847 gründeten die Briten ein Konsulat; ein deutscher Konsul wurde 1861 ernannt.
Dem Hamburger Handelshaus »Joh. Ces. Godeffroy« gelang es ab 1855, den Handel mit Samoa zu dominieren, was in den 1870-er Jahren weitere deutsche Firmen anlockte. Dadurch verschärfte sich die Konkurrenzsituation zwischen den drei Mächten (die »Three Powers«), von denen jedoch keine Samoa für sich gewinnen konnte. 1878 erhielten die Vereinigten Staaten den strategisch günstigen Hafen Pago Pago auf Tutuila in Ostsamoa. Ein Jahr darauf erhielt Deutschland einen Hafen bei Apia auf Upolu in Westsamoa. Thronstreitigkeiten zwischen den samoanischen Parteien und Konflikte zwischen den Drei Mächten führten 1888 zum ersten Samoanischen Bürgerkrieg, dem »Samoa-Krieg«. Ein Zyklop zerstörte im März 1889 in der Bucht von Apia liegende deutsche und amerikanische Kriegsschiffe. Daraufhin wurde der Konflikt auf der Berliner Samoa-Konferenz im selben Jahr beendet und die Machtkämpfe mit der »Berlin Treaty« zunächst beigelegt. In diesem Abkommen wurde Samoa als formal unabhängiges Königreich unter dem Protektorat der drei Mächte anerkannt.
Dieses Bündnis hielt bis zum Tode Königs Malietoa Laupepa im Jahr 1898, als wieder verschiedene samoanische Parteien um die Thronnachfolge rangen. Es kam zum zweiten Bürgerkrieg, der die wirtschaftlichen Interessen der Mächte in Gefahr brachte. Daher wurde im Samoa-Vertrag 1899 die Monarchie abgeschafft und die Teilung der Inseln beschlossen. Ostsamoa wurde Amerika zugeteilt und erhielt später den Namen Amerikanisch-Samoa. Westsamoa wurde zur deutschen Kolonie Samoa unter der Verwaltung von Gouverneur Wilhelm Solf. Großbritannien wurde mit anderen pazifischen Inseln entschädigt.
Zu Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 besetzte Neuseeland Westsamoa und erhielt es 1920 als Völkerbundmandat, 1946 als UNO-Treuhandgebiet. Im Zweiten Weltkrieg war Samoa Truppenstützpunkt, aber nicht von den großen Schlachten des Kriegs betroffen.
Am 1. Januar 1962 wurde Westsamoa als erstes fremd beherrschtes Land Polynesiens wieder unabhängig. Der Staatsname wurde 1997 von Westsamoa zu »Unabhängiger Staat Samoa« geändert.
Ostsamoa ist seit 1899 in amerikanischem Besitz, seit 1926 ist es eine abhängige Region und seit 1945 ein Außengebiet der USA.
Gedenkstein zur deutschen Besetzung Samoas. Die Inschrift lautet »Hier wurde am 1. Maerz 1900 die deutsche Flagge gehisst. Errichtet 1913«.
Westsamoa © CloudSurfer © / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0 /GDFL
Apia und Umgebung © CloudSurfer / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0 /GDFL Eigene Hervorhebung der Orte Tapatapao, Lotopa und Vailima (v.l.n.r.)
Richard in Tropen-Galauniform, gemalt von Else Deekens jüngster Schwester Ada Boese, vermutlich um 1905
Richard auf Samoa
1 Diese Zusammenfassung basiert auf den Informationen der Internetseite http://www.laender-lexikon.de/Samoa_(Geschichte).
FAMILIE DEEKEN
RICHARD DEEKEN
Dr. Richard Theodor Bernhard Joseph Deeken * 16. Juni 1874 in Westerstede/Oldenburg als Sohn des 1878 verstorbenen Oberamtsrichters Justizrat Leonard Deeken † 28. August 1914 in Arracour/Frankreich, an den Folgen einer Verwundung in der Schlacht von Serres
Richard Deeken war Leutnant beim 1. Westfälischen Feldartillerie-Regiment No.7 in Wesel, Gründer der Deutschen Samoa-Gesellschaft (DSG) in Berlin und ihr Pflanzungsdirektor auf Samoa, Schriftsteller, Direktor der Forst- und Kolonialschule in Miltenberg/Main und Herausgeber des »Weltkunde- und Weltwirtschaftsanzeigers«.
LEBEN2
1877 Ab dem Alter von drei Jahren lebt Richard im Haus seines Onkels, da seine Eltern krank sind. Mit vier Jahren werden er und sein Bruder Vollwaisen.
1893 Nach dem Abitur schlägt Richard Deeken eine Offizierslaufbahn ein. Er wird an die Neue Kriegstechnische Akademie in Berlin berufen. Dort absolviert er u. a. eine Ausbildung zum Dolmetscher für Englisch, Französisch und Italienisch, die ihn auch nach Amerika und Belgien führt. Zusammen mit Prof. Dr. Rothenbücher verfasst er den »Englischen Militärdolmetscher« für die Akademie. Dieser wird auch beim Boxeraufstand in China verwendet.
1900 Der Ausbruch einer lebensbedrohlichen Erkrankung der Lunge zwingt Deeken zu einem neunmonatigen Aufenthalt in Italien und Portugal und danach zu einer einjährigen Reise in die Südsee. Zu deren Finanzierung beschafft er sich Sammlungsaufträge von deutschen Museen, insbesondere des Berliner Museums für Naturkunde, und schreibt Berichte für deutsche Zeitungen über die neuen deutschen Kolonien in der Südsee. Zusätzlich erhält er von dem bekannten deutschen Konsul Kunst einen Inspektionsauftrag für dessen Pflanzungen auf Hawaii und Samoa. Er reist über Hawaii, Australien und Neuseeland nach Samoa und bereist die Marschall-, Karolinen- und Palauinseln.
1901 Deeken kehrt nach Deutschland zurück. Aus gesundheitlichen Gründen muss er sich vom Militärdienst verabschieden und wechselt in eine Stellung »à la suite« als Reserveoffizier. Seine Ärzte empfehlen ihm u. a. wegen seines Asthmas dringend, das Klima in Deutschland zu meiden. Daraufhin begibt sich Deeken auf Vortragsreisen durch ganz Deutschland, um für die Gründung einer Aktiengesellschaft zu werben und sich so eine neue Existenzgrundlage außerhalb Deutschlands zu schaffen. Deekens Buch »Manuia Samoa – Heil Samoa« erscheint und löst in Deutschland eine Samoa-Begeisterung aus.
1902 In Berlin gründet Deeken die DSG, eine Aktiengesellschaft zum »Zwecke des Kakaoanbaus«, deren Direktor auf Samoa er von 1902-1910 ist. Die Gesellschaft wird nie eine Dividende auszahlen. Die Möglichkeiten des wirtschaftlich rentablen Plantagenanbaus auf Samoa sind zu begrenzt und werden durch Richard Deeken überschätzt. Die deutschen Siedler, die häufig mit wenig Kapital Deekens Ruf nach Samoa folgen und nach seinen Versprechungen auf großen Reichtum hoffen, sind enttäuscht von den Anbaumöglichkeiten und der Knappheit an einheimischen Arbeitskräften. Deeken fordert daraufhin den Gouverneur Samoas, Wilhelm Solf, auf, mehr Land und Arbeitskräfte, beispielsweise in Form von Zwangsarbeit für die einheimische Bevölkerung, bereit zu stellen. Solf verweigert dies jedoch, da er durch den Ansturm von deutschen Siedlern das sensible Gleichgewicht zwischen einheimischen und europäischen Pflanzern bedroht sieht.
Da die stolzen Samoaner nicht regelmäßig auf fremden Pflanzungen arbeiten wollen und die eingeführten melanesischen Arbeiter nur auf den Pflanzungen der Deutschen Handels- und Plantagen Gesellschaft (DHPG) arbeiten dürfen, holt Deeken schließlich mit Erlaubnis der Regierung in Berlin einen Transport mit dreihundert chinesischen Kontrakt-Arbeitern aus China nach Samoa. Zweihundert Arbeiter gibt Deeken an andere Pflanzer weiter. Da die Chinesen sich gut bewähren, übernimmt die Kolonialregierung von Samoa die nächste Anwerbung und den Transport von Arbeitern aus China schon drei Jahre später. Ein Krankenhaus eigens für die chinesischen Arbeiter wird errichtet. Die chinesischen Arbeiter sind für die Pflanzer kostbar, nicht nur wegen der teuren Reisegelder und Gebühren, sondern insbesondere wegen ihrer wichtigen Aufgabe bei der Instandhaltung der Plantagen. Deekens Bemühungen haben zur Folge, dass das Geschäftswesen Samoas heutzutage fast ausschließlich in den Händen der Nachfahren chinesischer Kontraktarbeiter liegt. Dagegen stellen die Nachfahren der auf den Plantagen der DHPG isoliert gehaltenen melanesischen Arbeiter heute eine arme Unterschicht auf Samoa dar.
Kurz vor der Ausreise nach Samoa heiratet Deeken Elisabeth Boese in Köln.
1903 Das erste Kind der Deekens, Else Josepha Moana, wird geboren. Sie wird die Patentochter des letzten Königs von Samoa, Mata‘afa Josefo.
Die deutschen Pflanzer auf Samoa gründen unter dem Vorsitz Deekens einen genossenschaftlichen Pflanzerverein. Dieser Verein soll die Interessen der wenigen kleinen Pflanzer, die es in der jungen Kolonie Samoa schwer haben, gegenüber dem Gouverneur Solf besser vertreten, da Solf die große DHPG favorisiert, die im Gegensatz zu den Pflanzerfamilien kaum Schwierigkeiten hat. In der Resolution des Vereins fordert Deeken u. a. eine achtmonatige Zwangsarbeit der einheimischen samoanischen Bevölkerung auf Plantagen der Deutschen. Dies wird von Solf abgelehnt.
1904 Die Konflikte zwischen Deeken und dem Gouverneur Solf weiten sich auch auf andere Bereiche aus. Deeken fordert die deutschen Pflanzer auf, gegen die angeblich ungerechte Behandlung durch die Kolonialverwaltung Samoas zu protestieren. Ein weiterer Anlass der Konflikte ist die Unzufriedenheit einiger Pflanzerfamilien über die englische Unterrichtssprache in den englischen evangelischen Missionsschulen in der nun deutschen Kolonie. Im Gegensatz zur englischen Mission stellt sich die französische katholische Maristen-Mission um und lässt Brüder für Samoa im neu gegründeten Maristenkloster in Meppen ausbilden.
Der Konflikt zwischen Solf und Deeken geht bis auf das Jahr 1901 zurück, da der Gouverneur Deekens Pläne zum Aufbau der Kolonie Samoa als Siedlungskolonie von Anfang an ablehnt. Deekens Haltung spiegelt dabei vor allem eine rein auf die Interessen des deutschen Volkes ausgerichtete Gesinnung wider, welche die möglichst gewinnbringende Ausbeutung von Boden und Einheimischen in der Kolonie vorsieht. Dies steht entgegen der von Solf initiierten Land- und Titelkommission, die Rechtsansprüche überprüft und die Landrechte der Einheimischen gegenüber deutschen Siedlern zu stärken versucht.
Deeken wird wegen »schwerer Misshandlung« seiner chinesischen Arbeiter sowie Beleidigung des kaiserlichen Gouverneurs Solf angeklagt und zu einer Gefängnisstrafe im neu erbauten Gefängnis für Weiße auf Samoa verurteilt. Das Gefängnis mit Wellblechdach unter der Tropensonne hätte bei zwei Monaten Haft für Deeken mit seiner immer noch schwachen Lunge den Tod bedeuten können. Allerdings wird Deeken eine Teilbegnadigung durch den deutschen Kaiser zuteil. Die Strafe wird in eine Ehrenhaft3 auf der Festung Ehrenbreitstein bei Koblenz umgewandelt. Dies erfolgt durch die Intervention des Großherzogs von Oldenburg, dessen Orden Deeken trägt, mit Unterstützung der bekannten Zentrumsabgeordneten Matthias Erzberger und Karl Trimborn. Letztgenannter ist ein Cousin von Deekens Frau, die sich stark für ihren Mann einsetzt. Der einzige Bruder von Richard Deeken, der spätere Major Dr. jur. Matthias Deeken, trifft im November 1904 in Samoa zu Hilfe der verzweifelten Familie Deeken ein. In einem Schreiben vom 2. August 1905 aus dem Auswärtigen Amt in Berlin, Kolonialabteilung heißt es wörtlich: »[...] in Apia vom 3. August 1904 gegen Sie erkannte Gefängnisstrafe von zwei Monaten in Gnaden in eine Festungshaft von gleicher Dauer umzuwandeln [...].«
DIE HINTERGRÜNDE DES PROZESSES
»Deeken konnte als Einziger in der Kolonie Samoa Solf das Wasser reichen!«4 Um seinen stärksten Widersacher, der darüber hinaus gute Verbindungen zur Presse in Deutschland und zum Deutschen Reichstag hatte, zum Weggang aus Samoa zu zwingen, initiiert Solf über seinen chinesischen Koch eine Revolte einiger der chinesischen DSG-Kontraktarbeiter. Diese bedrohen nachts vor dem Direktionsgebäude im großen Pflanzungsbezirk, das achthundert Meter hoch und einsam in den Urwaldbergen gelegen ist, Deeken und seine junge Familie. Daraufhin vertreibt Deeken sie in seiner Not mit einer Kutscherpeitsche.
Dies wird ihm als schwere Misshandlung angelastet. Deswegen wird er vor dem Kaiserlichen Obergericht in Apia angeklagt, dessen oberste Gewalt, ebenso wie über die Zeitung, der Gouverneur innehat. Als Deeken über die Hintergrundrolle des chinesischen Kochs von Solfs aussagt, wird er zusätzlich wegen Gouverneursbeleidigung angeklagt. Die Informationen über Solfs Rolle in dieser Angelegenheit bekommt Deeken von einem sehr zuverlässigen chinesischen Hausangestellten, der das besondere Vertrauen der Familie genießt.
Diesem Prozess gingen weitere Gängeleien voraus. Beispielsweise lies Solf die englische Hebamme, die Deekens Frau im zwei Reitstunden entfernt von Apia gelegenen Direktionsgebäude im Mai 1904 bei der Geburt des zweiten Kindes beistand, nach Apia zurückbeordern, um eine Urkunde in einer Familiensache zu unterschreiben. Glücklicherweise hatte sie den Mut und konnte es sich als Engländerin leisten, sich diesem Befehl zu widersetzen, »weil sie eine Wöchnerin mit einem Neugeborenen und einem einjährigen Kleinkind nicht im Stich lassen« wollte. Ein anderes Beispiel waren die plötzlichen Schwierigkeiten für Deeken, die Pferdefuhrwerke mit der täglichen Nahrung für seine hundert chinesischen Arbeiter hinauf in die Pflanzungen zu bekommen. Eines Tages wurden beide Zufahrtswege gesperrt, da auf beiden gleichzeitig Wegearbeiten auf Anordnung des Gouverneurs ausgeführt wurden.
1905 Deeken reist mit seiner Frau und seinen beiden auf Samoa geborenen kleinen Kindern zwei Monate lang per Schiff nach Deutschland, um die ebenso lange Ehrenhaft anzutreten. Währenddessen macht die Familie bei den Großeltern Dr. Boese in Köln nahe dem Kölner Dom Urlaub. Anschließend kehren die Deekens sofort wieder zu den Pflanzungsbezirken der DSG nach Apia auf Samoa zurück.
1908 Deeken wird in den Gouvernementsrat von Samoa gewählt. Daraufhin reicht der Gouverneur Solf ein Rücktrittsgesuch an den Kaiser wegen Vertrauensverlusts in der deutschen und englischen Bevölkerung ein. In Folge dessen verzichtet Deeken auf die Position im Gouvernementsrat.
1910 Familie Deeken kehrt nach Deutschland zurück, damit die inzwischen fünf Kinder deutsche Schulen besuchen können. Sie ziehen nach Miltenberg am Main, wo es alle notwendigen Schulen gibt. Es wird ein großes Landhaus in einem weiten ehemaligen Weinberg über dem Main in einer gesundheitlich günstigen Windlage gebaut. Das Haus ist noch heute in Familienbesitz und denkmalgeschützt.
1911-1914 Deeken studiert Kolonialgeographie, tropische Landwirtschaft sowie Kolonialpolitik und promoviert über »Die Bodennutzung auf Samoa« an der Maximilian-Universität zu Würzburg. Sein Ziel ist es, in die Kolonialpolitik zu gehen. Die mündliche Prüfung findet am 25. Juni 1914 statt. Die Dissertation erhält die zweitbestmögliche Note magna cum laude. Parallel dazu wirkt Deeken als Herausgeber des »Weltkunde- und Weltwirtschaftsanzeigers«.
1912 Deeken ist Mitbegründer und einer der beiden Direktoren der Forst- und Kolonialschule in Miltenberg am Main mit Lehrtätigkeit. Diese wird nach dem Ersten Weltkrieg noch einige Jahrzehnte lang als Forstschule fortgeführt.
1913-1914 Im Herbst 1913 bis Frühjahr 1914 erfolgt Deekens vierte und letzte Schiffsreise um die Welt nach Samoa. In seiner Position als Vorstandsmitglied des Aufsichtsrats der DSG inspiziert er die dortigen Pflanzungsbezirke. Dazu bereist er die Tonga- und Fidji-Inseln, das Bismarck-Archipel und das Festland von Neuguinea. Im selben Jahr erscheint Deekens rassenpolitischer Roman »Rassenehre«, in dem er sich gegen »Mischehen« zwischen Samoanerinnen und deutschen Siedlern ausspricht.
1914 Zu Beginn des Ersten Weltkriegs fällt Deeken am 28. August 1914 im Alter von vierzig Jahren an der Westfront in der Schlacht von Serres. Er hinterlässt umfängliche schrifstellerische Werke, die er parallel zu seinen immensen praktischen Arbeitsanforderungen verfasste. Sein Nachlass umfasst insgesamt sechs Bücher und 135 Abhandlungen, Aufsätze und Artikel, insbesondere zur Kolonialgeografie, der tropischen Landwirtschaft und Kolonialpolitik.
Else im Kreis ihrer sechs Kinder, vermutlich um 1915
Else gemalt von ihrer jüngsten Schwester Ada Boese, vermutlich um 1905
Else am Strand von Apia
2 Diese Zusammenfassung des Lebens von Richard ist stark an die durch Rosemarie Vespermann-Deeken verfasste auf http://www.deeken-samoa.de veröffentlichte Biografie angelehnt. Sie wurde durch weitere Quellen ergänzt. Insbesondere der Konflikt zwischen Richard und Solf ist aus heutiger Sicht nicht eindeutig rekonstruierbar.
3 Ein Ehrenhäftling muss nur nachts in den Offiziersstuben anwesend sein.
4 Dieses Zitat entstammt einem Interview Rosemarie Vespermann-Deekens mit dem australischen Professor Dr. Peter Hempenstall, einem Biografen Solfs.
ELSE DEEKEN
Elisabeth Bertha Hermine Deeken geborene Boese, genannt Else oder Ella * 10. Juli 1879 in Köln als Tochter des Dr. med Julius Eduard Boese und der Maria Elisabeth Eleonore Boese geborene Jungbluth † 29. November 1958 in Miltenberg am Main
LEBEN5
Else verlebt eine »sonnige goldene Kindheit- und Jugendzeit«. Besonders in Erinnerung bleiben ihr die Ferien in Bodendorf, wo die Eltern ein kleines Landhaus hatten. In Köln besucht sie eine höhere Töchterschule und verbringt anschließend ein Jahr im Sacre Coeur Pensionat in Blumental.
1902 Nach der Verlobung mit Richard Deeken am 7. Februar 1902 heiratet sie ihn knapp fünf Monate später am 5. Juli dieses Jahres. Zehn Tage nach der Hochzeit tritt das frischgebackene Ehepaar die Reise zur Auswanderung nach Samoa an. »Die Pionierjahre in der Südsee« werden laut ihrer eigenen Erinnerungen zu ihren »schönsten und glücklichsten Erinnerungen« zählen.
1910 Das Ehepaar verlässt die »geliebte zweite Heimat« mit den auf Samoa geborenen fünf gemeinsamen Kindern und kehrt nach Deutschland zurück.
1911 Die Familie lässt sich in Miltenberg nieder. Das sechste und letzte Kind wird geboren. Im darauffolgenden Jahr beginnt der Bau des Hauses auf dem Grauberg in Miltenberg.
1914 Elses Ehemann Richard fällt in der Schlacht von Serres. Die sechs gemeinsamen Kinder sind zu diesem Zeitpunkt zweieinhalb bis dreizehn Jahre alt. Die Familie erhält Witwen- und Waisenrente und bleibt im Haus auf dem Grauberg wohnen. Der Besitz auf Samoa ist verloren. Um den Unterhalt des Hauses und der Familie zu finanzieren, eröffnet Else eine kleine Sommerpension im Grauberghaus und vermietet Zimmer an Sommergäste. Parallel setzt sie das umfangreiche schriftstellerische Werk ihres Mannes fort. Über diese Zeit schreibt sie später: »Es waren genug Sorgen da, aber immer wurden sie irgendwie gemeistert.« Alle ihre Kinder heiraten.
1933-1948 Beim Regierungsantritt Hitlers sah Else noch »bessere Zeiten« kommen, später durchlebt sie den zweiten Weltkrieg »mit seinen Schrecken und seinem furchtbaren Ausgang« sowie die Besatzung und zweite Inflation.
Lebensabend Als über Siebzigjährige schreibt Else Deeken im Rückblick auf ihr Leben: »Ich stehe an meinem Lebensabend, aber ich kann nicht sagen, dass ich auf zertrümmerte Hoffnungen sehe. Ich sehe auf manchen Kummer und Sorgen, auf Fehler und Verschulden, aber auch auf so viele, viele schöne, liebe Erinnerungen zurück. Ich bin geliebt von meinen guten und braven Kindern und Schwiegerkindern, die ihrerseits auch ihr Päckchen Sorgen zu tragen haben, und bin umringt von einer blühenden Enkelschar. Ich habe allen Grund Gott für alles zu danken. Er machte alles gut und richtig.«
Auszug aus dem Stammbaum der Deekens
Auszug aus dem Stammbaum der Deekens Die markierten Stationen sind Köln, Bremen, New York, Chicago, San Francisco, Honolulu, Pago Pago
5 Diese Zusammenfassung des Lebens von Else basiert auf ihren eigenen im Familienbuch niedergeschriebenen Erinnerungen, die durch Jahresangaben ergänzt wurden.
ELSE DEEKEN: AUFZEICHNUNGEN ÜBER DIE ERSTE ZEIT IN SAMOA
DIE REISE VON DEUTSCHLAND NACH SAMOA
VON DEUTSCHLAND NACH HAWAII
Freitag, den 11. Juli 1902
Nun war Abschied genommen. Da standen sie alle, alle die Lieben, auf dem Bahnsteig und winkten. Alle hielten sich tapfer, nur lächelnde Gesichter sollten mir in Erinnerung bleiben. Was sie gekostet, konnte ich nicht mal an mir selber ermessen, die ich auszog in die unbekannte Ferne, das unbekannte Leben, in die neue Heimat! Ich hatte das alles doch selbst gewählt!
Die Zurückbleibenden fühlten die Lücke, hatten die Sorge um das bis dahin so treu behütete Kind, das noch keine Enttäuschung erlebt, noch keine Sorgen kennengelernt hatte, das noch ganz unselbständig war. Freilich, da war der Mann, der Schwiegersohn, dem man volles Vertrauen schenkte, das tröstete!
Derweilen raste der Zug nach Norden. Noch viele Stationen wurden gemacht, überall wurde ich Familienmitgliedern und Freunden Vaters im Fluge vorgestellt, überall wurde Abschied genommen, Abschied der mir nicht viel bedeutete und doch immer wieder den ersten neu erleben ließ. Betäubt vom Abschiednehmen, von den vielen neuen Eindrücken ließ ich alles willenlos über mich ergehen. In Oldenburg bei Vetter Augustin hob ich als jüngstes Familienmitglied das eben geborene Töchterchen aus der Taufe, Agnes. Dann endlich kam Bremen, der NDL6-Dampfer »Kronprinz«, damals der größte und schnellste Passagierdampfer, der eben von seiner Jungfernfahrt zurückgekehrt war, – und das Meer! Die Abfahrt großer Passagierdampfer aus Welthäfen, die Seefahrt auf den äußerst bequemen und luxuriösen Schiffen des NDL sind so oft beschrieben worden, dass ich darüber weggehen kann.
Wer aber kann sich heute vorstellen, dass ich im Jahre 1902 ohne Pass, nicht einmal als Ehefrau eingetragen in den einfachen Militärpass meines Mannes, unbehelligt um die halbe Welt reiste? Wer heute nicht von jedem Konsulat eines jeden kleinsten Staates, den er auf der Durchfahrt berührt, deklariert und gestempelt ist, der kommt nicht weit, hat wenigstens mit Schwierigkeiten über Schwierigkeiten zu kämpfen. Wie einfach war doch das Reisen! Natürlich, Geld musste man auch damals schon haben, denn in New York musste man eine bestimmte Summe vorweisen können, um in das Land der Freiheit einzugehen, und ebenso musste man beweisen, dass man lesen und schreiben konnte. Dagegen machte der Zoll auch früher schon viele Unbequemlichkeiten. So hatten wir nichts von der herrlichen Einfahrt in den Hafen von New York, da uns währenddessen die Zollbeamten in den Klauen hatten und wir feierlich beeiden mussten, nichts Zollpflichtiges bei uns zu haben. Dafür waren sämtliche Passagiere auf einmal in die diversen Speisesäle zusammengetrommelt worden und mussten dort warten, bis sie an die Reihe kamen und auch alle übrigen abgefertigt waren. Danach wurden alle von der Gesundheitspolizei inspiziert.
Ja, vom Zoll kann ich noch ein Geschichtchen erzählen! Der »Kronprinz« war eine kleine schwimmende Stadt mit einer ganz stattlichen Bevölkerung, die den mächtigen Zollschuppen des NDL in Hoboken7, in den sie unter der liebevollen Führung der Stewards hinein getrieben wurden, füllten wie einen Ameisenhaufen. Jeder suchte sein Gepäck unter den weithin sichtbaren Anfangsbuchstaben seines Namens und musste nun warten, bis die Zollbeamten ihn abgefertigt hatten. Da meinte nun Vater, die lange Wartezeit benützen zu können, um die Fahrkarten nach Chicago zu besorgen, wohin wir schon anderntags weiterfahren wollten. Ich sollte bei unserm Gepäckberg, der nicht allein meine Aussteuerkisten enthielt, sondern auch mächtige Kisten voller Konserven, Getränke, Handwerkszeug und mehr, dazu noch ein großes Zelt, als Notwohnung für die erste Zeit gedacht, bleiben, ihn bewachen, und mich mit keinem Zollbeamten einlassen, da ja bis auf wenig Handgepäck alles unter Zollverschluss nach San Francisco durchreisen sollte. Vater war schon einmal in New York gewesen und glaubte, mit seiner Lokalkenntnis bald zurück zu sein. Er hatte nicht gedacht, dass er drei Stunden ausbleiben würde, denn die Entfernungen der Riesenstadt und die Umständlichkeiten bei den Bahnen, die keine einheitlichen Staatsbahnen, sondern Gesellschaftsbahnen waren, hatte er erheblich unterschätzt. Ich stand da, ein Pünktchen unter den Tausenden, ein Zwerglein neben meinem Kistenberg, aus dem als lange Wurst das Zelt hervorsah. Um mich herum wurde es allmählich leerer, die Zollbeamten kamen immer öfter und unser Kabinensteward hatte sich mehrmals angelegentlich nach dem Verbleib meines »Herrn Gemahls« erkundigt. Schließlich war ich ganz allein noch übrig, umstanden von sechs Zollbeamten, die alle gerne Schluss gemacht hätten und zum Lunch gegangen wären. Die mächtigen Tore, das Eingangstor auf der einen, das Ausgangstor auf der entgegengesetzten Seite, schienen sich in der Ferne wie zwei bösartige Augen zuzublinzeln. Ich war todmüde von dem Gewimmel und Gewirr der verflossenen Stunden und hungrig und durstig, da kam unser Kabinensteward und teilte mir mit tröstender Stimme mit, er habe mit dem Kapitän gesprochen, man wolle mich mit dem »Kronprinzen« wieder mit nach Hause nehmen, denn mein Mann würde wohl nicht wiederkommen! Ich lachte: »Bestimmt kommt er wieder, er besorgt doch nur die Fahrkarten nach Chicago!« Er darauf, unterstützt vom Kopfnicken sämtlicher Zollbeamten: »Ja, das sagen sie alle, wenn sie ihre jungen Frauen verlassen und durchgehen!« Da, als die Situation dramatisch zu werden drohte, erspähte ich am Ausgangstor eine kleine schwarze Ameise, die schnell größer wurde und eine große Tüte verheißungsvoll schwenkte mit einem Kilo herrlicher Pfirsiche zum Trost und zur Stärkung. Das andere war dann alles schnell erledigt.
Aber ich erlebte noch mehr in jenen langen Wartestunden. Vater hatte mich kaum verlassen, als ich von einem Herrn angesprochen wurde, dessen Englisch ich kaum verstehen konnte. Er sprach amerikanisches Englisch, das war, als ob er eine heiße Kartoffel im Munde habe. Nach standhaften Versuchen seinerseits und größten Anstrengungen meinerseits hatte ich endlich kapiert, dass er Abgesandter einer Miss Slone, einer lieben Freundin Vaters aus seiner Berliner Zeit, sei, die uns gerne treffen wollte. Ich konnte nichts tun, als ihm unser Hotel anzugeben, denn wir hatten noch keinen Tagesplan gemacht.
Es war drei Uhr geworden, als wir ins Hotel kamen, zu spät zum Lunch, zu früh fürs Dinner. Seit dem Frühstück hatten wir nichts mehr genossen. Wir





























