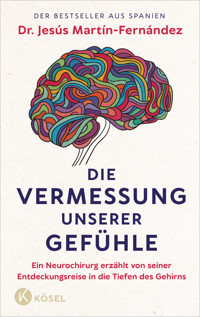
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Ich bin Neurochirurg geworden, weil ich verstehen wollte, wie der Geist funktioniert, nicht um Gehirne zu operieren.« Jesús Martin-Fernandez
Der junge Neurochirurg Dr. Jesús Martín-Fernández schrieb Medizingeschichte: Er führte die ersten Wachoperationen durch, bei denen er mithilfe Künstlicher Intelligenz die Emotionen seiner Hirntumorpatienten identifizierte. Dadurch ermöglichte er nicht nur seinen Patienten eine signifikant höhere Lebensqualität, sondern öffnete auch die Tür zu neuen und faszinierenden Theorien über das geheimnisvollste Organ des menschlichen Körpers, das Gehirn.
Auf packende und berührende Weise erzählt er seine persönliche Geschichte, bei der der geniale Funke seines Entdeckergeistes überspringt. Den von ihm miteingeleiteten Paradigmenwechsel erklärt er anschaulich mit Abbildungen und anhand konkreter Fallbeispiele seiner Patientinnen und Patienten. Der Bestseller aus Spanien verbessert das Verständnis vom menschlichen Gehirn und hat eine inspirierende Botschaft: »Geh weiter deinen Weg. Halte durch. Denn genau dort findest du die Wahrheit.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Der spanische Neurochirurg Dr. Jesús Martín-Fernández schrieb Medizingeschichte: Er führte als erster Mediziner eine Wachoperation durch, bei der er Künstliche Intelligenz einsetzte, um die Emotionen des Patienten zu identifizieren und sie zu speichern. Damit öffnete sich auch die Tür zu neuen und faszinierenden Erkenntnissen über das geheimnisvollste Organ des menschlichen Körpers, das Gehirn.
In seinem Buch schildert der junge Mediziner emotional und engagiert, wie es zu seiner Entdeckung kam. Mit seiner Neugier und Leidenschaft gepaart mit moderner Technologie und Forschung verbessert er die Lebensqualität von Hirntumorpatienten und sorgt für ein tieferes Verständnis des menschlichen Gehirns. Den von ihm miteingeleiteten Paradigmenwechsel erklärt er anschaulich mit Abbildungen und anhand konkreter Fallbeispiele seiner Patientinnen und Patienten.
Auf packende und berührende Weise erzählt Martín-Fernández seine persönliche Geschichte. Sein Mut, trotz Widrigkeiten weiterzumachen, dient nicht nur jungen Menschen als Beispiel. Seine inspirierende Botschaft lautet: »Geh weiter deinen Weg. Halte durch. Denn genau dort findest du die Wahrheit.«
Über den Autor
Dr. Jesús Martín-Fernández (geb. 1992 in Santa Cruz de La Palma) ist Neurochirurg und Neurowissenschaftler. Neben Medizin studierte er klassische Gitarre, Komposition und Orchestrierung. 2021 hat er den ersten auf Künstlicher Intelligenz basierenden Test entwickelt, um die Emotionen im Gehirn eines Patienten herauszufinden. Seitdem konzentriert er sich auf Wachoperationen bei Hirntumoren und ist zusammen mit seinem Mentor, dem renommierten Neurochirurgen Hugues Duffau, einer der weltweiten Förderer eines Paradigmenwechsels.
Dr. Jesús Martín-Fernández
DIE
VERMESSUNG
UNSERER
GEFÜHLE
Ein Neurochirurg erzählt von seiner Entdeckungsreise in die Tiefen des Gehirns
Übersetzung aus dem Spanischen von Imke Brodersen
Die Mehrheit der in diesem Werk geschilderten Fälle ist verifiziert und wird mit dem vorherigen Einverständnis der Patientinnen und Patienten veröffentlicht. Zum Schutz der Privatsphäre wurden jedoch teilweise die Namen geändert. Teilweise wurden die Fälle aus erzählerischen Gründen gestaltet und spiegeln nicht die Geschichte konkreter behandelter Personen wider.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2024 Jesús Martín-FernándezDer Originaltitel Dime qué sientes ist erschienen bei Ediciones Paidós, Barcelona, Spanien. Ediciones Paidós ist ein Imprint der Editorial Planeta S.A.
Copyright © 2025 für die deutsche Ausgabe Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Vera Baschlakow, Berlin
Umschlag: zero-media.net, München
Umschlagmotiv: istock/Ninevian
FinePic®, München
Illustrationen: © Javier Pérez de Amézaga Tomás, 2024
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-32831-3V001
www.koesel.de
Für meine Eltern, für eure Liebe und dafür, dass ihr für meine Träume gekämpft habt.
Für meinen Mentor, Hugues Duffau, der mir exakt so half, wie ich es brauchte, um die Welt zu bewegen.
Für meine Freunde Gabriel und Pedro, die mir ein Leuchtturm sind und mich erden, wann immer ich vom Kurs abkomme.
Inmitten des Hasses ging mir auf, dass ich eine unbesiegbare Liebe in mir trug. Inmitten der Tränen ging mir auf, dass ich ein unbesiegbares Lächeln in mir trug. Inmitten des Chaos ging mir auf, dass ich eine unbesiegbare Ruhe in mir trug.
Und allem zum Trotz begriff ich inmitten des Winters, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer existierte. Und das macht mich glücklich. Denn es ist nicht wichtig, wie sehr die Welt sich mir widersetzt, in mir gibt es etwas Besseres, das dagegenhält.
FREINACH: HEIMKEHRNACHTIPASA, ALBERTCAMUS
INHALT
Vorwort
Einleitung: Zum anderen Flussufer
1 Emotionen online festhalten
2 Das Gehirn – ein fünfdimensionales Metasystem?
3 Wachoperation an einer fünfsprachigen Dolmetscherin
4 Gibt es etwas Herrlicheres, als Musik zu machen?
Intermezzo: Resilienz
5 Wir haben die Ergebnisse
6 Warum hast du geweint?
7 Der Patient hat abgeschaltet
8 Eine extrakorporale Erfahrung
9 Warum wir die Grenzen anerkennen müssen
10 Der Tanz mit den Geistern von Broca und Wernicke
Epilog
Danksagung
Anmerkungen
VORWORT
In einer Welt voller Eile, die den Kompass verloren hat und in der es immer schwieriger wird, für einen Traum zu kämpfen, habe ich einen Fixpunkt entdeckt und empfinde mich mit einem Mal als absoluter Glückspilz. Nicht weil ich etwas erreicht hätte – denn bisher haben mein Team und ich kaum etwas vorzuweisen –, sondern weil wir nun einen Schritt weiter sind. Ich würde meinem alten Ich von vor sechs Jahren gern sagen, dass es sich nicht für immer so zu quälen braucht. Dass harte Arbeit immer zum Erfolg führt. Dass es sich lohnt, zum anderen Ufer aufzubrechen. Diesem Ich verdanke ich die Fähigkeit, sich gegen sich selbst, gegen den Strom, gegen alles zu stemmen. Denn auf die andere Seite zu rudern, ist nicht unbedingt eine Entscheidung, sondern etwas, das du tief in dir spürst. Und diesem Etwas gehst du nach. Wir haben die Verantwortung, diesem Licht auf der anderen Seite nachzugehen, wenn wir es wahrnehmen, auch wenn es nicht jedem gefällt, dass du deine Ideen leidenschaftlich verteidigst, solange du noch jung bist.
Ein junger Mensch kann seine Stimme nicht nach Belieben erheben. Das gilt nicht nur in der Neurochirurgie. Ich spreche vom Leben ganz allgemein. Und das weiß ich, weil ich es selbst erlebt habe, es noch immer erlebe. Vielleicht haben wir Jungen keine 30 Jahre Berufserfahrung, das mag sein, aber dennoch haben wir einen Traum, der uns antreibt, der uns vorandrängt und die Konsequenzen akzeptieren lässt. Für mich ist das die dringende Notwendigkeit, zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Ich will das Rätsel lösen, wie ein 1500 Gramm schweres Neuronengebilde den menschlichen Geist beherbergen kann und auf welche Weise dort eine Persönlichkeit, eine Emotion, ein Gefühl entstehen. Denn solange wir das nicht begreifen, können wir meiner Meinung nach nicht erfassen, warum wir einen Schritt weitergehen müssen, um für viele unserer Patienten eine bessere Lebensqualität zu erzielen. In meinen Augen kommen wir nicht weiter, wenn wir Gleichmut bewahren und vor der Komplexität des Gehirns die Waffen strecken. Und ich akzeptiere, dass ich nichts weiß und dass meine Suche weitergeht.
Dieses Tagebuch ist für alle, die glauben, dass es unmöglich ist, ein Motiv zu finden, um auf die andere Seite des Flusses zu gelangen. Denn es gibt dieses Motiv. Und ich glaube, dass man doch hinüberkommt, zumindest versuche ich das. Ganz gleich, wie turbulent und kalt das Wasser sein mag, wir brauchen nur einen Fixpunkt, und damit können wir versuchen, die Welt zu verändern. Deshalb lasse ich in diesem Tagebuch Revue passieren, wie es mir im Jahr 2023 ergangen ist, mit der gleichen Unsicherheit wie ein Lesender, der nicht weiß, welche Wendung die Erzählung nehmen wird. Ich verspreche, die Erfolge und Fehlschläge darzustellen, von der heutigen Zufriedenheit bis hin zu der Angst, was morgen geschehen mag. Die ganze Wahrheit.
EINLEITUNG
Zum anderen Flussufer
1. Februar 2023. Hospital del Mar, Barcelona. 23:00 Uhr.
Es läuft »Al otro lado del río« von Jorge Drexler, und ich sehe mein Leben wie im Zeitraffer vorüberziehen. Im Hintergrund höre ich, wie sich der Kaffeeautomat die letzten Tropfen für einen Espresso abringt, meinem vierten an diesem Tag. Es ist Schlafenszeit, doch mein Herz hämmert noch immer mit über 100 Schlägen pro Minute. Heute hat sich ein Kreis geschlossen. Heute habe ich Yolanda operiert und dabei einen Test eingesetzt, den wir mithilfe von künstlicher Intelligenz entwickelt haben, um zu ihren Emotionen vorzustoßen und diese zu erhalten. Und wir sind zu ihren Emotionen vorgestoßen! Im Gehirn der Patientin, während wir in einer Wachoperation einen Tumor entfernt haben. Heute haben wir in Echtzeit erlebt, wie Emotionen kollabieren und wie die Patientin vier Sekunden lang nicht mehr wahrnehmen konnte, welche Emotion die Avatare darstellten, die wir ihr über das Testverfahren zeigten. Zeitweise war Yolanda während der Hirnstimulation nicht bewusst, dass sie bei dem Test versagte, das heißt, sie war sich nicht mehr ihrer selbst bewusst und hatte die Fähigkeit zur Selbstevaluation verloren. Vorübergehend. Dadurch konnte ich die Areale identifizieren und erhalten, die ich nicht gemeinsam mit dem Tumor entfernen durfte. Aber heute hatte ich nicht nur Yolanda operiert, sondern in gewisser Weise auch meinen Onkel.
Er erlag vor sieben Jahren einem Gehirntumor, der in seinem rechten Temporallappen saß. Nach der Operation war er nie wieder er selbst. Nie mehr konnte er sich fühlen wie zuvor, Musik machen, Gitarre spielen, sich an der Sinfonie Nr. 5 von Schostakowitsch erfreuen oder eine Umarmung genießen. Warum nahm man das einfach so hin? Warum störte das niemanden in der Neurochirurgie? Warum zählte für uns immer nur, dass der Patient sprechen und sich bewegen konnte?
Seit meinem Medizinstudium wollte ich unbedingt die Komplexität des Gehirns verstehen. Ich erinnere mich an den Anatomieunterricht zum Nervensystem: Alles drehte sich um das Auswendiglernen von Gehirnregionen und ihrer jeweiligen Zuständigkeiten. Ernsthaft? Immerhin ahnte die Neurowissenschaft schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts, seit den Ausführungen des französischen Neurologen Pierre Marie, dass das Gehirn kognitive Funktionen einzig und allein über parallele elektrische Netze erzeugt, die Impulse weiterleiten, dabei ständig interagieren und sich neu konfigurieren, um unser Verhalten auf äußere Reize abzustimmen. Das Gehirn ist ein komplexes elektrisches System, das sich unablässig ändert!
Erst im vierten Jahr meines Studiums standen neurochirurgische Übungen in der Universitätsklinik der Kanaren auf dem Lehrplan. Dieses Fach faszinierte mich auf Anhieb. Ich weiß noch, wie ich einen Eingriff bei einer Patientin beobachtete, die an Epilepsie litt, nicht auf Medikamente ansprach und deren Leben stark beeinträchtigt war. Dr. Marín erläuterte uns sein Vorgehen in einer Weise, die es geradezu einfach erscheinen ließ, und das veränderte etwas in mir. Irgendwann im Oktober 2013 kam ich aus diesen Übungen und wusste, dass ich Neurochirurg werden wollte. Da wusste ich noch nicht, dass ich drei Wochen später Dr. Marín anrufen würde, um ihm zu erzählen, dass man bei meinem Onkel einen Hirntumor gefunden hatte – bei dem Menschen, der mir die Musik nahegebracht hatte, einem der ersten Menschen, die ich bewundert hatte. Ich verstand nichts von alledem. Warum? Vielleicht hat mir das Leben einen Stolperstein in den Weg gelegt und zugleich das Signal: Das ist es.
Fast zehn Jahre sind seit der Operation meines Onkels verstrichen, und heute weiß ich, dass es mir geglückt ist: Unser Test funktioniert. Während wir vier bis fünf Sekunden lang einen direkten, schmerzfreien elektrischen Reiz auf Yolandas Gehirn einwirken ließen, konnten wir das Gehirn in Echtzeit befragen, ob dieses Areal für die Erkennung von Emotionen auf den Gesichtern der Avatare entscheidend war oder nicht. Wir haben den Tumor entfernt, auch aus Regionen, die nach wie vor als inoperabel gelten, weil sie für die Emotionsverarbeitung unverzichtbar sind, wie zum Beispiel dem Cingulum, jener enormen Schwelle, die das Gehirn von vorn nach hinten durchzieht und über die unablässig emotionale Informationen kommen und gehen. Wir haben es geschafft.
Noch immer erklingt in Endlosschleife Jorge Drexler: »Rema – rema – rema – creo que he visto una luz al otro lado del río.«1 Und da bin ich. So fühle ich mich. Ich rudere still über den Fluss. Denn ich glaube, ich habe auf der anderen Seite ein Licht gesehen.
Aber zuvor – und da möchte ich die Wahrheit sagen – hatte ich eine Heidenangst. Um 8:46 Uhr betrat ich den OP-Saal, nachdem ich das komplette Vorgehen noch einmal mit dem Team durchgesprochen und unsere Neuropsychologin, Natalia, zum fünften Mal gefragt hatte, ob wirklich alles passe. Am Vortag hatten wir den Test zur Emotionserkennung exakt auf Yolanda, unsere Patientin, abgestimmt. Menschliche Emotionen sind zu komplex für ein pauschales Messinstrument. Weil jeder Mensch eine Emotion unterschiedlich einstufen oder empfinden kann, zeigten wir Yolanda die verschiedenen Emotionsdarstellungen und überprüften, wie sie diese jeweils wahrnahm und interpretierte. Alles war bereit. Gloria Villalba, die koordinierende Neurochirurgin der neurochirurgischen Abteilung des Hospital del Mar, die mich nach Barcelona eingeladen hatte, um diesen Fall mit dem Team zu operieren, hatte alles perfekt vorbereitet. Als ich in den OP-Saal kam, dachte ich nur: Hier sind zu viele Leute. Drei Kameras, Studierende der Medizin, Physiotherapeutinnen und Neuropsychologen vom Institut Guttmann. All das war für mich eine echte Herausforderung, kämpfte ich doch mit meinen Versagensängsten. Ich wusste, dass der bevorstehende Eingriff hier schon wochenlang Gesprächsthema war: eine Wachoperation, um einen Tumor aus der rechten Gehirnhälfte zu entfernen und gleichzeitig mittels eines neuen Testverfahrens in Echtzeit zu versuchen, die Emotionen der Patientin zu bewahren. Eines Testverfahrens, das ich einst ganz allein in meinem Zimmer skizziert hatte. Es war der erste Test zur Analyse der Emotionserkennung in vivo (also am lebenden, bewussten Menschen), der konkret auf das Operieren im Wachzustand zugeschnitten war. So etwas hatte es in dieser Form noch nie gegeben. Bis jetzt.
Trotz meiner Ängste erfüllte mich die ganze Zeit absolutes Vertrauen in das, woran ich monatelang gearbeitet hatte. Unmittelbar vor der Operation rief ich mir den letzten Satz ins Gedächtnis, mit dem ich mich nach meiner Ausbildung zum Neurochirurgen an der Universitätsklinik Nuestra Señora de Candelaria verabschiedet hatte: »Ich gehe fort, weil ich nicht nur Gehirne operieren will, sondern verstehen muss, wie unser Geist funktioniert.« Und dieser Satz hatte große Verantwortung zur Folge, in jeder Hinsicht.
Die Neurochirurgie ist eine anspruchsvolle Disziplin. Es ist nicht gern gesehen, wenn sich jemand mehr für die Hirnfunktion interessiert, anstatt nach einer Tumorentfernung am Hirnstamm Handschuhe voller Blut und Zerebrospinalflüssigkeit auszuziehen. Mich jedoch machte es nicht glücklich, meine Hände zu bewegen und mich dadurch »wie ein echter Chirurg« zu fühlen. Ich wollte zur anderen Seite des Flusses gelangen, wollte mehr über die Hirnfunktion herausfinden. Ich hatte den Eindruck, dass wir zu viel operierten, aber immer weniger verstanden, so als hätte die Neurochirurgie vor der Komplexität des Gehirns kapituliert. Was auch nicht gern gesehen wird, ist, wenn du einen anderen Teil deines Lebens dem Komponieren für ein Sinfonieorchester widmest oder dich zum Dirigenten ausbilden lässt. »Wie willst du als Neurochirurg auch noch Künstler sein?«, fragte mich einer meiner Professoren einst. Das verfolgt mich bis heute. Fünf Jahre lang habe ich es innerlich wiederholt. Dennoch blieb ich dabei. Ich blieb meiner unruhigen, vielleicht künstlerischen Wesensart treu. Und so verstand ich schließlich, dass das Gehirn und die Musik offenkundig etwas waren, das man aus der Sicht eines Künstlers betrachten musste, und dass es hinter dem, was wir sehen, noch andere Dinge gibt. Und so wie die Musik »etwas« ist, das wir weder berühren noch sehen können, ist dies auch bei der Gehirnfunktion mit ihren Netzen und Metanetzen der Fall. Tatsächlich wäre die Musik ohne ein Gehirn keine Musik, denn sie ist lediglich die Interpretation, die das Gehirn uns angesichts von in der Luft vibrierenden Partikeln empfinden lässt. Wie also sollte ich aufhören, ein Künstler zu sein? Ich liebe es, in einer Partitur Klangmuster zu erschaffen und Emotionen hervorzurufen. Die natürlich ebenfalls unsichtbar sind, aber eben doch existieren.
Deshalb gab ich nicht auf. Ich verfolgte weiterhin die Idee, etwas zu erschaffen, das uns ermöglichen würde, bei Patienten mit Hirntumoren die Emotionen und das Verhalten zu bewahren. Zumindest wollte ich es versuchen. Es ging nicht nur darum, das Andenken meines Onkels zu ehren und meinem Ego eine Medaille anzuheften. Ich hatte das Gefühl, es sei meine Pflicht als Wissenschaftler. Ich fand, wir müssten uns um den erheblichen Prozentsatz der Patientinnen und Patienten mit einem Hirntumor, deren Persönlichkeit, Verhalten oder Weltsicht nach der Operation beeinträchtigt ist, zumindest bemühen. Warum schien all das niemanden zu stören? Warum konnte mein Onkel niemanden finden, dem es wichtig war, dass er derselbe Mensch blieb, der er vor der Operation gewesen war?
Sechs Monate bevor alles losging, war ich in Montpellier eingetroffen. Dort sein zu dürfen, war, als würde ein Durstiger endlich Wasser bekommen. In Teneriffa hatte ich alles zurückgelassen. Nun winkte mir ein zweijähriger Forschungsaufenthalt bei Professor Hugues Duffau, der internationalen Koryphäe auf dem Gebiet der Hirntumorchirurgie am wachen Patienten. Für mich gab es nichts Wichtigeres auf der Welt, als den einzigen Neurochirurgen kennenzulernen, der in seinen wissenschaftlichen Artikeln auf die Emotionen und die Kognition des Menschen einging. Einen Wissenschaftler, der das Operieren im Wachzustand als Instrument einsetzte, um die Neurochirurgie auf ein neues Niveau anzuheben: den größtmöglichen Teil des Tumors entfernen und zugleich maximale Lebensqualität erhalten. Für mich ist er wie jener Mann in Die Reise des jungen Che, der den Fluss durchschwamm und der Strömung trotzte, um mit den Leprapatienten seinen Geburtstag zu feiern. Das Einzige, was für ihn zählt, ist der Patient. Deshalb wusste ich: Von ihm zu lernen, war der Fixpunkt, den ich brauchte, um weiter auf die andere Seite des Flusses zuzusteuern.
1
EMOTIONEN ONLINE FESTHALTEN
Begonnen hat alles vor zwei Monaten. Ohne dass es mir bewusst war.
8. Dezember 2022. Hospital del Mar, Barcelona. 11:15 Uhr.
»Ich glaube, jetzt haben wir den gesamten Tumor entfernt. Die Pyramidenbahn ist sechs Millimeter weiter hinten«, sagte meine Kollegin Gloria Villalba bei der Operation von Claudio.
»Wir können noch etwas tiefer nach vorn gehen, bis zum Fasciculus longitudinalis superioris. Wenn wir den stimulieren, wechselt Claudio automatisch die Sprache«, antwortete ich in einem Zustand der Synchronizität, der alles ganz einfach macht, weil Erleben und äußeres Geschehen perfekt passen. Ich war von dem, was ich sagte, fest überzeugt.
Und so erbat ich die Stimulationselektrode für die linke Hand und behielt den chirurgischen Sauger in der rechten. Für die Hirnkonnektivität ist es unerlässlich, die tiefen Nervenbahnen zu erhalten, die für die Verbindung von Gehirnarealen zuständig sind, und genau das ist die Aufgabe von tiefen Bahnen wie der Pyramidenbahn oder dem Fasciculus longitudinalis superioris. Während eines chirurgischen Eingriffs ist das nur möglich, indem man sie identifiziert, wenn man weiß, dass sie ganz in der Nähe sind. Wenn man bei zweisprachigen Menschen den Fasciculus longitudinalis superioris stimuliert, kann es zu einem unwillkürlichen Sprachwechsel kommen (Switching), das heißt, der Mensch verliert sekundenlang die Fähigkeit, weiter in der einen Sprache zu sprechen, und die andere Sprache springt ein.
»Tennisball.«
»Uhr.«
Ich bat erneut um die Elektrode, um einen tieferen elektrischen Reiz zu setzen und zu belegen, dass dort die tiefe Bahn verlief.
»Ball.« Wir zeigten Claudio das Bild eines Tennisballs, und er wechselte unbewusst ins Englische.
Um sicher zu sein, dass wir an diese tiefe Grenze vorgestoßen waren, die wir bei dem Eingriff bewahren wollten, wiederholte ich die Stimulation mit einem anderen Bild.
»Table.« Wieder der Sprachwechsel.
»Sehr gut. Wir haben ihn. Hier ist Schluss«, sagte ich zu Gloria.
Die Frage, an welcher Stelle man mit der Tumorresektion aufhören muss, um das perfekte Gleichgewicht zwischen dem Prozentsatz des entfernten Tumors und der Erhaltung der individuellen Lebensqualität zu erzielen, zählt zu den großen Herausforderungen in der Neurochirurgie.
Ich merkte, dass ich gerade erste Antworten auf manche Fragen fand. Mein Anliegen mit Gloria zu besprechen, tat mir gut. Ich fühlte mich wohl dabei, und sie war es, die mich ermunterte, Claudio in Barcelona zu operieren. Für ihn war es schon der zweite Eingriff in einem Jahr. Ich hatte ihn schon ein paar Monate zuvor in Teneriffa operiert, aber Glioblastome können beängstigend rasch nachwachsen. So kam es zu diesem erneuten Eingriff in Barcelona, bei dem wir den Tumor noch einmal entfernen wollten. Irgendwie begann alles mit Claudio.
Als Gloria und ich nach der Operation noch essen gingen, diskutierten wir angeregt über das Gehirn und die Projekte, die jeweils für uns anstanden.
»Wie läuft es bei Professor Duffau? Ich habe gelesen, dass du einen Test entwickelst, der bei einer Wachoperation die Emotionserkennung ermöglichen soll«, bemerkte sie.
»In Montpellier, hm, da hat man eine andere Einstellung zum Gehirn und zum menschlichen Geist. Das Operieren im Wachzustand beschränkt sich nicht auf Sprache und Bewegung. Etwas Derartiges habe ich noch nie gesehen«, gestand ich.
Schon damals trieb mich dieses Thema um. Für mich war es eine Tatsache, dass das Gehirn nicht nur aus Sehvermögen, Bewegung und Sprache besteht. Dass es in jedem Patienten buchstäblich ein eigenes Universum gibt. Ich war davon überzeugt, dass nicht die Sprache die beste Form ist, unsere Mitmenschen zu verstehen, sondern die Emotionen: die Art, wie wir diese Emotionen bei anderen wahrnehmen und sie »gespiegelt« nachempfinden. Das ist so. Weil ich mich gründlich damit befasst habe, aber auch, weil ich es persönlich erlebt habe. Fest steht, dass der Mensch von Natur aus dazu tendiert, sich möglichst angenehme Erfahrungen zu verschaffen. Unbewusst sind wir ständig auf der Suche nach Genuss. Deshalb hören wir Musik. Deshalb erklingt in meinen Kopfhörern gerade die Streicherserenade, Opus 48, von Tschaikowsky. Wir sind hedonistisch veranlagt. Das ist Teil unserer menschlichen Natur.
Ich weiß noch, wie mein Onkel nach seiner Operation genauso weitermachen wollte wie vorher. Er wollte etwas tun, was ihn früher glücklich gemacht hatte. Er nahm seinen Gitarrenkoffer und stieg mit dem Instrument zum Probenraum unserer in den 1960er-Jahren ins Leben gerufenen Familiengruppe, Los Viejos de La Palma, hinauf. Ihm und seinen Geschwistern – unter ihnen meine Mutter – war es gelungen, das Erbe der Folkloremusik der Kanaren zu erhalten. Musik zu machen, war sein Ein und Alles, aber jetzt bereitete es ihm keine Freude mehr. Und mitten in einer Probe hörte er auf zu spielen. Und sprach kein Wort mehr. Er wirkte ernst und traurig. Er hatte mich Gitarre spielen gelehrt, seit ich gerade einmal fünf Jahre alt war, also wollte ich nicht sagen: »Onkel, du hältst deine linke Hand zu weit von den Saiten weg. Du spielst gar nicht.« Es war, als würde er es nicht merken.
»Alles in Ordnung, Onkel Pepepe?«, fragte ich stattdessen, wusste aber schon, was los war.
»Ja. Alles in Ordnung«, antwortete er mit neutraler, ausdrucksloser Miene.
Ich habe mich nie getraut, ihn zu fragen, ob ihm bewusst war, was los war – dass er keine Freude mehr empfand, nicht einmal an der Musik. Dass er uns unsere Emotionen nicht mehr ansah. Oder ob er registrierte, dass er uns nicht mehr wie früher in die Arme nahm. Er sagte zu uns, es sei alles gut. Aber das war es nicht, so viel stand fest. Wenn wir ihm in das ungerührte Gesicht sahen, war uns bewusst, dass die universale Methode, zu wissen, was in jemandem vorgeht, den wir lieben, nicht über die Sprache verläuft, sondern über die gezeigten Emotionen. Und er konnte weder seine eigenen Emotionen zeigen noch die der anderen lesen. Wenn du so etwas als Angehöriger erlebst, bist du wie vor den Kopf gestoßen und fragst dich nicht, ob ein zerebrales Netz noch funktioniert oder nicht oder ob zusammen mit dem Tumor eine tiefe, für die Hirnfunktion entscheidende Verbindung entfernt wurde. Du findest dich damit ab, was dir zugestoßen ist.
Aber aus irgendeinem Grund konnte ich als Medizinstudent im achten Semester nach diesem 7. Januar 2014, an dem mein Onkel operierte wurde, nie mehr abschütteln, was ihm passiert war. Und ich wusste, dass ich irgendwann etwas dagegen tun wollte, wenn es mir möglich wäre. Als ich die Datensätze wissenschaftlicher Artikel durchsah, waren dort zahlreiche emotionale Störungen sowie Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen nach einer chirurgischen Tumorentfernung beschrieben. Aber ich fand nicht den geringsten Silberstreifen am Horizont. Es war, als hätten wir vor der Erkrankung kapituliert. Schließlich las ich, dass Professor Hugues Duffau mit seinem Team in Montpellier entsprechende Forschungen anstellte und davon berichtete. Das war ein Faden, den ich aufgreifen konnte, ein Lichtschimmer inmitten endloser Leere. Ich wusste, wenn ich mit aller Kraft ruderte, konnte ich etwas erreichen. So klein es auch wäre, etwas würde passieren. Aber trotz der Sicherheit, die ich empfand, plagten mich unsichere Zukunftsaussichten. Ich hatte Angst, bei dem Versuch zu scheitern. Und dieser verunsicherte junge Bursche ist niemals ganz verschwunden.
Ich habe alles gelesen, was ich über die Neurowissenschaften der Emotionen und das menschliche Verhalten finden konnte. Alle Artikel stammten von Duffau. Danach verstand ich, dass wir die Emotionen im Gehirn nicht lokalisieren können. Darin bestand das erste Problem. Wie soll man die Emotionen erhalten, wenn man ihren Sitz nicht kennt? Das erscheint paradox. Eine der attraktivsten Antworten hielt die Neurowissenschaft bereit: Vielleicht ließen sich die Emotionen einer Person schützen, indem man überprüfte, wie diese Person auf andere reagierte? Diese Fähigkeit wird als »soziale Kognition« bezeichnet. Der Begriff ist zwar vielschichtig, aber wir könnten ihn als die Fähigkeit definieren, die Gefühle und Emotionen anderer wahrzunehmen, zu interpretieren und dementsprechend zu handeln. In gewisser Weise ist es das, was definiert, wer wir sind und wie wir auf unser Umfeld reagieren. Deshalb begriff ich, dass das Phänomen der sozialen Kognition einen möglichen Ansatz darstellt, die Emotionsverarbeitung und folglich auch das Verhalten zu bewahren. Denn wenn wir Emotionen nicht mehr in den Gesichtern anderer wiedererkennen oder (fast immer unfreiwillig) nicht in der Lage sind zu erraten, was der andere denkt, können wir weder zu Hause in der Familie noch im Beruf noch in anderem Kontext adäquat handeln.
Aber eine Emotion zu sehen, ist doch sicher nicht dasselbe wie das eigene Empfinden, oder? Diese Frage lässt sich nicht endgültig beantworten, weil sie von etwas nicht Greifbarem abhängig ist, nämlich dem individuellen, subjektiven Erleben von dem, was wir jeweils einzeln als Emotionsempfinden definieren. Dennoch können wir uns darauf verständigen, dass die Prozesse, die beim Sehen einer Emotion und beim eigenen Empfinden ablaufen, zumindest aufs Engste verknüpft sind. Und das hat etwas mit dem Prozess der Empathie zu tun. Auch wenn wir das Wort »empathisch« tagtäglich dafür verwenden, dass jemand in der Lage ist, sich in eine Person hineinzuversetzen und ihre Gefühle zu verstehen, ist der Prozess der Empathie im Gehirn doch etwas komplizierter. Wenn wir jemandem in die Augen sehen, nehmen wir zugleich ein Komplettbild wahr – Gesichtsausdruck, Duft, den aktuellen sozialen Kontext sowie unsere eigenen körperlichen und emotionalen Empfindungen – und schließen innerhalb von Sekunden drei Unterprozesse ab, die sich überlagern und gemeinsam agieren:
Der erste Prozess verläuft extrem prompt auf dem Niveau der Wahrnehmung (perzeptorisch) und erkennt die Emotion, die das Gegenüber ausdrückt: ob es beispielsweise gerade verärgert ist, traurig oder glücklich. Der zweite Prozess ist die Spiegelung (mimetisch, auf Englisch auch Embodiment), über die wir diese Emotion nachempfinden und in uns spüren, was die andere Person fühlt. Bei genauerem Nachdenken fällt einem auf, wie oft uns ein körperliches Gefühl durchläuft und der Magen grummelt, wenn wir jemandem nur ins Gesicht schauen. Der dritte Prozess läuft auf einer kognitiveren, reflektierenden Ebene ab, auf der wir in der Lage sind, die soziale Situation des anderen einzubeziehen und ausgehend von der wahrgenommenen Reaktion eine Entscheidung zu treffen. Diese drei Teile bilden die Basis dessen, was wir als »soziale Kognition« bezeichnen.
Ich habe im Gehirn entdeckt, auf welche Weise wir solche Funktionen möglicherweise erhalten können, wenn wir sie über einen darauf basierenden Test am wachen Patienten evaluieren.
Womit weiterhin die Frage bleibt: Wo sitzen die Emotionen? Wie schützen oder bewahren wir während einer Operation etwas, das man nicht sieht? Welche Region müssen wir besonders beachten? Leicht hatten wir es nicht, weil es sich eben nicht um eine Region handelt. Wir konnten uns nicht länger einreden, Persönlichkeit und Emotionen seien im präfrontalen Kortex verankert. So ist es nicht. Wir müssen uns von der Lokalisierungsperspektive lösen, die einst aus der Phrenologie abgeleitet wurde, in der Joseph Gall jedem Abschnitt des Gehirns eine konkrete Funktion zuordnete. Dieser Theorie zufolge diente das Broca-Areal der Spracherzeugung, das Wernicke-Areal dem Sprachverständnis und der präfrontale Kortex der Emotionskontrolle. Aber das stimmt nicht. So funktioniert das Gehirn nicht. Es ist notwendig, diese Konzepte neu zu definieren. Broca und Wernicke beruhen auf einem Reduktionismus, der so nicht existiert und der nicht dem entspricht, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet. Den Grund dafür möchte ich Schritt für Schritt erklären, nachdem Sie das Motiv für diese Entdeckungsreise kennen.
Das Gehirn »von außen« zu kennen – die Anzahl der Gehirnlappen, die verschiedenen Windungen und Falten, seine Kontinente und Ozeane –, ist die eine Geschichte. Von dieser Warte aus erscheint es sinnvoll, jedem Abschnitt eine klar benannte Funktion zuzuschreiben. Wenn wir jedoch verstehen wollen, wie diese Neuronenmasse den menschlichen Verstand, das Bewusstsein und Hirnfunktionen erzeugt – das ist eine ganz andere Geschichte. Um dieser Frage nachzugehen, brauchen wir eine sehr viel breitere Sichtweise, denn unglücklicherweise (oder auch nicht) ist das Wesentliche für die Augen unsichtbar.
Alle Bücher, die je über die Emotionen und den präfrontalen Kortex geschrieben wurden, stützen sich auf eine Begebenheit aus dem Jahr 1848. Phineas Gage war ein nordamerikanischer Eisenbahnarbeiter, der am 13. September 1848 eine Ladung Sprengstoff für eine Felssprengung vorbereitete. Dabei durchbohrte ihm eine meterlange Eisenstange linksseitig den Schädel von der Schädelbasis bis zur Stirn. Gage überlebte und wurde nicht einmal bewusstlos, doch seine Persönlichkeit veränderte sich, und er verlor seine Arbeit, seine Freunde, seine Familie. Ab diesem Zeitpunkt ging man davon aus, dass der vorderste Teil des Frontallappens – der präfrontale Kortex – der Ort ist, an dem Persönlichkeit, Emotionen und Entscheidungsfindung verankert sind. Dank der Erforschung neuronaler Netze, computergestützter Neurowissenschaft und Studien bei Wachoperationen wissen wir heute, dass der Antrieb (Konation) – das Zusammenspiel von Funktionen, die mit tendenziellen Persönlichkeitsaspekten zu tun haben –, die Kognition und die Emotionen des Menschen, also das, was uns zu der Person macht, die wir sind, sich keineswegs in jedem Gehirn an einem feststehenden, allen gemeinsamen Punkt befinden. Um diesen Paradigmenwandel zu verstehen, der betrifft, was wir über das Gehirn zu wissen glaubten, müssen wir uns ein Grundprinzip klarmachen: Komplexe Hirnfunktionen (wie Aufmerksamkeit, Emotionen, Exekutivfunktionen oder Entscheidungsfindung) erwachsen aus dem Zusammenspiel vieler verschiedener und im ganzen Gehirn weit verstreuter Regionen. Diese sind jedoch synchronisiert und arbeiten somit zusammen. Und so betrachten wir das Gehirn inzwischen als ein System aus neuronalen Netzen, die sich jede Sekunde neu konfigurieren, um der Komplexität des Geistes Raum zu geben, nicht mehr als einzelne »Zimmer« oder separate, nicht austauschbare Bereiche. Was bedeutet, dass unser Wesen keineswegs im präfrontalen Kortex beheimatet ist. Emotionen, Verhalten, Persönlichkeit, das alles ist die Frucht einer beständigen und dynamischen Interaktion der zahlreichen Netze untereinander, in jeder Sekunde. Nur so können wir unbewusst Verhaltensweisen zeigen, die auf die diversen Reize abgestimmt sind, mit denen wir konfrontiert sind.
Wir haben das Gehirn lange wie den Planeten Erde angesehen und von weit oben betrachtet (siehe Abbildung 1). Niemand hat uns darauf hingewiesen, dass es zwischen den Kontinenten tiefe Ozeane gibt. Man hat uns auch nicht gesagt, dass bestimmte Städte auf mehreren Kontinenten exakt gleichzeitig aufleuchten, also synchronisiert, um Gehirnfunktionen zu ermöglichen. Wenn Berlin, Tokio und Buenos Aires synchron funktionieren können, um wie viel mehr müsste das für jeden Kontinent gelten? Deshalb konzentrierten wir uns bei der Planung eines Eingriffs am Gehirn nicht darauf, welchen Kontinent (oder welche Region oder welches isolierte Areal im Gehirn) wir retten sollten, als wäre jeder davon eine Welt für sich, sondern vielmehr auf die Frage, welcher Städteverbund über die verschiedenen Kontinente des Planeten zu erhalten wäre, damit dort weiterhin wie bei einem Orchester das Licht gleichzeitig an- und ausgeht. Und dabei mussten wir uns vergegenwärtigen, dass die Synchronisation zwischen den Städten ohne die tiefen Ozeane als Verbindungsglied verschwinden würde (siehe Abbildung 2).
Mit einer solchen dynamischen, sich im zeitlichen Verlauf ändernden Sichtweise (und etwas weniger Augenmerk auf unsere Vorstellung vom Gehirn) wird nachvollziehbar, warum ein Tumor im rechten oder linken Temporallappen Emotionsverarbeitung oder Verhalten beeinträchtigen kann. Weil alles verbunden ist. Buchstäblich. Denn wie sonst könnte ein Tumor fernab des Frontallappens derartige Folgen haben?
Abbildung 1. Um diesen Paradigmenwandel zu verstehen, brauchen wir ein Beispiel, das alle kennen, so wie diese Weltkarte. Die Kontinente erscheinen als voneinander getrennte Elemente; dazwischen liegen die Ozeane. So betrachtet, würde jeder Kontinent einem Zerebrallappen entsprechen.
Nach all diesen Überlegungen begriff ich also, dass das Problem nicht der Kontinent war, in dem der Tumor meines Onkels gelegen hatte – ob nun im Frontallappen oder im Temporallappen –, sondern dass man wahrscheinlich zusammen mit dem Tumor einen ganzen Ozean entnommen hatte, und zwar den Fasciculus fronto-occipitalis inferior (ab hier in der englischen Form IFOF abgekürzt), der verschiedene neuronale Netzwerke von grundlegender Bedeutung für höhere kognitive Funktionen verbunden hält. Es geht also nicht nur um die Städte, die aufleuchten, sondern auch um das, was sie dabei tun. Orchestriert. Und diese Synchronisation zwischen den neuronalen Netzwerken beruht auf jenen Ozeanen oder tiefen Nervenbahnen, die wir in diesem Tagebuch einzeln behandeln werden.
Abbildung 2. Die Funktionen entstehen über die Interaktionen zwischen den verschiedenen »Kontinenten« (das sind die neuronalen Netze), was es viel schwieriger macht, den exakten Sitz einer Hirnfunktion zu lokalisieren, weil es sich um etwas handelt, das in Bewegung ist. Die eigentliche Verbindung wären die tiefen Ozeane, die diese Netze ständig synchron halten.
»Und wie willst du das bewerkstelligen? Auf welche Weise willst du im OP-Saal vorgehen, um die Emotionsverarbeitung in ihrer ganzen Komplexität abzudecken?«, fragte Gloria weiter.
Meine Idee war, dass man auf der Basis von Tests zur Emotionserkennung bei Erkrankungen wie Schizophrenie oder Störungen aus dem autistischen Spektrum, für die man als Patient normalerweise nur die Augen benötigt, um eine Emotion zu identifizieren, einen Test erstellen könnte, der auf unser Hauptproblem bei der Wachoperation zugeschnitten wäre: Wir dürfen eine Hirnregion nur vier bis fünf Sekunden elektrisch stimulieren, um festzustellen, ob dieser Punkt (innerhalb eines Netzes) für die gerade untersuchte Funktion kritisch ist oder nicht. Wir brauchten also einen Test, der maximal vier Sekunden dauern durfte und dennoch realistisch simulierte, wie wir unsere Alltagsemotionen sehen. Also überlegte ich mir, mithilfe von professionellen Schauspielern über ein Tracking aller möglichen sozialen oder komplexen Emotionen (über Traurigkeit und Glück hinaus) eine Datenbasis zu erstellen. Auf diese Weise wollte ich irgendwie mediale Darstellungen festlegen, mit deren Hilfe ich so universell wie möglich feststellen könnte, dass beispielsweise Sehnsucht sich in dieser Form äußert und dass ein hyperrealistischer Avatar sie in diesen vier Sekunden darstellen kann. Anstatt mir lediglich einen Schauspieler zu suchen, hielt ich es für weitaus zuverlässiger, eine »gemittelte« Emotion zu generieren, in der viele dargestellte Emotionen verschmolzen, denn mir war bewusst, wie unterschiedlich sich Melancholie bei verschiedenen Menschen ausdrücken kann. Und künstliche Intelligenz kann uns helfen, solche Daten zu generieren.
Aber natürlich gab es da ein Problem, besser gesagt, mehrere. Ich war nicht bei Microsoft und hatte weder ein Budget noch ausreichende Mittel, auch wenn ich bereits angefangen hatte, mit dem wenigen herumzuspielen, was wir hatten. Ich wusste, dass es ein langer Weg werden würde, einen solchen Test durch ständige Verbesserung zu erschaffen und ihn dann gar bei einer Operation einzusetzen und seine Aussagekraft zu beweisen. Es ging mir nicht darum, einen allgemeingültigen Test auszutüfteln. Dazu war es noch zu früh. Wir hatten bereits hyperrealistische Avatare erzeugt, bei denen jede einzelne Geste oder Mimikveränderung, jeder Muskel, jede Pore perfekt zu erkennen waren. Jeder dieser Avatare war mit vier möglichen Antworten verknüpft, von denen nur eine richtig war, und ich hatte 30 Avatare mit 30 Emotionen. Diesen Test könnte der Patient am Tag vor dem Eingriff dreimal nacheinander durchführen. Später im OP-Saal würde man ihm dann nur die Emotionen zeigen, die er dreimal auf dieselbe Weise wahrgenommen hatte. So wollten wir gewährleisten, dass die jeweilige Emotion sich auf diese spezielle Weise äußerte. Denn sosehr wir auch darauf aus sind, die Emotionsdarstellung zu verfeinern, muss man doch immer berücksichtigen, wie unterschiedlich wir Menschen unsere Welt individuell betrachten. In dieser Hinsicht ist die Statistik eine gute Verbündete. Wir bestimmen die Zuverlässigkeit des Tests an gesunden Personen. Dasselbe gilt für die Konsistenz zwischen den Ergebnissen an einem Tag und einige Zeit später, damit wir sicher sein können, dass unser Instrument greift.
10. Januar 2023. Paris. 10:00 Uhr.
Gloria ruft an, um einen Fall aus ihrer Klinik zu besprechen. Es geht um eine fünfundvierzigjährige Frau nach epileptischem Anfall. Bei der Magnetresonanztomografie zeigte sich ein großer Tumor in der rechten Gehirnhälfte, der lebenswichtige Bereiche wie das Cingulum und das Corpus callosum infiltrierte.
»Würdest du in diesem Fall eine Wachoperation durchführen?«, fragt sie mich.
»Wenn die Patientin ihre gesamten Hirnfunktionen noch hat, gehe ich davon aus, dass der Tumor eher langsam gewachsen ist und ihr genug Zeit für Plastizität gelassen hat, um die Funktionen ganz am Rand des Tumors teilweise zu ersetzen. Wir können versuchen, Aufmerksamkeit, Exekutivfunktionen, semantische Kognition, Emotionsverarbeitung, Sprache und Bewegung zu überwachen und zu erhalten.«
Einen Tumor in der rechten Gehirnhälfte operiert man nicht jeden Tag im Wachzustand. Es wurde bereits getan, ja, aber es ist und bleibt selten, zumindest wenn wir uns weiterhin nur auf Sprache und Bewegung konzentrieren, wofür die linke Gehirnhälfte dominant ist, wo es zwei Sprachzentren und ein Bewegungszentrum gibt. Andererseits erschafft die Natur nichts ohne Grund. Kein Lebewesen hat einfach nur so zwei Gehirnhälften. Die Natur ist effizient; sie bringt nichts hervor, was belanglos wäre. Und ja: Wir haben zwei Gehirnhälften, und wenn wir die linke Gehirnhälfte noch immer als dominant bezeichnen, nur weil sie einen großen Teil unserer Sprache beherbergt, erscheint dies vielleicht übertrieben, sobald wir die Folgen für Emotionen, Persönlichkeit und Verhalten (die kognitiven Funktionen) einbeziehen, die Tumoroperationen am Gehirn in der einen wie der anderen Gehirnhälfte nach sich ziehen. Warum betrachten wir das Gehirn nicht als ein Ganzes? Alle neuronalen Netzwerke sind bilateral und tauschen unablässig Informationen aus!
ICH RUDERE MIT ALLER KRAFT. TIEF IN MIR LÄCHELE ICH
1. Februar 2023. Hospital del Mar, Barcelona. 09:12 Uhr.
Mein Fuß hatte das Pedal für den Wasserhahn betätigt, damit ich mir die Hände waschen konnte. Dabei ging ich gedanklich den einschneidenden Schritt durch, der nun vor mir lag. Ich wusste nicht, welche Temperatur das Wasser hatte. Nur, dass dies ein entscheidender Tag war. Wie auch immer er verlaufen würde.
Nach dem Waschen ging ich die 20 Schritte in den OP-Saal. Zwei Kameras folgten mir. Ich hob die Arme, um sicherzugehen, dass ich nichts berührte und dass der operationstechnische Assistent mir den sterilen Kittel und die Handschuhe Größe 7,5 anziehen konnte. Er band den Kittel zu. Als ich zum OP-Feld kam, sah ich, dass Dr. Gloria Villalba alles perfekt vorbereitet hatte: die Position von Yolanda, den Neuronavigator, die sterilen Etiketten für die kritischen Zonen, die wir in ihrem Gehirn vorfinden würden, und das Allerwichtigste: die Stimulationselektrode. Damit stand das Orchester bereit: alle Notenständer am richtigen Ort, Scheinwerfer an.
Im Hintergrund managte unser Neuroanästhesist Juan Fernández meisterlich das komplexe Gleichgewicht der Anästhesie bei derartigen Eingriffen. Yolanda war sediert, aber wach, während wir den erforderlichen Bereich ihrer Schädeldecke entfernten, um Zugang zum Gehirn zu erhalten. Um diesen Tumor zu erreichen, brauchten wir ein großes »Fenster«.
Ich weiß noch, wie sich alles anfühlte. Ich registrierte jeden Atemzug, hörte jedes Geräusch: den Sauger, das Rascheln meines Kittels, wenn ich mich bewegte, das Piepsen für Yolandas Herzschläge. Es war eine Form der Hyperaufmerksamkeit. Und der Hyperfokussierung.
Gloria nahm den Schädelknochen heraus. Als wir die Dura mater vor uns hatten, die Membran, die das Gehirn überzieht, forderten wir Juan auf, Yolandas Sedierung langsam zurückzufahren. Wir öffneten die Dura mater und legten das Gehirn frei, den Ort, an dem alle Informationen eines Menschen gespeichert sind und den man nur bei derartigen Operationen in dieser Form zu sehen bekommt. Auf Du und Du mit der Seele.
In zehn Minuten würden wir mit dem Mapping beginnen, also Yolandas Gehirn unablässig befragen, um eine »Karte« der kritischen Punkte für ihre verschiedenen Gehirnfunktionen zu erstellen und festzulegen, auf welchem Weg wir zum Tumor vordringen könnten.
Plötzlich wurde mir der Druck bewusst. Vor nicht einmal sechs Monaten hatte ich in Teneriffa meine Facharztausbildung zum Neurochirurgen abgeschlossen, und jetzt stand ich in einem Krankenhaus in Barcelona und wollte einen Eingriff durchführen, bei dem ich gewissermaßen Neuland betrat. Es war weltweit das erste Mal, dass jemand mithilfe von künstlicher Intelligenz, einer fortschrittlichen 3D-Anwendung und professionellen Akteuren einen auf die OP-Situation zugeschnittenen Test einsetzte, um die Emotionsverarbeitung zu erhalten. Gloria vermittelte mir all die Zuversicht, die ich in diesem Moment brauchte. Mit ihr hatte ich eine sehr erfahrene Kollegin an meiner Seite und fühlte mich sicher. Ich wusste, was ich tat und warum ich es tat. Aber ich hatte keine Vorstellung davon, was danach passieren würde oder wie es mit meinem Leben weitergehen könnte. Ich wusste nur, dass es gerade um eine Frau ging, die mir ausdrücklich gesagt hatte: »Ich will leben und auf mein Kind aufpassen können. Es ist mir egal, ob ich mich nicht bewegen oder nicht mehr laufen kann. Aber ich will ich selbst bleiben.« Darauf hatte ich ihr mein Wort gegeben. In diesem Fall kamen viele Erschwernisse zusammen. Der Tumor hatte das Cingulum infiltriert, eine der wichtigsten Strukturen für die Regulierung, Kontrolle und Verarbeitung von allem, das mit den Emotionen zusammenhängt. Das Cingulum ist wie eine Autobahn mit Hunderten von Fahrspuren, die große Mengen an emotionalen Informationen aufnehmen und abgeben. Aber im Gegensatz zu anderen tiefen Ozeanen besitzt das Cingulum eine gewisse Plastizität, kann sich also anpassen, um Funktionen ganz oder teilweise zu ersetzen. Es ist nicht wie der Fasciculus fronto-occipitalis inferior (IFOF), an dem wir zwangsläufig abbrechen müssen, sobald wir auf ihn treffen. Beim Cingulum muss man austesten, bis zu welchem Punkt es Funktionen verlagern konnte, und daran erkennen, ob man an den Tumor angrenzendes Gewebe entnehmen darf oder nicht. Und die einzige Möglichkeit, dies herauszufinden, ist ein elektrischer Reiz, während der Patient Aufgaben zur Emotionserkennung ausführt.
»Sprachstörung«, sagte Natalia Navarro, die Neuropsychologin meines Teams, die für diesen Eingriff nach Barcelona gekommen war.
»Sehr gut. Ich lasse die elektrische Schwelle bei 2,5 Milliampere. Beginnen wir mit Multitasking-Aufgaben mit Emotionserkennung und gleichzeitig ständiger Bewegung des linken Arms. Test starten«, sagte ich zu ihr in einem zeitlichen Raum, in dem es weder Vergangenheit noch Gegenwart noch Zukunft zu geben schien. Obwohl ich ihn wahrnehmen konnte. Buchstäblich.
»Verlangend … Neutral …«





























