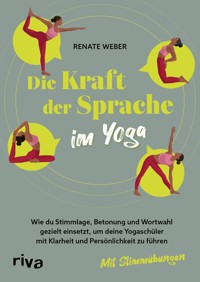12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Edition Noema
- Sprache: Deutsch
Burn-out – das ist die Diagnose, mit der Renate Weber in eine psychosomatische Klinik aufgenommen wird. Zu diesem Zeitpunkt liegen schon aufreibende Jahre der Auseinandersetzung hinter der Lehrerin: mit ihrer Familie, Freunden, Kollegen und Schülern. Und so wird schnell klar, dass es nicht nur Überlastung ist, die ihren Zusammenbruch verursacht hat, sondern tieferliegende Traumata. Mit ihren Therapeuten macht Renate sich auf die Suche nach den Ursachen ihrer seelischen Erschütterungen. Und sie finden einen Ausweg aus ihrer Verzweiflung: Renates überbordende Fantasie. Mit Heilungsmärchen, die das Rehmädchen Anuschka, den Kraken Kai und die Drachin Fulna auf eine packende Reise schicken, verarbeitet Renate ihre Traumata. Renate Weber verknüpft in diesem schonungslos offenen Heilungsroman autobiographische Erzählungen und amüsant-ergreifende Berichte aus dem Klinikalltag mit ihren persönlichen Heilungsmärchen. Sie gibt so einmalige Einblicke in den Heilungsprozess. Das Buch richtet sich an alle an Psychotherapie Interessierten und auch an von Traumatisierungen Betroffene, die Anregungen finden wollen, ihren eigenen Leidensweg zu verkürzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhalt
Was bisher geschah
Beim Universum bestellt
Briefumschlag mit Folgen
Zickzack
In meiner Mitte
Barrikaden
Plenum
Pendeln
Mehr Haare als Geld
Mini-Nati-Schweine-Lied
»Wegmachen!«
Gruppenbild
Linsensuppe
Einfall der Mungos
Auf Augenhöhe
Rosen und Narzissen
Starke und Schwache
Fast unsichtbar
Holding?
Bäume
Wahrheitskommission
Durchbruch alter Muster
Jetzt reicht's!
Ich würde das nie tun!
Vergebungsmeditation
Forum
Doppelter Geburtstag
How to say Goodbye?
Leerer Koffer?
Fast am Platz geblieben …
I did it my way …
Wiedergeborene
Last but not least
Unerwarteter Absturz
Der Abgrenzungsneid
Einfach viel zu viel
Kurschatten oder die Nacht, in der Tom kam
»Ihr seid doch alle nur gekauft!«
Geheilt?
Wie Kaugummi
Hunde- oder Menschenschule?
Unerwartete Begegnung
Imagination und Wirklichkeit
Was übrig bleibt
Fluch der Ahnen
»Das ist doch alles gar nicht wahr!«
Nein, danke!
Abschied für immer
Nowhere land oder angekommen?
Register
Literaturverzeichnis
Was bisher geschah
Mit 34 Jahren wurde die Protagonistin dieser Geschichte, Renate, mit der Diagnose Burn-out in eine psychosomatische Klinik aufgenommen. Was zunächst wie das Resultat einer chronischen Überlastung und Überforderung erschien, entpuppte sich mehr und mehr als ein Netzwerk verschiedener Traumata.
Gemeinsam mit ihren Therapeuten machte sich Renate auf die Suche nach ihren seelischen Erschütterungen. Dafür beschäftigte sie sich mit ihrer Familiengeschichte und brachte sie zu Papier. Die dabei festgehaltenen Erinnerungen an tragische Situationen, etwa an den sexuellen Missbrauch durch ihren Bruder in ihrer Kindheit, verselbstständigten sich und verstärkten die Angst und Verzweiflung, die Renate in sich spürte. Der Direktor der Klinik ermunterte sie, dieser traurigen Seite etwas Hoffnung entgegenzusetzen: Durch das Schreiben eines Heilungsmärchens, das helfen sollte, das Burn-out zu überwinden und Widerstandskraft zu erlangen. In der Heilungsgeschichte machen sich ein Rehmädchen, ein Kraken und eine Drachin auf einen unsicheren Weg in die Zukunft mit dem Ziel, die Traurigkeit zu überwinden.
Nach dem Klinikaufenthalt musste Renate feststellen, dass ihr neues Selbstbild noch keineswegs so gefestigt war, wie sie es sich gewünscht hatte. Und dass das Leben außerhalb der Klinik, privat und beruflich, weitere Herausforderungen mit sich brachte, für die sie noch nicht gewappnet war: Der Umgang mit ihrer Familie, die den Missbrauch verharmloste, Ablehnung von den Kollegen und eine drohende Zwangsversetzung, gegen die sich Renate schließlich erfolgreich und mit der Hilfe einer unerwarteten Unterstützergruppe zu Wehr setzen kann.
Schnell merkte Renate aber, dass ihre Kraftreserven sich dem Ende zuneigten. Und sie erinnert sich an den Satz ihrer Bezugstherapeutin aus der Klinik: »Sie können wiederkommen. Machen Sie eine Intervalltherapie!«
Beim Universum bestellt
18 Monate nach meinem ersten Aufenthalt betrat ich also erneut die Eingangshalle der Klinik. Auf dem Weg zu meinem Zimmer kam mir bereits Frau Mut, eine der Krankenschwestern, die ich bei meinem letzten Aufenthalt ins Herz geschlossen hatte, entgegen. Ich fiel ihr freudig um den Hals und dabei flüsterte sie in mein Ohr: »Wissen Sie, ich habe beim Universum bestellt, dass ich keinen Urlaub habe, wenn Sie kommen. Und so habe ich Sie mir gleich gekrallt, als ich die Liste mit den Neuankömmlingen gesehen habe! Wie ist es Ihnen denn so ergangen in den letzten zwei Jahren?«
Ich begann zu erzählen, von all den Schwierigkeiten, die mir im Alltag begegneten, davon, dass ich das Gefühl hatte, meine Mitmenschen immer gegen mich aufzubringen, und dass ich nun lernen wollte, Konflikte zu vermeiden. Als ich geendet hatte, war es eine Weile still. Dann blickte mich Frau Mut ernst an und sagte: »Frau Weber, ich glaube nicht, dass die Aggressionen Ihnen gegenüber nur auf Ihre Kommunikation zurückzuführen sind. Da Sie bereits viel an sich gearbeitet haben, bin ich mir sicher, dass sich hier etwas Grundlegendes Anderes immer wiederholt: Sie sind ein Spiegel für andere Menschen. Und Sie müssen davon ausgehen, dass den meisten Menschen nicht gefällt, was sie in Ihnen gespiegelt sehen. Es ist nicht das Bild, das sie mühsam nach außen aufrechterhalten oder wie sie gerne gesehen werden wollen. Was läge da näher, als den lästigen Spiegel einfach zu zerschlagen?«
Stirnrunzelnd blickte ich Frau Mut an. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie recht haben könnte. Ihre Erklärung widersprach meiner Überzeugung, dass ich schuld daran sein musste, wie man mich behandelte.
Am Abend, als ich endlich alle Dinge verstaut hatte, begann ich aufzuschreiben, was mich erneut in die Klinik gebracht hatte. Das war nicht so einfach, denn es war ein Gefühl, unter dem ich gelitten hatte, seit ich ein Teenager war. Und so versuchte ich diesem Problem mit einem Vergleich aus meinem Leben näher zu kommen: Als ich das erste Mal in die USA einreiste, musste ich mich in eine lange Warteschlange unter einem Schild einreihen. »For ALIENS« stand darauf. Und ich freute mich darüber, dass alle um mich herum ebenfalls »Aliens« waren. Ein »Alien« auf Reisen zu sein war wie ein Lebenselixier für mich: Obwohl ich alleine war, fühlte ich mich selten einsam. Und obwohl ich dicht gedrängt in einer ungeduldig wartenden Menschenmenge stand, machte mir das keine Angst. Denn ich hatte ein Ziel: Ich wollte auf die »andere Seite«. Dort wartete meine Wahlfamilie. Auf dem Rückflug mussten alle ALIENS durch einen menschengroßen Scanner. Die Strahlen dieses Scanners konnten ertasten, ob Sprengstoff im oder am Körper versteckt war. Bei mir schlug der Scanner aus: Ich hatte vergessen, meinen Metallgürtel auszuziehen. Wenn ich an vergangene Erfahrungen in Gruppen denke, so denke ich, dass ich gefühlsmäßig auch ein Stück Sprengstoff in mir trage. Es ist die Stärke meiner Empfindungen, die je nach Gegenüber überschwappen darf und sich kumuliert oder bis hin zu meiner Selbstaufgabe hartnäckig bekämpft wird.
Briefumschlag mit Folgen
Seit meiner Ankunft war bereits eine Woche vergangen. Ich war tatsächlich in die neue Kerngruppe von Herrn Pfeifer gekommen. Diesmal war es keine strukturgebende, sondern eine aufdeckende Gruppe. Die Oberärztin, Frau Dr. Feuer, hatte mich gleich nach meiner Ankunft auf diesen signifikanten Unterschied hingewiesen: »Aufgrund Ihrer frühkindlichen Störungen sind Sie eine Strukturpatientin. Bei Ihnen geht es also um Stabilisierung und Vermeidung der traumatischen Erinnerungen. Herr Pfeifer leitet jedoch diesmal keine strukturgebende, sondern eine aufdeckende Gruppe.«
»Ja, aber wenn ich mir Mühe gebe, kann ich mich auch in einer aufdeckenden Gruppe steuern«, gab ich mit Überzeugung zurück. »Wir lassen Sie nur an dieser Gruppe teilnehmen, weil Sie zu Herrn Pfeifer eine so tiefe Vertrauensbindung haben. Er wird die Gruppe zusammen mit Frau Silber leiten. Die Gruppe ist gerade erst eröffnet worden, alle Teilnehmer sind also gleichzeitig angekommen und es gibt keine Wechsel, die die Gruppendynamik beeinflussen. Es wird sich zeigen, ob Sie auf Dauer in dieser aufdeckenden Gruppe richtig aufgehoben sind.«
Schnell bemerkte ich, dass sich dieser zweite Aufenthalt schwieriger gestalten würde als der erste. Mir fehlten auch meine tierischen Begleiter, meine Meerschweinchen, denn in letzter Sekunde hatte ich eine Absage für das Tierzimmer bekommen, da eine Patientin mit Hund ihren Aufenthalt verlängert hatte. Ich hatte die beiden also nach langem Bitten in der Obhut meines Vaters gelassen und hoffte, sie bald nachholen zu können.
Meine erste Sitzung in der neuen Kerngruppe leitete Herr Pfeifer. Nachdem wir den Resonanzkreis gebildet hatten, fiel mein Blick auf einen versiegelten weißen Umschlag. Ich wurde unruhig, konnte aber nicht sagen, warum. Daniela, eine andere Patientin, sollte heute Raum erhalten, um darüber zu sprechen, was sie belastete. Als sie zu erzählen begann, fing ich zu zittern an, denn ich spürte, dass dieses Thema auch etwas mit meiner Vergangenheit zu tun hatte.
»Ja, und dann bin ich wieder auf die alten Unterlagen gestoßen und bin zusammengebrochen. Ich habe das Bild dann in den Umschlag getan und hierher mitgenommen.«
»Frau Müller, Sie erhöhen die Spannung, was ist auf dem Bild?«
Ich hatte plötzlich den Impuls, laut schreiend rauszurennen, weil ich nicht weiter zuhören wollte.
»Die Ärzte haben meinem Mann erlaubt, es zu fotografieren. Mein Mann hat mich damals sehr unterstützt.«
»Frau Müller, was ist auf dem Bild?«
»Es ist meine Totgeburt …«
In diesem Moment schossen mir die Tränen in die Augen. Etwas, das ich für längst als überwunden gehalten hatte, brach aus mir hervor. Es war die Trauer und Schuld darüber, einem neuen Wesen nicht den Weg in diese Welt ermöglicht zu haben, die Erinnerung an die Fehlgeburt, die ich selbst vor einigen Jahren erlebt hatte.
»Frau Weber, öffnen Sie die Augen und nehmen Sie Blickkontakt auf. Sie können sich neben mich setzen und mich auch anfassen«, bot Herr Pfeifer an.
Tatsächlich merkte ich, dass ich es auf meinem Platz kaum noch aushielt, da ich mich in meinen Erinnerungen zu verlieren drohte. So wechselte ich den Platz und ergriff – erstaunlich schnell für meine Verhältnisse – die Hand des Therapeuten. Wie eine Ertrinkende hielt ich daran fest. Es folgten weitere Details über Danielas Erfahrung mit der Totgeburt ihres Kindes und spätere Versuche, ein Kind zur Welt zu bringen.
Herr Pfeifer bemerkte, dass ich abstürzte, und rief: »Frau Weber, Sie können meine Hand auch fester drücken! Ich bin nicht aus Zucker!« Gesagt, getan. »Aua«, rief der Kunsttherapeut aus. Er war erstaunt über meine Kraft und ich musste unter den Tränen für einen Moment lächeln. Allerdings kippte der Stolz über diesen kleinen Sieg sofort wieder, als Daniela weitererzählte.
Als die Sitzung vorbei war, schien sich alles um mich herum zu drehen. Ich hatte so viel und so heftig geweint wie zuvor über ein ganzes Jahr ohne Gruppentherapie.
Mir war übel und ich hielt es im Speisesaal kaum aus. In mir wütete neben der tiefen Trauer eine unheimliche Wut, und zwar gegen mich selbst: Wie konnte es sein, dass ich nach einer Woche in der Klinik bereits so instabil war, dass ich jegliche Kontrolle über mein Leben verloren hatte? Noch vor einer Woche hatte ich die Tiefen des Atlantiks um die Insel El Ferrol herum erkundet. Ich war eingetaucht in eine Welt voller Wunder: Schwärme von Trompetenfischen, die auf einer mit seegrasbewachsenen Lavazunge schwebten, Mantas, die vor mir im Vulkangeröll nach Fressbarem wühlten, Seehasen und sogar Wasserschildkröten hatten mich in ihren Bann gezogen. Es war eine fabelhafte Welt, der ich mich zugehöriger fühlte als derjenigen, die über Wasser zu finden war. Ich war glücklich gewesen und hatte mich als Einheit mit dem Element gefühlt, das ich am meisten liebte: Dem Wasser.
Dieses Gefühl war nun wie weggeblasen. Ich spürte, dass ich meine Meerschweinchen in der Gruppentherapie als Unterstützer brauchte. Schließlich konnte ich die nächsten zehn Wochen ja nicht nur an der Hand von Herrn Pfeifer hängen. Deshalb nahm ich mir ein Herz und fragte die Patientin, die derzeit das Tierzimmer belegte, ob sie nicht schon am Freitag abfahren könne – schließlich fanden am Wochenende keine weiteren Therapien statt. Doch ohne Erfolg: »Nein, dann baue ich bestimmt einen Unfall, wenn ich so hetzen muss!«
Ich fühlte mich ausgeliefert und die Wut in mir schlug immer höhere Wellen. Ich versuchte, mich zu beruhigen, und überlegte angestrengt nach einem Ausweg. Ich beschloss, erstmal meine Kerngruppe zu fragen, ob es für sie in Ordnung wäre, mit zwei »Therapieschweinen« durch die nächsten Gruppensitzungen zu gehen. »Kein Problem, wenn es dir gut tut. Tut mir leid, wenn ich dich durch meine Geschichte so durcheinander gebracht habe!«, rief Daniela aus, stand auf und nahm mich in den Arm. Auch Thorsten und Karin stimmten zu.
Sofort machte ich mich also auf den Weg, um meine Meerschweinchen von meinem Vater abzuholen, durch dichten Verkehr und Schneetreiben. Als ich nach drei Stunden Fahrt bei meinem Vater ankam und die Küchentür öffnete, traf mich fast der Schlag: Nicht nur im Tierkäfig, sondern auch rund herum lagen Unmengen von Heu. Mein Blick fiel auf das Obst und Gemüse, das auf der Terrasse lagerte: Der Salat war erfroren, die Möhren braun und schrumpelig, lediglich die Äpfel schienen die frostigen Temperaturen gut überstanden zu haben. Im Käfig sah ich das ältere Tier, Tibi. Sie hatte etwas abgenommen und offensichtlich Mühe, das Heu in ihrem Mäulchen zu zerkleinern.
»Ich habe ihnen keine frischen Sachen gefüttert, weil ich die Reste davon ja wieder aus dem Käfig hätte herausnehmen müssen, damit sie nicht schimmeln«, erklärte mein Vater sorglos.
Ich war empört, doch anstatt meiner Entrüstung freien Lauf zu lassen, beschloss ich, die Tiere so schnell wie möglich in die Klinik zu transportieren.
»Papa, kannst du mir helfen, den Käfig ins Auto zu laden?«
»Ja, aber nimm doch den alten Käfig, der noch in deinem Kinderzimmer steht. Der ist nämlich sauber!«, gab mein arbeitsökonomischer Vater zu bedenken. Dieser Käfig hatte einst die Meerschweinchen meiner Mutter beherbergt. Nachdem ich mir als Studentin meine Zimmergenossen angeschafft hatte, war meine Mutter immer sehr traurig gewesen, wenn sie diese nach der Sommerfrische in unserem Garten wieder zurückgeben musste. Gegen den Willen meines Vaters hatten wir ihr dann eigene Meerschweinchen geholt, die allerdings mittlerweile gestorben waren.
»Nein, Papa, wir nehmen jetzt diesen Käfig, machen ihn sauber und laden ihn ins Auto«,sagte ich bestimmt zu meinem Vater, der mir dann schließlich doch half.
»Meinst du, du kannst hinten noch etwas sehen?«, fragte er mich und runzelte nachdenklich die Stirn, während er auf das bis an die Decke mit Heu, Stroh und Streu beladene Auto sah.
Ich ruckelte die Strohballen noch etwas zurecht, sodass ein kleiner Ausguck nach hinten frei wurde. Dabei wunderte ich mich, wie ich vor zwei Jahren sowohl die Tiere als auch meine Koffer in nur einer Autoladung hatte transportieren können. Die Rückfahrt verlief weitgehend ereignislos. Erst kurz vor der Klinik nahmen Wind und Schneetreiben so zu, dass ich kaum etwas sehen konnte. Und ich wünschte, jemand hätte mich von diesem Unterfangen abgehalten, denn ich hörte die vorbeirasenden Lastwagen mehr als dass ich sie sehen konnte.
Erleichtert parkte ich schließlich vor der Klinik. Um keinen Argwohn zu erwecken, setzte ich Tibi und Rudi zunächst in einen Umzugskarton, der noch in meinem Zimmer lagerte. Glücklich nahm ich die beiden Nager auf den Schoß. Schnell fiel mir auf, warum Tibi so abgenommen hatte. Ihre Vorderzähne waren so schief gewachsen, dass sie damit die langen Heuhalme nicht mehr hatte zerkleinern können. Seufzend rief ich eine Tierklinik an und fand tatsächlich einen Tierarzt, der Tibis Zähne noch am selben Abend stutzte. »Sie müssen dem Tier frische Sachen geben, die kann es leichter zerkleinern und Flüssigkeit daraus ziehen. Noch ein zwei Tage länger und es wäre gestorben. Bei Meerschweinchen geht das innerhalb von wenigen Tagen«, ermahnte er mich streng.
Ich war froh, dass ich die Tiere geholt hatte und dass Tibi noch lebte. Für mich waren die beiden so wichtig wie treue Freunde, die mir im Gegenzug für Futter und einen sauberen Käfig Lebensfreude und Zuneigung zurückgaben. Wieder in der Klinik, dachte ich über das zweite drängende Problem nach, das ich nun hatte: Die Putzfrauen. Selbst wenn ich den Karton mit Tibi und Rudi in den Kleiderschrank stellte, würde es doch unweigerlich nach Heu und Meerschweinchen riechen in meinem Nicht-Tierzimmer.
So hängte ich ein Schild mit der Aufschrift »Bitte heute nicht putzen!« außen an meine Zimmertür. Dann fiel ich erschöpft in einen tiefen Schlaf – und wurde durch ein penetrantes Klopfen an meiner Tür geweckt: »Renate, du sollst zu Herrn Pfeifer in die Sprechstunde kommen«, erklärte Karin mit einem Kopfnicken zum Büro des Kunsttherapeuten, das sich genau gegenüber meines Zimmers befand. »Du bist nicht allein gekommen, oder?«, fragte sie neugierig und ich zeigte auf die offene Umzugskiste. Karin blickte hinein, zeigte jedoch keine Gefühlsregung. Das irritierte mich etwas, doch dann ermahnte ich mich, dass nicht jeder Mensch so ein Tiernarr sein musste, wie ich es war.
Es war mittlerweile später Mittag und so setzte ich mich auf die Treppenstufen vor das Büro des Kunsttherapeuten und wartete müde ab, bis er die übrigen Patienten in seiner Sprechstunde beraten hatte.
Endlich empfing er mich mit den Worten: »Frau Weber, ich habe gesehen, dass Sie heute nicht in der Lebensführung waren. Was kann ich tun, um Sie so zu unterstützen, dass Sie an der Veranstaltung teilnehmen können?«
»Na ja, die Gruppentherapie gestern hat mich emotional sehr mitgenommen. Es könnte mich unterstützen, wenn ich meine Meerschweinchen zur Selbst-Stabilisierung in die Gruppentherapie mitbringen darf.«
»Wo sind denn Ihre Meerschweinchen gerade?«, fragte Herr Pfeifer nun etwas gedehnt.
Ich zeigte mit dem Daumen hinter mich in Richtung meines Nicht-Tier-Zimmers.
»Sie klären wohl nur etwas auf, wenn ich es in Kontakt bringe. Ansonsten machen Sie einfach ohne Absprache, was Sie wollen. Sie hätten mich beim Mittagessen fragen können!«,brach es wütend aus Herrn Pfeifer heraus.
»Ich hätte Ihnen das heute schon noch gesagt. Allerdings hätte ich vorher geguckt, wie Sie drauf sind …«, verteidigte ich mich.
»Man muss aber auch etwas in Kontakt bringen, unabhängig davon, wie der andere ›drauf‹ ist! Ich hätte Ihnen nicht gestattet, die Tiere in Ihrem aufgewühlten Zustand zu holen. Und was ist mit den anderen Gruppenmitgliedern. Was, wenn da jemand allergisch auf Meerschweinchen reagiert?«
»Die habe ich vorher gefragt, die haben nichts dagegen!«
»Und deshalb wohl auch das Schild Bitte heute nicht putzen an Ihrer Tür. Ich habe mich schon gewundert«, murmelte der Kunsttherapeut, und zum ersten Mal huschte so etwas wie ein Lächeln über sein Gesicht. »Ist ja schon kreativ und auch irgendwie lustig, die Gruppenmitglieder so alle mit ins Boot zu holen … Aber trotzdem, so behandele ich Sie nicht weiter! Alles, was hier passiert, auch wenn Sie an Veranstaltungen nicht teilnehmen, muss mit mir vorher abgesprochen sein. Und Tiere in einem Nicht-Tierzimmer zu halten ist gegen die Hausordnung. Gucken Sie mich nicht so an! Ich bin nicht Ihr Komplize. Ich werde das weiterleiten und Sie nicht vor den Konsequenzen schützen. Das schwächt Sie.«
»Bitte warten Sie bis Freitag, bevor Sie es der Hausdame sagen«, flehte ich. »Sonst darf ich vielleicht nicht mehr umziehen.« Ich hatte nämlich schon bemerkt, dass die neue Hausdame die vier Tierzimmer nur noch nach penetranter Nachfrage an Tierbesitzerpatienten vergab. Offensichtlich sollten auch diese verbliebenen Tierzimmer bald umgestaltet und alle Tierbesitzer in der Nachbarklinik untergebracht werden. Das war für mich keine Option. Denn mit meinen starken Rückzugstendenzen, da war ich sicher, würde ich noch größere Schwierigkeiten haben, an den Mahlzeiten und Veranstaltungen teilzunehmen, wenn ich extra aus der Nachbarklinik kommen müsste. Hier war es ein Vorteil, dass ich auf dem gleichen Gang wohnte, auf dem meine beiden Therapeuten ihre Büros hatten.
»Frau Weber, Sie müssen deshalb bestimmt nicht die Klinik verlassen. Aber als Ihr Therapeut bin ich mit den Alleingängen, die Sie immer wieder machen, nicht zufrieden. Und wenn Sie mit mir nicht im Kontakt sind, kann und werde ich Sie nicht behandeln!«
»Und was ist mit den Schweinchen in der Gruppentherapie? Ich habe die Tiere auch deshalb geholt, weil ich weiß, dass Daniela morgen ihre Geschichte weitererzählt. Und ich kann doch nicht ständig an Ihrer Hand hängen!«
»Das muss ich im Team besprechen«, grummelte Herr Pfeifer, der inzwischen wieder etwas milder gestimmt zu sein schien.
Am nächsten Morgen lief ich durch die langen Gänge der Klinik, als mir der Chefarzt, Herr Leben, gefolgt von der Oberärztin und einigen Therapeuten entgegenkam. Dabei grinsten sie mich breit an und ich wurde das Gefühl nicht los, Thema ihrer Sitzung gewesen zu sein. Mit einem vorsichtigen »Guten Morgen« zog ich an ihnen vorbei und lief schnurstracks in die morgendliche Kerngruppensitzung.
»Es braucht sehr lange, bis ich wütend werde, und gestern war ich sehr wütend auf Sie«, begann Herr Pfeifer. »Frau Weber, das ist eine gelbe Karte. Da waren wir uns im Team einig. Und es kann sein, dass bereits eine Rechnung über 70 Euro in Ihrem Postfach liegt für die zusätzlichen Reinigungsarbeiten in ihrem Nicht-Tierzimmer. Davon konnte ich die Hausdame leider nicht abbringen. Ich stehe aber zu meiner Entscheidung und von mir aus können Sie mich dafür doof finden …«
In diesem Moment passierte etwas Eigenartiges: Anstatt auf Herrn Pfeifer wütend zu sein, war ich plötzlich innerlich ganz ruhig, um nicht zu sagen beruhigt. Diese ungewohnte Reaktion konnte ich mir nicht erklären.
»Ich sehe, dass Sie sehr berührt sind«, bemerkte Herr Pfeifer.
»Ja. Ich glaube, dass sich vielleicht noch nie jemand die Mühe gemacht hat, meinem Verhalten Grenzen zu setzen, ohne mich gleichzeitig dafür zu verurteilen und verdrängen zu wollen.«
Und mit einem Blick auf Danielas immer noch ungeöffneten Briefumschlag fragte ich: »Kann ich die Meerschweinchen nun holen?«
»Ja.«
Schnaufend kam ich also wenig später mit dem Umzugskarton, in dem sich Rudi und Tibi befanden, die enge Dachbodentreppe hinauf. Als ich ihn neben meinem Stuhl absetzte, stieß Karin einen spitzen Schrei aus und rief: »Das stinkt ja, da setze ich mich weiter weg!«
Und damit setzte sie sich von mir weg auf einen Stuhl, der näher am Fenster stand. Auch Thorsten machte seinem Unmut Luft und sagte: »Ich weiß nicht, ob ich das dauerhaft aushalte.«Die anderen Kerngruppenmitglieder sagten nichts, und doch wirkte sich das Unbehagen von Karin und Thorsten auf die Gesamtatmosphäre aus, die nun sehr angespannt war.
Ich war von dieser Reaktion verwirrt, denn ich hatte ja alle Beteiligten vorher um die Erlaubnis gefragt, die Tiere zur Gruppentherapie mitbringen zu dürfen. Nun taten Karin und Thorsten so, als würden sie die Meerschweinchen als Bedrohung empfinden. Das konnte ich mir als Reaktion auf einen Hund noch erklären, hier jedoch fehlten mir die Worte.
»Auch Allergien«, schaltete sich Herr Pfeifer nun ein, »sind psychosomatisch bedingt, wie man an Experimenten unter Trance festgestellt hat. Patienten reagierten in diesem Zustand auf die betreffenden Stoffe plötzlich nicht mehr allergisch.«
Ich bemerkte, wie energisch Herr Pfeifer sich dafür einsetzte, dass ich meine Meerschweinchenunterstützung bekam, und gleichzeitig war ich traurig darüber, dass die Anderen plötzlich so viel Anstoß an den Tieren nahmen.
Und dann kam der Teil der Gruppensitzung, den ich am meisten gefürchtet hatte: »Kann ich jetzt weitermachen?«, fragte Daniela unruhig.
Blitzschnell lief ich zu der Meerschweinchenkiste, um Tibi und Rudi als moralische Verstärkung herauszuholen.
»Frau Weber, Sie sollen mir Bescheid sagen, wenn Sie die Meerschweinchen aus Ihrer Kiste holen oder wieder zurücksetzen. Ist das angekommen?«
»Ja«, gab ich zurück und streichelte Rudi und Tibi über das weiche Fell, denn ich hatte sie ja bereits auf dem Arm.
»Ähm, Herr Pfeifer?«
»Ja?«
»Der Rudi muss mal. Ich setze die Schweinchen jetzt wieder zurück.«
Verblüfft blickte mich der Kunsttherapeut an, nickte dann aber zustimmend.
»Woher weißt du das?«, fragte Daniela neugierig.
»Er wird dann immer so unruhig vorher und hört auf zu quieken.«
Für einen Moment huschte ein anerkennendes Lächeln über Danielas Gesicht, doch dann besann sie sich auf das Thema, das sie ja heute weiter einbringen wollte, und so setzte sie ihre traurige Geschichte fort. Obwohl sie den Briefumschlag geschlossen ließ, sah ich plötzlich alles wie in einem Film ablaufen: Das hoffnungsfrohe Paar nach dem ersten Ultraschall, das Bangen im Krankenhaus und schließlich das schmerzhafte Bewusstsein, dass das Kind nicht mehr im eigenen Körper »wohnte«. Dass es tot war und nie mehr wiederkommen würde. Ich sah Danielas totes Kind vor mir liegen und spürte nur noch Verzweiflung. In mir spielte sich noch ein zweiter Film ab. Doch ich konnte ihn nicht wirklich sehen. Es war, als ob jemand den Bildträger zerschnitten hätte. Ich wusste, was auf dem Film war: Es waren die Erinnerungen an die Fehlgeburt, die ich selbst erlitten hatte. Ich hörte die Stimme meines Frauenarztes: »Es ist immer wieder dieselbe traurige Geschichte.«
Und mich: »Bobo wird nicht zerschnitten! Ich will ihn beerdigen!«
»Wir brauchen nur ein kleines Stück. Renate, du und Felix, ihr wollt vielleicht weitere Kinder kriegen. Vielleicht hast du ja einen Vitalstoffmangel. Vielleicht hätte man das Kind ja mit einer Cerclage retten können.«
»Das geht mir jetzt zu weit! Ihre Tochter hatte eine Fehlgeburt. Mischen Sie sich bitte nicht weiter ein. Ich würde allerdings auch zu einer Untersuchung raten. Sie müssten ihn aber kühlen, das Eiweiß gerinnt jetzt sehr schnell …«
Abrupt wurde ich aus meinen Erinnerungen gerissen, denn ich spürte plötzlich eine extrem starke Wut im Raum. »Du hast doch nur die Totgeburt gehabt, weil du geraucht hast«, herrschte Christoph Daniela aufgebracht an.
»Herr Wirt, hier gehe ich entschieden dazwischen und stelle mich schützend vor Frau Müller. Ich toleriere Ihren persönlichen Angriff nicht. So etwas habe ich noch nicht erlebt: Dies ist ein geschützter Raum, insbesondere, wenn sich jemand öffnet. Und Sie haben Frau Müller nicht anzugreifen. Selbst wenn sie sich zu Tode raucht oder zu Tode säuft ist das nicht Ihre Verantwortung. Ich bin der Gruppentherapeut! Wenn Sie mit Ihrer Wut zu mir kommen, dann werde ich Sie genauso unterstützen wie Frau Müller jetzt. Und ich denke, Sie sitzen auf einem riesigen Berg aufgestauter Wut.«
Noch nie hatte ich Herrn Pfeifer so aufgebracht gesehen. Ich sah zu Christoph hinüber und bemerkte, dass der irritiert über diese Zurechtweisung war. Er hob an, etwas zu sagen, was ihm sichtlich schwerfiel: »Meine Eltern haben mich als Kind zugeraucht. Ich hatte schon früh Asthma, doch das hat sie nicht davon abgehalten, unsere kleine Wohnung weiter zuzuqualmen. Ich habe noch zwei Geschwister und in der Wohnung und auch bei meinen Eltern bekam ich wenig Raum für mich selbst. Es galten strenge Regeln, und ich habe immer versucht, mich an alle Regeln zu halten. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum die Renate diese Meerschweinchen mitbringen durfte«, ärgerlich blickte Christoph zuerst auf die Kiste mit den Tieren und dann auf mich.
»Ich hatte auch eine Fehlgeburt und die Tiere sind seitdem verstärkt wie ein Kinderersatz für mich«, versuchte ich Christoph zu erklären.
»Ja, aber die anderen bringen ja auch nicht einfach ihre Kinder mit in die Kerngruppe, um sich stabil zu fühlen«, hielt mir Christoph jetzt entgegen. In diesem Moment zog sich etwas in mir zusammen: Wie ein Stich fühlte ich, dass jemand über meine inneren Grenzen ging. Ich empfand Christoph als hart und unnachgiebig und hätte mir doch gerade nach meiner »Miniöffnung« in der Gruppe liebevolles Verständnis gewünscht. Ein Verständnis, wie Christoph es sich wahrscheinlich auch von seinen Eltern gewünscht hätte, doch der fuhr nun unbeirrt fort: »Das ist aber gegen die Regeln. Ich weiß, dass du uns alle vorher gefragt hast, aber wenn das jeder machen würde ….«
»Genau, da muss ich Christoph zustimmen«, sagte Thorsten nun. »Und wenn die Renate hier in der Gruppe ist, kann ich mich nicht öffnen«,führte er aus, ohne mich dabei anzublicken.
Wie von einem Hieb getroffen, zuckte ich zusammen. Doch da griff Herr Pfeifer ein: »Wissen Sie, Herr Schott, genau so entstehen Kriege. Durch dieses ›Und du darfst aber nicht hier sein!‹ Wenn Frau Weber nicht hier sein darf, dann dürfen Sie es vielleicht in der nächsten Sitzung auch nicht mehr. Und Sie nicht, und Sie nicht, und Sie nicht«, sagte Herr Pfeifer und deutete dabei der Reihe nach auf alle Kerngruppenmitglieder bis auf mich.
Mit jeder Minute, die ich mehr auf meinem Stuhl verbrachte, machte sich Unbehagen in mir breit. Ich wurde den Eindruck nicht los, dass alle Menschen, die sich je an mir und meinem Verhalten gestört hatten, in gerade eben dieser Kerngruppe repräsentiert waren. »Das ist ja hier wie in einer Matrix«, dachte ich mürrisch, sah Herrn Pfeifer an und hoffte, dass wenigstens er »der echte Herr Pfeifer« war und dass er mich in dieser missgünstigen Atmosphäre nicht im Stich lassen würde. Die war nämlich immer noch deutlich spürbar, und so war ich froh, als sich die Sitzung ihrem Ende zuneigte. Bevor ich aber meine Meerschweinchen aus dem Karton holte, um sie unten in meinem Zimmer wieder in ihren Käfig zu setzen, sprach mich Christoph an:»Sag mal, du hast doch eine Badewanne im Zimmer, oder?«
»Ja, woher weißt du das?«, fragte ich.
»Ich habe mir die Feuerschutzlagepläne des Hauses angesehen und geguckt, wer alles eine Badewanne hat. Ich habe nämlich nur eine Dusche.«
Mir fiel dazu nichts mehr ein. Beim Essen besorgte ich erstmal einen Krug mit Mineralwasser und stand plötzlich am Tisch Karin gegenüber, die laut schimpfte: »Dauernd muss ich das Wasser für die Gruppe holen. Dass das aber auch sonst keiner tut.«
»Jeder macht eben das, was er am besten kann«,konterte ich und blickte in Karins verblüfftes Gesicht. Es war nämlich keineswegs so, dass irgendjemand irgendetwas vom Buffet für andere holen musste. Das Wasser holte meistens spontan derjenige, der zuerst am Esstisch war.
Dann ging ich zum Buffet und erfreute mich an den Früchten, die ich rasch auf meinen Teller sammelte. Da gab es Papaya, Physalis und Kiwi sowie Orangenstückchen. Lediglich ein unangenehmer Fischgeruch stieg mir in die Nase.
»Du nimmst dir auch alles. Willst du nicht lieber meinen Fisch?«
»Nein, und ich glaube dir, dass du mir nur das gönnst, was du selbst nicht magst«, entgegnete ich frech. Ich war in Kampfeslaune und das merkte offensichtlich auch Karin, die mir ein anerkennendes: »Du bist aber frech!« hinterherrief, als ich mit meinem Teller zum Esstisch zurückging. Doch dann wurde ich wieder nachdenklich, denn diese Frechheit und dieses Selbstbewusstsein hätten mir in früheren Gruppensituationen sicherlich gut gestanden.
Doch das war wohl nicht das einzige, was gefehlt hatte. Ich erinnere mich nicht genau, wann ich angefangen habe, mich aus Gruppen zurückzuziehen. Aber schon als Teenager hatte ich das Gefühl, dabeizustehen, ohne dazuzugehören. Bis heute fühle ich mich oft unbehaglich und eingeengt in größeren Gruppen. In Gruppen fühlte ich mich einsamer als wenn ich allein oder mit meinen engen Freundinnen zusammen war. Ich hatte stets das Gefühl, anders zu sein. So sinnierend, sah aus dem Fenster des Speisesaals und bemerkte ein Eichhörnchen, das frei von Baum zu Baum hüpfte.
»Ja, genau«, dachte ich. In der Natur, im Wasser oder auf meinen Reisen fühlte ich mich mit allem verbunden. In Spanien konnte ich mich in der Dorfgemeinschaft bewegen und akzeptieren, dass ich anders war. Denn ich war ja keine Spanierin. Ich konnte mich mit den Spaniern verbinden in ihrer Spontaneität und ihrer Lebensfreude. Wenn ich diese beiden Qualitäten in mir verband, ging es auch in großen Gruppen in Deutschland gut. Mir war bewusst, dass ich mich ständig im »Transitbereich« des Lebens aufhielt, weil ich überall hinfuhr, um doch niemals richtig bei mir selbst anzukommen. Wie das Eichhörnchen wollte ich frei sein und von Baum zu Baum fliegen. Im Moment hatte ich das Gefühl, dass ein Teil von mir noch in Spanien war. Die Gesichter und Sprachfetzen vermischten sich in meinem Kopf.
Am Nachmittag hatte ich ein sehr schönes Erlebnis, das mich mit der bisherigen Woche wieder versöhnte: Ich sah die Pferde auf der Ranch wieder. Der Hengst Sam sah mich mit seinen großen braunen Augen an und ich flüsterte ihm in seine flauschigen Ohren, dass ich ihn und die Lamas sehr vermisst hatte. Er sah mich vertrauensvoll an, und als ich oben auf seinem Pferderücken war, streckte ich die Hände aus und konnte fliegen.
Renate auf Wallach Sam mit Lamas
Ich spürte, dass er auf mich aufpasste, und tatsächlich waren seine Ohren immer nach hinten gestellt. Ich schloss die Augen und sah mich auf Sam im wilden Galopp durch die Landschaft reiten. Als ich ihn später führte, versuchte er ein paar Mal seine Schnauze in meinen »Bereich« zu drehen. Ich schob ihn sanft zurück und erzählte ihm von meiner Woche in der Klinik. Dabei hatte ich das Gefühl, dass er mich verstand und es mochte, wenn ich zu ihm sprach. Ich hatte vergessen, wie schön es war, aus dem engen Tal, in dem die Klinik lag, heraus und auf die freien Felder zu fahren. Zum Abschied streichelte ich noch die Lamafrau Fellina und die Schafe. Aus den winzigen Lämmern waren zwei riesige Wolken geworden: eine schwarze und eine weiße. Ich fühlte mich mit diesen Tieren so verbunden, dass es mir schwerfiel, zu gehen. Vielleicht war ich irgendwo tief in meinem Herzen auch ein Tier. Denn nur so ist es zu verstehen, dass ich mich mit ihnen auf Anhieb verstehe und mir die Kommunikation mit Menschenherden so unheimlich zu schaffen macht.
»Vielleicht ist es eben einfach so«, sagte ich leise zu mir und fühlte mich durch den bestätigenden Kontakt mit den Tieren selbstbewusster. Sie gaben mir nie das Gefühl, dass ich falsch oder anders war. Sie akzeptierten mich so, wie ich bin. Seufzend, dass die Welt nicht von Tieren regiert wurde, schlurfte ich zurück in mein Zimmer.
Zickzack
Mit einem Gefühl des Unbehagens und der Angst betrat ich am Montag den Aesculapiumsaal zur Taketina-Intensivwoche. Meine Angst steigerte sich noch, als immer mehr Patienten und Therapeuten auf dem Boden Platz nahmen. Ohne Aussicht auf längere Rückzugsphasen erschien es mir als bedrohlich, mit so vielen Menschen über so viele Stunden zusammen zu sein. Ich suchte Schutz bei Daniela und nahm ihre Hand. Das hatten wir vorher besprochen. Als sich die rund 40 Patienten vorstellten, schienen mich die vielen Wahrnehmungen, die meine Augen aufnahmen, zu überfrachten, und so schloss ich sie.
Mit geschlossenen Augen lauschte ich den berühmten Worten von Charlie Chaplin, die Frau Elfenbein uns nun vorlas:
»Als ich mich selbst zu lieben begann,
konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid
nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben.
Heute weiß ich: Das nennt man AUTHENTISCH SEIN.
Als ich mich selbst zu lieben begann,
verstand ich, wie sehr es jemanden beeinträchtigen kann,
wenn ich versuche, diesem Menschen meine Wünsche aufzuzwingen,
auch wenn ich eigentlich weiß, dass der Zeitpunkt nicht stimmt
und dieser Mensch nicht dazu bereit ist – und das gilt auch,
wenn dieser Mensch ich selber bin.
Heute weiß ich: Das nennt man RESPEKT.
Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen
und konnte sehen, dass alles um mich herum
eine Aufforderung zum Wachsen war.
Heute weiß ich, das nennt man REIFE.
Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit,
zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin
und dass alles, was geschieht, richtig ist –
von da an konnte ich gelassen sein.
Heute weiß ich: Das nennt man SELBSTVERTRAUEN.
Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben,
und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen.
Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht,
was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt,
auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo.
Heute weiß ich, das nennt man EINFACHHEIT.
Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war,
von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen
und von Allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst.
Anfangs nannte ich das «Gesunden Egoismus»,
aber heute weiß ich, das ist SELBSTLIEBE.
Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, immer recht haben zu wollen,
so habe ich mich weniger geirrt.
Heute habe ich erkannt: das nennt man BESCHEIDENHEIT.
Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben
und mich um meine Zukunft zu sorgen.
Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo ALLES stattfindet,
so lebe ich heute jeden Tag und nenne es ERFÜLLUNG.
Als ich mich zu lieben begann,
da erkannte ich, dass mich mein Denken
armselig und krank machen kann.
Doch als ich es mit meinem Herzen verbunden hatte,
wurde mein Verstand ein wertvoller Verbündeter.
Diese Verbindung nenne ich heute WEISHEIT DES HERZENS.
Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen,
Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten,
denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander
und es entstehen neue Welten.
Heute weiß ich: DAS IST DAS LEBEN!«
Bewegt von diesen weisen Worten wurde es mir leichter ums Herz, als wir in die Gehübungen kamen. Je schneller ich ging, desto weniger musste ich die Außenwelt wahrnehmen, bis ich schließlich rannte, um schließlich nur noch das Pochen meines Herzens und meinen lauter werdenden Atem zu spüren. Trotzdem fiel es mir schwer, mich in die Struktur von Tanz und plötzlichen Trinkpausen einzufinden. Ich fühlte mich erschöpft und legte mich nach wenigen Tanzschritten in die Mitte. Ich pendelte zwischen einer dumpfen Müdigkeit und dem Willen, mitzumachen, hin und her. Dieses Phänomen begleitete mich über die nächsten zwei Tage.
Am dritten Tag sollten wir zunächst mit verbundenen Augen zwei Wachsmalkreiden aussuchen, um dann mit den beiden Farben im Einklang mit der vorgespielten Musik zu malen. Es sollte kein geplantes Bild werden, und als ich die Augenbinde wieder abnahm, erschrak ich: In wilden roten und braunen Linien war ein Bild entstanden, dass vor Verlust und Leid nur so schrie.
»Hängen Sie Ihre Werke bitte hier an die Saalwand«, forderte uns Frau Elfenbein auf.
»Frau Elfenbein?«, fragte ich.
»Ja?«
»Da ist aber nichts drauf – nur Gekritzel. Und wenn ich es mir genauer angucke, glaube ich, dass ich dann mal zum Arzt muss. Tschüß.« Der tiefe Ausdruck von Leid und innerer Zerrissenheit hatte mich erschreckt. Ich hatte nicht erwartet, dass in einem zufällig entstandenen Kritzelbild so viel Ausdrucksfähigkeit stecken konnte. Und ich war bestürzt, zu erkennen, wie traurig ich wirklich noch war – und wie sehr ich diese Traurigkeit hinter meinen Scherzen versteckte. Frau Elfenbein sah mich ernst an, als sie antwortete:
»Frau Weber, bleiben Sie bitte hier. Wissen Sie, wenn ich in eine Kunstausstellung gehe, dann sehe ich dort oft Bilder, die weniger ausdrucksvoll sind, als das, was Sie hier geschaffen haben. Und da Ihnen das nicht bewusst zu sein scheint, habe ich Sie alle gebeten, Ihre Werke aufzuhängen. Und bitte bewerten Sie nicht dauernd mit den eingeschränkten Maßstäben, nach denen wir in unserer Gesellschaft alles schnell in ›gut‹ oder ›schlecht‹ aburteilen.«
Nach der Pause hingen alle unsere Bilder an der Wand und bildeten ein einzigartiges Sammelsurium. Nun bekamen wir den Auftrag, unsere Gefühle in Ton zu »drücken« und bei Bedarf Geräusche zu machen. Ich schrie. Während einige meiner Nachbarn den Platz wechselten, spürte ich, wie meine Nachbarin sich zunächst innerlich gegen mein Schreien wehrte, bis sie schließlich lachte und abwertende Bemerkungen von sich gab. Ich hielt inne. Ich kannte diese abwertenden Sätze. Plötzlich war meine ganze Kraft wie weggeblasen und ich fühlte mich nur noch schlecht. Doch dann wurde ich wütend: Ich verpasste dem Ton Handkantenschläge, trampelte auf ihm herum – und ja, ich schrie wieder. Schwitzend kratzte ich den festgetrampelten Ton von der Unterlage und formte ihn zu einer Figur mit traurigen Augen und einem riesigen, schreienden Mund: Dem Wutschreier.
Der Wutschreier
Ich hätte gerne geweint, aber das konnte ich nicht – schon gar nicht vor so vielen Menschen. In meiner Familie war es akzeptiert, Wut auszudrücken, während es galt, Tränen zu vermeiden. Ich bemerkte, dass mein Wutanfall nun auch Frau Elfenbein irritierte, die sagte: »Und Sie können auch in Ihre Lebensfreude gehen.«
Tatsächlich wurde ich beim Kneten eines zweiten Tonklumpens ruhiger. In der Gesprächsrunde danach sprach eine Patientin die abfälligen Bemerkungen bzw. das Lachen über meinen Wutanfall an. Meine »Tonnachbarin« verteidigte sich und ich lag erschöpft von dem wilden Tanz neben Daniela und wollte eigentlich nur meine Ruhe haben.
»Und es ist nicht gut, sich so zu verausgaben, dass keine Energie mehr übrigbleibt. Auch im Leben kommt immer wieder etwas dazwischen, wofür wir Kraftreserven brauchen«, mahnte Frau Elfenbein und blickte mir dabei direkt in die Augen. »Wir machen jetzt eine 20-minütige Pause.«
Die Vorstellung, mich im Schwimmbad erfrischen zu können, weckte meine Lebensgeister, und so lief ich eilig aus dem Saal, um wenig später mit noch tropfenden Haaren die Treppe des Schwimmbadaufgangs herunterzusteigen. Sogleich begegnete mir der wütende Blick von Frau Rapp, die die nächste Therapieeinheit auch sogleich mit einer Predigt begann:
»Wir haben es noch nie erlebt, dass es so schwer ist, Sie alle hier in diesem Raum zu halten. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass hier so viele kreative Energien im Raum sind, die man schlecht bündeln kann. Und bei einigen hier habe ich den Eindruck, dass sie sich schlichtweg aus der Therapie wegschleichen wollen«, dröhnte Frau Rapp und ahmte dabei den breitbeinigen Gang eines Betrunkenen nach. »Das ist nicht erlaubt während des Therapieprozesses. Wenn es nun tatsächlich bald bei Ihnen tropft, dann melden Sie sich bitte bei einem von uns ab und dann können Sie natürlich auf die Toilette gehen. Haben wir uns verstanden?« Ich spürte Wut und Angst. Wie früher gegenüber meiner Mutter begann ich mich trotzig zu verschließen und zu schweigen. Ich wusste, wenn ich floh, würde mir jemand aus der Armada der Therapeuten folgen. Ich konnte weder Frau Rapp noch Frau Elfenbein angucken und ging zu Frau Mut, in der Hoffnung, dass wir gemeinsam rausgehen würden. Doch wir blieben im Raum und in mir kam Verzweiflung hoch, als sie meine Hand hielt. So etwas Einfaches sollte mir helfen? Tatsächlich schien es zu helfen, und das machte mich noch trauriger und brachte mich noch mehr durcheinander.
Doch am nächsten Morgen überkam mich erneut ein starker Widerwille, gepaart mit der Angst, den Saal nicht verlassen zu können, wenn mich die Gefühle der anderen und meine eigenen innerlich überfluteten. So steuerte ich geradewegs auf Frau Rapp zu, die noch damit beschäftigt war, ihre Berimbao zu stimmen.
»Ja?«
»Ich bin total wütend auf Sie, weil Sie das mit den Toilettengängen gestern so bildlich vorgeführt haben. Das war beschämend. Und ich habe Ihrem Team Bescheid gesagt, wenn ich mir ein anderes T-Shirt angezogen oder etwas getrunken habe, weil ich so heftig getanzt habe. Und in meinem Leben gehe ich immer, wenn ich will, sonst fühle ich mich eingesperrt. Eigentlich mag ich Sie ja ganz gerne, aber so halte ich das nicht aus.«
»Wissen Sie was, Sie sagen mir einfach Bescheid, wenn Sie rausgehen. Oder noch besser, wir tun so, als ob wir nie über die ganze Sache geredet hätten, und Sie gehen einfach, wenn Sie müssen«, erlaubte die Tanztherapeutin.
»Sie sind echt total durchgeknallt«,erwiderte ich anerkennend. »Kann ich Sie kurz drücken?«
»Jo«,machte Frau Rapp, nahm mich in die Arme und strich mir dann kurz über die Wange, als wäre ich ein kleines Mädchen. Dann meinte sie:»Ich muss jetzt anfangen.«
Und dann kam das Schönste der ganzen Intensiv-Woche: Wir sollten einen Außenkreis formen und zwischen ihm und der Kreismitte pendeln, um uns gleichzeitig als Teil der Gemeinschaft und als Individuum zu fühlen. Zwei Patienten kamen mit ihren Partnerinnen in die Mitte und führten Standardtänze vor. Die Menge klatschte, doch ich spürte nur Verunsicherung und Neid. Verunsicherung, weil ich dachte, dass meine improvisierten Bewegungen nun nicht mehr gut genug wären, und Neid, weil ich diese Bewegungen nie hatte lernen wollen. Aus Trotz und der Angst heraus, dass ich ohne Tanzpartner übrig bleiben würde. Ein spanisches Lied begann zu spielen und es zog mich in die Kreismitte. Ich schloss die Augen und stellte mir vor, in Spanien bei einer fiesta am Meeresstrand zu sein. Die Unsicherheit war verflogen und ich wurde von einer unglaublichen Lebensfreude erfüllt, die mich am Außenkreis entlanghüpfen ließ. Frau Rapp und Frau Elfenbein blickten erstaunt zu mir hinüber, als hätten sie in der Klinik noch nie einen so mit Freude erfüllten Menschen gesehen.
Das Gefühl hielt noch lange an, die Rhythmus-Silben schwirrten mir durch den Kopf, und ich war froh, dass sie meine normalen Gedanken unterbrachen. Stolz, dass ich die Intensivwoche, meine inneren Aufs und Abs, meine Zickzacklinie, so gut überstanden hatte, lief ich zu meinem Briefkasten. Dort fand ich einen Zettel, auf dem neben einem Spülmittel-Sticker mit rotem Filzstift geschrieben stand: »Macht die Haare schön.« Ich zuckte zusammen. Ablehnungen wie dieser Zettel waren es, die ich in Großgruppen so sehr fürchtete. Seit der Oberstufe hatte ich sie durch Blicke, Getuschel, Unfähigkeitsgutachten und Versetzungen erfahren. Mein erster Impuls war, mich mit dem Zettel auf mein Zimmer zurückzuziehen und niemanden etwas zu erzählen. Es war mir peinlich, so offensichtlich abgelehnt und gemobbt zu werden. Doch dann tat ich etwas Neues: Im Speisesaal zeigte ich meiner Kerngruppe den Zettel. Sie waren entsetzt. Plötzlich spürte ich den Blick der Patientin, die neben mir getöpfert und sich über meinen Wutanfall lustig gemacht hatte: Sie wollte meine Reaktion testen. Wie zu Schulzeiten fühlte ich mich nun in meinem Umfeld nicht mehr sicher. So sah ich in den übrigen Taketina-Teilnehmern Komplizen meiner Angreiferin. Das änderte sich erst nach einem Gespräch mit Frau Mut. Sie nahm mir den »Giftzettel« aus der Hand, faltete ihn und schrieb auf die noch leere, abgeknickte Seite: »Neid ist die höchste Form der Anerkennung! Je höher der Baum, desto neidischer der Wind!«
»Das hängen Sie sich jetzt in Ihr Zimmer und dann gucken Sie immer wieder zwischen den beiden Aspekten hin und her«, bedeutete sie mir. »Das ist auch das Prinzip der EMDR-Therapie: Sie betrachten traurige und danach sofort schöne Erinnerungen. Nach einer solchen Pendel-Übung geht es Ihnen besser, weil das Gehirn bei den schönen Erinnerungen entspannen kann. Das ist so, wie wenn Sie aus einem stickigen Raum gehen und erst beim erneuten Eintritt merken, dass die Luft abgestanden ist. Wenn Sie nicht rausgehen, ist Ihnen diese Erkenntnis nicht möglich.«
Nach dieser Erklärung nahm Frau Mut ein Hustenbonbon aus ihrer Tasche und warf es mir mit den Worten »Ich habe ein Problem!«