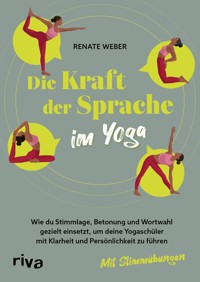15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Edition Noema
- Sprache: Deutsch
Burn-out – das ist die Diagnose, mit der Renate Weber in eine psychosomatische Klinik aufgenommen wird. Zu diesem Zeitpunkt liegen schon aufreibende Jahre der Auseinandersetzung hinter der Lehrerin: mit ihrer Familie, Freunden, Kollegen und Schülern. Und so wird schnell klar, dass es nicht nur Überlastung ist, die ihren Zusammenbruch verursacht hat, sondern tieferliegende Traumata. Mit ihren Therapeuten macht Renate sich auf die Suche nach den Ursachen ihrer seelischen Erschütterungen. Und sie finden einen Ausweg aus ihrer Verzweiflung: Renates überbordende Fantasie. Mit Heilungsmärchen, die das Rehmädchen Anuschka, den Kraken Kai und die Drachin Fulna auf eine packende Reise schicken, verarbeitet Renate ihre Traumata. Renate Weber verknüpft in diesem schonungslos offenen Heilungsroman autobiographische Erzählungen und amüsant-ergreifende Berichte aus dem Klinikalltag mit ihren persönlichen Heilungsmärchen. Sie gibt so einmalige Einblicke in den Heilungsprozess. Das Buch richtet sich an alle an Psychotherapie Interessierten und auch an von Traumatisierungen Betroffene, die Anregungen finden wollen, ihren eigenen Leidensweg zu verkürzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 708
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Hannah
Heidi
Unter Schmerzen
Humpelfums
Abendmahlzeit
Rückzug
Latein
Fast wie früher
Einfach nicht genug
Weln
Ganzstadt
Ricky
Mandalafrau
Fußstapfen
Give me a break!
Volle Kraft voraus
Nur Faxen
»Der Opa hat es doch gesagt!«
Integrierte Gesamtschule am Acker
Absetzung in Pumps
Nachhall
Eine Versetzung und ein neues Leben
Wie die Faust aufs Auge
Zigarrenkiste
Zerbrochen
Das Tabu
Operationen
Die Macht der Hausschuhe!
Advocatus diaboli
Erster Klinikaufenthalt
Ankunft in der Klinik
Grenzenlos?
In der Nacht
Die Dyade
Weit, weit weg ...
Das große »Ja«
Tresor mit Traumamaterial, bewacht von Fellfrau Sam und Reptilien-Schutzwächtern
Auf Socken
Voll schizzo ...
Noch ein Stück Butter?
Externe Feentherapie
Eine magische Welt
Heilungsmärchen: Der letzte Tanz oder wie alles begann
Der Ring
Quo vadis?
Fulna
Kai
Zum Änderland
Klinikkiosk
Zu spät
Der Gestagata
Flashback: Südengland
El Sabio
Auf der Suche
Eine treue Freundin
Therapieschweinchen
Nachschub
Flashback Schwalmstadt
Gefährliche Bälle
Die Rettung der inneren Kinder
Der Diamantenkrater
Im Tal der vergessenen Prinzessinnen
Alles muss raus
Ey-normal!
Familienaufstellung
Echos der Vergangenheit
Flashback New York
Weise Tischtherapeutin
Die Mutprobe
Der enthüllende Traum
Liste der Schrecken
Die Rettung der inneren Natis
Tödliches Gift
Ratlos
Bei den Delphinen
Im gesicherten Kreis
Das Moor der Angst
Zweiseitiger Kampf
Nator
SOS
Macht der Stille
Die Mumbai
Die gestörte Schnecke
Bei Terrax
Wider die Nicht-Verlängerung
Vorbereitungen
Abgrenzungstraining bei Terrax auf dem Mond
Die Mitte
Sam
Sich stellen
Keinen Sinn
Letzter Wunsch
Innere Reh-Rettung
The River Is Flowing
Im Diamantenkrater
Was nun? Es war einmal ein Kloster ...
Alles nur Holz?
Von der Wahrheit enttäuscht
Abendmeditation
Mobile
Der Schamane
Die Rückkehr
Das Ende
Vorbereitungen
Kein Empfang
Nachspiel
Zwischenschau
Wiedereingliederung
Das System schlägt zurück
Von links oben nach rechts: Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Integrationsbeauftragte, Chefnonne vor Holzbuddha, Hausarzt, Psychiater, Rechtsanwältin
Der etwas andere Antrag
Sechzig Prozent
Flashback: Das renommierte Gymnasium
Abrechnung
Wie es weiter geht ...
Register
Literaturverzeichnis
Impressum
Vorwort
Lieber Leser,
dieses Buch ist die Geschichte meiner Heilung. Als ich begann, es zu schreiben, lag mein Leben wie ein bunter Scherbenhaufen vor mir. Freundschaften brachen weg, der Kontakt mit meiner Familie war belastend und in der Schule beförderten mich die immer größeren Klassen und höheren Korrektur- und Erziehungsanforderungen in ein völlig überdrehtes Hamsterrad. Familiengründung und Partnerschaft scheiterten, so als hätte es die schönen Momente in den Jahren davor nie gegeben. Bei einem Umzug fiel mir das Gleichnis von Giovanni Papini in die Hände. Und während ich mich auf eine Umzugskiste setzte und las, war es mir, als würde der Dichter neben mir sitzen und gemeinsam mit mir auf den Scherbenhaufen blicken:
Die Uhr, die um sieben Uhr stehen blieb
von Giovanni Papini
An der Wand meines Zimmers hängt eine schöne alte Uhr, die nicht mehr funktioniert. Ihre Zeiger, die seit jeher stillstehen, zeigen unermüdlich dieselbe Uhrzeit an: Punkt sieben Uhr.
Fast immer ist die Uhr nur ein unnützer Wandschmuck an einer weißen Wand. Zweifelsohne gibt es jedoch zwei Augenblicke am Tag, zwei flüchtige Momente, in denen die alte Uhr wie Phönix aus der Asche aufersteht.
Während die anderen Uhren der Stadt in ihren verrückten Gangarten die sieben Uhr anzeigen und die Kuck-Kuck-Schreie und Gongs der übrigen Maschinen sieben Mal ihren Gesang erschallen lassen, scheint die alte Uhr in meinem Zimmer ihr Leben zurückzugewinnen. Zweimal am Tag, morgens und abends, befindet sich die Uhr im absoluten Einklang mit dem Rest des Universums. Wenn man diese Uhr nur in diesen beiden Augenblicken betrachten würde, könnte man meinen, sie funktioniere perfekt. Aber wenn dieser Moment vorbei ist und der Gesang der übrigen Uhren erstirbt und ihre Zeiger wieder ihren monotonen Gang aufnehmen, verliert meine alte Uhr diesen Schritt und bleibt der Uhrzeit treu, bei der sie eines Tages stehen geblieben ist. Ich liebe diese Uhr. Je mehr ich von ihr rede, desto mehr liebe ich sie, weil ich mit jedem Mal fühle, dass ich ihr immer ähnlicher werde. Auch ich bin in einer Zeit festgehalten, auch ich fühle mich gefangen und unbeweglich, auch ich bin auf eine gewisse Art und Weise ein unnützes Schmuckstück an einer weißen Wand.
Aber auch ich erlebe kurze Momente, in denen auf mysteriöse Weise meine Stunde schlägt. Während dieser Augenblicke fühle ich mich lebendig. Ich kann mehr erschaffen, träumen, fliegen, sagen und fühlen als während der übrigen Zeit. Diese harmonischen Verbindungen kommen und gehen das eine ums andere Mal in einer unerschöpflichen Folge.
Das erste Mal, als ich dieses Gefühl hatte, versuchte ich mich an diesen Moment zu ketten in dem Glauben, dass ich ihn für immer andauern lassen könnte. Aber es war nicht so. Wie meiner Freundin der Uhr so entschwindet auch mir die Zeit der anderen.
... Nach diesen Momenten führen die in die Menschen eingepflanzten Uhren ihre Gangart fort, und ich kehre zurück zu meinem routineartigen statischen Tod, zu meiner Arbeit, zu meinen Gesprächen im Café, zu meiner langweiligen Gangart, die ich mein Leben nenne.
Aber ich weiß, dass das Leben etwas anderes ist. Ich weiß, dass das Leben die Summe all jener Augenblicke ist, die, obwohl sie kurz sind, uns im Einklang mit dem Universum fühlen lassen. Fast alle Menschen glauben, dass sie (die Armen!) leben. Nur gibt es Momente der Vollkommenheit und alle, die es nicht wissen und darauf bestehen, dass sie in jedem Augenblick leben, werden gefangen bleiben in der Welt des Graus und der Alltäglichkeit.
Deshalb lieb ich dich, alte Uhr, weil wir uns ähnlich sind, du und ich.1
Ähnlich wie Giovanni Papini mit seiner Uhr, die um sieben Uhr stehen blieb, erging es mir mit der Zeit. Und ich fragte mich, warum das so war. Zunächst erschien mir alles wie ein Zufall. Doch je älter ich wurde, desto mehr wurde mir bewusst, dass meine Uhr mich in vielen Zusammentreffen mit Menschen zu überholen schien. Und während die Festivitäten und Gespräche der anderen andauerten, fiel ich in eine bodenlose Tiefe, in der ich mich selbst nicht mehr spüren konnte. Es schien ausweglos, aus meiner Depression zu anderen Menschen hinaufzurufen. Und so schwieg ich. Ich ließ nur noch meine Freunde an meinen positiven Gefühlen teilhaben. Ich verstand damals nicht, warum das so war, doch ich fürchtete immer, dass mir jemand meine Freude wieder zerschlagen könnte. Heute weiß ich, dass mich viele negative Bemerkungen aus meiner Herkunftsfamilie und später aus meinem Umfeld tatsächlich in eine Abwärtsspirale katapultierten. Dies geschah immer häufiger und ich fühlte mich ausgeliefert. Ich begann, mich nach den schönen Zeiten in meinem Leben zu sehnen, doch die lagen in der Vergangenheit. In meinem gegenwärtigen Leben verdichteten sich die Dinge, die mir etwas bedeuteten, zu einer Welle von schmerzlichen Erfahrungen. Donnernd brach sie über mich herein: Es schien lange her gewesen zu sein, dass meine Uhr und ich zur gleichen Zeit innehielten. Ich wurde sehr krank und keines der vielen Medikamente, die ich über zwei Jahre hinweg genommen hatte, schien zu wirken. In diesen Monaten war es mir, als hätte jemand mir meine Zeit genommen. Ich fühlte mich an den Rand gedrängt und konnte aufgrund der Nebenwirkungen der Medikamente nicht mehr richtig am Leben teilnehmen. Es war so, als wäre ich zu Gast in einer ungeliebten Wohnung. Und auch mein Körper, der ja mein einziges wirkliches Zuhause war, schien mich nicht mehr beherbergen zu können und zu wollen: Ich hatte die Kontrolle über mein eigenes Leben verloren. Da erinnerte ich mich daran, wie eine Freundin mir einmal gesagt hatte: »Die Bücher, die ich schreibe, sind wie Kinder für mich. Die, die ich lese, wie Freunde.«
Und ich beschloss, genau so ein Buch zu schreiben. Ein Buch, das mir und anderen ein Freund sein kann, und zwar einer, der nicht weggeht und den wir immer wieder aufsuchen können. Als ich begann, dieses Buch zu schreiben, konnte ich mir jedoch nicht vorstellen, jemals damit fertig zu werden. Doch je länger ich schrieb, desto mehr erinnerte mich das, was ich selbst erlebt hatte, an die Geschichte meiner Vorfahren. Die Umstände waren zwar immer andere gewesen, doch die Gefühle dazu waren es nicht. Und so begann ich nachzuforschen. Ich wollte wissen, warum sich die Menschen in meiner Familie immer auf die gleiche Art untereinander verletzten und miteinander verstrickten. Ich schrieb auf, welche Sätze und Handlungen es waren, die mich im Zusammensein mit meiner Herkunftsfamilie so verletzten. Dabei fand ich heraus, dass es bei jedem Zusammentreffen immer die gleichen Sätze waren, die wie ein Nadelregen auf mich niederprasselten. Ich selbst erstarrte währenddessen immer und konnte meinen Schmerz nicht äußern. Ich fühlte mich hilflos und nicht richtig, so, wie ich war. Äußerte ich im Nachhinein meine Wahrnehmung wurde diese meist mit einem »Ach, du bist einfach zu empfindlich!« abgetan.
Bis zu dem Tag, an dem ich zusammenbrach und mit der Diagnose Burn-out in eine psychosomatische Klinik eingewiesen wurde. Eine neue Mitpatientin löste etwas in mir aus. Ich fühlte mich unter ihren Blicken unwohl, in der Buffetschlange kam sie mir zu nah, doch ich brachte wie üblich kein Wort heraus. In dieser Nacht hatte ich einen Albtraum: Eine neunarmige Krake lachte mich hämisch an und würgte mich mit zwei ihrer Tentakeln. Der Kontakt mit dieser Mitpatientin wurde für mich so schwierig auszuhalten, dass ich einige Mahlzeiten ausfallen ließ – bis ich entnervt vor Hunger in die Pflege ging. Zu meiner Überraschung tat die Schwester meine Wahrnehmung nicht ab, sondern berichtete mir, dass bereits andere Patienten mit ähnlichen Engegefühlen bei ihr gewesen seien. Und zwar immer im Zusammenhang mit der neuen Patientin. Nach und nach begann ich, meiner Wahrnehmung wieder zu trauen und verurteilte mich nicht mehr dafür, dass ich bereits erste Anzeichen von Druck verspürte, bevor auch andere sie bei Konflikten spürten.
Es tat mir weh, zu erkennen, dass ich all die Jahre doch richtig gewesen war. Und ich verstand immer noch nicht, warum meine Wahrnehmung von meiner Mutter und meinem Bruder so bekämpft worden war. Mein Vater hatte sich meine Wahrnehmung immer angehört, ohne sie zu verurteilen. Doch er war so häufig im Ausland gewesen, dass er mich in meiner Kindheit wenig unterstützen konnte. Heute bin ich mir sicher, dass mein Vater unter dem sogenannten Asperger-Syndrom leidet, einer milden Form des Autismus. Dies erklärt viele seiner Reaktionen und auch, warum er mir nicht emotional nahe sein konnte, selbst wenn er nicht auf Reisen war.
Ich spürte, dass die Ursachen für meine unterdrückten Gefühle in der Vergangenheit lagen. Damals war mir noch nicht bewusst, dass meine Mutter ihre eigenen und meine Wahrnehmungen über Grenzüberschreitungen unterdrückte. Und damit gab es den dunklen Teil in unserer Beziehung, in dem das Unausgesprochene schwelte. Er wurde überdeckt von dem funktionierenden Teil unserer Beziehung, indem gemeinsame Urlaube, intellektuelle Themen und Schule, körperliches Wohl und Gemütlichkeit eine Rolle spielten. Wenn ich auf diesen Teil und die Fotos dazu schaute, so konnte ich kaum glauben, dass es daneben noch diese andere Wahrheit gab. Die Wahrheit nämlich, dass ich mich von meiner Mutter seit und mit dem sexuellen Missbrauch, den ich in meiner Kindheit erfahren habe, allein und im Stich gelassen fühlte. Über dieser Verletzung lagen Wut, Trauer und Resignation. Gegen meinen Bruder und gegen meine Mutter. All diese Gefühle sind jedoch nie offen ausgesprochen worden. Sie meldeten und melden sich nach jedem Zusammentreffen mit Vehemenz. Ich spürte, dass die Ursachen für diese Ambivalenz tief in der Vergangenheit liegen mussten. So beschäftigte ich mich mit der Geschichte meiner Mutter: Sie beginnt mit dem Jahr 1937. Der Entschluss meiner Großmutter, in die spätere sowjetisch besetzte Zone zu ziehen, sollte weitreichende Folgen für die kommenden Generationen haben. Je mehr ich mich mit der Geschichte von damals beschäftigte, desto schlimmer wurden meine Albträume: Ich wurde von totalitären Regimen verfolgt, entdeckt und hingerichtet. Meine Bezugstherapeuten in der Klinik verboten mir, weiterzuschreiben. Doch es war bereits zu spät: Durch mein Schreiben hatte ich eine Grenze überschritten – es war, als hätte ich ein Schweigegelübde gebrochen, das meine Mutter mir stillschweigend auferlegt hatte. Möglicherweise war es das Schweigegelübde für eine ganze Generation von »vergessenen Kindern« (so nennt die Journalistin Sabine Bode die Generation, die in den letzten Kriegsjahren des Zweiten Weltkriegs geboren wurde). Je mehr ich über diese »vergessene Generation« las, desto klarer wurde mir, dass die Unterdrückung ihrer eigenen Gefühle meine Mutter lange Zeit vor dem psychisch-körperlichen Zusammenbruch bewahrt hatte. Der Preis dafür war hoch: Er bestand in unserer emotional gestörten Beziehung.
Doch selbst wenn meine Aufzeichnungen diese Geschichte des emotionalen Mangels dokumentieren, so schien es zunächst, als entstünde hier ein Freund, zu dem man nur zum Weinen gehen konnte. Ich fragte mich, was mir noch fehlte. Und ich erkannte, dass es Mut war. Der Mut, trotz allem zu leben und Freude empfinden zu können. Deshalb richtete ich mein Augenmerk auf all die schönen Erfahrungen in meinem Leben. Sie standen nun neben den anderen. Lange fiel es mir schwer, beide Seiten des Lebens inner- und außerhalb meiner Familie in ihrer Widersprüchlichkeit anzunehmen. Obwohl ich nun über »das Gute« schrieb, trieben immer mehr traumatische Erfahrungen in meinem Bewusstsein an die Oberfläche. Je mehr ich sie nachzeichnete, desto größer wurde meine Erstarrung angesichts der schockierenden Ereignisse. Als ich mit dem Direktor der psychosomatischen Klinik darüber sprach, riet er mir, ein Heilungsmärchen für das kleine, verletzte Mädchen zu schreiben, das ich einst war.
Je stärker sich meine Fantasie mit diesem Märchen beschäftigte, desto mehr Fabelwesen entstanden. Und alle hatten sie eines gemeinsam: Sie waren Anteile meiner Persönlichkeit. Ich malte sie und konnte sie immer deutlicher vor meinem inneren Auge sehen. Ich schuf eine Welt, in der ich mich mehr und mehr zu Hause fühlte. Dieser Rückzugsort half mir und gab mir die Kraft, besser auf verletzende Kommentare reagieren zu können. Ich zog nun plötzlich Menschen an, mit denen ich nährende Beziehungen pflegen konnte. Es tat immer noch weh, auf meinem Scherbenhaufen zu laufen. Mittlerweile wusste ich allerdings, wo er anfing, und auch, wo er wieder aufhörte. Es gelang mir immer öfter, den Scherbenhaufen zu umrunden und dabei zu erkennen, dass auch die Gefühle hierzu ein Anfang und ein Ende hatten. Ich hatte in meinem Leben und in meiner Vergangenheit aufgeräumt. Wieder blickte ich auf all die Verletzungen: Sie waren noch da. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass sie wichtig waren und dass ihre Dokumentation zusammen mit den korrigierenden Erfahrungen, die ich in der Klinik machte, anderen Menschen helfen könnten. Und so veränderten sich meine Aufzeichnungen aufs Neue: Der Fokus lag jetzt nicht mehr darauf, warum es Menschen gab, die andere verletzten, sondern wie ich mit diesen sich ständig wiederholenden verletzenden Situationen umgehen konnte. Es war wie ein Muskeltraining: Meine ersten Abgrenzungsversuche waren noch sehr unsicher. Die positive Botschaft ist: Je mehr ich mich abgrenze, desto besser fühle ich mich mit mir selbst. Und das, obwohl meine Umwelt zunächst aggressiv auf meine Abgrenzung reagierte. Ich hielt mir all meine schmerzlichen Erfahrungen vor Augen und sagte mir, dass es mir (und letztlich auch anderen) nichts nützen würde, wenn ich mich für das energetisch auspowerte, was sie an mir durchsetzen wollten. Es war ein langer Kampf und mit je mehr Selbstverständlichkeit ich meinen Platz einnahm und Stellung bezog, desto geringer wurden die Widerstände. Jetzt blieben »die Uhr« und ich immer häufiger wieder gleichzeitig stehen: Ich bin wieder im Einklang mit mir und dem Universum. Und das, liebe Leser, wünsche ich Ihnen auch. Möge meine Reise zum Mittelpunkt des Selbst Sie dabei unterstützen, dass »Ihre Uhr« und Sie wie ein Phönix aus der Asche in den Himmel aufsteigen.
Renate Weber, August 2018
1 Übersetzung aus dem Spanischen von Renate Weber, Originaltext: Papini, Giovanni, El reloj parado a las Siete, s. https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-abelardo-castillo-madre-ernesto.html
Hannah
Meine Großmutter Hannah war so stur wie ich. Schon als Kind war sie sehr eigensinnig, wenn sie ihre Interessen durchsetzen wollte. Sie trug lieber den Leuten auf dem Marktplatz ihre selbst verfassten Gedichte vor, statt ihre Hausaufgaben zu machen, oder sie spielte, zur Belustigung der Nachbarschaft, mit ihren Geschwistern die Theaterrollen ihres Vaters nach, bei dessen Proben sie ihn heimlich beobachtet und belauscht hatte. Selbst die Strafpredigten und Züchtigungsversuche ihres strengen Vaters hatten ihren eigensinnigen Charakter nicht brechen können. Später war der Vater nachsichtiger geworden, nachdem er sich der Frömmigkeit ergeben und sich mit religiösen Themen befasst hatte. Er war ein oft arbeitsloser Schauspieler, der seine Trunksucht gegen eine absurde Gottesgläubigkeit eintauschte und eines Tages lallend verkündete: »Morgen baue ich eine Kirche!« Obwohl ihn eigentlich niemand mehr ernst nahm, brachte er es mit seiner Überzeugungskraft tatsächlich fertig, seine Freunde für seine Pläne zu begeistern, und ein halbes Jahr später konnte die neuapostolische Kirche eingeweiht werden. Benjamin, mein Urgroßvater, wurde zum Stammesältesten ernannt und trank von da an keinen Tropfen Alkohol mehr.
Im Jahr 1937 zog meine Großmutter Hannah gegen den Wunsch ihrer Eltern mit ihrem damaligen Mann, dem Werkzeugmacher Fritz, von Rheinstadt nach Mecklenburg-Vorpommern. Mit Fritz hatte Hannah zwei Töchter, Renate und Josepha, die allerdings schon früh zu Halbwaisen wurden: Im Jahr 1939 starb Fritz nach einer Entzündung im Fuß, ohne dass die Ärzte den Grund für die nicht abheilende Entzündung herausfinden konnten. Sie vermietete sein Zimmer an einen neuen Untermieter, den Ofensetzer Ernst, mit dem sie 1942 eine Tochter bekam, die sie Heidi nannten und die 36 Jahre später mich zur Welt bringen sollte.
Doch auch diese Beziehung stand unter keinem guten Stern. Ernst wurde eingezogen und lernte erst während eines zweiwöchigen Heimaturlaubs seine inzwischen einjährige Tochter kennen. Er war gleich so vernarrt in das Kind, dass Hannah es nicht übers Herz brachte, ihm zu sagen, dass Heidi unter schwerem Asthma litt. Der Arzt hatte ihr prophezeit, dass das Mädchen den Sommer nicht überleben würde, und auch Ernst hatte düstere Vorahnungen, was seine eigene Zukunft in den Schützengräben Russlands anging. Zwei Wochen später war er tot, aber Heidi lebte.
Der neue Untermieter hieß Klaus. Da er wegen eines angeborenen Herzfehlers von der Heeresleitung als wehruntauglich eingestuft worden war, bestand bei ihm nicht die Gefahr, dass Hannah ihn an die Front verlieren würde. Er arbeitete als Filmvorführer und Musiker im örtlichen Kino. Mit ihm brachte sie die Kinder Paul und Ruth zur Welt. Josepha und Renate mussten nun häufig in der Schule fehlen, da sie zu Hause gebraucht wurden.
Im März 1945 kam Hannahs Mutter Sabine aus Rheinstadt zu Besuch. Hannah freute sich sehr, denn ihre Mutter brachte ihnen nicht nur Lebensmittel mit, sie kümmerte sich auch liebevoll um Josepha und Heidi. Doch der Zeitpunkt war schlecht gewählt.
»Das sind die Russen! Heidi, hol' Oma! Wir müssen uns verstecken.«
Heidi rannte auf den Hof, aber sie fand ihre Oma nicht. Also lief sie zu ihrer Mutter, denn sie hatte gemerkt, dass die sehr besorgt war und es ernst gemeint hatte.
Das bedrohliche Grölen auf der Straße kam näher, wurde lauter.
Stumm vor Angst, mit dem Baby im Arm, half Hannah Heidi und Josepha, die Dachbodenleiter hochzuklettern. Dann stieg auch sie hinauf und gab den Mädchen den Säugling, um die Leiter einziehen zu können. Flüsternd gebot sie ihnen, sich still zu verhalten. Aber sie hatten ihre Angst gespürt und kauerten sich neben ihre Mutter. Hannah war sicher, dass die Russen Klaus, den sie inzwischen geheiratet hatte, einfach erschossen hätten, wenn er dagewesen wäre. Doch Klaus war in dem Kino, in dem er arbeitete, um dort mit seinen Musikerkollegen zu proben. Aber wo war Sabine?
Dann hörten sie die grölenden Männerstimmen, die »DAWEI« brüllten, in ihrem Haus, das Zersplittern von Glas, anscheinend hatten sie auch Möbel umgeworfen. Hannah saß regungslos da und horchte auf die Stimmen der russischen Soldaten, denn sie verstand deren Sprache ja nicht, und Josepha blickte sie hilfesuchend an.
Und plötzlich war es still. Bis die schrillen Schreie einer Frau zu ihnen hinaufdrangen. Josepha hatte die Stimme ihrer Oma erkannt, die um Hilfe schrie.
Nach einer endlos erscheinenden Weile, und nachdem die schweren Schritte der Soldaten nicht mehr zu hören waren, wagte sich Hannah die Leiter hinunter, die Kinder sollten sich auf dem Dachboden weiterhin ruhig verhalten. Im Erdgeschoss bot sich ihr ein Bild des Schreckens, der sinnlosen Zerstörung: Alles, was sie sich so mühsam aufgebaut hatte, lag nun in Scherben und Trümmern vor ihr.
Sie rannte in den Garten. Dort fand sie ihre Mutter, die blutend und verstört auf dem Boden lag, mit zerfetzter Kleidung. Sie half ihr, sich auf Klaus' Bett zu legen, und holte einen nassen Lappen, um das Blut vom Körper ihrer Mutter zu wischen. Sabine drehte ihr Gesicht zur Wand, sie sagte nichts und wollte nicht sehen, was mit ihr geschehen war. Auch Hannah schwieg − es gab nichts zu sagen.
Vor »den Russen« sollte meine Großmutter bis an ihr Lebensende Angst haben. Kurz vor ihrem Tod wurde sie immer verwirrter, und einmal, als wir sie besuchten, hielt sie ihren eigenen Sohn für einen Russen und hätte ihn beinahe mit dem Küchenmesser erstochen.
Heidi konnte Klaus nicht leiden, denn der war oftmals ungeduldig mit seinen Stieftöchtern. Einmal hatte er sie, nachdem sie die Leiter zum Dachboden hinaufgeklettert war, mit dem Gürtel seiner Hose geschlagen. Nur Paul, seinen Sohn, den Stammhalter, schien er wirklich zu lieben. Ihm brachte er Süßigkeiten und Spielsachen mit. Heidi und Josepha schenkte er kaum mal etwas.
Eines Tages kam Heidi mit einer grün-rot geringelten Zuckerstange nach Hause. »Wo hast du die her?«, fragte ihre Mutter. Sie hatte Paul auf dem Arm und tätschelte ihm liebevoll die Wange.
»Die hat mir ein Mann mit schwarzem Helm und Gewehr geschenkt. Er hat so komisch gesprochen.«
Entsetzt schaute Hannah sie an, riss ihr die Zuckerstange aus der Hand und warf sie in den Schlund des Kachelofens. Heidi war fassungslos, sie meinte, ihre Mutter würde ihr die Süßigkeit nicht gönnen. Da hatte sie endlich auch mal ein Geschenk erhalten, und ihre Mutter nahm es ihr weg. Sie fühlte sich ungeliebt und unverstanden.
Meine Mutter war sechs Jahre alt, als ihre Schwester Renate 1948 nach einem einwöchigen Krankenhausaufenthalt an Typhus starb. Hannah hatte Heidi erklärt, dass der Name Renate »die Wiedergeborene« bedeutete. Das war Heidis einziger Trost. Sie beschloss: »Sollte ich jemals eine Tochter bekommen, soll sie Renate heißen!« Und sie hielt Wort.
Heidi
Es lagen einige Kinder auf dem Boden der Ladefläche, erschöpft durch die lange Fahrt, die Hitze und die stickige Luft. Einige konnten zu ihrem Glück schlafen, obwohl der Lastwagen ihre Körper in den Kurven unsanft hin- und herwarf. Heidi kletterte auf eine Bank, die dort stand. Josepha war aufgesprungen, um ihr zu helfen, die Stricke der Plane zu lockern. Heidi holte mehrmals tief Luft, es dauerte jedoch einen Moment, bis sie sich an den seltsam rauchigen Geruch da draußen gewöhnt hatte. Sie geriet zwar vor einem Asthmaanfall jedes Mal in Panik, aber ihr starker Überlebenswille half ihr, sich auf das Ein- und Ausatmen zu konzentrieren, und so löste sich allmählich der Klumpen in ihrem Oberkörper, und sie konnte die langen Schornsteine und die rußverschmierten Häuser wahrnehmen. Auch die meisten Fenster schienen schwarz vor Ruß zu sein!
Klaus hatte seiner Frau ein Ultimatum gesetzt: »Entweder, du schaffst deine Töchter aus dem Haus, oder ich gehe!« Es gäbe einfach nicht genug zu essen, und es sei ja auch nur vorübergehend, fügte er etwas versöhnlicher hinzu. So kam es, dass Josepha und Heidi mit einem Kriegswaisen-Transporter vom Roten Kreuz zu Hannahs Mutter nach Rheinstadt in den Westen geschickt wurden.
Zum Schrecken der Kinder sollte keine von ihnen bei Oma Sabine wohnen. Stattdessen wurden sie auf die beiden Tanten aufgeteilt: Josepha sollte weiter ins Schwäbische fahren, wo Hannahs Schwester Frieda wohnte und dringend Hilfe mit den Kindern und im Haushalt benötigte. Auch Heidi konnte nur einen Tag bei ihrer Oma bleiben, dann sollte sie bei deren Tochter Liesel und ihrem Mann Kurt unterkommen.
Liesels Kinder waren beide im Babyalter gestorben, was Oma Sabine für den Auslöser ihres ausgeprägten Sauberkeitswahns und ihres sich immer mehr verschließenden Wesens hielt. Ironischerweise litt die Tante an einer Allergie gegen Reinigungsmittel, weshalb es ihr sehr gelegen kam, nun ihre Nichte mit dem alltäglichen Wohnungsputz betrauen zu können. Mit ihrem Onkel, Kurt, verstand sie sich nach anfänglicher Scheu prächtig. Er brachte Heidi Bücher mit, und sie verschlang geradezu wissbegierig den Lesestoff. Sie war, zur Freude ihrer Pflegeeltern und der Gäste, die zu Besuch kamen, »ein artiges Mädchen«, das alles beobachtete und sich stets still verhielt. Das beschränkte sich allerdings nur auf die Wohnung. Denn sobald sie ihren Hausdienst erledigt hatte, lief sie hinaus. Und dort, auf dem schmutzigen Asphalt der Straße, verwandelte sich die sonst so angepasste, brave Heidi in einen Wildfang. Dort war sie am schnellsten auf den Rollschuhen, nutzte ein Regenfass als Planschbecken und gewann fast immer beim Murmelspiel.
Abends im Bett erinnerte sie sich noch an das letzte Spiel, nach dem die anderen Kinder ihr einen ganzen Beutel Murmeln als Gewinn geben mussten, und sie schloss zufrieden die Augen, um zu schlafen. Doch dann hörte sie, wie die Tür ihres Zimmers leise von außen geöffnet wurde. Immer häufiger kam es vor, dass Onkel Kurt in ihr Zimmer kam, immer dann, wenn Tante Liesel schlief. Heidi war immer froh, wenn er wieder ging und wenn »es« vorbei war, was er unter der Bettdecke mit ihr machte. Anfangs hatte er ihr gesagt, dass er nur mit ihr reden wollte und ihr erzählt, dass er Liesel ja nur deshalb geheiratet hatte, weil seine Eltern ihm dazu geraten hatten. Denn sie war eine gute Hausfrau, und allein das war es wohl, so meinten sie, was Kurt brauchte. Aber er hatte auch andere Bedürfnisse, und deshalb schlich er zu Heidi ins Zimmer. Heidi schämte sich und traute sich manchmal gar nicht, ihrer Tante ins Gesicht zu schauen. Aber sie sagte nichts, denn dann hätte Liesel sie sicher sofort zu ihrer Mutter geschickt, und was ihre Familie, ihre Freunde und die Leute von ihr denken würden, das wollte sie sich gar nicht erst vorstellen.
Von ihrer Mutter erhielt sie ab und zu einen Brief. Josepha sah sie nur noch bei den Familienfesten in Oma Sabines Garten. Sie schien sich bei Frieda, der Schwester ihrer Mutter, nicht sehr wohlzufühlen, aber Josepha klagte nicht über ihr Schicksal, und Heidi hatte sich auch trotz allem an ihre Pflegeeltern gewöhnt. Denn bei ihrer Mutter konnten sie ja nicht bleiben. Aber sie spürten beide, dass man sie eigentlich nur aus Gefälligkeit aufgenommen hatte, und sie wussten ebenso, dass man von ihnen eine tiefe Dankbarkeit dafür erwartete, dass sie »im Westen« leben durften.
Als sie 19 Jahre alt war, hatte sich in Heidis Leben sehr viel getan. Sie hatte inzwischen ihr Abitur gemacht und sich zu einer hübschen, jungen Frau entwickelt. Sie war mit ihren Pflegeeltern aus der Arbeitersiedlung fortgezogen, nachdem Onkel Kurt das Rentenalter erreicht hatte. Nun lebten sie zu dritt in einem kleinen Haus. Sieben Jahre später hatte Heidi ihr verkürztes Referendariat beendet, ihre erste Anstellung als Studienrätin bekommen.
»Du willst ja nur nicht, dass ich Johannes heirate«, hatte Heidi Onkel Kurt mit blitzenden Augen vorgeworfen.
»Er kann dich nicht richtig lieben«, erwiderte der. »Er ist ein Egoist, er liebt nur sich selbst.«
Einen Monat später fand die Hochzeit statt. Johannes hatte mit seiner Mutter einen Fackelzug organisiert, sodass sich auch viele Dorfbewohner der Hochzeitsgesellschaft anschlossen: Es war eine richtig schöne feierliche Prozession.
Am nächsten Morgen ließ Tante Liesel es sich nicht nehmen, für alle Familienangehörigen ein Festessen zu kochen. Das Brautpaar war währenddessen zum Fotografen gegangen. Als Heidi zum Haus ihrer Pflegeeltern zurückkehrte, hörte sie, dass Tante Liesel und ihre Mutter in der Küche miteinander stritten.
»Du hast Heidi und Josepha damals doch einfach weggegeben, weil dein Mann das gefordert hat. Und dann bist du nach Jahren gekommen, um die Mädchen als Babysitter und Haushaltshilfen zurückzuholen.«
»Du weißt doch gar nicht, wie das ist, wenn man kleine Kinder zu versorgen hat. Ich habe drei Männer und meine Tochter Renate verloren. Da drüben im Osten, dort sind die Warteschlangen endlos, und es fehlt an allem. Den Russen ist es doch egal, wie es uns geht.«
Als sie Heidi bemerkten, verstummten beide Frauen.
Nur Stunden später brach Tante Liesel tot zusammen. Sie hatte schon eine Weile unter Blutdruckproblemen gelitten, die sich verstärkten, wenn sie sich aufregte.
Heidi sah, dass Onkel Kurt fassungslos am Tisch saß, mit Tränen in den Augen. So niedergeschlagen hatte sie ihn noch nie erlebt.
****
1976 wurde mein Bruder Hans geboren. Heidi hielt ihren Sohn in den Armen – ein kleines Bündel Mensch. Das Baby sah sie aus großen, blauen Augen vertrauensvoll an, und sie schwor sich in diesem Augenblick, auf dieses kleine Wesen immer gut aufzupassen. Auch Johannes blickte sichtlich stolz auf seinen Sohn. »Lässt du ihn mich auch mal halten?«, fragte er, und Heidi übergab ihm behutsam das Baby und lächelte glücklich, als der Vater an ihm schnupperte. Zwei Jahre später war meine Mutter erneut schwanger, aber die Wehen hatten viel zu früh eingesetzt. »Ich habe eine Erkältung, ich kann leider nicht zu dir ins Krankenhaus kommen. Nimm' dir doch nach der Ausschabung einfach ein Taxi, mein Schatz«, hatte Johannes ihr gesagt, als sie ihn endlich am Telefon erreichte. Seine Stimme klang eher unbeteiligt, er fragte nicht einmal, wie es ihr ging.
Im Aufwachraum spürte sie, dass jemand an ihrem Bett stand. »Johannes?« Sie öffnete die Augen. Aber es war Onkel Kurt, der nach ihrer Hand griff und sie stumm drückte. Es war gar nicht notwendig, dass sie über das tragische Geschehen sprachen, sie verstanden sich auch ohne große Worte.
Heidi telefonierte einmal wöchentlich mit Onkel Kurt. Seit dem Tod seiner Frau fühlte er sich einsam in dem Dorf und in dem Haus, das von Rheinstadt ein ganzes Stück entfernt war, sodass ihn kaum jemand besuchte von der Familie oder den früheren Freunden. Er sprang gerne ein, als meine Eltern sich nach dem Tod des Babys eine kleine Auszeit nehmen und romantisch essen gehen wollten. Als sie nach Hause kamen und Heidi das Gästezimmer betrat, sah sie Onkel Kurt auf dem Boden liegen, und als sie ihm ins Gesicht schaute, merkte sie sofort, dass er tot war. Hans lag im Gästebett. Fürsorglich hatte Onkel Kurt ihn noch in seinen letzten Lebensminuten zugedeckt. Als Johannes ins Gästezimmer kam, lehnte sich Heidi an ihn und schluchzte: »Er ist tot!«
»Der hat sich eben überfressen.«, sagte Johannes emotionslos. Und Heidi fühlte sich nicht nur in dieser Situation von ihm in Stich gelassen.
Unter Schmerzen
Als meine Mutter mit mir schwanger war, verbrachte sie die letzten beiden Monate zur Sicherheit in einem Krankenhaus. Zu seinem Verdruss sollte Hans die Zeit über bei Josepha und Wolfram in Rheinstadt bleiben.
Da die beiden sehr gläubig waren, wurde der Vierjährige nicht nur zu den Kirchgängen mitgeschleppt, sondern musste auch noch regelmäßig am Unterricht der Sonntagsschule teilnehmen. Tante Josepha fand er ganz in Ordnung, aber Onkel Wolfram war streng, hatte eine laute Stimme und war derjenige, der auf die Kirchenbesuche bestand. Ständig stellte Hans etwas an, in der Hoffnung, dass Josepha und Wolfram die Faxen dicke haben und ihn endlich nach Hause schicken würden.
Heidi erging es nicht besser. Mein Vater drückte sich davor, seine Frau emotional zu unterstützen und mied die Besuche im Krankenhaus wie die Pest.
»Frau Weber, wenn Sie so oft aufstehen, besteht die Gefahr, dass Sie auch dieses Kind verlieren. Der Muttermund ist jetzt schon viel zu weit geöffnet. Wir müssen eine Cerclage machen und ihn zunähen, wenn Sie sich nicht schonen«, erklärte der Chefarzt der Geburtsklinik. »Warum sind Sie denn jetzt schon wieder aufgestanden?«
»Ich habe meine Kleidung gewaschen.«
»Kann Ihr Mann Ihnen denn keine saubere Kleidung bringen?«
»Der ist im Urlaub, er muss sich erholen.«
»Jetzt? In dieser Situation?«
»Ja, es sind doch Semesterferien, da muss er keine Vorlesungen halten.«
Eine junge Krankenschwester erbarmte sich und verbrachte bald ihre Mittagspausen bei Heidi im Zimmer. Kurz vor der Entbindung kam Josepha mit Hans zu Besuch. Auch wenn die letzten Wochen mit ihrem Neffen aufreibend gewesen waren, spürte sie einen Stich, als sie wieder alleine zu ihrem Mann zurückkehrte. Ihre Ehe war, trotz aller Versuche, kinderlos geblieben.
Im Sommer 1980 kam ich mithilfe eines Kaiserschnitts auf die Welt. Johannes war noch immer nicht aus dem Urlaub zurück, und so fühlte sich Heidi frei, das Versprechen einzulösen, das sie sich selbst damals bei der Beerdigung ihrer achtjährigen Schwester gegeben hatte. Ich erhielt den Namen Renate.
»Das ist ein sehr schöner Name, er klingt so kraftvoll. Ich glaube, sie wird später mal eine Kämpferin wie Sie!« Nachdem die Schwester das Zimmer verlassen hatte, betrachtete Heidi das Baby liebevoll und sagte: »Ja, ich habe dich dem Leben abgetrotzt, Renate.« Sie war so glücklich in diesem Moment.
Humpelfums
Mit meinem großen Bruder verstand ich mich prima, und ich liebte ihn für seine Spielideen und die vielen lustigen Streiche, die ihm einfielen. Ich war fünf, als Heidi eine mehrwöchige Kur machte und uns mit Johannes alleine ließ. Der schlief die meiste Zeit oder verzog sich in sein Arbeitszimmer unterm Dach, wo er an seinem Schreibtisch Seminare vorbereitete. Aber eigentlich war es uns ganz recht, dass er sich so selten blicken ließ. Er hatte einen Artikel über die gesundheitsfördernde Wirkung von Knoblauch gelesen und trug nun immer ein Päckchen mit dem Pulver dieses Knollengewächses mit sich herum. Der penetrante Geruch kündigte ihn an, lange bevor man ihn sah.
Auch deshalb hielten wir uns lieber draußen auf. Um unser Taschengeld aufzubessern, versuchten wir, mit Watte gefüllte »Zigaretten« an vorübergehende Passanten zu verkaufen, und konnten gar nicht begreifen, dass sie so entsetzt reagierten und etwas von »Jugendamt einschalten« murmelten.
Seitdem unsere Mutter verreist war, verlotterte das Haus – die Schmutzwäsche türmte sich kniehoch im Badezimmer, und inzwischen hatten sich mehrere Ameisenstaaten in den Zimmern niedergelassen, deren Straßen man anhand der Krümel folgen konnte, die wir auf dem Fußboden entsorgt hatten.
Zurück im Haus suchten wir nach neuen Lösungen für das Ameisenproblem. Immerhin waren es nur noch wenige Tage, bis Heidi aus der Kur zurückkehren würde. Ab und zu kam Johannes runter und bot uns eine Prise aus seinem Tütchen mit dem widerlichen Knoblauchpulver an, was wir stets mit angeekelten Gesichtern ablehnten.
Dafür konnte er oft etwas aus seiner schwarzen Jacke mit den vielen Löchern herauszaubern, und das entschädigte uns für den Knoblauchgestank. Aber an diesem Tag war ich nicht zufrieden mit den hervorgezauberten Bonbons. Ich hatte Hunger, doch Dinge wie Kochen und Einkaufen waren für unseren Vater so fremd wie Aufräumen. Er schlug vor, dass mir Hans eine Dose Ravioli aufmachen oder wir eine Tassensuppe essen sollten. Er selbst nahm sich einen Harzer Roller aus dem Kühlschrank und verschwand wieder in seinem Zimmer.
Da sich in meinem Zimmer bereits Spinnen breitgemacht hatten und ich nicht auch noch Ameisen dort beherbergen wollte, kamen wir auf die Idee, die Ameisen mit Papas Knoblauchpulver zu vertreiben. Aber anstatt vor dem stinkigen Pulver zu fliehen, transportierten es die Ameisen einfach mit den Krümeln in ihre Löcher.
An dem Tag, an dem Mutter zurückkommen sollte, bot uns unser Vater 50 Pfennige für jede halbe Stunde Hausputz.
»Ich mag aber nicht putzen«, maulte mein Bruder. Er saß mit griesgrämigem Gesicht, in ein helles, schmuddeliges T-Shirt und eine Lederlatzhose gekleidet, am Küchentisch, auf dem sich Comic-Hefte und anderer Papierkram sowie Vitamintabletten und allerlei Zeug, das da nicht hingehörte, angesammelt hatten.
»Spielst du Humpelfums mit mir?«, fragte ich unseren Papa.
»Nee, nicht mit dir, aber mit dem Hans. Dann wird die Küche jedenfalls sauber«, murmelte er. Mein Bruder lachte, legte sich wie ein Käfer auf den Rücken und ließ sich von ihm an den Beinen durch die Küche ziehen. Und tatsächlich: Dort, wo er den Boden mit Hans gewischt hatte, war das dreckige Grau verschwunden, und es kam wieder ein kräftiges Gelb zum Vorschein. Papa und Hans putzten auf diese eigenartige Weise die Küche und den Flur, und ich schaute etwas unschlüssig in die Ecken, in denen es mittlerweile nur so vor Ameisen wimmelte. Inzwischen hatten sie ihre Straßen so verbreitert, dass sie einer vierspurigen Autobahn glichen.
»So, das ist schon mal geschafft«, rief unser Vater vergnügt und ließ Hans' Füße auf den Boden fallen. Der hatte nun ein rotes Gesicht, aber nicht von der Anstrengung, sondern vom Lachen. Aber seine gerade noch helle T-Shirt-Rückseite war nun schwarz, mit braunen Krümelpunkten gemustert.
»Ich geh' jetzt duschen«, sagte mein Bruder, und damit entzog er sich dem Putz- und Räumauftrag auf geschickte Weise.
Unser Vater nickte ihm nur zu und nahm das restliche Knoblauchpulver aus dem Kühlschrank. »Das muss ich jetzt noch schnell essen, dann kann die Mama mir das nicht verbieten«, sagte er augenzwinkernd zu mir.
»Und was ist mit den Ameisen?«
Ich überlegte mir, dass die Ameisen möglicherweise nicht schwimmen konnten und holte einen Eimer, den ich bis zum Rand mit Wasser füllte, und den stieß ich vor der Ameisen-Hauptzentrale um. Jauchzend stellte ich fest, dass die Ameisen in der Wassermasse ertranken. Bestärkt durch den schnellen Erfolg füllte ich den Eimer erneut mit Wasser, um auch die anderen Ameisen mit meinem Anti-Ameisen-Mittel in Küche und Flur zu eliminieren. Als mein Vater kam, konnte ich ihm stolz berichten. »Guck mal, Papa, die Ameisen mögen kein Wasser. Sie können nämlich nicht schwimmen!«
»Ja, schon, aber das Wasser müssen wir schnell wegwischen! Nimm dir einen Lappen. Ich gehe wieder an meine Arbeit.«
Ich war enttäuscht, dass er meine brillante Aktion gegen die Ameisen kaum gewürdigt hatte und wischte mit dem Lappen auf dem Boden herum. Aber als der vollgesogen war, wusste ich nicht, wie ich das Wasser aus dem Lappen auswringen sollte. Deshalb holte ich aus dem Wohnzimmer eine Decke, die dann auch viel saugfähiger war.
Ich war derartig in die Arbeit vertieft, dass ich nicht bemerkte, dass die Haustür geöffnet wurde. »Aber Nati? Was machst du denn da? Ist ein Rohr geplatzt? Wo ist denn dein Vater?«
»Mama!« Ich lief zu ihr, und sie umarmte mich. Sie sah erholt aus, nicht mehr so furchtbar gestresst wie vor ihrer Kur. Ich freute mich natürlich sehr, dass sie wieder bei uns war. Doch gleichzeitig wurde mir klar, dass ich jetzt nicht mehr mit Hans vom Kleiderschrank auf Omas alte Matratze springen konnte, und sie würde auch einige andere Dinge verbieten, die uns Spaß gemacht hatten.
Abendmahlzeit
»Und pass auf deine kleine Schwester auf«, hatte unsere Mutter Hans zugerufen, als wir in den Zug stiegen, der uns ins Ruhrgebiet bringen sollte.
1986 verbrachten unsere Eltern die Sommerferien auf Teneriffa, Hans war zu einem Zeltlager angemeldet, und ich sollte ein paar Tage bei Josepha und Wolfram bleiben.
Seitdem Josepha einen Pflegesohn adoptiert hatte, war sie sehr viel umgänglicher geworden. Unsere Tante erzählte uns, dass sie Georg adoptiert hatte, weil seine Mutter die Wäsche nicht mehr gewaschen und nicht mehr für ihn gekocht hatte. Entsetzt sahen Hans und ich uns an. Wir hatten anscheinend beide den gleichen Gedanken: Wenn Mama das nächste Mal länger in der Kur war, durften wir niemandem sagen, dass unser Vater nicht für uns kochte. Und Hans sollte dann besser darauf verzichten, Feuerwerkskörper in die Briefkästen der Nachbarn zu werfen.
Ich wollte nicht, dass Hans ins Zeltlager fuhr und mich dort zurückließ. In dem Zimmer auf dem Dachboden, in dem ich schlafen sollte, holte Hans ein Spiel aus dem Schrank und erklärte mir: »Das sind Plastik-Smarties, und du machst für jeden Smartie eine Kniebeuge. Und wenn du mit denen fertig bist, dann kommt der Goldgang und legt dir eine Goldmünze unters Bett.«
»Echt?«
»Wenn ich es dir doch sage! Aber du musst bei den Kniebeugen die Augen schließen und jedes Smartie zählen, sonst kommt er nicht. Er möchte nämlich nicht von den Menschen gesehen werden.«
Ich tat also, was er mir gesagt hatte, hörte auch noch das Rascheln einer Tüte, und dann knarrten die Stufen. Hans war verschwunden. Ich rief mehrfach seinen Namen, aber erhielt keine Antwort. Als ich hinunterging, hörte ich aus dem Wohnzimmer laute Schnarchgeräusche. Da lag Onkel Wolfram in seinem Ohrensessel, und ich fand weder Georg noch Tante Josepha. Also ging ich die Treppe hinauf, und in meinem Zimmer blickte ich unter mein Bett. Dort lag eine Goldmünze, und ich musste niesen wegen der Staubflocken. Aber dabei waren wohl Tröpfchen auf die Münze gekommen. Ich wollte sie wegreiben, doch das Gold löste sich von der Münze, und an meinen Fingern hatte ich nun goldene Streifen. Ich kroch unter dem Bett hervor und rannte die Treppe hinunter in die Küche. Dort traf ich Tante Josepha an, die inzwischen zurückgekommen war.
»Was ist denn los, Nati?«, fragte sie mich erstaunt.
»Wo warst du denn?«
»Ich habe deinen Bruder zum Bahnhof gebracht.«
»Hans hat eine Goldmünze unters Bett rollen lassen, und jetzt sind meine Finger vergoldet, aber die Münze nicht.«
»Das ist doch nur Wasserfarbe, wasch die einfach ab.«
Rückzug
Mein Vater versank nach dem Tod seiner geliebten Mutter in Trauer, und es schien so, als hätte sie auch sein Interesse an seiner Familie mit ins Grab genommen. Er zog sich immer mehr aus dem Familienleben zurück. Mit der Zeit hatte sich eine eigentümliche Kluft in unserer Familie aufgetan: Während meine Mutter Hans in so ziemlich allem Rückendeckung gab und sie gemeinsam an mir herumkritisierten, fühlte ich mich nur von meinem Vater richtig verstanden. Er war genauso sensibel wie ich und trat immer schnell den Rückzug an, wenn der Familiensegen drohte, in eine Schieflage zu rutschen.
Als wir am Nachmittag meines elften Geburtstags am Küchentisch saßen, um Kuchen zu essen, war mein Vater bereits längst wieder in seinem Arbeitszimmer. Etwas verstimmt stocherte ich in meinem Stück Schokokuchen herum. Es dauerte nicht lange, bis sich meine Mutter echauffierte: »Renate, nimm die Füße vom Tisch! Man muss sich ja für dich schämen.« Ich seufzte, und sie nahm einen Schluck Kaffee. »Aber das ist ja kein Wunder«, murmelte sie, »wenn du dir von deinem Vater die schlechten Manieren abguckst. Falls ich mal wieder länger nicht da wäre, würdet ihr verlottern, aber er würde es nicht einmal merken.«
Wenn sie so von unserem Vater sprach, bildete sich sofort ein Kloß in meinem Hals, und der Klumpen in meinem Magen wurde immer größer. Ihre abfälligen Kommentare über ihn hatten sich verschärft, und es fiel mir schwer, noch einen Bissen herunterzukriegen. Und dann brach es aus mir heraus: »Natürlich! Als wäre er ohne dich gar nicht lebensfähig. Aber das ist unfair! Es liegt doch nicht nur an ihm, dass bei uns alles so verlottert ist! Alles alter, verschlissener Krempel. Papa hat gemeint, wenn wir die alten Lumpen von außen ans Haus hängen, dann müssen wir keinen Einbruch befürchten. Das sei besser als jede Alarmanlage!«
Heute weiß ich, dass meine Mutter mit ihren Nerven am Ende war und sich von meinem Vater alleingelassen fühlte. Er hatte darauf bestanden, dass seine demenzkranke Mutter ihre letzten Lebensjahre bei uns verbringen sollte statt in einem Pflegeheim. Als Mama das ablehnte, weil sie mit uns und der vollen Stelle schon genug belastet sei, kam es zum Eklat. Meine Oma kam also doch in ein Pflegeheim und Vater unternahm jeden Sonntag mit ihr und uns Ausflüge, damit sie das Gehen nicht verlernte. Den Höhepunkt dieser für uns aufregenden Ausflüge bildete die Einkehr in eine Gaststätte. Da wir unsere Portionen nie aufbekamen, bestellte sich mein Vater nie etwas, sondern machte Resteessen. Nach Omas Tod wurden die Ausflüge weniger, dann ging mein Vater nur noch mit einem Familienmitglied essen, weil er es nicht ertrug, dass sich das Gesprächsthema bei mehreren Familienmitgliedern nicht mehr um ihn drehte.
Jetzt, hier am Esstisch, nahm meine Mutter meinen Ausbruch mit kühler Gelassenheit hin. »Weißt du, Renate, wenn ich dich anschaue, in dem löchrigen, vergammelten Pulli, dann ist mir klar, bei wem du dir das abgeguckt hast.«
Hans sah das offenbar genauso: »Du siehst aus wie eine Pennerin. Die würden dich sofort in ihre Gemeinschaft aufnehmen!«, pflichtete er der Mutter mit einem gehässigen Grinsen bei.
»Was ist denn mit dem schönen Kapuzenpulli, den ich dir zum Geburtstag geschenkt habe? Warum ziehst du den denn nicht an? Ich muss mich ja vor den Kollegen in der Schule und vor den Nachbarn schämen. Die denken ja, ich würde mich nicht um dich kümmern.«
»Lass sie doch, Mama! Die ist eben wie ihr Herr Vater.«
Die Mutter nickte eifrig. »Ja, und statt etwas zu ändern, zieht sie sich beleidigt zurück! Also wirklich, da komme ich erschöpft aus der Schule, und dann muss ich auch noch in solch ein mucksches Gesicht gucken. Dabei kriegt sie doch alles, was sie möchte.«
Wenn sie in meiner Anwesenheit über mich in der dritten Person sprach, platzte mir jedes Mal der Kragen. Wütend sprang ich auf.
»Ja, jetzt rennt sie wieder zu ihrem Vater«, hörte ich meinen Bruder übertrieben laut seufzen. Ich stürmte nach oben, aber nicht zu meinem Vater, sondern in mein Versteck auf dem Dachboden. Ich wollte nur noch meine Ruhe haben und meine Kassetten mit Geschichten von Astrid Lindgren anhören. Ich fühlte mich gekränkt. Solche Anfeindungen, auch von meinem Bruder, erlebte ich in der letzten Zeit häufig.
Als mein Vater aus seinem Arbeitszimmer kam, versteckte ich mich hinter einem Stapel Umzugskisten. Ich fand darin eine Bibel. Die Heiligenbilder waren so farbenfroh und wirkten so friedlich. Diese Menschen hatten sich wahrscheinlich besser verstanden, das war nicht so wie bei uns zu Hause. Dort sorgten Hans und meine Mutter immer öfter für eine unfriedliche Stimmung, weil sie an mir und meinem Vater dauernd etwas auszusetzen hatten. Aber vielleicht war ich ja wirklich so sonderbar, dass sie mit mir nichts anfangen konnten. Hans war dagegen ein echter Spaßmacher, mit seinen Wortspielen konnte ich nicht mithalten.
Latein
Wie zerrüttet die Ehe unserer Eltern war, zeigte sich, als Hans schon wieder drohte, in Latein durchzufallen. Vater konnte sich immer mächtig über die augenscheinliche Faulheit seines Sohnes aufregen, während Mutter ihn in Schutz nahm, indem sie ihrem Mann vorwarf, mich zu bevorzugen und die »Schlechte-Vater-Karte« ausspielte.
»Du hast Hans damals ja sogar einfach ausgesperrt, damit er dich nicht bei deiner Arbeit stört«, fauchte sie ihn an. »Er war damals erst drei Jahre alt! Er wollte doch nur, dass du dich auch mal mit ihm beschäftigst. Wahrscheinlich lutscht er deshalb immer noch am Daumen.«
Damit war die Diskussion für meinen Vater beendet, und wenn sich das Thema nicht wechseln ließ, floh er einfach in sein Zimmer.
Nach dem Streit, der an diesem Abend überraschenderweise mit der elterlichen Einstimmigkeit endete, Hans vom Gymnasium auf die Hauptschule zu schicken, wollte ich mich mit meinem Bruder solidarisch zeigen und sagte ihm, dass ich Latein auch doof finden würde, obwohl ich ja noch gar kein Latein im Unterricht hatte, weil ich erst acht war.
»Du weißt ja gar nicht, was das ist«, brummelte Hans. »Komm, wir spielen ›Sterne schießen‹ an meinen Computer, oder ›Giana Sisters‹ oder ›Poker‹ oder was auch immer.«
»Ist es das Spiel, in dem die Frau nackt ist, wenn man gewinnt?«
»Ja, genau!«
»Okay«, sagte ich, denn ich war froh, dass ich ihn auf andere Gedanken gebracht hatte.
Aber die Stimmung blieb trüb, und in den nächsten Wochen verbarrikadierte sich Hans immer länger in seinem Zimmer und machte sich irgendwann nicht einmal mehr die Mühe, die Rollläden hochzuziehen.
Als ich während dieser Zeit einmal mit meiner Freundin Anja zusammen buntes Konfetti aus meinem Zimmerfenster kippte, stürzte er plötzlich wütend hinein und schrie, dass wir gefälligst sofort mit dem Unsinn aufhören sollten. Er knallte die Tür hinter sich zu, und wir schauten uns verdutzt an.
Achselzuckend schütteten wir noch die restlichen zwei Tüten hinterher, aber dann stand Hans wieder in der Tür. Er brüllte und spritzte uns etwas ins Gesicht, das furchtbar brannte, und ich musste meine Augen vor Schmerzen schließen.
Als er gegangen war, fragte Anja: »Wie geht es dir?«
»Geht schon wieder«, murmelte ich, immer noch geschockt von Hans' Verhalten.
»Das war Tränengas. Du hast fast alles abbekommen. Mann, warum hast du dich nicht wie ich weggedreht? Du bist da wie verdattert stehengeblieben.«
Ich konnte mein Verhalten auch nicht erklären. Als ich mich bei meinem Vater über Hans beschwerte, ließ der meinen Bruder uns einen Kinoeintritt ausgeben. Ich konnte mich allerdings nicht richtig darüber freuen und verbrachte in den nächsten Tagen viel Zeit in meinem Bett. Dann bekam ich eine Grippe und ärgerte mich darüber, dass mir das ausgerechnet in den Herbstferien passieren musste. Mir war mit einem Mal schrecklich kalt.
Fast wie früher
Gerade weil Hans sich so stark verändert hatte, nutzte ich jede Gelegenheit, bei ihm zu sein, und versuchte, seine neuen Hobbies auszublenden, etwa die Pornos, Gewaltspiele und Horrorfilme auf seinem PC. Als unsere Eltern an diesem Abend ausgingen, hatten wir endlich einmal wieder einen schönen Tag miteinander verlebt. Es war heiß gewesen, und wir hatten uns mit kaltem Wasser abgespritzt. Um meinen Bruder zu beeindrucken, hatte ich mir insgesamt zehn Eimer übergekippt. Überhaupt war ich stolz darauf, dass er mich ›cool‹ fand, weil ich nicht so etepetete war, wie die anderen Mädchen in meinem Alter. Ich benahm mich mehr wie ein Junge, deshalb spielte er immer noch gerne mit mir.
Das Bett von Hans war viel größer als meines, das ein Geschenk von Oma gewesen war und auf dem man – mangels Sprungfedern – nicht gut herumhüpfen konnte und das außerdem viel zu klein war für eine Kissenschlacht. Daher war es keine Frage, dass ich bei ihm im Bett schlafen würde.
»Du, Nati«, sagte Hans, als wir das Licht ausgemacht hatten, um zu schlafen. »Kannst du mal probieren, einen Bleistift in deine Scheide zu stecken?«
Ich traute meinen Ohren nicht. »Was soll ich?«
»Die Schwester von Kevin hat das auch gemacht. Es gibt Frauen, die stecken sich sogar eine Gurke rein.«
Ich fand das eigenartig. Ich schämte mich, wusste aber gar nicht genau, warum. »Was soll das? Du bist irgendwie anders geworden. Du spielst gar nicht mehr mit mir wie früher.«
»Das ist bei uns Jungs eben so. Die Kinderspiele interessieren mich nicht mehr.«
»Aber ich mag das, was du dir in deinem Computer anguckst, auch nicht.«
»Also gut, wenn ich mir deine Scheide anschauen darf, dann spiele ich mit dir. Versprochen!«
Ich überlegte. »Hm, auch mit den Barbie-Puppen?«
»Ja, auch mit denen. Ich schenk dir sogar eine.«
Hans hatte mitbekommen, dass ich einerseits wie ein Junge sein wollte, aber andererseits darunter litt, dass ich mit der Brille und den kurzen Haaren nicht so hübsch war wie die anderen Mädchen. Deshalb mochte ich neuerdings Barbies, und ich freute mich immer sehr, wenn ich eine geschenkt bekam. Also zog ich meine Pyjamahose und den Slip aus. Hans knipste das Licht wieder an und gab mir einen Bleistift, und ich versuchte, den in meinen Unterleib einzuführen. Aber es war mir unangenehm, es tat mir weh, und dass Hans mir so fasziniert dabei zuschaute, war mir peinlich.
»Los, mach'«, forderte er mich auf, aber in seinen Augen war etwas, was mich erschreckte, und dass er mir solch einen Druck machte, gefiel mir nicht.
Ich versuchte es also weiter. Schließlich hatte ich den Bleistift bis zur Hälfte in meine Scheide gesteckt, und ich wunderte mich selbst, als ich sagte: »Der ist jetzt in der Emma.«
›Emma‹ – ich fand es merkwürdig, dass ich mein Geschlechtsteil so nannte. Ich hatte den Namen irgendwo mal gelesen. Als ich den Bleistift herauszog, war er feucht und glibberig.
»Wenn du jetzt meinen ›Willi‹ eincremst, dann kaufe ich dir morgen eine Barbie-Puppe«, versprach mir Hans, denn ich hatte ihn aufgrund seiner Aufforderung angeschaut, als könnte ich nicht glauben, was er von mir verlangte.
»Kevins Schwester macht das auch, also stell' dich doch nicht so an«, fügte er mit Nachdruck hinzu. Ich war heillos überfordert und fühlte mich unter Druck gesetzt. Andererseits wollte ich nicht, dass er mich als zickig ablehnte und dann womöglich gar nicht mehr mit mir spielen würde. Also cremte ich seinen ›Willi‹ ein. Er wurde immer fester und größer, und dann war er plötzlich ganz hart und steif, und es kam etwas Dickflüssiges heraus.
»Ich muss aufs Klo«, sagte ich und rannte los. Danach ging ich in mein Zimmer. Ich wollte nur noch alleine sein, und ohne dass Hans es von mir verlangt hatte, war mir klar, dass ich über das Geschehene mit niemandem sprechen durfte.
Am nächsten Tag ging Hans mit mir in einen Spielzeugladen und kaufte mir eine Skipper-Puppe. Ich musste ihn daran erinnern, dass er mir auch versprochen hatte, mit mir zu spielen. Er stieß einen tiefen Seufzer aus. »Aber nur kurz, ich bin mit Kevin verabredet.«
Obwohl wir auf seinen Baum kletterten, sah er alle paar Minuten auf seine Uhr. »Jetzt reicht's mir, ich muss los.« Ich nickte nur, und ich war fast erleichtert, als er nach unten kletterte. Dieses verkrampfte Getue ging mir auf die Nerven. Ich wusste in diesem Augenblick, dass es mit Hans niemals mehr so unbeschwert sein würde, wie es früher war, und das tat mir weh.
Beim Abendessen blickte ich Hans verstohlen von der Seite an. Er benahm sich wie immer, aber für mich hatte sich etwas Entscheidendes geändert: Unseren Gemeinschaftsgeist gab es nicht mehr. Mein Appetit war mir plötzlich vergangen.
Als ich am nächsten Abend in der Badewanne saß, kam Hans ins Badezimmer. »Darf ich mir deine ›Emma‹ angucken?«, fragte er ganz lieb, und ich traute mich nicht, ihm das zu verweigern. Ich schämte mich. Auf eine ganz eigenartige Weise fühlte ich mich schuldig, weil ich mich darauf eingelassen hatte.
Es passierte dann immer wieder, dass er mich bedrängte. Er forderte immer mehr und nutzte jede Gelegenheit, ohne dass unsere Eltern etwas bemerkten. Ich konnte mich niemandem anvertrauen, zog mich immer mehr zurück und nahm nur noch am Familienleben teil, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Die Eltern meinten, ich wäre in einer Trotzphase, das gute Verhältnis mit meinem Vater war ebenfalls gestört. Ich vermied es, mit Hans alleine im Haus zu sein und verkroch mich immer öfter auf den Dachboden in mein Versteck. Aber auch dort fand er mich, und auch dort forderte er mich zu sexuellen Handlungen auf. Ich fühlte mich einsam, ließ es geschehen − damit ich mich nicht ganz so alleine fühlte. In der Gegenwart der Eltern benahm sich Hans mir gegenüber gleichgültig – als hätte er nichts mit meiner Situation zu tun. Ich war total verunsichert und schloss mich abends in meinem Zimmer ein. Aber er klopfte nachts, wenn die Eltern schliefen, an meine Tür und schob kleine Zettel unten durch, auf denen solche Botschaften standen, wie »Ich will deine Fotze lecken!« Als er immer aufdringlicher wurde, öffnete ich die Tür, weil ich befürchtete, dass die Eltern bemerken würden, dass er nachts zu mir ins Zimmer wollte. Er behauptete: »Ich hab' dich so lieb, ich möchte meinen ›Willi‹ in deine ›Emma‹ stecken.« Ich schaffte es einfach nicht, ihn abzuweisen. Er versuchte es dann, aber ich war zu verkrampft, es tat mir weh. Danach öffnete ich die Tür nicht mehr und ging abends auch nicht auf die Toilette, sondern pinkelte in einen Topf.
Als ich eines Tages im Partyraum mit der elektrischen Eisenbahn spielte, kam Hans mit seinem Freund Kevin herein. Hans holte unter dem Sofa einige Zeitschriften hervor, und Kevin staunte, dass er so viele Pornohefte hatte.
»Meine Eltern würden mir das niemals erlauben«, sagte er mit belegter Stimme, und beide Jungs schauten sich die Abbildungen mit Bemerkungen wie »ist das geil!« und gierigen Blicken an.
»Nati, willst du auch mal gucken?«, fragte Hans ganz harmlos, aber ich wusste ja, dass er nicht lockerließ, wenn er bei mir etwas erreichen wollte. Also nahm ich ein Heft, und die sexuellen Darstellungen fand ich aufregend, aber auch ekelhaft, und die Gegenwart von Kevin war mir sehr unangenehm.
»Du hast mich doch auch lieb, oder?«, forderte Hans mich heraus. »Ich möchte gerne deine ›Emma‹ sehen.« Auch Kevin blickte mich auffordernd an, und ich zog meine Hose und den Schlüpfer aus, wie von einer fremden Kraft geführt.
»Darf ich auch mal?«, fragte Kevin und kam näher. In diesem Augenblick wehrte sich alles in mir dagegen, denn das war kein Bruder-Schwester-Spiel mehr. Ich sprang auf und rannte halbnackt die Treppe hoch zu meinem Vater. Hans kam hinter mir her, aber ich schaffte es gerade noch, ihm die Tür vor der Nase zuzuknallen.
»Hans und Kevin − die haben – die wollten mich da unten anfassen«, schluchzte ich.
Mein Vater sprang auf, wollte etwas sagen, aber dann lief er in den Keller. Ich hatte ihn nie zuvor so aufgebracht erlebt. Dann hörte ich Geschrei und schließlich das laute Aufheulen von Hans. Als unsere Mutter nach Hause kam, sprachen die Eltern sehr erregt miteinander. Beim Abendessen hatte ich keinen Appetit, aber Hans auch nicht. Er saß mit gesenktem Kopf am Tisch. Aber auch ich fühlte mich unbehaglich, denn insgeheim dachte ich, dass ich nicht ganz unschuldig an der prekären Situation war, denn ich hätte von vornherein nicht auf seine Sexspiele eingehen dürfen. Ich fühlte mich mies, weil ich plötzlich so ›empfindlich‹ reagiert hatte.
Später klopfte meine Mutter an meine verschlossene Zimmertür. »Hans wird dich niemals mehr anfassen«, sagte sie, und damit war es zu einem Tabu-Thema in meiner Familie geworden. Aber ich hatte meinen Bruder als Freund verloren − das wurde mir in diesem Moment klar, und darüber war ich sehr traurig.
Einfach nicht genug
Die Erlebnisse mit meinem Bruder hatten in mir etwas ausgelöst, das ich rückblickend als Flucht nach vorn bezeichnen würde: Ich sehnte mich nach Abenteuern und hatte ein enormes Geltungsbedürfnis entwickelt. Mit 13 Jahren wollte ich interessanter, waghalsiger und lustiger sein und mehr erleben als alle Siebzehnjährigen zusammen. Darum machte ich in meiner Jugend ziemlich verrückte Dinge.
Hans fing an, in einem Fastfood-Laden neben der amerikanischen Siedlung zu arbeiten und prahlte mit dem locker verdienten Geld. Wir hatten uns schon oft im Käseburger's durch das Angebot geschlemmt, obwohl ich damals eigentlich Vegetarierin war.
Um dort arbeiten zu können, fälschte ich das Alter auf meinem Schülerausweis von 13 auf 16 Jahre und fühlte mich sehr verwegen. Meinem Freundeskreis erzählte ich stolz von meiner Arbeit, aber ich spürte bald, dass die sonntägliche Acht-Stunden-Schicht an meinen Kräften zehrte und mein Elan beim Burger-Belegen deutlich nachgelassen hatte.
Nach einigen Wochen lud mich mein indischer Kollege Sanjay zum Kaffee ein. Er war 25 und sah sehr gut aus. Wir verständigten uns in einem Sprachmix aus Deutsch und Englisch miteinander. Ich fühlte mich geschmeichelt, dass sich solch ein gutaussehender Mann in mich verliebt hatte und projizierte in ihn die Rolle des großen Beschützers, der mir alle Unannehmlichkeiten aus dem Weg räumen würde. Doch meine gesunkene Motivation war meinem Chef aufgefallen, und eines Tages, nachdem meine Schicht beendet war, zahlte er mir meinen Lohn aus und setzte mich vor die Tür.
Meine Eltern waren sehr erleichtert, als ich ihnen von meiner Kündigung erzählte, und überboten sich darin, mir Jobs anzupreisen, von denen sie dachten, dass sie geeigneter für mich seien. Von Sanjay wussten sie nichts, dabei hatte ich ihn sogar schon einmal in seinem Apartment, das er sich mit mehreren Landsleuten teilte, besucht. Es war mir unangenehm gewesen, dass sie uns beim Knutschen zuguckten.
Als Alibi für meine Eltern musste meine beste Freundin Anja herhalten. So auch für jenen Sonntag, an dem Sanjay mich vom Bahnhof der Nachbarstadt abholen wollte, um mit mir einen englischsprachigen Film zu sehen. Als er mit seinen Freunden im Schlepptau erschien, war es mit meiner guten Laune vorbei. Etwas missmutig ließ ich mich von ihm an der Hand in einen Nebeneingang des Bahnhofgebäudes ziehen und erstarrte, als sich die pinke Neonreklame vor mir auftat. Sanjay machte tatsächlich Anstalten, am Eingang Karten für das Pornokino zu kaufen. Ich erwachte aus meiner Schockstarre und riss mich von ihm los. Auf dem Weg zur Bahn stolperte ich noch über einen Junkie, der sich gerade eine Spritze setzte.
Plötzlich war ich gar nicht mehr stolz darauf, einen 25-jährigen Freund zu haben, der mich für mindestens 16 gehalten hatte.
Ich war froh, wenigstens mit Anja über das Erlebte sprechen zu können. Sie lud mich ein, am darauffolgenden Wochenende mit ihr und ihren Eltern die Nachbarsstadt zu besichtigen. Ich fühlte mich endlich wieder wie ein 13-jähriges Mädchen, das keine 16-Jährige spielte.