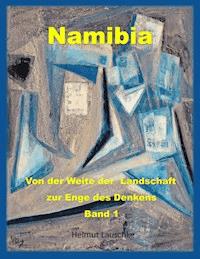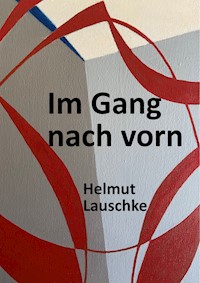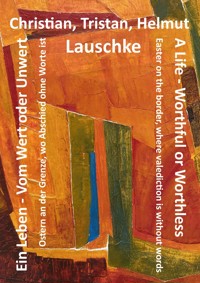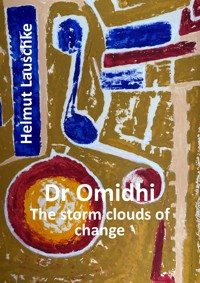Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der seelische 'Kwashiorkor' war ein Erwachsenensyndrom mit dem Mangel an Bildung und vielleicht auch dem Mangel an Ethik. Dagegen war der körperliche Kwashiorkor das Syndrom der malignen Unterernährung bei Kindern durch den chronischen Eiweißmangel. Diese Kinder hielten es mit dem Leben nicht lange durch. Sie fielen um und starrten aus großen Augen in den Himmel, wenn der letzte Atemzug sie verwehte. Eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, lag auf dem Operationstisch. Ihr "Freund" hatte ihr in den Bauch geschossen, weil sie ihn nicht mehr liebte und nicht mehr mit ihm schlafen wollte. Der junge Mann hatte sich anschließend selbst das Leben genommen. Es war eine mehrstündige Operation, bei der die Patientin viel Blut verloren hatte. Der Ausgang der Notoperation zur Rettung des jungen Lebens stand zwischen Hoffnung und Zweifel. Der Morgen begann zu dämmern, als sich Dr. Ferdinand auf den Weg zur Wohnstelle machte. Die ersten Vögel zwitscherten von den Bäumen. Es war still im Dorf. Die Menschen schliefen noch. Er schloss die Tür auf, streifte die verschwitzten Sandalen von den Füßen und setzte sich mit einer Zigarette auf den Absatz der Terrasse. In Gedanken sah er die junge Frau hilflos im Bett der Intensivstation liegen, die zu schwach war, um über das, was vorgefallen war, zu weinen. Sie wusste vielleicht nicht, dass sie schwanger war, und überließ jede Entscheidung über Leben und Tod dem Schicksal, den Schwestern und dem Arzt. Mit der Unabhängigkeit kamen Patienten, die mit HIV (Human Immunodeficiency Virus) infiziert oder an AIDS (Aquired Immunodeficiency Syndrome) erkrankt waren. HIV/AIDS war vor der Unabhängigkeit so gut wie unbekannt. Das Virus wurde von Menschen, die vom Norden die Grenze nach Namibia überquerten, mitgebracht. Es waren vorwiegend Männer und Frauen, die aus dem Exil zurückkehrten. Viele von ihnen waren PLAN-Kämpfer. Eine junge Frau hilft ihrer alten Mutter auf den Schemel. Die alte Frau klagt über Schmerzen in den Kniegelenken. Dr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Lauschke
Dr. Ferdinand
Chirurg vor der namibisch-angolanischen Grenze
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Dr. Ferdinand
Die Hähne krähen das fünfte Mal
Kurz vor Mitternacht
Anderes aus der Wirklichkeit
Die Blick- und Lichtschranke zwischen mager und fett
Mit Blick auf den Patienten
Das Mädchen mit dem Knochensarkom im rechten Oberarm
Ein besonderer Augenblick
Der Zehenblick und die Würde des Fußes
Mit Blick auf die Hautfarbe
Von der ungleichen Melanozytenzahl und dem Exodus der weißen Nonnen
Epilog
Impressum neobooks
Dr. Ferdinand
Die Hähne krähen das fünfte Mal
Es ist halb sechs, als die Hähne das fünfte Mal krähen. Ferdinand stellt sich unter die Brause und wäscht sich den Schlaf aus dem Gesicht. An diesem Morgen will er früh im Hospital sein, um die Patienten noch vor der Morgenbesprechung zu sehen. Überhaupt will er am Arbeitsstil festhalten, wie er ihn vor der Unabhängigkeit hatte. Doch spürt er die Zeichen der Schwäche, die sich durch die jahrelange Überforderung an ihn gehängt hat. So vermisst er seit über einem Jahr das Gefühl des Frischseins beim Aufwachen, das Gefühl, wirklich ausgeschlafen und erholt zu sein. Stets sind Reste der vorangegangenen Tage im Denken übrig, die sich, wenn sich die Ladungen ballen, bis zum Kopfschmerz am frühen Morgen zusammendrücken. An manchen Morgen muss er eine Schmerztablette nehmen.
Nach der Tasse Kaffee macht er sich auf den Weg zum Hospital. An diesem Mittwochmorgen nimmt er den kürzeren Weg zwischen dem zerfledderten Lattenzaun und dem ausgerollten Stacheldraht, ein Weg, den er nach beiden Richtungen einige tausend Male gegangen war. Von den fünf aufgestelzten Caravan-Häusern links des Weges stehen nur noch zwei leer. Drei Caravan-Häuser, die dem Hospital am nächsten stehen, sind von Schwestern bewohnt. Im letzten Haus, das dem Hospital gegenübersteht, wohnt Schwester Sarah, die bei der Bombenexplosion am 19. Februar 1988 in der Barclay’s Bank schwere Verbrennungen erlitten und das rechte Bein verloren hat. Sie wohnt mit ihren zwei kleinen Kindern und muss nur die Straße mit den vielen Schlaglöchern überqueren, wenn sie zum Hospital geht. Ihr Arbeitsplatz ist in der CSD (Central Sterilisation and Disinfection), die sich am Ende des Operationstraktes befindet.
Ferdinand geht durch die Hospitaleinfahrt, deren Torflügel und Pfosten verbeult sind. Der rechte Flügel mit dem verknickten Pfosten steht offen. Dahinter sitzt zurückgesetzt auf einem Stuhl der Pförtner, der sein Morgenei entpellt und die Schalenstücke mit dem linken Schuh in den Sand reibt. Er stopft das Ei in dem Moment in den Mund, als Ferdinand das Tor passiert und ihm einen guten Morgen wünscht. Der Pförtner nickt mit dem Kopf, während er das Ei zerkaut.
Der Vorplatz riecht nach Urin. Das findet Ferdinand normal, weil es duch all die Jahre so riecht. Nur als die britische Königin mit Prinz Philip dem Hospital einen Höflichkeitsbesuch abstattete, war der stechende Geruch zwei Tage vor ihrem Besuch bis drei Tage nach ihrem Besuch verschwunden. Da wurde der Vorplatz mit viel Wasser jeden Morgen und jeden Abend abgespritzt und geschrubbt. Die kleine namibische Flagge ist noch nicht an der überhohen Fahnenstange auf dem für den königlichen Besuch gemauerten Podest des Vorplatzes hochgezogen worden. Ferdinand betritt die ‘Intensiv’-Station, die den anspruchsvollen Namen der vielen Mängel wegen nicht verdient, und sieht nach den Risikopatienten. Die klinischen Befunde trägt er in die Krankenblätter ein. Zwei Schwestern aus der Nachtschicht begleiten ihn und berichten von ihrer Arbeit. Ferdinand hört es heraus, dass die Seele der Krankenpflege, wie sie vor der Unabhängigkeit so mitfühlsam zu spüren war, nach der Unabhängigkeit verkümmerte. Von der Höhe und Größe des Berufes mit der hohen Verantwortung war beim Großteil der Schwestern und bei den Matronen nichts mehr zu spüren. Der Krankenpflegeberuf ist zur Mussroutine abgesunken und seelisch verwelkt.
Als ein Symptom der Unabhängigkeit versteht Ferdinand die abnehmende Zahl der an den Patienten arbeitenden Schwestern. Dafür nimmt die Zahl der sitzenden Funktionärsschwestern in den klimatisierten Büros mit den höheren Gehältern kontinuierlich zu. Die Schwestern in kleinerer Zahl verrichten die Arbeit weiter am Patienten, manche von ihnen mit menschlicher Hingabe, ohne dabei auf die Uhr für die Tee-, Kaffee- und die Mittagspause zu sehen. Das aber tut die größere Zahl der ‘gehobenen’ und vom Patienten weggehobenen Schwestern und Matronen nicht, die sich dieses ‚vorbildliche‘ Verhalten nach der Unabhängigkeit angewöhnt haben.
Die Blume der pflegerischen Nächstenliebe ist vertrocknet, die den ganzen Menschen fordert und vor der Unabhängigkeit so großartig tätig war. Den Verlust dieser wunderbaren Blume versteht Ferdinand als Ausdruck der Erschöpfung im Zusammengehen mit der inneren Leere und Orientierungslosigkeit. Das Verlustsyndrom hat auch mit dem Bildungsdefizit zu tun, denn praktizierte Menschlichkeit setzt ein Grundmaß an Herzensbildung voraus.
Eine rühmliche Ausnahme ist der Engel bei den Kinderschwestern. Sie ist sich auch nach der Unabhängigkeit in der Arbeit treu geblieben. Diese Schwester arbeitet mit Herz und selbstloser Hingabe an den kranken Kindern. Sie schaut auf die kleine Armbanduhr mit dem schlichten Armband nicht für ihre Teepause, sondern damit die Kinder zur rechten Zeit gewaschen und gefüttert und die Verbände gewechselt werden. Diese Vorbildlichkeit hat zur Folge, dass diese Schwester sich körperlich verzehrt und bei der verantwortungsvollen Arbeit an Körpergewicht verliert, während viele der anderen Schwestern und die Matronen durch das viele Sitzen an Gewicht zunehmen. Kein Wunder, dass die Kinder den Engel lieben und ihm an den Kittelzipfeln hängen.
Schwund und Mangel an pflegerischer Hingabe ist eine bestürzende Erkenntnis nach dem Sturz der weißen Apartheid mit dem Aufkommen der namibischen Unabhängigkeit. Die Entfremdung vom Patienten als Folge der sitzenden Schreibtätigkeit mit den ‘Meetings’ in den klimatisierten Räumen hat deutlich zugenommen. In diesen ‘Meetings’ erfreuten sich die sandwichbeladenen Teller in den Tee- und Kaffeepausen der Beliebtheit. Die Folge war die Gewichtszunahme der zuhörenden und mitschreibenden Teilnehmer. Je mehr palavert wurde, je länger dauerten die Sitzungen mit dem Sitzen. So blieb es nicht aus, dass auch mehr gegessen und getrunken wurde. Die weitere Folge war die Verkürzung mit Verbreiterung der Hälse und die Schwergängigkeit mit den Auswölbungen der Gesäße. Die Gewichtszunahmen erstaunten, denn solange war Namibia noch nicht unabhängig. Das Verfettungssyndrom der Sitzenden ging mit der Abmagerung der in ständiger Bewegung Verbliebenen einher, die in der Krankenpflege aktiv waren. Es war eine Art seelischer ‘Kwashiorkor’, bedingt durch das rasche ‘Aufblühen’ der Gesundheitsfunktionäre mit der dort verbundenen Übergewichtigkeit. Es bestand kein Zweifel, dass die Gesichter der Funktionäre die Züge der besonderen Wichtigkeit angenommen haben. Nun gingen Wichtigkeit und Übergewichtigkeit Hand in Hand, oder Hand und Fuß, oder anders gesagt, sie gingen in einer Person. Die Gesichter der Wichtigkeit haben sich auch mondartig gerundet. Da sich beides nicht so ohne weiteres vertrug, kam es zur ungewollten Komik im Ausdruck der Gesichter innerhalb dieser Umkreise, was gelegentlich und ebenso ungewollt ein Schmunzeln der Betrachter freisetzte.
Der seelische ‘Kwashiorkor’ war ein Erwachsenensyndrom mit dem Mangel an Bildung und vielleicht auch dem Mangel an Ethik. Dagegen war der körperliche Kwashiorkor das Syndrom der malignen Unterernährung bei Kindern durch den chronischen Eiweißmangel. Er wurde bei Kindern auffällig durch die ausladenden Wasserbäuche auf den dünnen Stelzbeinen. Diese Kinder hielten es mit dem Leben nicht lange durch. Sie fielen um und starrten aus großen Augen in den Himmel, wenn der letzte Atemzug sie verwehte. Die Rippen ihrer Brustkörbe wölbten sich weit heraus. Das tiefe Mitgefühl galt den Kindern:
Ist das Wasser in den Kinderbäuchen,
schreit die Seele auf vor Schmerz.
Große Augen trüben sich zum Ende,
früh zieht der Tod ins Kinderherz.
Kurz vor Mitternacht
Das Telefon klingelte. Die Schwester rief aus dem 'theatre' an und sagte, dass der diensttuende Kollege Probleme bei der Operation habe und Hilfe brauche. Dr. Ferdinand zog sich Hemd und Sandalen an und machte sich auf den Weg zum Hospital. Der klare Sternenhimmel gab genug Licht, um Schlaglöcher und Baumstümpfe zu umgehen. Die Mondsichel hatte den halben Weg genommen, den Centaurus erreicht und fuhr dem Kreuz des Südens entgegen. Im Kopf saßen die Gefangenen an Hals und Beinen gefesselt in der Höhle (Platons Höhlengleichnis). Bizarre Schatten mit zu breiten Gesichtern auf zu kurzen Hälsen oder langgestreckte Kopfprofile mit zu langen Nasen auf langgezogenen Hälsen zogen vorüber. Da waren Hände mit verbogenen und langen Fingern, Hände, an denen Finger fehlten. Es gab Fäuste von gigantischer Größe, die groß genug waren, die Höhle mit wenigen Schlägen zu zertrümmern. Dr. Ferdinand stolperte über einen Stein, weil er dem Höhlengleichnis nachhing und sich nicht auf den Weg konzentrierte. Er hörte im Geiste das Klappern und Schlagen schwerer Ketten, das sich zum ohrenbetäubenden Kreischen und Quietschen der Ketten einrückender T-34 Panzer der Roten Armee bei Kriegsende verstärkte; er hörte das Stöhnen der Gefangenen aus seiner Kindheit. Als er den Platz vor der 'Municipality' überquert hatte und am ersten der fünf aufgestelzten Blockhäuser vorüberging, hatte er das Kettengeräusch so stark im Ohr, dass ihm nun der Weg verkettet, ja zugekettet erschien, wo vor der Unabhängigkeit der Stacheldraht ausgerollt war und man aufpassen musste, von dem Draht nicht aufgerissen zu werden.
Er erreichte das Hospital, zog die Kette vom verbogenen Torflügel der Einfahrt, schob ihn auf, wobei der Rahmen über den Boden kratzte, ging hindurch und schob den Torflügel zu, ohne die Kette wieder einzuhängen. Er überquerte den Vorplatz, ohne auf den Uringeruch zu achten, ging den Gang links von der Rezeption geradedurch, drehte hinter dem OP-Haus nach rechts, öffnete die Tür zum 'theatre', schloss sie hinter sich und stand im Umkleideraum, wo im Teeraum nebenan eine Schwester mit ernstem Gesicht auf ihn wartete und ihn bat, sich zu beeilen. Er tat es, warf seine Zivilkleidung über den Haken, zog die grüne Hose an und streifte sich das grüne Hemd noch über, als er schon im Waschraum stand und durch die offene Glastür in den OP-Raum blickte und den Schweiß auf der Stirn des jungen Operateurs und das besorgte Gesicht der OP-Schwester sah. Er meldete sich, drehte sich um, öffnete den Wasserhahn und wusch seine Hände über der Zinkwanne. Er trocknete sich die Hände, während eine Schwester ihm den grünen Op-Kittel überzog, und streifte mit Mühe die schlecht gepuderten Gummihandschuhe über, als er schon am OP-Tisch stand.
Was war geschehen? Eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, lag auf dem Operationstisch. Ihr "Freund" hatte ihr in den Bauch geschossen, weil sie ihn nicht mehr liebte und nicht mehr mit ihm schlafen wollte. Der junge Mann hatte sich anschließend selbst das Leben genommen, indem er sich in den Kopf geschossen hatte. Im eröffneten Bauch der jungen Frau stand ein Blutsee, den der junge Kollege nicht unter Kontrolle brachte. Der Narkosearzt hatte ihr drei Konserven der Blutgruppe Null transfundiert. Zwei Konserven waren noch verfügbar. Das war alles, was im Labor aufzutreiben war. Von den Abdecktüchern tropfte das Blut auf den Boden, wo eine Schwester grüne Tücher auslegte. Dr. Ferdinand sog das Blut aus der Bauchhöhle, während der Kollege eine große Kompresse auf Milz und linke Niere drückte. Der Dünndarm wies an mehreren Stellen Löcher auf, aus denen Darminhalt heraustrat und sich mit dem Blut vermischte. Der Narkosearzt war nervös und sagte, dass der Blutdruck nicht mehr zu messen sei. Dr. Ferdinand bat, den Tisch in Kopftieflage zu bringen. Mit dieser Maßnahme und dem Druck mit der Kompresse auf Milz und linke Niere gelang es, die Blutung zu drosseln. Dann klemmte er die blutenden Gefäße zur Milz ab und sah, dass das Organ völlig zerrissen war, und entfernte die Milz mit wenigen Handgriffen. Er stopfte die Milzloge mit einer großen Kompresse aus. Der nächste Schritt galt der linken Niere, wo es aus einem Kapsel- und darunterliegenden Geweberiss diffus blutete. Dr. Ferdinand legte einige Parenchym- und Kapselnähte und brachte die Blutung völlig zum Stehen. Er revidierte die großen Gefäße des Nierenstiels, die unverletzt waren. Dann prüfte er die Darmschlingen von der oberen Flexur, wo der Zwölffingerdarm in den Leerdarm übergeht, bis zum Übergang des Krummmdarms in den aufsteigenden Dickdarm oberhalb des Blinddarms mit dem Anhängsel des Wurmfortsatzes. Die meisten Löcher wurden durch Wandnähte verschlossen. Doch waren einige Schlingen des Krummdarms in der Durchblutung soweit gestört, dass sie herausgeschnitten und die Darmenden neu verbunden werden mussten. Schließlich wurden die Lücken im Darmgekröse durch Nähte geschlossen.
Es war eine mehrstündige Operation, bei der die Patientin viel Blut verloren hatte. Der Narkosearzt hatte die Nervosität behalten, obwohl er den Blutdruck wieder für messbar erklärte, wenn auch der obere Messwert weit unten lag und der Puls raste. Von den fünf Blutkonserven waren vier gegeben und das Volumendefizit wurde mit Plasma- und Plasmaersatzlösungen aufgefüllt. Über den Blasenkatheter entleerte sich nur etwas Urin infolge des Kreislaufschocks. Der Urin war durch die Nierenverletzung blutig. Dr. Ferdinand führte ein Gummirohr in die Bauchhöhle, dessen Ende in die tiefste Bauchtasche hinter der Gebärmutter gesenkt wurde. Diese Tasche hieß Douglas-Tasche (nach seinem Erstbeschreiber James Douglas, Arzt und Anatom in London (1675-1742). Beim Vorschieben des Gummirohres in diese Tasche fiel ihm die vergrößerte Gebärmutter auf, deren Größe einer frühen Schwangerschaft entsprach. Er bezweifelte, dass der junge Embryo diese Tortur überlebte und die Schwangerschaft ausgetragen würde, vorausgesetzt, die Mutter käme mit dem Leben davon. Die fünfte Blutkonserve lief und war bereits halbleer, als nach der letzten Revision der Bauchhöhle Dr. Ferdinand die große Mullkompresse aus der Milzloge entfernte und die Bauchwand in ihren Schichten vernähte. Es war eine Notoperation zur Rettung eines jungen Lebens, deren Ausgang zwischen Hoffnung und Zweifel stand.