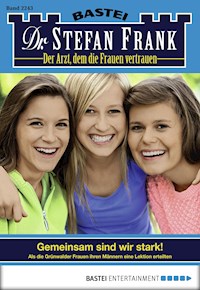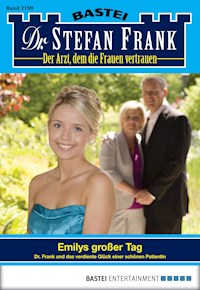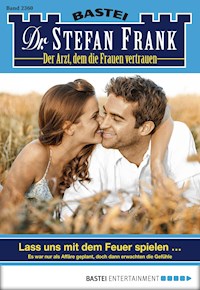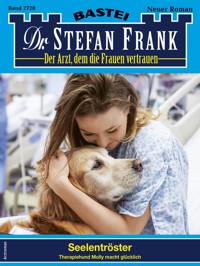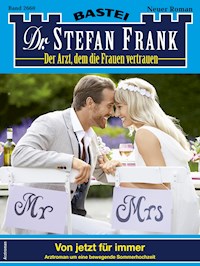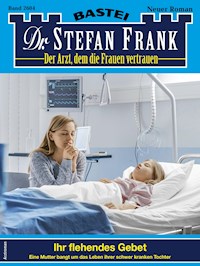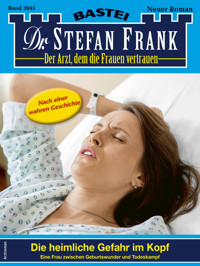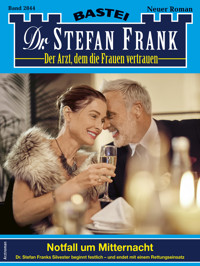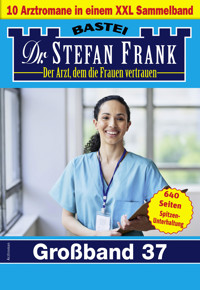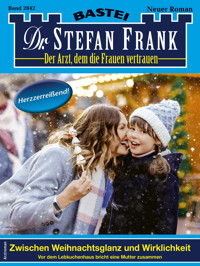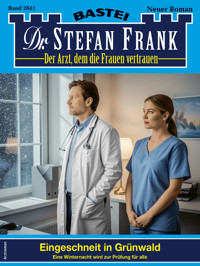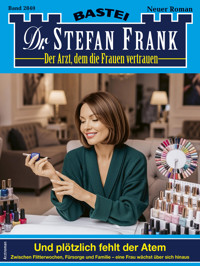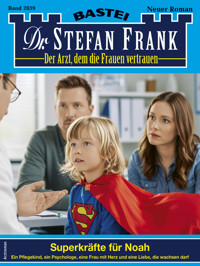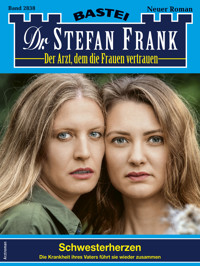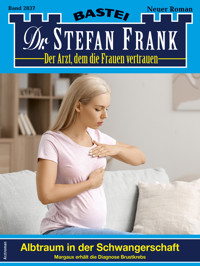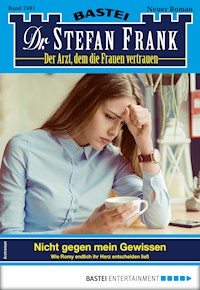
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dr. Stefan Frank
- Sprache: Deutsch
Nicht gegen mein Gewissen
Wie Romy endlich ihr Herz entscheiden ließ
Mit klopfendem Herzen steht Romy im Elternhaus ihres Freundes und lauscht. Hinter dem dicken Vorhang, der den abzweigenden Flur vor Zugluft schützt, erklingt Gemurmel. Das ist doch die Stimme ihres Freundes Severin, der sich mit seinem Vater unterhält! Die beiden betreiben eine seit Generationen bestehende Apotheke und haben oft geschäftlich miteinander zu reden. Aber dies hier klingt anders als ein normales Gespräch. Gedämpft und irgendwie angespannt. Trotzdem sind die Worte zu verstehen.
Nach und nach sickert ins Bewusstsein der jungen Frau, was sie hier hört - und das ist so ungeheuerlich, dass es ihr eiskalt den Rücken hinunterläuft!
Eines ist klar: Wenn sie mit diesem neuen Wissen an die Öffentlichkeit geht, dann sind Severin und sein Vater in großen Schwierigkeiten. Doch wenn sie es nicht tut, dann stehen womöglich Menschenleben auf dem Spiel ...
Liebe Leserinnen und Leser, welchem dunklen Geheimnis ist Romy auf die Spur gekommen? Wie wird sie mit diesem Wissen umgehen? Und was kann Dr. Frank tun, um der verunsicherten Frau zu helfen? Antworten auf all diese Fragen erhalten Sie in dem brandneuen Band der Bastei-Erfolgsserie "Dr. Stefan Frank".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Nicht gegen mein Gewissen
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabeder beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: HBRH / shutterstock
eBook-Produktion:3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 9-783-7325-7516-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Nicht gegen mein Gewissen
Wie Romy endlich ihr Herz entscheiden ließ
Mit klopfendem Herzen steht Romy im Elternhaus ihres Freundes und lauscht. Hinter dem dicken Vorhang, der den abzweigenden Flur vor Zugluft schützt, erklingt Gemurmel. Das ist doch die Stimme ihres Freundes Severin, der sich mit seinem Vater unterhält! Die beiden betreiben eine seit Generationen bestehende Apotheke und haben oft geschäftlich miteinander zu reden. Aber dies hier klingt anders als ein normales Gespräch. Gedämpft und irgendwie angespannt. Trotzdem sind die Worte zu verstehen.
Nach und nach sickert ins Bewusstsein der jungen Frau, was sie hier hört – und das ist so ungeheuerlich, dass es ihr eiskalt den Rücken hinunterläuft!
Eines ist klar: Wenn sie mit diesem neuen Wissen an die Öffentlichkeit geht, dann sind Severin und sein Vater in großen Schwierigkeiten. Doch wenn sie es nicht tut, dann stehen womöglich Menschenleben auf dem Spiel …
Der Blick aus dem Fenster war deprimierend und schön zugleich.
Deprimierend, weil das Fenster zu einem Raum im Souterrain gehörte – zu einem Stockwerk also, dass sich noch unter dem Erdgeschoss befand – und deshalb fast auf Bodenhöhe abschloss.
Wenn man vom Schreibtisch aus zu dem kleinen Fenster hinüberschaute, sah man praktisch direkt in Augenhöhe auf den Rasen, wo die Wurzeln einiger alter Bäume an manchen Stellen machtvoll durch den Boden gebrochen waren.
Wenn man hingegen in den Himmel schauen wollte, musste man entweder den Kopf fast auf die Schreibtischplatte legen oder ganz nahe an die kleine lukenartige Öffnung herantreten.
Erfreulich hingegen war, dass einige Meter weiter zur Straße hin die Osterglocken schon seit Tagen in voller Blüte standen und damit endgültig den Sieg des Frühlings über den Winter verkündeten; über diesen endlos grauen, kalten Winter, der Romys Stimmung in den letzten Wochen auf eine harte Probe gestellt hatte.
Denn auch wenn sie eigentlich kein Typ war, dessen Befindlichkeit in starkem Maße vom Wetter abhing, so war ihr das fehlende Tageslicht in der letzten Zeit doch arg aufs Gemüt geschlagen. Zumal es ja morgens noch lange Zeit dunkel oder zumindest dämmrig gewesen war, wenn sie in der Frühe ihre Wohnung verlassen musste, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Grünwald zu ihrer Arbeitsstelle zu fahren.
Erst in den letzten beiden Wochen nach der Zeitumstellung hatte die Sonne schon beim Verlassen ihres Hauses freundliche Strahlen auf sie herabgesandt, was Romy freilich nichts mehr nutzte, sobald sie die Tür zu ihrer Arbeitsstätte aufgeschlossen hatte. Denn in diesem Gemäuer war Tageslicht eine Rarität.
Romy Auer arbeitete in der Bereichsbibliothek des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin. Diese Einrichtung verfügte über etwa fünfundzwanzigtausend Bücher, dazu über fast vierzigtausend Sonderdrucke von alten medizinischen Abbildungen. Außerdem wurden hier die laufenden Ausgaben von mehr als dreißig medizinischen Zeitschriften gesammelt.
Was nach einem großen Bestand klang, war nicht wirklich viel – gemessen an der Hauptbibliothek der Universität, die über mehrere Millionen Bücher und weitere Medien wie CDs und Zeitschriften verfügte. Deshalb war Romy die einzige Bibliotheksmitarbeiterin hier am Institut.
Vor knapp einem Jahr war sie von einer kleinen Zweigstelle der Stadtbibliothek hierher gewechselt, wo man ihr statt einer halben Stelle eine ganze angeboten hatte.
Anfangs hatte sie sich sehr über den Wechsel gefreut, natürlich auch des Geldes wegen, da man von einer halben Stelle in München ja kaum leben konnte – schon gar nicht im schönen Grünwald. Aber das war nicht der einzige Grund gewesen.
Die Aussicht auf interessante Diskussionen mit den Studenten, Doktoranden und vielleicht sogar Professoren über die ethischen Aspekte der Medizin hatte sie ebenfalls gereizt, denn dieses Thema interessierte sie sehr.
Allerdings hatten die letzten Wochen und Monate sie dann doch herb enttäuscht, denn bei Weitem nicht alles hatte sich als so rosig entpuppt, wie Romy es sich in der ersten Phase ihrer Begeisterung ausgemalt hatte.
Angefangen bei der düsteren Stimmung, die das alte Gemäuer aufgrund der kleinen Fenster verbreitete, herrschte im gesamten Institut ein eher rauer Ton, auch wenn Romy hier unten davon zunächst gar nicht so viel mitbekommen hatte. Ja, eingangs war ihr nicht einmal aufgefallen, dass vor allem die Doktoranden, die sich hier Bücher für ihre Dissertationen ausliehen, häufig recht wortkarg wirkten.
Als sie aber dann den Leiter des Instituts, Prof. Dr. Hans Georg Hockenholtz, auf der ersten Mitarbeiterversammlung erlebt hatte, war sie fast vom Glauben abgefallen. War dieser cholerische und unbeherrschte Mann wirklich jener nette, ältere Herr, der sie beim Vorstellungsgespräch – wenn auch ein bisschen von oben herab – stolz über die große Bedeutung des Instituts aufgeklärt hatte?
Leider hatte es Romy im Anschluss an dieses Gespräch versäumt, sich ihren zukünftigen Arbeitsplatz schon mal im Voraus zeigen zu lassen – ein verhängnisvoller Fehler, den sie sicher nie wieder begehen würde. Sehr wahrscheinlich hätte sie dann nämlich ihren Stellenwechsel noch einmal überdacht.
So aber saß sie nun seit gut einem Dreivierteljahr in diesem dunklen Loch – in der „Gruft“, wie sie ihren Arbeitsplatz inzwischen nannte.
Worunter sie am allermeisten litt, war die Tatsache, dass sie hier unten fast den ganzen Tag lang völlig allein war und so gut wie keinen Kontakt zu den übrigen Institutsmitarbeitern hatte, die in den beiden Etagen über der Bibliothek ihre Dienstzimmer hatten. Die Zahl der täglichen Buchentleihungen hielt sich nämlich sehr in Grenzen.
Dabei war Romy eigentlich eine sehr kontaktfreudige Person. Klein und zierlich, mit brünetten Haaren, die sie meist zu einem wippenden Pferdeschwanz zusammengebunden hatte, und wachen blauen Augen, war sie normalerweise ein Ausbund an Lebenslust.
Durch ihre Lebhaftigkeit wirkte die Sechsundzwanzigjährige manchmal fast noch ein bisschen mädchenhaft.
In den düsteren Gemäuern hier schien ihr allerdings schon ein gehöriger Teil dieser lebhaften Ausstrahlung abhandengekommen zu sein.
Gerade schloss sie mit einer müden Handbewegung den Haupteingang auf. Sofort schlug ihr wieder der muffige, kellerartige Geruch entgegen. Schnell betätigte sie den Lichtschalter. Einige Augenblicke später flammte fahles Neonlicht auf, welches den tristen Gang, von dem die einzelnen Räume abgingen, nicht ganz ausleuchtete.
Romy trat in ihr Arbeitszimmer und schaltete auch hier das Licht und gleichzeitig den Computer ein. Als Nächstes öffnete sie das kleine Fenster.
Munteres Vogelgezwitscher drang in den Raum. Mehrere Meisen stritten sich in den alten Bäumen lautstark um winzige Krumen. Ein rostrotes Eichhörnchen sprang über den Rasen und huschte dann geschwind einen Baumstamm hinauf.
Direkt vor dem Fenster reckten sich ein paar zarte Löwenzahnblätter in die Höhe. Auch einige Brennnesseln waren schon gut zu erkennen und sogar die typischen runden Blätter des Gundermanns.
Endlich begann mit dem Frühling auch wieder die Heilpflanzensaison, und zwar genau mit jenen stärkenden und blutreinigenden Kräutern, die Mensch und Tier nach dem langen und kräftezehrenden Winter am meisten brauchten.
Wie klug die Natur doch war, wie weise sie für all ihre Geschöpfe sorgte! Romy lächelte versonnen und wandte sich dann dem Computer zu.
Heute stand wieder einmal das sogenannte Ansigeln auf dem Plan. Dabei musste der Buchbestand der Institutsbibliothek in den großen digitalen Katalog des Universitätsverbundes eingepflegt werden.
So arbeitete sie einige Zeit fort. Niemand störte sie, denn das Sommersemester hatte gerade angefangen, und überall liefen Eingangsveranstaltungen, die die meisten Studenten nicht versäumen wollten, weil hier die Modalitäten des Notenerwerbs für das kommende Semester geklärt und die Literaturlisten ausgegeben wurden.
Genau aus diesem Grund erwartete Romy heute in der Vorlesungspause einen kleinen Ansturm auf die Bibliothek, wie er allerdings nur zu Beginn eines jeden Semesters und auch nur kurzfristig auftrat.
Sie hatte von den Dozenten die Literaturlisten für deren Seminare natürlich schon einige Zeit zuvor erhalten und in der letzten Woche die sogenannten „Handapparate“ eingerichtet – besondere Regalreihen in der Nähe des Bibliothekseingangs, in denen die entsprechenden Bücher aufgestellt waren.
Die Bücher aus den Handapparaten durften nicht ausgeliehen werden, man konnte mit ihnen nur in der Bibliothek arbeiten. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass zumindest ein Exemplar des entsprechenden Titels auch wirklich immer vorhanden war.
Die meisten Studenten allerdings mochten die düsteren Räume der Institutsbibliothek ebenso wenig, sie liehen sich das entsprechende Buch lieber in der Hauptbibliothek aus.
Romy konnte dieses Verhalten gut nachvollziehen, aber es führte eben leider dazu, dass sie jeden Tag stundenlang allein hier herumsaß. Gerade am Nachtmittag blieb die Bibliothek meist menschenleer – vor allem jetzt, wo endlich der Frühling Einzug gehalten hatte.
Im Grunde, dachte Romy, fühlte sich dieser Arbeitsplatz an wie eine Einzelzelle im Gefängnis.
Lustlos wandte sie sich wieder ihrem Computer zu und nahm das nächste Buch vom Stapel.
***
Zur gleichen Zeit standen Hildegard und Alwin Breitenbach, jeweils ein Ohr an die Wand gepresst, in ihren ausgetretenen Filzschlappen auf dem weichen Teppich ihres Wohnzimmers und horchten angestrengt hinüber in die Nachbarwohnung.
Beiden zitterten vor Anstrengung die Knie, denn längeres Stehen in einer so angespannten Haltung waren sie in ihrem Alter nicht mehr gewohnt. Schließlich hatte jeder von ihnen schon die Achtzig überschritten.
„Hörst du es auch?“, fragte Hildegard und sah ihren Mann an.
„Pssst, sei doch mal ruhig!“, erwiderte Alwin Breitenbach und lauschte erneut nach drüben. „Ich hör nix“, sagte er schließlich.
„Doch!“, widersprach seine Frau und presste ihr Ohr noch einmal gegen die Wand. „Da ist was Komisches. So was Langgezogenes. Das bilde ich mir nicht ein. Haben Wigands neuerdings ein Kätzchen?“
Ratlos sahen sich die beiden Alten an. Eigentlich war es ein lustiges Bild, wie sie da so einträchtig in ihrer blümchentapezierten guten Stube nebeneinanderstanden und die Nachbarn zu belauschen versuchten.
Gleich nach ihrer Hochzeit waren sie in diese Wohnung gezogen, hatten ihr ganzes Leben hier verbracht und niemals auch nur an einen Umzug gedacht. Die Nachbarn hingegen hatten öfter mal gewechselt, waren ausgezogen oder gestorben; neue waren gekommen, und ganz langsam hatte sich der Charakter des Wohnviertels verändert.
Das fühlten Alwin und Hildegard Breitenbach sehr deutlich, denn noch immer nahmen sie rege Anteil am nachbarschaftlichen Leben. Zum Glück konnten sie sich noch vollständig selbst versorgen, warum also hätten sie sich nicht auch um ihre Mitmenschen kümmern sollen? Sehr viel anderes gab es ja nicht mehr zu tun.
Kinder waren ihnen leider versagt geblieben. Vielleicht auch deshalb achtete vor allem Hildegard interessiert und neugierig auf all die Kleinen in der Nachbarschaft und kümmerte sich um sie, wenn deren häufig alleinstehende Mütter arbeiten mussten. Im ganzen Viertel war Hildegard Breitenbach als hilfsbereite Ersatzoma bekannt, an die man sich im Notfall wenden konnte.
Seit einigen Jahren allerdings wohnte in der Wohnung direkt neben ihnen eine junge Frau, die von ihren hilfsbereiten Nachbarn partout nichts wissen wollte. Eingezogen war sie damals mit einem Mann und einem Baby. Bevor Breitenbachs ihre neuen Nachbarn aber richtig hatten kennenlernen können, war der Mann schon nicht mehr dagewesen – dafür aber nach kurzer Zeit ein anderer.
Wenig später hatte es bereits einen dritten Familienvater gegeben, kurz darauf einen vierten. Mit dem waren die Probleme dann richtig losgegangen, denn offensichtlich hatte er die junge Mutter wieder zum Drogenkonsum verführt, von dem sie nach Geburt des Babys mühselig losgekommen war.
Jedenfalls war seither immer wieder lautes Poltern aus der Nachbarwohnung gedrungen, oft genug mitten in der Nacht. Als sich in die heftigen Streitereien dann auch noch Kinderweinen gemischt hatte, waren Breitenbachs nicht länger untätig geblieben, sondern hatten das Jungendamt verständigt.
Die Beamten waren auch recht schnell gekommen und hatten das Kind – ein kleines blasses Mädchen namens Mona mit blonden Haaren und hübschen blauen Augen – erst einmal in staatliche Obhut genommen. Bei seiner mittlerweile völlig alkohol- und drogenabhängigen Mutter hatte es nicht mehr bleiben können. Diese hatte Besserung gelobt und sogar einen neuen Entzug begonnen.
Eine Zeitlang hatte sie sich tatsächlich sehr am Riemen gerissen und schließlich auch ihren dubiosen Lebensgefährten vor die Tür gesetzt. Aber schon kurze Zeit nachdem Mona wieder zu ihr hatte zurückkehren dürfen, war das Ganze von vorn losgegangen.
Das Jugendamt hatte erneut eingreifen müssen und die kleine Mona abermals in ein Heim gebracht. Wieder hatte die Mutter Besserung gelobt, und wieder hatte ein Richter nach einiger Zeit entschieden, dass das Mädchen im Interesse einer funktionierenden Mutter-Kind-Bindung nach Hause zurückkehren durfte.
Was er offensichtlich nicht in Betracht gezogen hatte, war, dass Monas Mutter lediglich am Kindergeld interessiert war, welches sie ja nur bekam, wenn das Mädchen tatsächlich bei ihr zu Hause lebte. Jedenfalls war vor einigen Monaten wieder einmal ein seltsamer Onkel in die Nachbarwohnung eingezogen. Er brachte Monas Mutter offenbar im Gegenzug für sexuelle Gefälligkeiten Alkohol und harte Drogen mit.
„Da! Ich höre es doch!“, sagte Hildegard Breitenbach in diesem Moment zu ihrem Mann Alwin und löste das Ohr von der Wand. „Also, ich gehe da jetzt rüber. Irgendwas stimmt doch da nicht!“
Sie griff nach dem Wohnungsschlüssel, trat hinaus in den Hausflur und klingelte energisch an der nachbarlichen Wohnung. Hinter der Tür wurde ein schwaches Geräusch hörbar.
„Hallooooo“, rief Hildegard Breitenbach laut und klopfte an der Wohnungstür. „Frau Wiegand? Sind Sie zu Hause?“
„Nein“, erklang ein schwaches Stimmchen hinter der Wohnungstür. „Ich bin ganz allein.“
„Bist du das, Mona?“, fragte Hildegard zurück. Fünf oder sechs Jahre alt musste die Kleine jetzt sein. „Wo ist denn deine Mama? Sag mal, machst du uns mal die Tür auf? Du kennst uns doch, wir sind Oma Hildegard und Opa Alwin von nebenan.“
„Ich kann nicht“, kam es leise zurück. „Die Tür ist abgeschlossen.“
„Was? Die Tür ist zugesperrt?“ Erschrocken drehte sich Hildegard zu Alwin um, der inzwischen auch in den Hausflur getreten war. „Du bist ganz allein in einer verschlossenen Wohnung? Hast du denn keinen Schlüssel?“
„Nein.“ Das Kind hinter der Tür begann zu schluchzen. „Ich hab so Hunger, und es ist nichts mehr im Kühlschrank.“
„Du hast Hunger?“, fragte Hildegard entgeistert. „Wie lange bist du denn schon allein?“
„Ich weiß nicht“, kam es zögernd zurück. „Es war dunkel und hell und wieder dunkel. Und jetzt ist es wieder hell.“
„Um Gottes willen!“, sagte Hildegard entsetzt und wandte sich erneut zu ihrem Mann um. „Hol sofort das Telefon, Alwin, und ruf die Polizei. Die Kleine ist schon seit Tagen dort eingeschlossen!“ Sie schüttelte fassungslos den Kopf. „Deshalb also war es die ganze Zeit so ruhig. Und ich dachte schon, es hätte sich endlich was gebessert.“