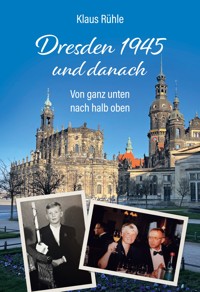
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Es gibt Ereignisse, die exemplarisch sind für ihre Zeit. Im Zweiten Weltkrieg war dies die Bombardierung und fast vollständige Auslöschung Dresdens am 13. und 14. Februar 1945. Dieses Ereignis prägte das Leben der Menschen, die davon Zeuge wurden. Klaus Rühle wurde 1941 in Dresden geboren. Er überlebte das Bombeninferno in einem Luftschutzkeller zusammen mit seinem kleinen Bruder Uwe und seiner Mutter Margareta. Er lernte beide deutschen Staaten kennen, nutzte mit großer Eigeninitiative die Bildungschancen und beschreibt den westdeutschen wirtschaftlichen Aufstieg und den eigenen Aufstieg aus dem Arbeitermilieu mit dem wachen Blick des "Wanderers" zwischen diesen sehr unterschiedlichen Welten, aber auch mit der Fähigkeit, sich schnell in unterschiedlichsten Milieus zurechtzufinden. Seine Kindheit unter der sowjetischen Besatzungsmacht im zerstörten Dresden war von Hunger geprägt. Die Mutter erkrankte, weswegen Klaus in Kinderheimen untergebracht wurde, wo er seelische Grausamkeit erfuhr. Die zweite Republikflucht im Sommer 1954 führte die Familie in Westdeutschland mit dem Vater zusammen. Klaus absolvierte eine Landwirtschaftslehre, machte das Abitur und studierte Landwirtschaft in Bonn. Als Agrarwissenschaftler mit Promotion wurde er in der chemischen Industrie eingestellt. Die Leser werfen hier einen intimen Blick hinter die Fassaden eines Weltkonzerns. Die Arbeit in der Industrie forderte von ihm vollen Einsatz unter einer zunächst sehr ungünstigen Chefkonstellation, doch seine Familie gab ihm Kraft. Nach einem Austausch der Führungsgarde kam wieder mehr Menschlichkeit in die Firma. Der Autor möchte mit diesen autobiografischen Erzählungen vor allem jungen Menschen, die in der Ausbildung sind, Mut machen, nie aufzugeben. Es gibt immer ein Licht am Ende eines Tunnels. Für Klaus Rühle war das Ziel der Aufstieg aus der Arbeiterklasse ins mittlere Management. Es hat ihm Freude gemacht, dieses Ziel zu erreichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gewidmet sei dieses Buch von ganzem Herzen mit Dank posthum meiner geliebten Frau Ingrid für ihre Liebe und Lebenshilfe, die sie uns über viele Jahrzehnte geschenkt hat. Stolz bin ich auf meine drei Kinder und acht Enkelkinder. Ich wünsche ihnen, dass sie das Leben lieben und es genießen, niemals verzagen und nie aufgeben.
Inhalt
Vorwort
Die Zerstörung Dresdens – Eine traumatische Erfahrung
Erste Jahre in Dresden – Ein Blick zurück
Fringsen
Unser Domizil gegenüber der Yenidze
Ein Blick zurück
Typhuserkrankung – Noch mal Glück gehabt
Grundschule und meine Jahre als Heimkind
Einschulung in die 48. Grundschule in Dresden-Friedrichstadt
Ein weiterer Schicksalsschlag – Mutter erkrankt schwer
Jauernick, DDR – Meine erste Station als Heimkind
Zweite Heimstation in Dresden
Dritte Heimstation in Hamm in Westfalen, Waisenhaus Vorsterhausen
Frust
Vierte Station: das Schwesternhaus in Heessen
Zurück in Dresden – Jugendstreiche, tolldreiste Geschichten, Freizeitaktivitäten
Unsere Volksschullehrer
Gefährliche Hunde? Beobachtung vom Klassenfenster aus
Marktplatz mit Obst (Mundraub)
Birnenklau
Erdbeer- und Kirschenklau
am Schloss Pillnitz und die Kreuzotter
Das alte Bahnerhäuschen gegenüber der Yenidze
Schrebergärten mit nachfolgendem Kinobesuch
Kinobesuche mal „schwarz“
In die Unterwelt
Heinz-Steyer-Stadion
Weitere Freizeitaktivitäten
Der Fund
1950: Misslungener Fluchtversuch
17.6.1953: Arbeiteraufstand in Dresden
Das Lotte-Rotholz-Heim in Radebeul und die zweite Republikflucht
Das Leben im Westen – Heessen in Westfalen
Schämen musste ich mich fast nie, aber kämpfen – Meine Grundschulzeit im Westen
Schlag mit Folgen
Körperstrafe – Züchtigung durch Prügel
Finanzierung von Klassenfahrten
Zeugnisse und andere Leistungsnachweise
Briefmarkenverkauf
Sonstige „Auswüchse“
Turnunterricht einmal anders
Zwei böse Klassenkameraden
Zubrot Kartoffelernte
Abschied vom Klassenlehrer und von der Volksschule
Unheilvolle Erfahrungen als Tischlerlehrling
Jugendsünde
Von der Hobelbank zur Farm
Flatteritis
Besuch bei den Damen
Kreissägen mit Folgen
Hengstfohlen, geboren in freier Natur
Rattennester im Getreidepansen
Hähnchen köpfen
Erstes eigenes Domizil
Rote Rosen für Maria
Die Gebärmutter
Abschied vom Betrieb/Wie geht es weiter?
Arbeitszeugnis
Jahrzehnte später
Der Gemischtbetrieb in Diestedde
Allgäuer Handmelkmethode
Einmal im Monat ins Kino – wenn der Film nicht auf dem katholischen Index war
Militärisch ausgerichtete Fahrschule
Zwei besondere Ereignisse in der Fahrschule
Deckbullen und künstliche Besamung
Messen und Exerzitien
Der Pferdeflüsterer, erste Berufserfahrung mit Pferden
Reitunterricht bei einem Rittmeister
Maiausritte und Wettbewerbe zu Pferde
Fuchsmajor
Mobile Tanzschule im Dorf
Kirchenchor mit Folgen – Namenstag
Gehilfenprüfung und Bewerbung
Schwarzbuntzuchtbetrieb
Bullenoperation
Erfahrungen mit Häftlingen
Ponyhengstkastration
Letzter Deckakt
Tätigkeit als Milchkontrollassistent
Das Seminar
Aufgabenbereich
Milchfettbestimmung
Fristlose Kündigung des Vorgängers
Tierauktionen: Rinder, Kühe, Kälber, Bullen
Staatlich geprüfter Klauenpfleger
Erster Auftrag
Zuchtrinderexport nach Tunesien
Geburten und Entsorgung der Nachgeburten auf der Fahrt
Vierzehn Tage zwangsweise in Chiasso
Übernachtung im Erste-Klasse-Wartesaal
Von Genua nach Tunis per Frachtschiff
Die Versuchsfarm im Medjerda-Tal –
Wir erkunden Land und Leute
Ein orientalischer Puff
Karthago
Der Journalist aus Ostberlin
Heimreise über Palermo und Rom – Frisörbesuch in Rom
Ein bestialischer Mord im Milchkontrollbezirk
Ereignisse aus jüngster Zeit
Militärdienst bei den Feldjägern
Feldjägerausbildungskompanie 444
Kubakrise
Ausbildung zum Feldjäger
Sanitäts- und Hygieneunterricht
Juni bis August 1963: Uffz.-Lehrgang in Sonthofen
Körper trifft Geist – Atombusen-Lilly trifft Schachspieler
Die Schleifer: Umsteigen, am Schießstand, im Gelände, im Manöver
In der Polizeizelle
Dienst am Flughafen Langenhagen und auf dem Fliegerhorst Wunstorf
Vier Abgänge
Die Wende
Die Michelsenschule in Hildesheim
Von Lehrern, Vermieterinnen, einem speziellen Wirt und Zimmerkollegen
Meine geliebte Frau Ingrid
Hannover, Dortmund, Hildesheim/Himmelsthür
Bonn, St. Augustin-Hangelar, auf dem Niederberg
Burscheid im Rheinisch-Bergischen Kreis
In wilder Ehe leben? Wir heiraten
Was ist Glück? Kann das Glück immerwährend sein?
Die Krankheit
Ausblick
Nachtrag
Das große Ziel: Reifezeugnis im Juni 1967
Eintritt in die gymnasiale Oberstufe und Heirat
Broterwerb in Hildesheim vor dem Studium
Studienjahre in Bonn
Umzug von Himmelsthür nach Hangelar-Niederberg bei Bonn
Studieren als Arbeiterkind
Vorlesungsskripte: Anfertigen und Vermarkten
Professoren, Prüfungen, Studentenvertreter, 68er-Bewegung
Die Promotion
Bewerbungen und erste Berufserfahrungen als Akademiker
Verantwortlichkeit, Aufgabengebiete leitender Angestellter
Erste große Enttäuschung in der Firma
Vorgesetzte: Die kleinen Chefs
Neuseeland, September bis Dezember 1981
Charakteristika eines Psychopathen
Vorgesetzte: Die großen Chefs
Der Kaiser von China
Die Intrige
Tragischer Suizid
Wandel durch Wechsel – Die neue obere Führungsgarde mit mehr Menschlichkeit
Beförderung
Projektarbeit
Plagiatsskandale und „Dieselgate“
Von Kolleginnen und Kollegen
Freundschaften in der Firma
Unsere Bosse – Charakteristika
Familie, Selbstkritik, Ausblick
Anhang
Vorwort
„Doppelt lebt, wer auch Vergangenes genießt.“Marcus Valerius Martialis (40–104 n. Chr.), römischer Dichter
Schon lange trug ich die Idee zu diesem Buch in mir, genauer entstand sie nach der langjährigen Pflege meiner Frau daheim und ihrem Tod im Mai 2019. Seinen Ausgang nehmen sollten die darin geschilderten Ereignisse bei der fürchterlichen Zerstörung der einst schönsten Stadt Deutschlands, der Barockstadt, dem Elbflorenz Dresden, meiner Geburtsstadt, am 13.02.1945. Mittendrin in diesem Inferno habe ich damals als Dreieinhalbjähriger in der Altstadt traumatische Erfahrungen durchlebt, die ich nie vergessen werde. Ich schrieb mir ab dem 13.02.2020 die Probleme, die Erfahrungen, all die Höhen und Tiefen meines Lebens von der Seele. Sie sind in diesem Buch versammelt. Erzählt werden außergewöhnliche Geschichten, inspirierende Figuren, nachahmenswerte Charaktere, aber auch faktengetreu abscheuliche Ereignisse, wenn auch mit einem gewissen Maß an literarischer Freiheit.
Meine Kindheit war geprägt von der Liebe meiner Mutter Margareta und der meiner Großmutter Martha. Die Mutter erkrankte schwer, nachdem sie bei den Siegermächten, den Russen auf dem Schlachthof in Dresden-Friedrichstadt später bei den Verkehrsbetrieben der Stadt Dresden tätig gewesen war, zuerst als Schaffnerin, danach als Straßenbahnfahrerin. Da die Mutter erkrankte, uns nicht mehr versorgen konnte, betreute die Oma meinen kleinen Bruder, den Säugling Uwe, während ich, als quirliger Junge, ins Kinderheim musste. Insgesamt war ich vom 5. bis zum 13. Lebensjahr in fünf Kinderheimen, davon drei im Osten und zwei im Westen Deutschlands. An die katholischen Heime habe ich überwiegend negative Erinnerungen, bis hin zu den dort erfahrenen seelischen Grausamkeiten. Lediglich im Katholischen Schwesternhaus in Heessen in Westfalen fühlte ich mich wohl. Dort wurde ich von einer Sozialschwester gut versorgt. Ich war immer ein Kämpfer, musste mich oft behaupten, ja durchkämpfen. Bei Angriffen zu wehren, wusste ich mich, so weit das möglich war. In die Familie einer Arbeiterklasse hineingeboren, wo kein Gold in die Wiege gelegt wurde, erfuhr ich bald, dass auf den Köpfen der Schwächeren die Macht der Stärkeren, der Überlegenen ausgeübt wird.
Unsere erste versuchte Republikflucht im Jahr 1950 misslang. 1954 gelang es Mutti, mit mir und Uwe, aus der DDR zu fliehen. Es ging in den „Goldenen Westen“, der aber gar nicht so golden war. Zunächst fuhren wir mit der Bahn zu Tante Erni, der Schwester unserer Mutter, nach Braunschweig und von dort weiter ins westfälische Heessen. Die Familienzusammenführung funktionierte. Doch mir als Flüchtling fiel die Integration in die neue Heimat sowie die lokale katholische Grundschule schwer. Aber bald war ich Teil der Schülergemeinschaft der Klasse 13, war also integriert. Nach einer geschmissenen Tischlerlehre bei dem Ausbeutermeister Heinrich Timmermann aus Schlesien – nach einem tätlichen Angriff auf mich, den dreizehneinhalbjährigen Tischlerlehrling – wurde das Lehrverhältnis aufgelöst. Der Tischlermeister wurde schuldig gesprochen, doch eine Entschädigung erhielten wir nicht. Der Meister durfte nur drei Jahre lang keine Lehrlinge ausbilden, das war’s. Von der Hobelbank ging es für mich in einen bäuerlichen Betrieb, wo ich als Stadtmensch die Natur und die Liebe zur Landwirtschaft entdeckte.
Und wieder war es der Weitblick der Mutter, die sich erkundigt hatte und mich diese Ausbildung absolvieren ließ. Ich absolvierte erfolgreich eine Landwirtschaftslehre, wurde Milchkontrollassistent, dann Angestellter beim Milchkontrollverband Westfalen-Lippe in Münster. Nach der Bundeswehrzeit besuchte ich als „Quereinsteiger“ die Berufsaufbauschulklasse an der Höheren Landbauschule, der Michelsenschule in Hildesheim, mit den Abschlüssen der Mittleren Reife und staatlich geprüfter Landwirt. Danach wechselte ich in die Gymnasialabteilung mit dem Abschluss der erfolgreichen Allgemeinen Hochschulreife, wobei mir meine Verlobte Ingrid in den harten, langen Ausbildungszeiten über den zweiten Bildungsweg immer mit Rat und Tat treu zur Seite stand. Finanziell unterstützte sie mich. Wir heirateten 1966 und danach begann ich ein Studium der Agrarwissenschaften in Bonn, das ich 1975 mit einer Dissertation abschloss. So konnte ich mich als frisch gebackener Dr. Dipl.-Ing. agr. in der chemischen Industrie als landwirtschaftlicher Berater bewerben, wo ich nach der Probezeit von einem Jahr als leitender wissenschaftlicher Angestellter übernommen wurde.
Aus einer Arbeiterfamilie in Dresden stammend war ich als Republikflüchtling fremd und mittellos in den Westen gekommen. Nach den ersten negativen Berufserfahrungen hatte ich das unverbrüchliche Verlangen, eine höhere Ausbildung zu beginnen und abzuschließen. Willensstark und mit einer Art innerem Brennen wollte ich in eine höhere Liga aufsteigen, hart arbeiten, mehr Verantwortung übernehmen und größeren finanziellen Spielraum haben. Es war ein langer Weg bis ins mittlere Management. Ich war der Erste in unserer Familie mit Abitur und Hochschulausbildung. Darauf waren meine Frau Ingrid, meine Eltern und meine Schwiegereltern stolz. Sie alle unterstützten mich, wie eine große Familie mit Zusammenhalt das tut, so weit es ihnen möglich war. Daher möchte ich ihnen allen posthum einen großen Dank aussprechen, besonders meiner lieben Frau Ingrid. Sie war es auch, die unseren drei Kindern so vieles auf ihren Lebenswegen mitgegeben hat, dass sie sich erfolgreich im Leben und im Beruf behaupten können. In unserer Familie konnten sie in ihrer Kindheit Wurzeln schlagen, später gaben wir, speziell Ingrid, ihnen Flügel, selbstständig zu werden.
Ich fragte mich oft, ob sich die Mühen und Entbehrungen einer langen höheren Ausbildung über den zweiten Bildungsweg und eines dreißigjährigen Berufslebens gelohnt haben. Alles hat seinen Preis, und wo gehobelt wird, da fallen Späne. Die Qual des Aufstiegs zeigt nicht den Preis, der dafür gezahlt wird. Dennoch komme ich zu der Schlussfolgerung: Ja, es hat sich gelohnt. Es ließ sich aber nur erreichen mit viel Ausdauer, Willenskraft, Durchhaltevermögen, Fleiß und der Stärke, den Druck der Gesellschaft in der Hierarchie des Berufslebens auszuhalten. Ab und zu kam ein Moment, in dem ich vieles infrage gestellt habe. Mein Motto war stets: nie aufgeben.
Das Vergangene durchlebte ich wieder beim gedanklichen Eintauchen und Schreiben dieser Biografie: Das Vergangene ist nicht tot, es lebt in uns fort. Berichtet wird über die Zeitgeschichte von 1941 bis 2022. Es geht dabei nicht um die absolute Wahrheit, sondern um meine Wahrheit, wie ich sie erlebt habe. Dabei habe ich nicht vor, Zeitgenossen zu brüskieren. Nicht zu vergessen ist, dass Erinnerung sich verändert, ja fehlerhaft sein kann. Was von mir vor Jahrzehnten, vor zwanzig, vierzig und mehr Jahren erlebt worden ist, stellt sich heute gegebenenfalls ganz anders dar. Und so bitte ich die Leser, mir ein gewisses Maß an literarischer Freiheit zuzugestehen. Auch dort, wo der Autor den Leser hinter die glitzernden Fassaden eines Weltkonzerns blicken lässt. Und das aus eigener Erfahrung.
Seit Mai 2019, nach dem Tode meiner Frau, wohne ich allein in meinem Haus. Meine erwachsenen drei Kinder mit Familien und meine acht Enkelkinder sind mir eine große Freude und Stütze. Dieses Glück hat nicht jeder. Das schätze ich sehr und bin dankbar dafür. Ich bin frei, unabhängig, habe keine Angst und erwarte fast nichts – nur hoffe ich, dass ich nicht schwer erkranke, mich nicht mehr selbst versorgen kann. Und dass es meiner Großfamilie weiterhin gut geht.
Wenn ich Jugendliche und einige Erwachsene mit der Kraft dieser Worte und meiner früheren immerwährend unruhigen Psyche erreiche, ihnen damit Mut und Ansporn zum Erreichen ihrer Ziele vermitteln kann, so würde ich mich sehr freuen. Die Lebensqualität, die Gründung und Pflege einer Familie sollte bei allem Ehrgeiz im Erwerbsleben möglichst nie vernachlässigt werden. Hier setzt die Selbstkritik des Autors ein. Die Deutungshoheit der Ausführungen liegt beim Leser, der sich ein Bild von dessen Leben und Lebenszielen bilden kann.
Die Menschen in diesem Buch gibt oder gab es wirklich. Die Namen von Persönlichkeiten, von Landwirten, Handwerkern, Lehrern, Mitschülern, Vermieterinnen, Professoren, Vorgesetzten, Kollegen und Kolleginnen sowie anderer Zeitgenossen, die in diesem Roman erwähnt werden, wurden weitgehend anonymisiert. Das heißt, ihre Namen wurden verfremdet, geändert, um deren Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte zu schützen.
Die Zerstörung Dresdens – Eine traumatische Erfahrung
13.02.1945: Ein Krachen, Feuerschein, herzzerreißende Angstschreie und immer wieder ein Donnerhall nach dem anderen. Nichts als Chaos um mich herum. Im ersten Moment weiß ich nicht, wie mir geschieht. Ich fühle mich mutterseelenallein und habe fürchterliche Angst. Was ist geschehen? – Ich kann mich noch an diese Schrecksekunden oder -minuten in Todesangst erinnern, die sich damals gegen 22 Uhr in Dresden im Hause an der Falkenbrücke ereigneten, wo wir zur Miete wohnten, meine Mutter mit ihren beiden Söhnen, dem Säugling Uwe und mir. Ein traumatisches Erlebnis. Ich war damals ein dreieinhalb Jahre alter Junge und stand im Flur des besagten Hauses. Die Mutter mit dem erst vier Monate alten Säugling Uwe auf dem Arm war unmittelbar in der Nähe. Sie sagte zu mir: „Klaus, bleib hier stehen. Ich muss noch einmal nach oben in die Wohnung etwas holen. Geh auf keinen Fall weg!“ Menschen liefen angstvoll und in Panik im Hause umher. Ihr Ziel war der Luftschutzkeller. Auch von draußen, wo es dunkel war, wehten überaus angstvolle Stimmen herein. Wieder und wieder ein Feuerschein nach dem anderen. Alles wurde immer wieder blitzschnell hell erleuchtet und es krachte fürchterlich. Menschen schrien vor Todesangst. Mich überkam eine riesengroße Angst. Wo war die Mutti? Ich fühlte mich buchstäblich mutterseelenallein. Ich erinnere mich: Mit der linken Hand hielt ich ein Federbett fest, das auf dem Hausflurboden lag. In der rechten hielt ich eine braun emaillierte Milchkanne mit einem Bügel und rundem Holzhandgriff. Ja, die rechteckige Form und die Farbe der Bodenfliesen sind mir noch in Erinnerung. Die Fliesen waren schachbrettartig diagonal verlegt, schwarze und weiße. Die Mutter kam mit dem Bruder Uwe zurück. Wir müssen wohl gemeinsam in den Luftschutzkeller geflüchtet sein. An das, was sich dann ereignete, kann ich mich nicht erinnern, noch nicht einmal an den Bombenalarm und die weiteren Bombenexplosionen.
Es war spätabends am 13.02.1945. Wie ich später erfuhr und über die Zerstörung Dresdens gelesen habe, fand in diesem Moment der erste angloamerikanische Bombenangriff statt, der die einstmals schönste Stadt Deutschlands, das sogenannte Elbflorenz, meine Geburtsstadt, in Schutt und Asche legte. Die Familie hatte überaus großes Glück. Ich überlebte mit meinem kleinen Bruder Uwe und meiner Mutter Margareta das Bombeninferno im Keller des Hauses an der Falkenbrücke, in dem wir wohnten, inmitten des Stadtzentrums, nicht weit vom Dresdner Hauptbahnhof und der Altstadt entfernt. Praktisch alle Gebäude im Stadtzentrum mit der Altstadt wurden zerstört, größtenteils „wegrasiert“, nur einige Keller nicht. Und in einem davon überlebten wir die großen Fliegerangriffe mit den flächendeckenden Bombardements.
Nur wenige Sekunden oder Minuten mag diese Szene angedauert haben, in der ich mich den schrecklichen Ereignissen ausgeliefert sah, ohne Mutter, schutzlos, völlig hilflos, vor der Flucht in den schützenden Luftschutzkeller überfiel mich Angst, ein Gefühl des Alleinseins, des Ausgeliefertseins. Dieses Szenario brannte sich förmlich in mein Hirn ein. Es war ein Trauma, das ich mein Leben lang nicht habe bewältigen können. Alle anderen Szenen und Erinnerungen, die anschließenden wellenförmigen Bombenangriffe, das Leben und Überleben im Keller und Erinnerungen an die folgende Zeitspanne waren später weg, verdrängt oder ausgelöscht.
In dieser Nacht vom 13. auf den 14.02.1945, in der die angloamerikanische Luftwaffe in einem verheerenden Bombardement das zuvor weitgehend verschonte Dresden zerstörte, starben mindestens 25 000 Menschen1, weltberühmte Bauwerke, fast die gesamte Innenstadt und zahlreiche Wohngebiete gingen im Feuersturm unter. Für die Dresdner ist der 13. Februar bis heute das traumatische Datum ihrer Stadtgeschichte geblieben. Und für mich war es ebenfalls ein traumatisches Erlebnis, das ich nie vergessen habe und das zu posttraumatischen Belastungsstörungen führte.
Notat 1: Die Bombenangriffe
Die Zerstörung Dresdens und des Umlandes begann schon 1944 im Zuge des Zweiten Weltkrieges. Die ersten Luftangriffe erfolgten am 24.08.1944. Ziel waren die Industrieanlagen in Freital (Mineralölwerk) und Gittersee. In seinen mit authentischem Bildmaterial reich ausgestatteten Büchern beschreibt der in Dresden aufgewachsene Autor Matthias Gretzschel die Vorgeschichte des Bombenkriegs und die Chronologie2der Luftangriffe wie folgt:
24.08.1944: Industrieanlagen in Freital-Birkigt (Mineralölwerk) und GitterseeUSAAF
7.10.1944: Friedrichstadt (Güterbahnhof, Industrie, Hafen)USAAF
16.01.1945: Tagesangriff auf den Bahnhof Friedrichstadt (auch Cotta, Löbtau und Leutewitz getroffen)USAAF
13.02.1945: 22:03 Uhr Beginn des Nachtangriffs mit Abwurf von „Christbäumen“ und Zielmarkierungen, 22:13 bis 22:28 Uhr Abwurf von 900 Tonnen Spreng- und BrandbombenRAF
14.02.1945: 1:23 Uhr bis 1:54 Uhr: Zweite Angriffswelle mit 1500 Tonnen BrandbombenRAF
14.02.1945: 12:17 bis 12:31 Uhr Tagesangriff mit Abwurf von 474,5 Tonnen Spreng- und 296,5 Tonnen BrandbombenUSAAF
15.02.1945: 11:51 bis 12:01 Uhr weiterer Tagesangriff mit 460 Tonnen Bomben, verstreut auf das Gebiet zwischen Meißen und Pirna.USAAF
02.03.1945: Bahnanlagen in Friedrichstadt und Neustadt und umliegende Bebauung (853 Tonnen Spreng- und 127 Tonnen Brandbomben).USAAF
17.04.1945: Tagesangriff mit 1500 Tonnen Spreng- und 164 Tonnen Brandbomben; Zerstörung von Hauptbahnhof, Neustädter Bahnhof und Bahnhof Friedrichstadt; mindestens 450 Tote.USAAF
In der Literatur sind diese verheerenden Auswirkungen sehr gut dokumentiert. Dresden wie auch viele andere deutsche Städte wurden von einem hohen Kultur- und Versorgungsstand zurück auf das Niveau des Mittelalters gebombt. Einen Eindruck von der enormen Zerstörung vermitteln Fotos , die den Blick vom Turm der Kreuzkirche auf die durch Luftangriffe zerstörte Innenstadt Dresdens und vom Rathausturm zeigen, wie er sich 1945 darbot (siehe die Abbildungen 1, 2 und 3 im Anhang).
Notat 2: Erste Angriffswelle in der Nacht vom 13. zum 14.02.1945
Am 13. Februar 1945, dem Faschingsdienstag, wurde um 21:45 Uhr in Dresden der 175. Fliegeralarm ausgelöst. Die Menschen begaben sich in die Keller ihrer Häuser oder Wohnblocks und in die wenigen vorhandenen Luftschutzbunker. Die Angriffe begannen bei aufgeklartem, wolkenlosem Nachthimmel. Um 22:03 Uhr wurde die Innenstadt von Lancaster-Bombern der No. 83 Squadron, einer „Pfadfinder“-Einheit, mit Magnesium-Lichtkaskaden („Christbäumen“) ausgeleuchtet, zwei Minuten darauf warfen neun britische Mosquitos rote Zielmarkierungen auf das gut sichtbare Stadion am Ostragehege nordwestlich des Stadtkerns (Heinz-Steyer-Stadion). Von 22:13 bis 22:28 Uhr fielen die ersten Bomben. 244 britische Lancaster-Bomber der No. 5 Bomber Group zerstörten die Gebäude mit 529 Luftminen und 1800 Spreng- und Brandbomben mit insgesamt 900 Tonnen Gewicht. Sie gingen südwestlich des Zielpunktes in einem 45-Grad-Fächer zwischen der großen Elbschleife im Westen der Stadt, dem industriell bebauten Ostragehege (heute Messegelände) und dem etwa 2,5 Kilometer Luftlinie entfernten Hauptbahnhof nieder. In diesen 15 Minuten wurden drei Viertel der Dresdner Altstadt in Brand gesetzt. Gezielte Treffer einzelner Gebäude waren bei diesen Nachtangriffen der RAF weder beabsichtigt noch möglich. Vielmehr sollte ein Bombenteppich die gesamte Innenstadt großflächig zerstören. Die Flammen der brennenden Innenstadt nach der ersten Angriffswelle waren in weitem Umkreis am Himmel zu sehen. Manche Brände loderten noch vier Tage lang.
Notat 3: Zweite Angriffswelle in der Nacht des 14. zum 15.02.1945
Um 1:23 Uhr begann die zweite Angriffswelle mit 529 britischen Lancaster-Bombern der Gruppen No. 1, No. 3 und No. 8 der Royal Air Force sowie der Gruppe No. 6 der kanadischen Luftwaffe. Sie warfen bis 1:54 Uhr insgesamt 650.000 Stabbrandbomben – 1500 Tonnen – über einem Gebiet von Löbtau bis Blasewitz und von der Neustadt bis Zschertnitz ab. Die von der ersten Angriffswelle verursachten Brände dienten nach Augenzeugenberichten britischer Fliegerbesatzungen zur Orientierung für die nachfolgenden Bomber. Ihre Bomben trafen auch die Elbwiesen und den Großen Garten, wohin viele Dresdner nach der ersten Welle geflüchtet waren. Die Frauenklinik Pfotenhauerstraße des Stadtkrankenhauses Dresden-Johannstadt und die Diakonissenanstalt in der Neustadt wurden schwer beschädigt. Beide Bombardements betrafen ein Stadtgebiet von etwa 15 Quadratkilometern. Diese zweite Angriffswelle zerstörte die Technik der ausgerückten Feuerschutzpolizei und verhinderte weitere Löschaktionen, sodass sich die zahlreichen Einzelfeuer rasch zu einem orkanartigen Feuersturm vereinten. Diese zerstörten ganze Straßenzüge. In der extremen Hitze schmolzen Glas und Metall. Der starke Luftsog wirbelte größere Gegenstände und Menschen umher oder zog sie ins Feuer hinein. Sie verbrannten, starben durch Hitzeschock und Luftdruck oder erstickten in den Luftschutzkellern an Brandgasen. Wer sich ins Freie retten konnte, war auch dort dem Feuersturm und den detonierenden Bomben ausgesetzt.3
Meine Oma Martha erzählte mir als Kind, dass sie gerade an den Augen operiert worden war. Sie hatte noch einen Verband und versuchte, sich aus der brennenden Klinik ans Elbufer zu retten. Sie hat überlebt.
In Deutschland ist bekannt, dass viele Menschen die Narben des Zweiten Weltkriegs noch viele Jahrzehnte später in ihrem Inneren gespürt haben. Diese enormen Flächenbombardements auf deutsche Städte haben tiefe Wunden in die Psyche der betroffenen Zivilisten, vor allem der Kinder, geschlagen, die noch sieben Jahrzehnte später nicht verheilt waren.
1 Ursprünglich gab das DRK, u. a. unter Berücksichtigung der 200 000 Flüchtlinge in Dresden aus den deutschen Ostgebieten, 275 000 Tote an. Eine Zahl, die etwa 10 Prozent dieser Anzahl entspricht, hat eine Historikerkommission im Jahr 2018 nach intensiven Recherchen festgelegt.
2 Matthias Gretzschel: Als Dresden im Feuersturm versank. Siehe auch Wikipedia: Dresden. USAAF: Angriff der amerikanischen United States Air Force; RAF: Angriff der britischen Royal Air Force.
3 Gerhard Hauptmann hat sehr treffend seine Gefühle bei der Zerstörung und Ansicht der Stadt ausgedrückt: „Wer das Weinen verlernt hat, lernt es wieder beim Untergang Dresdens (Ich stehe am Ausgangstor meines Lebens und beneide meine toten Geisteskameraden, denen dieses Erlebnis erspart geblieben ist).“ Notiert habe ich dies während unseres Besuchs in Dresden mit Rathausturmbesichtigung und der dortigen Ausstellung am 10.09.2002.
Erste Jahre in Dresden – Ein Blick zurück
Ich erinnere mich. Nachdem wir in der Falkenbrücke ausgebombt worden waren, wurde uns eine kleine Wohnung in Dresden-Friedrichstadt zugewiesen: Weißeritzstraße 2b, Parterre rechts, zur Straßenseite hin, gegenüber dem großen Kühlhaus. Schräg gegenüber an der Straßenkreuzung befand sich die zerstörte Yenidze. Unsere kleine Dreizimmerwohnung lag rechts vom Hausflur; sie war durchgehend von der Straße bis zum kleinen Hinterhof. Schätzungsweise betrug die Wohnfläche 50 Quadratmeter. Sie bestand aus einem kleinen Flur, links hinter der Eingangstür befand sich die Toilette, damals schon mit Wasserspülung ausgestattet. Der Wasserbehälter aus Gusseisen befand sich oben an der Wand unter der Decke. Die Spülung wurde mechanisch ausgelöst durch den Zug an einer Gliederkette, an deren Ende sich ein porzellanartiger rundlich-länglicher Griff befand. Rechts neben dem Flur war ein kleines Zimmer, in dem unsere Oma Martha lebte, daneben das etwas größere Wohnzimmer mit zwei Fenstern, links daneben ein kleines Schlafzimmer mit einem Fenster. Die Wände waren einfach gekalkt, mit einem schwachfarbigen Muster versehen, aufgebracht wahrscheinlich mit einer Gummiwalze. Tapeten waren damals Mangelware. Die Holzfenster waren doppelflügelig. Im Winter waren diese oft am frühen Morgen mit Eisblumen übersät. An komfortable Thermoscheiben, doppel- oder gar dreischeibig, war noch lange nicht zu denken. Diese kamen erst in den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts auf, zumindest im Westen. Um die unangenehm kalte Zugluft einigermaßen zu reduzieren, steckte Mutter im Winterhalbjahr eingerollte alte Wolldecken zwischen die Fensterflügel. Der Fußboden bestand aus ausgetretenen einfachen Holzdielen, der Küchen- und Badezimmerboden war aus gestrichenem Estrich. Die Küchenwände waren ebenfalls nicht gefliest, sondern mit einem mattgrünen Ölfarbenanstrich versehen. Ein gewisser Komfort stellte in diesen alten Stadthäusern, die Ende des 19. Jahrhunderts erbaut worden waren, der Kachelofen im Wohnzimmer dar, etwa 1,80 Meter hoch, in quadratischer Form mit einer Abmessung von etwa einem mal einem Meter. Die dunkelgrünen konvexen glänzenden Kacheln spendeten uns angenehme Wärme, so weit wir Brennmaterial beschaffen konnten. Auch ich organisierte Feuerholz und anderes Brennmaterial. Praktisch in der ganzen Stadt – wie in vielen deutschen Städten damals – gab es keine öffentlichen Sitzbänke aus Holz mehr, keine Gartenlauben aus Holz, auch Büsche und Stadtbäume waren abgeräumt, bei Nacht und Nebel abgeholzt worden. Natürlich war das nicht legal, doch in der Not versucht jeder zu überleben. Mundraub und Brennstoffklau waren lebenserhaltend und wurden, so weit ich es als Kind in Dresden mitbekam, von der Polizei nicht verfolgt. Das sah einige Jahre später anders aus. Der Diebstahl von sogenanntem volkseigenen Vermögen, also in Fabriken, Schlachthöfen, HO-Läden (staatlichen Geschäften der Handelsorganisation der DDR) und Büros wurde geahndet und führte leicht zu harten Gefängnisstrafen, oft mit mehrjähriger Haft in dem berüchtigten Zuchthaus in Bautzen. Ein schlechtes Gewissen bei dem, wodurch ich etwas zum Familienleben beitragen konnte, hatte ich nicht. Die lebenslustigen Rheinländer hatten dazu eine besondere Einstellung.
Fringsen
Im katholischen Rheinland ist die Silvesterpredigt des Kölner Kardinals Joseph Frings zum Jahreswechsel 1946/1947, die er in der noch oder wieder intakten Kirche St. Engelbert in Köln-Riehl hielt, unvergessen. Der bei den Kölnern sehr beliebte, weitsichtige und menschliche Kardinal predigte in diesem kalten Hungerwinter, dass der Mundraub für den Eigenbedarf, das Organisieren von Nahrung und das Klüttenklauen4 erlaubt seien. Dabei ging es auch um den Diebstahl von Kohle und Kartoffeln aus Zügen oder Lastwagen, um die ärgste Not zu lindern. Diese Art von „Organisieren“ wurde in Notzeiten als entschuldbarer Mundraub dargestellt. Der Volksmund leitete daraus bald das populäre Wort „Fringsen“ ab, das nicht nur in Köln, sondern bald auch im ganzen Rheinland, wenn nicht in der ganzen Republik bekannt wurde. Auf diese berühmte Predigt weist eine Bronzetafel in St. Engelbert hin:
AUF DER KANZEL DIESER KIRCHE SAGTEKardinal Josef FringsIN SEINER SILVESTERPREDIGT 1946: „WIR LEBEN IN ZEITEN, DA IN DER NOT AUCH DER EINZELNE DAS WIRD NEHMEN DÜRFEN, WAS ER ZUR ERHALTUNG SEINES LEBENS UND SEINER GESUNDHEIT NOTWEN- DIG HAT, WENN ER ES AUF ANDERE WEISE, DURCH SEINE ARBEIT, ODER DURCH BITTEN, NICHT ERLAN- GEN KANN.“ DARAUF PRÄGTE DER KÖLNER VOLKSMUND DAS WORTFringsen.
Unser Domizil gegenüber der Yenidze
Das Haus neben unserem war zerstört, die Trümmer waren bereits abgeräumt. Gegenüber war inmitten des riesigen städtischen Kühlhauses ein Baukomplex komplett zerstört worden. Beide Gebäude hatte ein Bombenteppich getroffen. Das Haus gegenüber der Haupteinfahrt zum Kühlhaus, also das zweite neben unserem, stand noch, es war baugleich zu dem, in dem wir damals wohnten. Die Yenidze5 (siehe Abbildung 4 im Anhang) war ein ehemaliges Fabrikgebäude der Zigarettenfabrik Yenidze mit orientalisierender Architektur, das 1907 eröffnet worden war. Es stand an der Weißeritzstraße am östlichen Rand von Friedrichstadt, unweit des Kongresszentrums, und nur einen Steinwurf von unserem damals neu bezogenen Domizil in der Weißeritzstraße 2b entfernt. Nach dem Kriege sah ich als Kind oft hoch zu dem nach den Angriffen stark beschädigten Gebäude und zu der verbogenen und verdrehten Stahlkonstruktion der Kuppel. Die bunten Glasfelder in dem Stahlgerüst waren da längst weggeschmolzen. Ich dachte daran, wie schön das wohl mal ausgesehen haben mochte. Was hatten die Menschen darin getan, was gearbeitet, wie gelebt, kurzum, wie hatten das Gebäude und die ganze Stadt wohl vor dem Kriege ausgesehen? Erkunden konnten wir Jungen dieses Trümmergelände mit dem stark beschädigten Gebäudekomplex nicht, es war verbarrikadiert. Erst Jahre später erfuhr ich mehr darüber. Ich konnte, so weit vorhanden, darüber nachlesen und mir sogar in alten Filmen einen Überblick verschaffen.
1996 hat ein Konsortium von Versicherungen und Banken aus dieser zerstörten Architektur einen ansehnlichen Gebäudekomplex als Hingucker errichten lassen, mit Büros, Wohnungen und oben mit einer Gastronomie mit Rundumausblick auf die Elbe mit dem Kongresszentrum, das Maritim-Hotel, die Altstadt mit Semperoper, das Italienische Dörfchen, den Zwinger, das Schloss, die Hofkirche, die Brühlsche Terrasse, die Kunstakademie mit dem goldenen Engel auf der Kuppel, die Frauenkirche und vieles andere mehr. In der Kuppel über dem Restaurant der Yenidze befindet sich seit der Fertigstellung ein Theater (die 1001 Märchen GmbH, das Dresdner-Märchenerzähl-Theater). Es lohnt sich, dieses Gebäude zu besichtigen und vor allem den Rundblick auf die Dresdner Altstadt und die Elbe zu genießen, wie ich bei späteren Besuchen erlebt habe. Diesen Wiederaufbau haben wir damals nicht miterlebt, da waren wir schon lange, seit August 1954, im Westen. Doch immer wieder kehre ich gern zurück in meine Geburtsstadt an der Elbe und freue mich, wie die Stadt nach und nach wieder in ihrem alten Glanz erwacht. Ein Dresdner Bürgermeister nach der Wende sagte einmal, jeder Dresdner, der einmal weggezogen sei, kehre gern wieder zurück in seine Stadt. Welcher Bürgermeister sagt das nicht? Doch spricht daraus Heimatstolz, Sehnsucht nach früheren Erinnerungen, Erlebnissen, Familienbanden, aber auch nach dort erlebten Not- und Angstzeiten, die man sein Leben lang nicht vergisst.
Ein Blick zurück
Ich wurde am 08.08.1941 im Friedrichstädter Krankenhaus in Dresden geboren und habe einen drei Jahre jüngeren Bruder. Er heißt Rolf Uwe, kurz Uwe genannt. Der älteste Bruder Achim war 1940 im Kindbett gestorben. Unsere Mutter Margareta erzählte uns später, dass sie im Krankenhaus von NSDAP-Funktionären „bearbeitet“ worden war, ihren erstgeborenen Sohn mit dem Vornamen Adolf in das Geburtsregister eintragen zu lassen. Das lehnte sie jedoch entschieden ab.
Mein Vater Wilhelm war damals gezogener (oder freiwilliger?) Soldat der deutschen Polizeitruppen in der UdSSR. Da er schon über vierzig Jahre alt war (Jahrgang 1901), wurde er nicht in der kämpfenden Truppe an der vordersten Front eingesetzt, sondern im Hinterland. Hier musste er mit seinen Kameraden das von der deutschen Wehrmacht in der Ukraine besetzte Gebiet sichern. Nur einmal erzählte er mir, wie sie von Partisanen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion angegriffen wurden und wie bestialisch diese seinen Vorgesetzten, einen Major, töteten. Sie fanden seinen Leichnam am nächsten Tag mit zwei Meißeln im Kopf.
Die deutschen Okkupanten waren auch nicht ohne Schuld. Ich denke hier nur an die Dokumentation und die ausführliche Berichterstattung dazu viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, hier vor allem an die Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung in den Jahren 1995 bis 1999 und von 2001 bis 2004. Die erste trug den Titel „Vernichtungskrieg – Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“, die zweite „Verbrechen der Wehrmacht – Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941–1944“. Durch diese Ausstellungen wurden Verbrechen der Wehrmacht in der Zeit des Nationalsozialismus, vor allem im Krieg gegen die Sowjetunion, einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht und kontrovers diskutiert. Die zunehmende Kritik von Historikern und das dadurch ausgelöste Medienecho bewogen den Institutsleiter Jan Philipp Reemtsma6, die Ausstellung am 4.11.1999 vorläufig zurückzuziehen. Er beauftragte eine Historikerkommission mit deren Überprüfung. Nach der Kritik an der ersten Ausstellung setzte die zweite andere Akzente, bekräftigte aber die Grundaussage einer Beteiligung der Wehrmacht am Vernichtungskrieg des NS-Regimes gegen die Sowjetunion und am Holocaust.
In einem Gespräch mit mir berichtete mein Vater einmal von seinen Einsätzen in der Ukraine und von seinen Beobachtungen, wie die einfache Landbevölkerung, die Kleinbauern dort lebten. In Erinnerung blieb mir – und ich kann es kaum glauben –, wie sie, die Deutschen, sahen, wie die arme Landbevölkerung auf den kleinen Höfen ihre Notdurft rund um das Haus auf dem Garten- oder kleinen Ackerland verrichtete, quasi als organischer Dünger für ihre Erzeugnisse für den Eigenbedarf als Selbstversorger. Die Hinterlassenschaften waren besonders im Winter, wenn Schnee lag, nicht zu übersehen. Vielleicht war das nur dem Mangel an Nahrungsmitteln in außergewöhnlichen Notzeiten geschuldet und es war damals nicht das Routineverfahren in Friedenszeiten. Die meisten Arbeiten, auch schwere landwirtschaftliche, mussten die Frauen verrichten. Oft genug sahen sie in den Hütten, wie der Mann, der Kleinbauer, auf dem Kachelofen lag, sich ausruhte oder schlief, während die Frau schwere Arbeiten erledigte. Ab und zu trieben sie den betreffenden Mann aus dem Haus, um ihn zum Arbeiten anzutreiben. Einmal, so mein Vater, habe er mit Waffengewalt, mit einer gezogenen Pistole einen Kameraden davon abgebracht, eine Ukrainerin zu vergewaltigen. Der Mann lag schon auf ihr, sie schrie angstvoll. Unser Vater Wilhelm kam ihr zu Hilfe. Ich weiß aber weder wo noch wann das in der Ukraine geschah, wo die Front verlief etc. Leider haben wir, mein Bruder und ich, quasi die nachfolgende Generation, zu wenig oder gar nicht nachgefragt.
Meine Mutter, Margareta, Jahrgang 1913, hatte praktisch keine Ausbildung. Sie war vor ihrer Eheschließung als Haushaltshilfe tätig gewesen, wie so viele junge Frauen ihrer Generation. Ihr Mann Wilhelm war ein einfacher Arbeiter, später Maschinist, also ebenfalls ohne eine besondere Ausbildung. Beide stammten aus dem Arbeitermilieu. Die Mutter lebte mit ihren beiden Söhnen Uwe und mir in der Altstadt von Dresden an der Falkenbrücke, nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt. Die Hausnummer ist mir nicht bekannt. Das Haus steht nicht mehr. Es ist, wie Tausende Häuser in Dresden, dem Inferno zum Opfer gefallen.
Notat 4: Falkenbrücke
Die Falkenbrücke führte von der Falkenstraße über die westlichen Eisenbahngleise des Hauptbahnhofes zur Zwickauer Straße und der Straße „An der Falkenbrücke“, die schließlich in die Chemnitzer Straße mündete. Die Benennung stammt aus dem Jahr 1887. Auch die Straßenbahn, zum Beispiel die Linie 15 nach Plauen, fuhr über diese Brücke. Die Falkenbrücke ist längst abgerissen worden. Bescheidene Reste sollen noch am nördlichen Ende der Zwickauer Straße zu sehen sein. In den Annalen wird berichtet, dass ab 1910 der „Brücke“-Künstler Erich Heckel (1883–1970) sein Atelier im Haus Nr. 2a hatte. Neben der Falkenbrücke führten noch die Chemnitzer Brücke und die Hohe Brücke über die westlichen Bahngleise des Hauptbahnhofes. Dieses Umland gehört zwar noch zur Altstadt, war aber wohl kaum eine noble Gegend beziehungsweise kein teures Pflaster. Dass der Künstler, Maler und Grafiker Erich Heckel in seinen jungen Jahren dort lebte, ist kein Indiz für eine wohlhabende Gegend. Künstler waren oft zu Lebzeiten, besonders in jungen Jahren, arme Schlucker und konnten sich kein Domizil oder Atelier in einer besseren Gegend leisten.
Die Eltern haben uns von ihren frühen Ehejahren und ihrem Leben in Dresden kaum etwas erzählt. Der Vater berichtete auch nicht von seinen Erlebnissen und Erfahrungen als Soldat, als Polizist im Zweiten Weltkrieg. Ich stand unter dem Eindruck, sie wollten das nicht. Sie verdrängten diese Zeit ganz einfach. Und wir haben auch nicht danach gefragt. Im Nachhinein war das sicherlich ein Fehler, ganz einfach auch ein Verlust für unsere Familienhistorie. Die Eltern können nun nicht mehr befragt werden. Sie sind schon vor vielen Jahren verstorben.
Typhuserkrankung – Noch mal Glück gehabt
Es gibt bei mir eine riesige Erinnerungslücke, die von dem erwähnten ersten traumatischen Erlebnis der Dresdner Bombennacht bis etwa zu meinem vierten Lebensjahr reicht. Ich erkrankte lebensgefährlich an der schrecklichen Infektionskrankheit Typhus. Unbehandelt kann diese Durchfallerkrankung sehr gefährlich verlaufen. Nachdem Dresden, diese hoch entwickelte Kulturstadt, praktisch in einer Nacht, der zum 1302.1945, ins Mittelalter zurückgebombt worden war, herrschte dort Hungersnot, es gab kaum sauberes Trinkwasser und die alten guten Hygienestandards konnten vorerst nicht mehr eingehalten werden. Das war der Nährboden für viele Infektionskrankheiten, vor allem für Typhus (Bauchtyphus) und eine abgeschwächte Form von Paratyphus. Diese Krankheiten werden hauptsächlich hervorgerufen durch Salmonellen, die schwere Durchfallerkrankungen mit Flüssigkeitsverlust verursachen. Die Symptome sind Kopf- und Gliederschmerzen sowie Fieber, das innerhalb von zwei bis drei Tagen auf 41 Grad ansteigen kann, dazu kommen allgemeine Krankheitsgefühle, Benommenheit, Bauchschmerzen mit Durchfall, Husten, Übelkeit und Erbrechen sowie Flecken auf Bauch und Rücken und eine weißlich-graue Verfärbung der Zunge. Die Ansteckung erfolgt vor allem durch die Aufnahme von kontaminiertem Wasser und Lebensmitteln, die durch infektiöse Fäkalien verunreinigt sind. Bleibt eine Erkrankung unbehandelt, ist die Prognose nicht gut. Bevor es Antibiotika gab, verstarben etwa 15 bis 20 Prozent der Patienten. Das A und O bei der Prophylaxe ist, die hygienischen Standards einzuhalten. Heute erkranken weltweit jährlich etwa 22 Mio. Menschen an Typhus. Geschätzt wird, dass davon ca. 200 000 daran versterben. Am häufigsten sind Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren betroffen (WHO, geschätzt, Stand 2018).
Und ich war damals, 1946, in meinem fünften Lebensjahr einer der vielen von einer Typhusinfektion Betroffenen. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich in einem städtischen Krankenhaus in Dresden-Löbtau nachts oder frühmorgens aufwachte. Ich lag in einem kleinen Krankenzimmer und vermute im Nachhinein, dass ich dort in einer Art Quarantäne war, um andere nicht anzustecken. An irgendeinen Leidensweg, an Schmerzen, an Durchfall oder andere Unbilden kann ich mich nicht erinnern. Das alles ist in meinem Gehirn wie ausgelöscht, es wurde verdrängt oder in irgendeiner Schublade versiegelt abgelegt.
Ich weiß noch, dass ich, als es langsam hell zu werden begann, mal dringend austreten musste. Dazu verließ ich mein Bett, öffnete die nicht abgeschlossene Tür – und sah in einen Abgrund. Ich konnte in die andere Hälfte des zerbombten Krankenhauses sehen, unter mir nur Schutt- und Ziegelhaufen. Ich schätze, ich befand mich im dritten Stockwerk des Gebäudes. Das kleine Krankenzimmer war früher anscheinend eine Art Abstellraum, ein Ausgang oder ein Durchgang zu einem benachbarten Raum gewesen. Da war nichts abgesichert. Es war vergessen worden, ohne an die möglichen fatalen Folgen zu denken. Ein Schritt weiter und ich wäre in die Tiefe gestürzt, zu Tode gekommen. Diesen Vorfall habe ich meiner Mutter nicht berichtet. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Dass sie mich nicht auf der Krankenstation besuchen durfte, hat mir am meisten gefehlt. Ich war wieder einmal völlig allein.
Jahrzehnte später berichtete mir meine Frau Ingrid von der Infektionskrankheit Diphtherie, mit der sie als Kleinkind in Quarantäne in einem Dortmunder Krankenhaus gelegen hatte. Auch sie durfte niemand besuchen, nicht einmal ihre Mutter, Gerda Windisch, geborene Pappe. Ihr Vater, Kurt Windisch, war damals in russischer Kriegsgefangenschaft in Sibirien gewesen.
Bald wurde ich gesund. Wie lange ich im Krankenhaus bleiben musste, ist mir nicht bekannt. Mutter sagte zu mir: „Klaus, du hast Glück gehabt. Die Ärzte meinen, du hast ein starkes Herz, sonst hättest du das nicht überlebt.“ Mein Vater, der die Familie verlassen hatte, war schon im Westen. Er hatte Medikamente geschickt, die mir halfen. Auch die gab es damals nicht mehr in Dresden. Es waren sicherlich Antibiotika, die damals schon zur Therapie eingesetzt wurden. Und ich dachte später so noch bei mir: Na Junge, da hast du ja mal wieder Glück gehabt.
Jahre später, so Ende der Vierziger-, Anfang der Fünfzigerjahre wurde ich noch einmal auf Typhus in einem Krankenhaus untersucht. Die Erreger können heute im Blut nachgewiesen werden, nach der Infektion auch in Harn und Stuhl über Antikörper. Damals musste ich für diese Untersuchung – es wurde Gallenblasenflüssigkeit benötigt – sechs Stunden lang (!) mit einem Schlauch im Magen auf der linken Seite auf einer harten Unterlage liegen. Ein festes Kissen wurde mir dazu in Magenhöhe unter den linken Brustkorb gelegt. Ich musste nüchtern zu dieser Prozedur erscheinen. Nach einer langen Zeit in dieser ungünstigen Position war schließlich die gelb-grüne Gallenblasenflüssigkeit da. Das Ergebnis war negativ. Ich hatte keine Typhuserreger mehr in mir, war also kein Dauerausscheider. Diese Krankheit ist schon seit vielen Jahren meldepflichtig. Ich weiß nicht genau, ob das damals schon so war. War diese Untersuchung eine vorauseilende prophylaktische Vorsichtsmaßnahme meiner Mutter? Vielleicht schon mit der Planung der Ausreise, der Flucht in den Westen?
Notat 5: Typhus
Und in jüngster Zeit? Das Robert Koch-Institut berichtet, dass die Krankheit zwar weltweit vorkommt, aber vor allem in Entwicklungsländern verbreitet ist, in denen schlechte hygienische Bedingungen herrschen. In Afrika, Südamerika und Südostasien sind besonders hohe Erkrankungszahlen sowie wiederholte Ausbrüche und Epidemien bekannt. Wenn es heutzutage Typhus-Fälle in Deutschland gibt, dann wurde die Erkrankung hauptsächlich durch Reisende aus tropischen Ländern eingeschleppt. Das höchste Ansteckungsrisiko besteht in Indien und Pakistan. In Deutschland sind die Erkrankungszahlen deutlich zurückgegangen, weil die hygienischen Bedingungen stark verbessert wurden. Im Jahr 2012 erkrankten 58 Menschen an der meldepflichtigen Krankheit Typhus und 43 Personen an der typhusähnlichen Krankheit Paratyphus.
4 Als Klütten, Klütt oder Klüt wurden einfache vorindustriell von Hand hergestellte Braunkohlepresslinge aus dem Rheinischen Revier bezeichnet. Später wurde die Bezeichnung in der rheinischen und kölschen Mundart umgangssprachlich verallgemeinert und auch für industriell gepresste Briketts verwandt.
5 Hugo Zietz, der Inhaber der „Orientalischen Tabak- und Cigarettenfabrik Yenidze“, die 1884 gegründet wurde, ließ dieses Fabrikgebäude im orientalischen Stil mit verglaster Kuppel und als Minarett kaschiertem Schornstein errichten. Die Dresdner nannten den Gebäudekomplex „Tabakmoschee“, als sie sich mit diesem architektonischen Fremdkörper in ihrer Stadt mit ihren historischen barocken Bauten schließlich anfreundeten. Zietz wollte mit dieser Benennung seine Verbundenheit zeigen und Werbung betreiben für den aus dem damaligen Osmanischen Reich und dem heutigen Nordgriechenland importierten Tabak, der als der mildeste, aromatischste und würzigste Zigarettentabak galt. 1924 wurde die Fabrik an Reemtsma verkauft.
6 Jan Philipp Reemtsma (*26.11.1952) ist ein deutscher Germanist, Historiker, Publizist und Mäzen, dessen Wirken von der Literaturwissenschaft bis zur sozialwissenschaftlichen Gewaltanalyse reicht.
Grundschule und meine Jahre als Heimkind
Einschulung in die 48. Grundschule in Dresden-Friedrichstadt
Im Herbst 1947 wurde ich in die 48. Grundschule in der Seminarstraße 11 eingeschult. Eine Zuckertüte gab es nicht. Es fehlte auch sonst an allem. Mutter hatte mir aus einem alten Militärmantel für den Winter eine Jacke bzw. einen Mantel geschneidert. Lange Strümpfe hatten wir Jungen an, die hielten zwar warm, kratzten aber fürchterlich. Wir mussten dazu ein Laibchen mit Strumpfhaltern tragen.
In den Wintermonaten war die Elbe oft zugefroren. Dann gingen wir nach Schulschluss zum Ostragehege und marschierten über das Eis zur Neustadt, sobald die mit Eisenstangen und Hanf- oder Drahtseilen markierten Übergänge auf dem Fluss freigegeben worden waren. Jedenfalls waren wir immer froh, wenn der Winter vorbei war und wir auf diese Winterklamotten verzichten konnten. Denn die Winter waren damals hart mit Frost und viel Schnee. Im Sommer gingen wir meist barfuß, um die Schuhe zu schonen, denn Leder war Mangelware und sehr teuer. Mutter sagte: „Wenn drei Gewitter vorbei sind, dürft ihr barfuß gehen.“ Ob es wahr ist, dass dann der gefühlte Sommer da ist? Viele Straßenbelege bestanden damals noch aus Pflastersteinen (Basalt, Granit, Grauwacke). Die ersten Asphaltdecken kamen auf und wenn es heiß war, wurde der Asphalt weich. Das barfüßige Hineintreten fühlte sich zunächst angenehm warm an, doch danach war es unangenehm klebrig und wir hatten Mühe, abends die Füße sauber zu bekommen.
Es mangelte in den ersten Nachkriegsjahren an allem. Hunger hatten wir immer. Mutter Margareta und Oma Martha sorgten zwar für uns, sodass wir kein gravierendes Hungergefühl hatten, doch genug zu essen gab es eigentlich nie. Ich weiß noch, wie Oma einmal sagte:
„So, jetzt koche ich Kartoffelschalensuppe.“ Ja, alles wurde verwertet. Aber zum Mausen (Klauen) wurden wir von der Mutti nicht angewiesen. Das taten wir manchmal heimlich, auch ohne Schuldgefühle, wenn ich zum Beispiel an die Schrebergarten-„Besuche“ denke.
Unser Klassenlehrer war ein großer, hagerer Mann von etwa 45 Jahren. Er sah ziemlich verhungert aus: mageres, blasses Gesicht, die Wangenknochen stachen spitz aus seinem Gesicht, das Haupthaar war stramm nach hinten gekämmt und mit Brillantine fest auf die Schädeldecke gepappt. Im Nachhinein denke ich, war er froh, unser Klassenlehrer zu sein, denn wir waren keine schwierige Klasse. Er hat uns auch nicht schlecht behandelt. An Einzelheiten wie Charakteristika seines pädagogischen Wirkens kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht lag es daran, dass er uns ziemlich in Ruhe ließ in dieser Notzeit.
Von der Seminarstraße ging es in das Schulhauptgebäude durch einen Torbogen nach links in die Schule. Rechts davon befindet sich auch heute noch das alte rechteckige Turnhallengebäude. Neben dem kleinen Schulhof befand sich ein eingezäuntes freies Freilandaquarium, das von Schilf umwachsen war. Als ich viele Jahre später mit meiner Frau, meinem jüngsten Sohn und Tante Wally, einer geborenen Windisch (aus Gera), meine Geburtsstadt besuchte, machten wir natürlich auch einen Abstecher zur 48. Grundschule. Unser Jüngster war derzeit – es war 1988, also noch vor der Wende – zehn Jahre alt. Ich sagte zu ihm: „Komm, jetzt gehen wir mal in die Turnhalle. Ich zeige dir, wo ich als Junge etwa in deinem Alter geturnt habe.“ Es war gerade Unterrichtsbetrieb. Ein junge, hübsche, blonde Sportlehrerin, die bedröppelt dreinschaute, begrüßte ich und sagte ihr, ich wolle meinem Sohn zeigen, wo ich vor 47 Jahren geturnt habe. Sie hörte an unserem Dialekt – ich sprach kein Sächsisch mehr –, dass wir Fremde (der Klassenfeind?) aus der BRD waren. Offensichtlich hatte sie kein Interesse daran, mit uns zu reden. Sie wusste wohl nicht, wie sie uns begrüßen sollte. Und so verließen wir zügig die Turnhalle. Im Schulgebäude zeigte ich meiner Familie von außen die Fenster meines ehemaligen Klassenzimmers im zweiten Stock, das von der Seminarstraße aus gesehen links lag. Schon 1988 wurde dieses Gebäude als Schulmuseum genutzt. Der eigentliche Schulbetrieb wird im hinteren alten Schulgebäude am Ende des Schulhofes und in einem rechts davon gelegenen Neubau weitergeführt. Das Lehrerzimmer befand sich damals in dem alten Gebäude rechts neben dem Schulhof im Erdgeschoss. Dahin musste ich einige Male während meiner Schulzeit, um nach einem Lehrer zu fragen, der offensichtlich nicht mehr verfügbar war, da er „niebergemacht“ hatte, also fluchtartig verschwunden war.
In den Jahren in Dresden fühlte ich mich frei, oft ungezwungen und konnte mit meinen Kumpels in der zerstörten Stadt als „Schlüsselkind“ vieles unternehmen. Über die Jugendstreiche, tolldreiste Geschichten und Freizeitaktivitäten erzähle ich später noch.
Ein weiterer Schicksalsschlag – Mutter erkrankt schwer
Eine kleine Erdgeschosswohnung in der Weißeritzstraße 2b war nach dem Krieg unser neues Domizil. Hier lebten wir mit meiner Oma Martha, einer kleinen gebeugten Frau von etwa siebzig Jahren. Ihren Mann, unseren Opa, haben wir nie kennengelernt. Sie war uns immer eine liebevolle, fürsorgliche Oma. Sie versorgte uns, besonders meinen kleinen Bruder Uwe. Wir gingen von hier aus – es waren nur zwei Kilometer – zum Kindergarten. Zu Beginn meiner Schulzeit konnte ich noch eine Zeit lang den Kindergarten besuchen. Das war eine Besonderheit. Ob das eine Vereinbarung zwischen meiner Mutter und der Kindergartenleiterin war, weiß ich nicht. Der Kindergarten lag schräg gegenüber dem Zwinger mit dem Kronentor und der Holzbrücke über dem Zwingergraben. Das Kindergartengebäude war ein Provisorium, ein einfacher Flachdachbau aus Holz. Das große Grundstück war eingezäunt und reichte bis zur zerstörten Orangerie mit den Restsäulen.7 Wir Kinder hatten hier genügend Auslauf und viel Platz zum Spielen und Toben. Später ging auch mein kleiner Bruder in diesen Kindergarten, der sich dort wohlfühlte. Die Leiterin, eine ältere Kindergärtnerin, war wie eine Mutter zu uns, liebevoll und verständnisvoll. Wir mochten sie sehr und nannten sie Tante Hilpert. Da waren noch einige andere, jüngere Kindergärtnerinnen. Etwas habe ich von ihnen in Erinnerung: Es war kurz vor dem Wochenende. Das eine Fräulein – so sollten wir sie ansprechen – sagte zu ihrer Kollegin: „Am Sonntag treffe ich meinen Freund. Ob ich wohl hübsch genug aussehe? Und die Haare? Ob ich noch zum Frisör muss?“ Die Kollegin gab ihre Empfehlungen. Schon damals merkte ich, dass Frauen viel Wert auf ihr Äußeres legen und immer schön sein wollen. An ein altes Foto erinnere ich mich: Tante Hilpert spielt mit uns, sie kniet praktisch auf allen vieren im Sandkasten, Uwe reitet auf ihrem Rücken. Beide lachen aus vollem Herzen. Alles war zunächst gut.
Notat 6: Vati Wilhelm, geboren am 19.06.1901 in Prag – damals (1944) beinahe ein Todesurteil
Vati muss im Jahr 1944 auf Heimaturlaub in Dresden gewesen sein. Mutti war zu der Zeit hochschwanger mit meinem Bruder Uwe, denn er wurde am 26.10.1944 geboren. Wie das folgende Ereignis abgelaufen sein kann, lässt sich nur bruchstückhaft anhand von kurzen Erzählungen von Mutti zusammenpuzzeln, die in Heessen erfolgten, als ich 15 war, also 1956. Vater war oft impulsiv, ließ sich zu Äußerungen hinreißen, die er später sicherlich bereute. So muss es auch während seines Heimaturlaubs von der Front in der Ukraine gewesen sein, als er mit zivilen Polizeikollegen in Dresden diskutierte. Sie waren ihm wohl zu linientreu, zu Führer-gläubig. Schließlich soll er geäußert haben, dass das alles keinen Zweck, keinen Sinn mehr habe, denn der Krieg sei ohnehin verloren. Aufgrund dieser wehrzersetzenden Äußerungen wurde er gleich vor Ort verhaftet und im Polizeipräsidium in Dresden inhaftiert. Wie Mutti davon erfahren hat und in so kurzer Zeit bei der Polizei auftauchte, für ihren Mann gekämpft und ihn schließlich frei bekommen hat, ist mir unerklärlich. Ich habe sie damals leider nicht danach gefragt. Auf jeden Fall war noch kein schriftlicher Haftbefehl oder gar ein Protokoll angefertigt worden.
Mutti sagte mir damals nur: „Klaus, in dem Zustand kann sich eine Frau mehr erlauben als üblich.“ Damit meinte sie sicherlich, dass auf eine Frau kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes – Achim, unser ältester Bruder, war schon im Kindbett gestorben – Rücksicht genommen wurde. Vielleicht hat sie auch den Führer ins Spiel gebracht, dem sie bislang zwei Söhne geboren hatte, und dass nun der Ernährer der Familie für seine defätistischen Äußerungen sein Leben verlieren soll. Zum Glück schaffte sie es, ihren Mann freizubekommen.
Der Vater hat uns später verlassen. Wir Kinder kannten ihn kaum. Wann er gegangen ist, weiß ich nicht. Mutter sagte mir, dass er, als er aus dem Kriege zurückgekommen war, zunächst kurze Zeit als Arbeiter im nahe gelegenen Friedrichstädter Krankenhaus tätig war. Dann verließ er die Familie und floh in den Westen. Später wurde die Ehe geschieden.
Notat 7: Mutti Margareta, geboren am 21.03.2013 in Münsterberg, geborene Hümer
Mutti Margareta musste somit die beiden Jungen allein durchbringen. Sie arbeitete zunächst bei den Russen auf dem Friedrichstädter Schlachthof, später bei den Dresdner Verkehrsbetrieben als Schaffnerin, danach als Straßenbahnfahrerin. Mitfahren durfte ich nicht, dazu war ich wohl noch zu klein. Oft hatte sie Nachtschicht, und das war gefährlich. In den Vierzigerjahren nach dem Kriege waren die deutschen Frauen für die sowjetischen Soldaten noch eine Art Freiwild, wie ich schon als Kleinkind in der Weißeritzstraße beobachten konnte. Es war bestimmt kein einfacher Job. Die technischen Standards dieser Verkehrsmittel – kalte, zugige, klapprige Straßenbahnwagen, gefährliche Nachtfahrten – waren damals bei Weitem nicht mit den heutigen zu vergleichen. Schließlich erkrankte Mutter sehr schwer an Rheumatismus. Sie konnte sich kaum bewegen. Als ich sie allein im Friedrichstädter Krankenhaus besuchte, lag sie in einem tristen Zimmer. Sie konnte vor Schmerzen kaum sprechen. So leichenblass und regungslos, wie sie dalag, dachte ich, sie würde bald sterben. Und ich hatte mal wieder eine Heidenangst um sie.
Ich war wohl ein sehr lebhafter Junge. Meine Oma konnte mich neben meinem kleinen Bruder allein nicht versorgen. Mein Bruder Uwe war 4 und ich, Klaus, 7 Jahre alt. Ab und zu schaute eine mit meiner Mutter befreundete 28-jährige Frau nach uns. Sie war noch ledig, hieß Frau Schindler und wohnte bei ihrer älteren Schwester im Erdgeschoss gegenüber unserer Wohnung. Frau Schindler war bereits in ihrem jungen Alter Hochkranführerin. Wenn sie von ihrer Arbeit sprach, staunte ich nur, was Frauen in der DDR leisteten und in welchen Berufen sie tätig waren.
Schlussendlich musste ich ins Kinderheim, weil Mutter krank war, danach wieder voll berufstätig und die Oma mich und Uwe nicht zusammen betreuen konnte. Leider gab es in den Kinderheimen keinen Kontakt zu meiner Mutter, weder telefonisch noch brieflich. In der letzten Heimstation in Radebeul durfte ich alle vier Wochen übers Wochenende nach Hause. Das war ein Fortschritt für mich und die Familie.
Jauernick, DDR – Meine erste Station als Heimkind
Da ich aufgrund der familiären Verhältnisse nicht daheim in Dresden bleiben konnte, kam ich zunächst in ein Kinderheim nach Jauernick. Das war 1948/1949, es war die erste Station meiner insgesamt fünf Kinderheimaufenthalte. Warum gerade hierhin, in ein Dorf bei Görlitz, der östlichsten Stadt Sachsens und Deutschlands, an der Neiße gelegen, in der Region Lausitz in Niederschlesien? Ich weiß es nicht. Vielleicht gab es damals in Dresden nicht genügend unzerstörte staatliche Kinderheime. Auf jeden Fall befand ich mich bald in einem katholischen großen Heim in Jauernick.
Es sah aus wie ein Gutshof. Die Gebäude waren um einen großen Hofplatz gruppiert, abgeschlossen von der Außenwelt, zugängig durch ein großes Hoftor. Wir hatten junge Erzieherinnen und einen Pfarrer mit stattlicher sportlicher Figur, so zwischen 35 und 45 Jahre alt. Es war Winter. An einem Nachmittag befanden wir uns in einem Aufenthaltsraum, darin gab es einen Kachelofen mit großem Sims und einer Rundum-Sitzgelegenheit. Der Pfarrer kam herein, scherzte mit der hübschen Erzieherin, fasste sie bei den Hüften und hob sie mit Schwung hoch und setzte sie auf den Kachelofensims. Beide lachten und hatten ihren Spaß. Uns Kinder beachtete er nicht. Das war nur eine kurze Szene, die mir aber zu denken gab. War da etwa mehr?
An Nutztiere oder einen landwirtschaftlichen Gutsbetrieb kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht hatte es eine derartige Bewirtschaftung früher gegeben, wie es oft bei kirchlichen Einrichtungen mit hohem Selbstversorgungsgrad üblich war. Ein Kloster, wie zum Beispiel das riesige ehrwürdige Kloster Marienthal, konnte es nicht gewesen sein, wie ich im Internet viele Jahre später gesehen habe. Nach meinen Recherchen müsste es das katholische Kinderheim Sankt-Wenzeslaus-Stift (siehe Abbildung 5 im Anhang) gewesen sein, damals hatte alles viel älter ausgesehen, ohne farbigen Anstrich. Heute ist es eine katholische Bildungs- und Begegnungsstätte des Bistums Görlitz in Jauernick-Buschbach, acht Kilometer von Görlitz entfernt.
Das große Heim lag in einem kleinen Tal. Gegenüber an einem Hang befand sich eine kleine katholische Dorfschule. An den Schulbetrieb kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber auch hier im östlichsten Sachsen waren die Winter sehr kalt. Schon auf dem Weg zur Schule froren wir. Und wenn es Weihnachten zur Mitternachtsmesse in die Kirche ging, stapften wir durch den Schnee und froren entsetzlich. Ansonsten gab es keine besonderen Vorkommnisse. Auch hier fühlte ich mich mutterseelenallein. Ich erhielt nie einen Brief von meiner Mutter und hatte auch keinen Kontakt zu meinem Bruder und der Oma. Telefonate gab es für uns nicht. Auch persönliche Ansprechpartner hatte ich nicht. Ich wusste nur, dass Mutter mich, wenn sie wieder gesund sein würde, hier bestimmt herausholte. Sie konnte nichts dafür; sie liebte uns Kinder, auch unsere Oma liebte uns sehr.
Danach ging es wieder zurück in meine Geburtsstadt und wieder folgte der Besuch der 48. Grundschule. Bis heute ist mir unerklärlich, warum ich mich an so viele Ereignisse der damaligen Zeit nicht mehr erinnern kann.
Zweite Heimstation in Dresden
Es war 1949/50. Wenn Mutter keine Zeit für mich hatte, weil sie krank war, im Krankenhaus oder bei den Verkehrsbetrieben im Schichtdienst als Straßenbahnfahrerin arbeitete, schaute die junge Frau Schindler, die ebenfalls in der Weißeritzstraße 2b wohnte, im Parterre links, gegenüber unserer Wohnung, nach mir. Sie wusch oder badete mich in unserer Küche in einer kleinen Zinkbadewanne. Als meine Mutter mal wieder verhindert war, sollte ich ins Heim. Meine Mutter hatte Frau Schindler beauftragt, mit mir bei der Stadt vorzusprechen. Wir wurden an ein staatliches Kinderheim verwiesen, wo ich vorgestellt wurde. Ich schaute an der Rezeption nach oben zu der Heimleiterin. Ich erinnere mich, wie diese auf mich herabsah und Frau Schindler fragte: „Ist der Junge denn schwer erziehbar?“ Frau Schindler schaute mich an und sagte: „Nein, ich glaube nicht. Nein, das ist er nicht.“ Ich bin sicher, hätte sie eine negative Auskunft gegeben, wäre ich in eine andere Abteilung gekommen, wo ich es noch schwerer gehabt hätte.
Es muss im Jahr 1950 gewesen sein, da war ich 9 Jahre alt. Ich befand mich nun in einem staatlichen Kinderheim in irgendeinem Stadtteil von Dresden. Es war ein großes Wohnhaus mit drei Etagen. Ich schätze, wir waren dort ca. 100 Kinder. Hinter dem Haus gab es einen Bolzplatz, wo wir oft Fußball gespielt, „gebäbbelt“, haben. Von hier aus liefen wir zur Schule, die etwa fußläufig maximal eine halbe Stunde vom Heim entfernt war. Es ging durch einen kleinen Wald, durch grünes Gelände mit Buschwerk und Weiden. Rechts vom Weg war eine große Gärtnerei mit einigen Glasgewächshäusern. Der Betrieb lag einsam und verlassen da, keiner kümmerte sich darum. Unter uns Heimkindern hieß es nur, die Eigentümer hätten „niebergemacht“, das heißt, sie seien in den Westen abgehauen, geflüchtet, wie so viele DDR-Bürger. Zuerst waren nur wenige Scheiben der Gewächshäuser kaputt, dann immer mehr. Wir brauchten keine Konsequenzen zu befürchten und so dienten uns die Glasscheiben im Vorbeigehen als Zielscheiben. Es war leicht, sie mit den Steinen zu treffen. Wie das so schön schepperte. Daran hatten wir unsere Freude. Im Nachhinein hatten wir dann doch ein schlechtes Gewissen.
Inzwischen war die Ehe meiner Eltern geschieden worden. Später habe ich von der Mutter erfahren, dass der Vater Alimente in Form von Naturalien im Wert von 200 DM (West) pro Monat schicken musste. Mutter wünschte sich das. Und Vater schickte. Das sah ich dann viele Jahre später auch in den Scheidungsdokumenten: Die Gerichte in Ost und West arbeiteten, zumindest in derartigen Familienangelegenheiten, zusammen. Mein Vater wurde vom Amtsgericht Ahlen in Westfalen verurteilt, die Familie mit Naturalien zu unterstützen. Meine Mutter war eine kluge, vorausschauenden Frau. Sie ließ sich von ihrem Exmann hauptsächlich Bohnenkaffee und Schokolade schicken, denn diese Güter waren nach dem Kriege sehr knapp, besonders in der DDR. Als Kind trank ich noch keinen Bohnenkaffee, aber ich mochte Schokolade gerne. In der DDR gab es damals bekanntlich „Vitalade“, eine Art Kunst- oder Ersatzschokolade, denn Kakaobohnen waren zu der Zeit nicht zu bekommen. Vitalade wurde aus gehärtetem Pflanzenfett, Sojamehl, Braumalz und Haferflocken hergestellt, sie schmeckte fürchterlich süß. Aber da wir nichts anderes gewohnt waren, wurde das gelegentlich ganz gern gegessen. Wir Kinder hatten praktisch niemals Westschokolade. Diese konnte Mutter auf dem Schwarzmarkt zusammen mit dem echten Kaffee gut verkaufen.
Mein sehnlichster Wunsch war es, Fußballschuhe und einen Fußball geschenkt zu bekommen. Zu meinem Geburtstag erhielt ich diese großartigen Geschenke. Welch eine Freude! Mein Vater schickte mir echte Lederfußballschuhe mit festen Stollen und einen echten Lederfußball. Wir Jungen bekamen auch einmal kurze Lederhosen, die unverwüstlich waren. Wir haben sie lange, bis zu einem Alter von 15 oder 16, getragen, als sie schon knapp saßen und wir nach der Flucht in den Westen Mitglieder im Deutschen Wanderbund waren. In der DDR gab es damals auf diesem Sektor nur Kunststoffartikel, Plaste. Mit den Geschenken meines Vaters war ich im Kinderheim König. Oft habe ich mit den anderen Jungs in dieser wertvollen Ausrüstung Fußball gespielt. Doch schon nach einer Saison waren die Fußballschuhe und der Fußball weg. Ganz einfach: Sie wurden im Heim gestohlen. Ich konnte mich an niemanden wenden, mich nicht beschweren. Ich stand allein und ohne Hilfe da. Eine Suche nach diesen wertvollen Dingen erfolgte nicht. Das war damals für mich eine große Enttäuschung.
Die Nahrungsversorgung im Heim – und nicht nur in diesem – war recht gut. Es gab sogar Butter, zum Beispiel zwei Stückchen zum Frühstück. Meine Oma (aus Schlesien) hörte ich oft in Dresden sagen: „Oh, Junge, gute Putter, das ist was Gutes, die gibt’s hier kaum.“ Milch und Butter gab es sonst nur rationiert auf Milch- bzw. Buttermarken, besonders für Familien mit kleinen Kindern. Auch bei anderen Nahrungsmitteln herrschte diese Zwangsbewirtschaftung, zum Beispiel bei Fleisch und Brot. Magermilch hingegen gab es damals ohne Lebensmittelmarken. Und so habe ich fürsorglich von meiner Frühstücksration täglich ein Stück gute Butter abgezweigt, es im Winter auf der Außenfensterbank verpackt und versteckt, um es beim nächsten Heimgang der Familie mitzubringen. Aber das hat nicht funktioniert. Nach Tagen roch die Butter ranzig und war nicht mehr genießbar. Auch das war eine besondere Erfahrung in Kindheitsjahren.
Und wieder gab es eine kurze Teil-Familienzusammenführung in der Weißeritzstraße 2b. Als Schulkind war ich ein „Schlüsselkind“, denn die Oma war nicht immer da und Uwe war im Kindergarten. Ich hatte einen Haustür- und Wohnungsschlüssel an einem Band um den Hals hängen, war oft auf mich allein gestellt. Das war wohl im Jahr 1951. Die Mutter war vollbeschäftigt als Straßenbahnfahrerin, und ich war weitaus frei von Zwängen. Dass ich regelmäßig Schularbeiten gemacht habe, daran erinnere ich mich nicht.
Dritte Heimstation in Hamm in Westfalen, Waisenhaus Vorsterhausen
Im Frühjahr 1951 kam ich in den Westen, in die Bundesrepublik Deutschland, genauer in den Hammer Westen nach Westfalen, in das katholische Waisenhaus Vorsterhausen, Wilhelmstraße 128. Jahre später las ich Folgendes: Das Anwesen war damals ein Gutsbetrieb. Die katholische Pfarrgemeinde St. Agnes hatte es 1886 erworben, um dort ein katholisches Waisenhaus einzurichten. Dieses wurde am 13.12.1887 durch Pfarrer Josef Middendorf, den damaligen Pfarrer von St. Agnes, eingeweiht. 1984 wurde das Kinderheim geschlossen. Die Trägerschaft und die Leitung gingen von der katholischen Kirchengemeinde St. Josef an den Caritasverband Hamm über. Es wurde eine katholische Jugendhilfeeinrichtung, die ihren Dienst im Sinne christlicher Nächstenliebe allen jungen Menschen und ihren Familien, die Hilfe benötigten, unabhängig von deren religiöser, weltanschaulicher oder politischer Überzeugung, anbot, so sagt es die Informations- und Werbeschrift dieser Organisation. Das historische Gebäude wurde 1985 trotz zahlreicher Proteste abgerissen. Weder bei der Stadt Hamm noch durch Recherche bei der Nachfolgeorganisation, dem Caritas-Familienforum, konnte ich Informationen oder Dokumente über meinen ehemaligen Heimaufenthalt in Vorsterhausen erlangen.
Warum kam ich nun in ein über 500 Kilometer von Dresden entfern





























