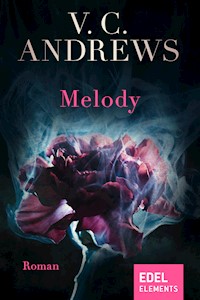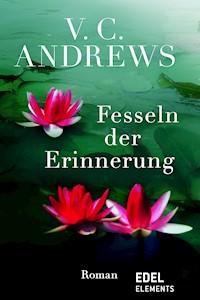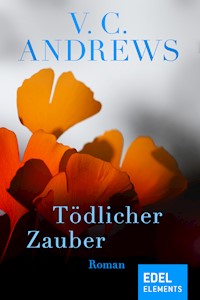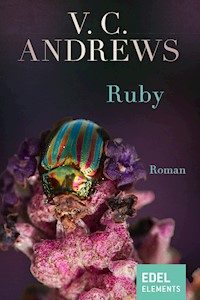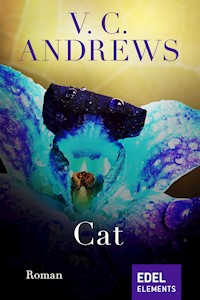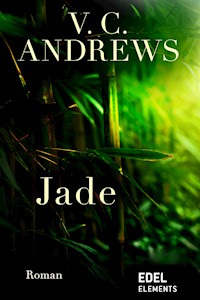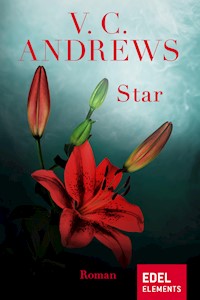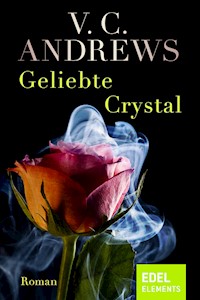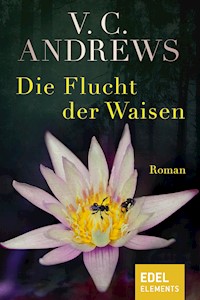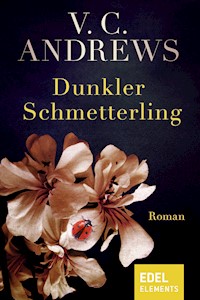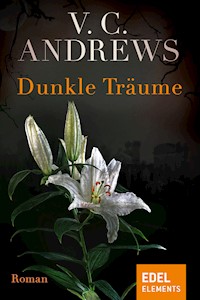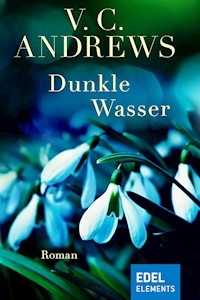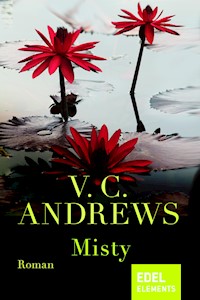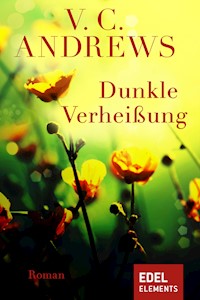
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Landry-Saga
- Sprache: Deutsch
Seit dem Tod ihrer Großmutter weiß Ruby, wer ihr Vater ist. Pierre Dumas, wohlhabender Immobilienmakler aus New Orleans, nimmt die verlorene Tochter mit offenen Armen in seinem herrschaftlichen Haus auf. Doch Rubys tragisches Schicksal beginnt, als ihre Stiefmutter sie zusammen mit Rubys intriganter Zwillingsschwester Gisselle auf eine Privatschule schickt. Unermüdlich denkt sich Gisselle neue Grausamkeiten für ihre Schwester aus. Trost findet Ruby nur in ihrer Liebe zu Beau, einem früheren Schulfreund. Doch Gisselles Haß ist unerbittlich…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 655
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
V.C. Andrews – eine der erfolgreichsten Bestsellerautorinnen der Welt. Und eine Meisterin der romantischen Spannung!
Der wohlhabende Pierre Dumas empfängt seine verloren geglaubte Tochter Ruby mit offenen Armen. Doch Rubys scheinbares Glück verwandelt sich nur zu schnell in ein Leben voll Angst, als sie mit ihrer Zwillingsschwester Giselle auf eine Privatschule geschickt wird. Unermüdlich denkt sich Giselle neue Grausamkeiten für ihre Schwester aus, und Trost findet Ruby nur in ihrer Liebe zu dem früheren Schulfreund Beau. Ob er sie jedoch vor Giselles Hass wird schützen können, ist ungewiss...
Ein fesselnder Roman voller Leidenschaft und dunkler Geheimisse aus dem Herzen der Südstaaten – V.C. Andrews´ große "Landry-Saga"!
PROLOG
Lieber Paul,
ich habe bis zum letzten Moment gewartet und Dir diesen Brief vor allem deshalb geschrieben, weil ich bis jetzt nicht sicher war, ob ich tun werde, worum mein Vater mich gebeten hat, nämlich, zusammen mit meiner Zwillingsschwester Gisselle eine Privatschule für Mädchen in Baton Rouge zu besuchen. Ich habe es ihm zwar versprochen, aber es bereitet mir Alpträume. Ich habe die Broschüren der Schule gesehen, die sich Greenwood nennt. Alles sieht wunderschön aus, ein imposantes Gebäude, in dem die Klassenzimmer untergebracht sind, eine Aula, eine Turnhalle und sogar ein überdachter Pool, außerdem drei Schülerwohnheime, vor denen üppige Weiden und Eichen stehen. Das Gelände hat einen eigenen Teich, an dessen Ufer lavendel-farbene Hyazinthen stehen, und es ist mit Roteichen und Walnußbäumen bewaldet. Es gibt Tennisplätze und Felder für Ballspiele – kurz und gut, alles, was man sich nur wünschen kann. Ich bin sicher, daß die Einrichtungen, aber auch die Möglichkeiten, die sich dort bieten, weit besser sind als alles, was ich in unserer staatlichen Schule in New Orleans hätte.
Aber es ist eine Schule, die nur von den reichsten jungen Frauen aus den besten kreolischen Familien in ganz Louisiana besucht wird. Ich habe keine Vorurteile gegen reiche Leute und angesehene Familien, aber ich weiß, daß ich dort von Dutzenden und Aberdutzenden von Mädchen umgeben sein werde, die so aufgewachsen sind wie Gisselle. Sie werden so denken wie sie, und sie werden mir das Gefühl geben, eine Außenseiterin zu sein.
Mein Vater ist voller Zuversicht. Er glaubt, ich kann jedes Hindernis überwinden und es mühelos mit jedem einzelnen der snobistischen Mädchen aufnehmen. Er setzt so viel Vertrauen in meine künstlerische Begabung, daß er sicher ist, die Schule wird dieses Talent sofort anerkennen und dafür sorgen, daß es weiter ausgebildet wird – damit ich Erfolg habe und die Schule sich diesen Erfolg zuschreiben kann. Ich weiß, daß er mir nur helfen will, meine Zweifel und Ängste abzuschütteln.
Aber wie unwohl mir auch bei dem Gedanken ist, diese Schule zu besuchen, vermute ich doch, es ist das Beste, was ich im Moment tun kann, denn auf die Art kann ich zumindest meiner Stiefmutter Daphne entkommen.
Als Du bei uns zu Besuch warst und mich gefragt hast, ob die Lage sich gebessert habe, habe ich ja gesagt, aber das war nicht die ganze Wahrheit.
In Wahrheit wäre ich beinahe in der Nervenheilanstalt eingesperrt und vergessen worden, in der mein armer Onkel Jean, der Bruder meines Vaters, sitzt. Meine Stiefmutter hatte sich mit dem Anstaltsleiter verschworen, um mich einweisen zu lassen. Dank der Hilfe eines sehr netten, aber äußerst gestörten jungen Mannes namens Lyle konnte ich fliehen und nach Hause zurückkehren. Als ich meinem Vater berichtete, was vorgefallen war, hatten er und Daphne daraufhin eine fürchterliche Auseinandersetzung. Nachdem alles geklärt war und er mir den Vorschlag unterbreitet hatte, mich und Gisselle nach Greenwood zu schicken, habe ich gesehen, wie wichtig es ihm war, uns von Daphne fernzuhalten, und ich habe auch gesehen, wie glücklich sie darüber war, daß wir fortgehen.
Deshalb bin ich so hin- und hergerissen. Einerseits macht mich der Gedanke an Greenwood sehr nervös, und andererseits bin ich froh, dem zu entkommen, was sich zu einem sehr düsteren und trostlosen Zuhause entwickelt hat. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, meinen Vater zu verlassen. Er scheint binnen weniger Monate um Jahre gealtert zu sein. Da und dort ziehen sich plötzlich graue Strähnen durch sein kastanienbraunes Haar, er hält sich nicht mehr so aufrecht und bewegt sich auch nicht mehr so energisch wie noch kurz nach meiner Ankunft. Nur sehr ungern lasse ich ihn im Stich, aber er wünscht, daß Gisselle und ich diese Privatschule besuchen, und ich möchte ihn glücklich machen und ihm einen Teil seiner Last und seiner Anspannung nehmen.
Gisselle hat nicht aufgehört zu jammern und zu klagen. Ständig droht sie damit, nicht nach Greenwood zu gehen. Sie ächzt und stöhnt darüber, daß sie im Rollstuhl sitzen muß, und sie hetzt alle im Haus durch die Gegend, ihr dies und jenes zu holen und sich jeder ihrer Launen zu fügen. Ich habe sie nicht ein einziges Mal sagen hören, daß Martin und sie selbst schuld waren an dem Autounfall, weil sie Pott geraucht hatten. Statt dessen will sie der ungerechten Welt die Schuld daran zuschieben. Ich kenne den wahren Grund, aus dem sie sich darüber beklagt, nach Greenwood gehen zu sollen; sie fürchtet, dort nicht alles, was sie will, auf der Stelle zu bekommen. Wenn sie vorher schon schrecklich verzogen war, dann war das gar nichts im Vergleich zu dem, was sie jetzt ist. Das macht es mir schwer, Mitleid mit ihr zu haben.
Ich habe ihr alles erzählt, was ich über unsere Herkunft weiß, obwohl sie immer noch nicht akzeptieren will, daß ihre Mutter eine Cajun war. Natürlich akzeptiert sie bereitwillig alles, was ich ihr über Grandpère Jack erzähle, wie er die Schwangerschaft unserer Mutter ausgenutzt hat, um ein Geschäft mit Grandpère Dumas zu machen und Gisselle an die Dumas zu verkaufen. Er wußte damals nicht, daß unsere Mutter mit Zwillingen schwanger war, und Grandmère Catherine hat ihm diesen Umstand bis zum Tag unserer Geburt vorenthalten, weil sie nicht bereit war, mich auch zu verkaufen. Ich habe Gisselle gesagt, sie hätte ohne weiteres diejenige von uns beiden sein können, die im Bayou geblieben wäre, und ich hätte diejenige sein können, die in New Orleans aufgewachsen wäre. Diese Möglichkeit läßt sie erschauern, und dann klagt sie eine Zeitlang nicht mehr; trotzdem ist das Zusammensein mit ihr schwer zu ertragen, und ich wünschte manchmal, ich wäre nie aus dem Bayou fortgegangen.
Natürlich denke ich oft an das Bayou und die wunderschönen Tage, die wir gemeinsam verbracht haben, als Grandmère Catherine noch am Leben war und wir beide, Du und ich, die Wahrheit über uns nicht wußten. Wer auch immer gesagt haben mag, daß Unwissenheit selig macht, er hat die Wahrheit gesagt, insbesondere, wenn es um Dich und mich geht. Ich weiß, daß es für Dich schwerer war, mit dieser Wahrheit zurechtzukommen; Du mußtest, vielleicht mehr als ich, mit Lug und Trug leben. Aber wenn ich eins gelernt habe, dann, daß wir vergeben und vergessen müssen, wenn wir auch nur an irgend etwas auf Erden noch Freude haben wollen.
Ja, ich wünschte, wir wären nicht Halbbruder und Halbschwester und, ja, ich käme zu Dir nach Hause, und wir würden uns im Bayou ein gemeinsames Leben aufbauen, denn das ist immer noch das, woran mein Herz am meisten hängt; aber das hat uns das Schicksal nicht bestimmt. Ich möchte, daß wir für immer nicht nur Bruder und Schwester, sondern auch Freunde sind, und Gisselle, nachdem sie Dich jetzt kennengelernt hat, wünscht sich dasselbe. Jedesmal, wenn ich einen Brief von Dir bekomme, besteht sie darauf, daß ich ihn ihr vorlese, und jedesmal, wenn Du sie erwähnst oder sie grüßen läßt, strahlt sie. Man weiß bei Gisselle allerdings nie, woran man ist und ob es sich nicht nur um eine vorübergehende Laune handelt.
Ich freue mich schrecklich über Deine Briefe, aber ich kann doch nichts dagegen tun, daß ich jedesmal ein wenig traurig werde. Ich schließe die Augen und höre die Symphonie der Zikaden oder den Ruf der Eule. Manchmal bilde ich mir ein, Grandmère Catherines Gerichte tatsächlich zu riechen.
Gestern hat Nina uns zum Mittagessen geschmorte Langusten zubereitet, genauso, wie Grandmère Catherine sie gekocht hat, mit einer Buttersauce und kleingehackten grünen Zwiebeln. Sowie Gisselle gehört hat, daß es ein Cajun-Gericht ist, fand sie es natürlich widerlich. Nina hat mir zugezwinkert, und wir haben heimlich miteinander gelacht, denn nur wir beide wußten, daß Gisselle vorher herzhaft zugelangt hatte.
So oder so verspreche ich Dir zu schreiben, sowie wir uns in Greenwood eingewöhnt haben, und falls es Dir möglich ist, wirst Du uns vielleicht demnächst dort besuchen. Aber zumindest weißt Du dann, wohin Du mir schreiben kannst.
Ich möchte gern mehr über das Bayou und die Menschen dort hören, vor allem über Grandmère Catherines Freundinnen. Aber mehr als alles andere möchte ich von Dir hören. Ich nehme an, ein Teil von mir möchte auch etwas über Grandpère Jack hören. Es fällt mir zwar schwer, an ihn zu denken, ohne zugleich an die abscheulichen Dinge zu denken, die er getan hat, aber ich stelle mir vor, daß er inzwischen ein schwächlicher alter Mann ist.
Uns ist so früh in unserem Leben so viel zugestoßen. Vielleicht ... vielleicht haben wir genug Unglück und harte Zeiten durchgemacht, vielleicht können wir den Rest unseres Lebens glücklich verbringen und gute Zeiten haben. Bin ich dumm, wenn ich so etwas denke?
Ich kann deutlich sehen, wie Du mich mit Deinen wunderschönen blauen Augen anlächelst, sie funkeln und strahlen.
Wir haben heute eine sehr warme Nacht. Der Abendwind trägt den Duft von grünem Bambus, Gardenien und Kamelien hoch zu mir. Es ist eine jener Nächte, in denen man meilenweit jeden Laut hören kann. Ich sitze an meinem Fenster und höre die Straßenbahn durch die St. Charles Avenue rattern, und irgendwo spielt jemand Trompete. Es klingt traurig und doch schön.
Jetzt sitzt eine Trauertaube auf dem Geländer der oberen Galerie und stößt ihre Klageschreie aus. Grandmère Catherine hat früher immer gesagt, wenn ich abends zum erstenmal die Taube höre, muß ich jemandem etwas Gutes wünschen, und zwar schnell, sonst wird ihr trauriger Ruf einem Menschen, den ich liebe, Pech bringen. Es ist eine Nacht zum Träumen, eine Nacht für Wünsche. Ich wünsche mir etwas für Dich.
Geh nach draußen, und ruf den Sumpffalken für mich. Und dann wünsch mir etwas.
Wie immer alles Liebe Ruby
1.
Der erste Tag
Das Pochen eines Spechts weckte mich aus meinem unruhigen Schlaf. Ich hatte den größten Teil der Nacht wachgelegen und mich im Bett herumgewälzt, weil ich mir Sorgen gemacht hatte, was der nächste Tag wohl bringen mochte. Endlich waren meine Augen vor Ermüdung zugefallen, und ich wurde in die Welt wirrer Träume gezogen. Ein vertrauter Alptraum begann. Ich trieb in einer Piragua durch den Sumpf. Das Wasser hatte die Farbe von dunklem Tee. Ich hatte keinen Stab zum Staken; die Strömung trug mich fort in die geheimnisvolle Dunkelheit; das Louisianamoos bewegte sich in der leichten Brise wellenförmig, ein gespenstisches Bild. Auf der Wasseroberfläche glitten grüne Schlangen, die meinem Kanu folgten. Die glänzenden Augen einer Eule schauten mich aus der Dunkelheit voller Argwohn an, während ich tiefer und immer tiefer in den Sumpf hinein trieb.
In diesem Alptraum höre ich gewöhnlich ein Baby weinen. Es ist noch zu klein, um Worte zu bilden, doch sein Schrei klingt sehr nach dem Ruf: »Mommy, Mommy.«
Das lockt mich an, aber normalerweise erwache ich aus diesem entsetzlichen Alptraum, ehe ich weiter in die Dunkelheit hineingezogen werde. Letzte Nacht überschritt ich jedoch den Endpunkt, den ich in diesem Traum bisher stets erreicht hatte, ich setzte meinen Weg in die düstere, schwarze Welt fort.
Die Piragua umrundete eine Biegung und bewegte sich etwas schneller voran, bis ich den schimmernden, knochenweißen Umriß eines Skeletts ausmachte, das mit seinem langen, dünnen Zeigefinger in die Dunkelheit vor mir wies und mich drängte, genauer hinzusehen. Da sah ich schließlich das Baby, das allein in einer Hängematte auf der Veranda vor Grandpère Jacks Hütte zurückgelassen worden war.
Die Piragua wurde langsamer, und dann sah ich, wie Grandpères Hütte im Sumpf zu versinken begann. Die Schreie des Babys wurden lauter. Ich versuchte, meine Hände als Paddel zu benutzen und auf die Art schneller voranzukommen, doch sie blieben zwischen grünen Schlangen stecken. Die Hütte sank immer tiefer.
»NEIN!« schrie ich. Tiefer und immer tiefer sank sie, bis nur noch die Veranda und das Baby in der Hängematte zu sehen waren. Das kleine Mädchen hatte ein winziges Gesicht. Ich streckte die Arme aus, als ich näher kam, aber als ich endlich die Hängematte hätte packen können, versank auch die Veranda.
In dem Moment hörte ich das Pochen des Spechts, und als ich die Augen aufschlug, sah ich, daß die Morgensonne ihre Strahlen in mein Zimmer sandte und ihren Schein auf den perlfarbenen seidenen Himmel über meinem riesigen Bett aus dunkler Kiefer warf. Als blühten sie gerade auf, begannen auch die Farben der Blümchentapete in dem warmen Licht an Leuchtkraft zu gewinnen. Obwohl ich kaum geschlafen hatte, war ich froh, mit soviel Sonnenschein zu erwachen, insbesondere nach meinem Alptraum.
Ich setzte mich auf und rieb mir mit den Handflächen das Gesicht, dann holte ich tief Atem und redete mir gut zu, stark zu sein, bereit für den Tag und voller Hoffnung. Von draußen hörte ich die Stimmen der Gärtner, die sich in alle Richtungen verstreuten, um die Hecken zu schneiden, Unkraut zu jäten und die Bananenblätter aus dem Pool zu fischen und von den Tennisplätzen aufzusammeln. Meine Stiefmutter Daphne bestand darauf, daß das Grundstück und die Gebäude allmorgendlich in einen Zustand versetzt wurden, als sei in der Nacht nichts geschehen, ganz gleich, wie stürmisch der Wind geweht hatte oder wie kräftig der Regen heruntergeprasselt war.
Am Vorabend hatte ich die Kleidungsstücke herausgelegt, die ich auf der Reise zu unserer neuen Schule tragen wollte. Da ich damit rechnete, daß meine Stiefmutter meine Aufmachung mit kritischem Blick begutachten würde, hatte ich mich für einen meiner längeren Röcke und eine passende Bluse entschieden. Gisselle hatte sich nach langem Hin und Her erweichen lassen und mir erlaubt, auch ihre Sachen herauszulegen, obwohl sie vor dem Einschlafen gelobt hatte, nie wieder aufzustehen. Ihre Drohungen und Schwüre hallten noch in meinen Ohren.
»Lieber sterbe ich in diesem Bett«, jammerte sie, »als daß ich morgen diese gräßliche Reise nach Greenwood antrete. Denk daran, die Sachen, die du für mich ausgesucht hast, werden die sein, die ich trage, wenn ich meinen letzten Atemzug mache. Außerdem ist das alles deine Schuld!« erklärte sie und ließ sich theatralisch auf ihr Bett zurückfallen.
Solange ich auch schon mit meiner Zwillingsschwester zusammengelebt haben mag, ich habe mich nie daran gewöhnen können, daß wir einander so unähnlich sind, obwohl unser Gesicht und unsere Figur, unsere Augen und unsere Haarfarbe regelrechte Duplikate sind. Und das liegt nicht nur daran, daß wir so verschieden aufgewachsen sind. Ich bin sicher, daß wir schon im Leib unserer Mutter nicht miteinander ausgekommen sind.
»Meine Schuld? Weshalb sollte es meine Schuld sein?« Sie richtete sich auf und stützte sich auf die Ellbogen.
»Weil du in all das eingewilligt hast, und weil Daddy alles tut, womit du einverstanden bist. Du hättest ihm widersprechen und weinen müssen. Du hättest ihm eine hysterische Szene machen müssen. Hast du denn gar nichts von mir gelernt, seit du aus den Sümpfen fortgelaufen bist?« fragte sie erbost.
Lernen, wie man eine hysterische Szene macht? Was sie in Wirklichkeit meinte, war, ich hätte lernen müssen, wie man zu einer verzogenen Göre wird, und das war eine Lektion, die ich wahrhaftig nicht gebrauchen konnte. Ich verschluckte mein Lachen, denn ich wußte, daß es sie nur noch mehr in Wut versetzt hätte.
»Ich tue nur das, wovon ich glaube, daß es für alle Beteiligten das beste ist, Gisselle. Ich dachte, das hättest du verstanden. Daddy will uns hier nicht mehr haben. Er glaubt, wenn wir fort sind, wird das Leben für Daphne und ihn leichter – und für uns beide auch. Vor allem, wenn man bedenkt, was alles passiert ist!«
Sie ließ sich auf das Bett zurücksinken und schmollte. »Man dürfte einfach nicht von mir verlangen, daß ich etwas für andere tue. Nicht nach allem, was mir zugestoßen ist. Alle sollten in erster Linie an mich denken und daran, wie sehr ich leide«, stöhnte sie.
»Mir scheint, das tun ohnehin alle.«
»Wer denn? Wer?« fauchte sie und war plötzlich von Energie und Kraft erfüllt. »Nina kocht, was dir schmeckt, und nicht, was mir schmeckt. Daddy fragt dich nach deiner Meinung, ehe er mich fragt. Beau kommt ins Haus, um dich zu besuchen und nicht mich! Also wirklich ... sieh nur ... sogar unser Halbbruder Paul schreibt nur an dich und nie an mich.«
»Er läßt dich immer grüßen.«
»Aber er schreibt nie einen Brief an mich allein«, sagte sie mit Nachdruck.
»Du hast ihm nie geschrieben«, entgegnete ich.
Darüber dachte sie einen Moment lang nach. »Jungen sollten den ersten Brief schreiben.«
»Vielleicht Jungen, mit denen man befreundet ist, aber doch nicht ein Bruder. Bei einem Bruder spielt es keine Rolle, wer zuerst schreibt.«
»Warum schreibt er mir dann nicht?« jammerte sie.
»Ich werde ihm sagen, daß er dir schreiben soll«, versprach ich ihr.
»Nein, das wirst du nicht tun. Wenn er es nicht von sich aus tut ... dann ... dann ... soll er es eben bleiben lassen. Ich werde einfach für immer hier liegen bleiben und nichts anderes zu tun haben, als wie üblich die Decke anzustarren und mich zu fragen, was wohl die anderen tun, woran sie gerade ihren Spaß haben ... woran du gerade deinen Spaß hast«, fügte sie in scharfem Ton hinzu.
»Du liegst überhaupt nicht da und stellst dir irgendwelche Fragen, Gisselle«, sagte ich und konnte mir das Lächeln nicht länger verkneifen. »Du gehst, wohin du willst und wann du willst. Du brauchst nur mit dem Finger zu schnippen, und schon springen alle. Hat Daddy den Lieferwagen etwa nicht nur deshalb gekauft, damit man dich in deinem Rollstuhl überall hinbringen kann?«
»Ich hasse diesen Lieferwagen. Und ich hasse es, im Rollstuhl transportiert zu werden. Ich komme mir vor wie etwas, das geliefert wird, wie Brot oder ... oder ... Bananenkisten. Ich lasse mich nicht darin transportieren«, beharrte sie.
Daddy hatte vorgehabt, uns in Gisselles Lieferwagen nach Greenwood zu bringen, aber sie hatte sich strikt geweigert. Er hatte den Lieferwagen vor allem wegen der vielen Dinge nehmen wollen, auf denen sie bestand, weil sie glaubte, nicht ohne sie auskommen zu können. Sie hatte Wendy Williams, unser Zimmermädchen, endlose Stunden in ihrem Zimmer gehabt und alles einpacken lassen; sie hatte darauf bestanden, die belanglosesten Kleinigkeiten mitzunehmen, und das nur, um alles noch schwerer zu machen. Ich hatte sie darauf hingewiesen, daß wir im Internat nur begrenzten Platz zur Verfügung haben würden und ohnehin Schuluniformen tragen müßten, aber meine Einwände hatten sie von nichts abbringen können.
»Sie werden mir dort schon Platz machen. Daddy hat gesagt, sie würden alles tun, um mir entgegenzukommen. Und was das Tragen von Schuluniformen angeht ... das werden wir ja sehen.«
Sie wollte ihre Stofftiere mitnehmen – jedes einzelne, ohne Ausnahme –, ihre Bücher und Zeitschriften, die Fotoalben, fast ihre gesamte Garderobe einschließlich all ihrer Schuhe, und sie hatte Wendy sogar die Kosmetik bis auf die letzte Tube einpacken lassen!
»Das wird dir leid tun, wenn du in den Ferien nach Hause kommst«, hatte ich sie gewarnt. »Dann hast du die Dinge, die du brauchst, nicht hier und ...«
»Dann werde ich eben jemanden losschicken, damit er sie mir kauft«, hatte sie selbstgefällig erwidert und plötzlich gelächelt. »Wenn du darauf bestehen würdest, mehr mitzunehmen, dann würde Daddy einsehen, wie furchtbar dieser Transport wird, und es sich vielleicht anders überlegen.«
Gisselles Verschlagenheit überraschte mich immer wieder. Ich hatte ihr geantwortet, wenn sie auch nur halb soviel Energie darauf verwendet hätte, die Dinge zu tun, die sie wirklich tun mußte, statt alles daran zu setzen, sich vor ihren Verantwortlichkeiten zu drücken, dann hätte sie es in jeder Hinsicht zu Erfolgen bringen können.
»Ich bin dann ein Erfolg, wenn ich es sein will, wenn ich es sein muß«, hatte sie erwidert, und ich hatte jedes weitere Gespräch mit ihr aufgegeben.
Jetzt war der Morgen unserer Reise angebrochen, und mir graute davor, in ihr Zimmer zu gehen. Ich brauchte keinen von Ninas Kristallen, um vorauszusagen, was ich zu erwarten hatte. Ich zog mich an und bürstete mein Haar, ehe ich zu ihr ging. Im Korridor begegnete ich Wendy, die aus Gisselles Zimmer geeilt kam; sie war in Tränen aufgelöst und murmelte vor sich hin.
»Was ist los, Wendy?«
»Monsieur Dumas hat mich nach oben geschickt, damit ich ihr helfe, aber sie hört überhaupt nicht auf mich«, klagte sie. »Ich habe sie immer wieder angefleht, sich von der Stelle zu rühren, aber sie liegt nur da wie ein Zombie, kneift die Augen zusammen und stellt sich schlafend. Was soll ich bloß tun?« jammerte sie. »Madame Dumas wird mich anschreien und nicht etwa sie.«
»Niemand wird dich anschreien, Wendy. Ich bringe sie dazu aufzustehen«, sagte ich. »Laß mir nur einen Moment Zeit.«
Sie lächelte und wischte sich die Tränen von den Pausbacken. Wendy war nicht viel älter als Gisselle und ich, aber sie hatte die Schule schon nach der achten Klasse abgebrochen und war Zimmermädchen bei den Dumas geworden. Seit Gisselles Autounfall war Wendy allerdings eher Gisselles Prügelknabe und hatte am meisten unter ihren Wutausbrüchen und hysterischen Anfällen zu leiden. Daddy hatte eine Krankenschwester eingestellt, die sich um Gisselle kümmern sollte, aber sie hatte Gisselles Launen nicht ertragen. Ebensowenig hatten es die zweite und die dritte Krankenschwester bei uns ausgehalten, und daher hatte Wendy das Pech, daß ihr neben ihren übrigen Aufgaben auch noch die übertragen worden war, sich um Gisselle zu kümmern.
»Ich verstehe wirklich nicht, warum du auch nur das Geringste für sie tust«, sagte Wendy; ihre dunklen Augen funkelten wütend.
Ich klopfte an Gisselles Tür, wartete und trat ein, als ich keine Antwort bekam. Es war alles genau so, wie Wendy es mir geschildert hatte: Sie lag noch unter der Decke und hatte die Augen geschlossen. Ich trat ans Fenster und schaute hinaus. Von Gisselles Zimmer aus blickte man auf die Straße. Die Morgensonne glitzerte auf dem Pflaster, und es war kaum Verkehr. An unserem Lattenzaun entlang waren die Azaleen, gelbe und rote Rosen und Hibiskus in einer atemberaubenden Farbenpracht aufgeblüht. Ungeachtet der Zeit, die ich schon in dieser Villa gelebt hatte, auf diesem Anwesen in dem berühmten Garden District von New Orleans, hatte ich doch nie die Ehrfurcht vor den Prachtbauten und der Gartengestaltung verloren.
»Was für ein herrlicher Tag«, sagte ich. »Denk nur an all die schönen Dinge, die wir auf der Fahrt sehen werden.«
»Es ist eine langweilige Fahrt. Ich bin schon in Baton Rouge gewesen. Wir werden nur an häßlichen Ölraffinerien vorbeikommen.«
»Ach du meine Güte, sie ist noch am Leben!« rief ich aus und schlug die Hände zusammen. »Dem Himmel sei Dank. Wir haben alle geglaubt, du seist über Nacht dahingeschieden. «
»Du meinst, das habt ihr euch alle gewünscht«, murrte sie erbost. Sie drehte sich um, ließ den Kopf auf dem großen, weichen Federkissen liegen und schmollte.
»Ich dachte, du hättest dich bereit erklärt, mitzukommen und keinen Aufruhr zu veranstalten, solange du alles mitnehmen darfst, was du mitnehmen willst, Gisselle«, sagte ich und rang um Geduld.
»Ich habe nur gesagt, daß ich aufgebe. Ich habe nicht gesagt, daß ich einverstanden bin.«
»Wir beide haben uns die Broschüren angesehen. Du hast zugegeben, daß es dort schön zu sein scheint«, rief ich ihr ins Gedächtnis zurück. Sie fixierte mich.
»Wie kannst du bloß so ... so ... blauäugig sein? Schließlich mußt du Beau hier zurücklassen, oder hast du das vergessen? Und wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.«
Beau hatte die Mitteilung, daß ich nach Greenwood gehen würde, sehr hart getroffen. Wir hatten es ohnehin schon schwer genug gehabt, einander zu sehen. Seit Daphne meine Zeichnung von Beau entdeckt hatte, hatten wir unsere Romanze geheimhalten müssen. Er hatte mir für einen Akt Modell gestanden, und sie hatte das Bild gefunden und seinen Eltern davon erzählt. Er war hart bestraft worden, und man hatte uns verboten, einander zu sehen. Aber mit der Zeit hatten seine Eltern ihre Vorschriften ein wenig gelockert, vorausgesetzt, daß Beau versprach, auch mit anderen Mädchen auszugehen. In Wirklichkeit tat er das gar nicht, und selbst wenn er zu einem Schulball mit einem anderen Mädchen erschien oder ein anderes Mädchen zu einer Ausfahrt in seinem Sportwagen mitnahm, dann lief es doch immer wieder darauf hinaus, daß wir schließlich zusammenfanden.
»Beau hat versprochen, mich zu besuchen, sooft er kann.«
»Aber er hat dir nicht versprochen, ein Mönch zu werden«, sagte sie prompt, um mir einen Stich zu versetzen. »Ich kenne ein halbes Dutzend Mädchen, die nur darauf warten, ihn in die Krallen zu kriegen, angefangen mit Claudine und Antoinette«, hob sie freudig hervor.
Beau war einer der begehrtesten Jungen in unserer Schule, er sah aus wie der Star einer Fernsehserie. Er brauchte ein Mädchen nur mit seinen blauen Augen anzusehen und zu lächeln, und schon schlug ihr Herz so schnell, daß sie etwas Dummes sagte oder tat. Er war groß und gut gebaut, einer der Footballstars unserer Schule. Ich hatte mich ihm hingegeben, und er hatte mir seine tiefe Liebe geschworen.
Vor meiner Ankunft in New Orleans war er Gisselles Freund gewesen, aber sie hatte ihn mit Begeisterung an der Nase herumgeführt und damit gequält, daß sie auch mit anderen Jungen flirtete und ausging. Sie hatte nie erkannt, wie sensibel und ernsthaft er sein konnte. Für sie waren ohnehin alle Jungen gleich. Sie sah in ihnen Spielzeug, nicht Menschen, denen man trauen konnte und die es verdienten, daß man sich loyal verhielt. Sie konnte sich immer noch nicht in Gesellschaft eines jungen Mannes aufhalten, ohne ihn damit zu quälen, wie sie eine Schulter vielsagend hochzog oder flüsternd versprach, etwas Ungeheuerliches mit ihm zu tun, falls sie jemals miteinander allein sein sollten.
»Ich lege Beau nicht an die Leine«, sagte ich. »Er kann tun, was er will, und er kann es tun, wann er will«, erklärte ich mit einer solchen Gelassenheit, daß sie die Augen weit aufriß. Enttäuschung machte sich auf ihrem Gesicht breit.
»Das ist nicht dein Ernst«, beharrte sie.
»Und ich habe mich von ihm auch nicht an die Leine legen lassen. Wenn wir eine Zeitlang voneinander getrennt sind und das dazu führt, daß er eine andere Freundin findet, jemanden, den er lieber mag, dann war uns das wahrscheinlich ohnehin bestimmt«, sagte ich.
»Ach, du und deine verdammte Schicksalsgläubigkeit. Ich vermute, mir würdest du erzählen, das Schicksal habe es mir bestimmt, für den Rest meines Lebens verkrüppelt zu sein, stimmt’s?«
»Nein.«
»Was denn dann?«
»Ich will nicht schlecht über die Toten sprechen«, sagte ich, »aber wir beide wissen doch, was ihr am Tag des Unfalls getan habt, Martin und du. Dafür kannst du nicht das Schicksal verantwortlich machen.«
Wütend verschränkte sie die Arme.
»Wir haben Daddy versprochen, daß wir der Schule eine Chance geben und einen Versuch unternehmen. Du weißt doch selbst, wie die Dinge hier stehen«, rief ich ihr ins Gedächtnis zurück.
»Daphne haßt mich nicht so sehr, wie sie dich haßt«, gab sie mit glühenden Augen zurück.
»Sei dir dessen nicht so sicher. Sie. ist darauf versessen, uns beide aus ihrem Leben zu entfernen. Du weißt, wie sehr sie uns verabscheut: Wir wissen, daß sie nicht unsere Mutter ist und daß Daddy unsere Mutter mehr geliebt hat, als er sie je lieben könnte. Solange wir in ihrer Nähe sind, kann sie nicht vor der Wahrheit fliehen.«
»Mich hat sie jedenfalls nicht verabscheut, ehe du hier aufgetaucht bist«, wütete Gisselle. »Seitdem ist es mit meinem ganzen Leben nur noch bergab gegangen, und jetzt werde ich in irgendeine Mädchenschule abgeschoben. Wer will schon in eine Schule gehen, in der es keine Jungen gibt?«
»In der Broschüre heißt es, daß die Schule von Zeit zu Zeit mit einer Knabenschule gemeinsame Tanzabende organisiert«, sagte ich. In dem Moment, in dem diese Worte über meine Lippen kamen, bereute ich sie auch schon.
»Tanzveranstaltungen! Kann ich etwa tanzen?«
»Ich bin sicher, daß es viele andere Dinge gibt, die du an den Tagen, an denen sie Greenwood besuchen dürfen, mit den Jungen anfangen kannst.«
»Besuchen dürfen? Das klingt einfach gräßlich, wie in einem Gefängnis.« Sie fing an zu weinen. »Ich wünschte, ich wäre tot. Und wie ich das wünschte. Ich wünschte es wirklich.«
»Jetzt hör aber auf, Gisselle«, flehte ich. Ich setzte mich auf ihr Bett und nahm ihre Hand in meine. »Ich habe dir doch versprochen zu tun, was ich kann, um es dir leichter zu machen, dir bei den Hausaufgaben zu helfen und auch sonst für dich zu tun, was nötig ist, oder etwa nicht?«
Sie zog ihre Hand zurück und rieb sich mit ihren kleinen Fäusten die Augen trocken, ehe sie mich ansah.
»Alles, was ich will?«
»Alles, was du brauchst«, verbesserte ich sie.
»Und wenn die Schule einfach gräßlich ist, wirst du dich dann gemeinsam mit mir gegen Daddy stellen und darauf bestehen, daß er uns wieder nach Hause kommen läßt?« Ich nickte. »Versprich es mir.«
»Ich verspreche es dir, aber es muß wirklich furchtbar sein und nicht nur so, daß dir gewisse Vorschriften nicht passen.«
»Versprich es mir bei ... bei Pauls Leben.«
»O Gisselle.«
»Tu es, oder ich glaube dir nicht«, beharrte sie.
»Also gut. Ich verspreche es dir bei Pauls Leben. Weißt du, manchmal bist du einfach abscheulich.«
»Ich weiß«, lächelte sie. »Und jetzt geh zu Wendy, und sag ihr, daß ich bereit bin, aufzustehen und mich vor dem Frühstück waschen und anziehen zu lassen.«
»Ich bin schon da«, sagte Wendy, die zur offenen Tür hereinkam.
»Du hast uns wohl nachspioniert«, klagte Gisselle sie an. »Uns belauscht.«
»Nein, das habe ich nicht getan.« Wendy sah mich voller Entsetzen an. »Ich spioniere euch nicht nach.«
»Natürlich spioniert sie uns nicht nach, Gisselle.«
»Du meinst, natürlich tut sie es. Sie findet es ganz toll, zu lauschen und durch uns ein romantisches Leben zu führen«, spottete Gisselle. »Hast du nur uns und deine Frauenzeitschriften, Wendy? Oder triffst du dich jede Nacht mit Eric Daniels hinter den Umkleidekabinen?«
Wendy war außer sich vor Verlegenheit. Ihr Mund sprang auf, und sie schüttelte den Kopf.
»Vielleicht sind wir in einer Privatschule wirklich besser dran, wo man uns nicht ständig im Auge behält und uns nachspioniert«, seufzte Gisselle. »Schon gut, schon gut«, fauchte sie. »Hilf mir beim Waschen, und bürste mir das Haar. Steh nicht rum und schau, als wärst du gerade ohne Höschen ertappt worden.«
Wendy keuchte. Ich wandte mich ab, um mein Lachen zu verbergen, und dann eilte ich nach unten, um Daddy zu sagen, daß alles in Ordnung sei: Gisselle würde angekleidet und abreisebereit zum Frühstück erscheinen.
Seit Daphne versucht hatte, mich in der Heilanstalt einsperren zu lassen, und mir die Flucht gelungen war, war das Leben im Hause Dumas schwierig gewesen. Unsere gemeinsamen Mahlzeiten, zu denen es nur kam, wenn wir ausnahmsweise einmal alle da waren und Zeit hatten, verliefen still und förmlich. Daddy scherzte nicht mehr mit Gisselle und mir, und wenn Daphne überhaupt etwas zu sagen hatte, dann ergriff sie meistens abrupt das Wort und äußerte sich kurz und bündig. Die meiste Zeit wurde damit zugebracht, Gisselle zu bemitleiden oder ihr Dinge zu versprechen.
Zwischen uns war zwar angeblich so etwas wie ein Waffenstillstand geschlossen worden, aber Daphne klagte trotzdem ständig und war unaufhörlich darauf aus, Dinge an mir zu finden, die sie kritisieren konnte. Sie hackte ständig auf meinem Vater herum, und ich glaube, das war es, was ihn schließlich zu der Überzeugung brachte, es sei das klügste, uns aus dem Haus zu schaffen und in eine Privatschule zu schicken. Jetzt tat Daphne so, als sei das ihre Idee gewesen, und sie betonte immer wieder, wie wunderbar das für die ganze Familie sei. Meine Vermutung war, daß sie fürchtete, wir würden uns im letzten Augenblick weigern, diese Schule zu besuchen.
Daddy saß allein im Eßzimmer, las die Morgenzeitung und trank seinen Kaffee, als ich nach unten kam. Ein Croissant mit Butter und Gelee lag auf einem kleinen Teller neben seiner Tasse. Er hatte mein Kommen nicht bemerkt, und einen Moment lang konnte ich ihn unbemerkt beobachten.
Unser Daddy war ein umwerfend gut aussehender Mann. Er hatte die gleichen grünen Augen wie Gisselle und ich, aber sein Gesicht war schmaler, seine Wangenknochen waren markanter. In der letzten Zeit schien er um die Taille herum ein wenig zugenommen zu haben, aber er hatte immer noch einen kräftigen Oberkörper. Er war stolz auf sein volles kastanienbraunes Haar und bürstete es immer noch aus der Stirn zurück, aber mittlerweile hatte er nicht mehr nur an den Schläfen graue Strähnen. In der letzten Zeit erweckte er meistens den Eindruck, als sei er müde oder tief in Gedanken versunken. Er verbrachte weniger Zeit außer Haus, ging kaum noch fischen oder jagen und hatte folglich die tiefe Bräune verloren, die er früher immer gehabt hatte.
»Guten Morgen, Daddy«, sagte ich und setzte mich. Er ließ seine Zeitung sinken und lächelte, aber in seinem Blick war ein Zögern, das mir sagte, daß es bereits so früh am Morgen Ärger zwischen ihm und Daphne gegeben hatte.
»Guten Morgen. Bist du aufgeregt?«
»Ja, und ich fürchte mich«, gestand ich ein.
»Hab keine Angst. Das allerletzte, was ich will, ist, euch an einen Ort zu schicken, an dem ihr nicht glücklich seid. Glaub mir.«
»Ja, ich glaube es dir«, sagte ich. Edgar erschien mit einem silbernen Tablett in der Tür, er brachte mir meinen Orangensaft.
»Ich nehme heute morgen auch nur Kaffee und ein Croissant, Edgar.«
»Das wird Nina gar nicht gefallen, Mademoiselle«, warnte er mich. Seine dunklen Augen wirkten noch dunkler als sonst, sein Gesicht niedergeschlagen. Ich sah ihm nach, als er das Eßzimmer verließ, und dann wandte ich mich zu Daddy um, der lächelte.
»Edgar hat dich sehr gern, und es tut ihm leid, daß du fortgehst. Er weiß, ebenso wie ich, daß wir deine Fröhlichkeit und den heiteren Klang deiner Stimme sehr vermissen werden. «
»Dann sollten wir vielleicht doch nicht gehen. Vielleicht ist es ein Fehler«, sagte ich behutsam. »Gisselle klagt immer noch darüber.«
»Gisselle wird immer klagen, fürchte ich«, entgegnete er seufzend. »Nein, nein, wenn es auch bedauerlich ist, so halte ich es doch für das beste für dich. Und für Gisselle«, fügte er eilig hinzu. »Sie verbringt zuviel Zeit allein und ergeht sich in Selbstmitleid. Ich bin sicher, du wirst dafür sorgen, daß ihr das in Greenwood nicht möglich ist.«
»Ich werde mich um sie kümmern, Daddy.«
Er lächelte. »Ich weiß. Sie hat keine Ahnung, wie glücklich sie sich schätzen kann, eine Schwester wie dich zu haben«, sagte er, und um seine müden Augen spielte ein liebevolles Lächeln.
»Kommt Daphne nicht zum Frühstück nach unten?« fragte ich.
»Nein, sie nimmt ihr Frühstück heute im Schlafzimmer ein«, erwiderte er eilig. »Nina hat es ihr gerade nach oben gebracht.«
Es überraschte mich nicht, daß Daphne uns am Tag unserer Abreise soweit wie möglich ignorieren wollte, aber ich hatte fast damit gerechnet, daß sie ihre Schadenfreude zeigen würde. Schließlich bekam sie, was sie wollte: Sie wurde mich los.
»Ich werde am Mittwoch Jean besuchen«, sagte Daddy. »Ich bin sicher, er wird nach dir fragen. Und natürlich nach Gisselle.«
»Sag ihm, daß ich ihm schreiben werde«, erwiderte ich. »Ich tue es auch ganz bestimmt. Ich werde lange Briefe schreiben und ihm alles schildern. Wirst du ihm das von mir ausrichten?«
»Selbstverständlich. Und ich werde euch auch besuchen«, versprach Daddy. Ich wußte, daß er sich schuldig fühlte, weil er Gisselle und mich in eine Privatschule schickte; er hatte im Lauf der letzten Woche mindestens ein dutzendmal versprochen, uns zu besuchen.
Edgar kam mit meinem Croissant und dem Kaffee, Daddy wandte sich wieder seiner Zeitung zu. Ich trank den ersten Schluck Kaffee und knabberte an meinem Croissant, aber ich fühlte mich, als hätte ich einen Fisch im Magen, der beim Schwimmen mit seinem Schwanz meine Eingeweide kitzelte. Wenig später hörten wir das Surren des elektrischen Rollstuhls. Gisselle kam nach unten; wie üblich ächzte und stöhnte sie dabei.
»Dieser Rollstuhl bewegt sich so langsam. Warum kommt Edgar nicht nach oben und trägt mich ins Eßzimmer? Oder Daddy? Jemand sollte ausschließlich zu diesem Zweck eingestellt werden. Ich komme mir so blöde vor. Wendy, hast du gehört, was ich gesagt habe? Tu nicht ständig so, als hättest du mich nicht gehört.«
Daddy ließ seine Zeitung sinken und sah mich kopfschüttelnd an. »Ich sollte besser hingehen und ihr helfen«, sagte er, stand auf und half Wendy, Gisselle ins Eßzimmer zu bringen.
Nina kam aus der Küche gestürzt, stemmte die Arme in die Hüften, blieb in der Tür stehen und funkelte mich finster an.
»Guten Morgen, Nina«, sagte ich.
»Was ist denn das für eine Begrüßung? Du ißt nicht, was Nina für dich zubereitet hat. Du hast die Fahrt nach Baton Rouge vor dir, und du brauchst deine Kraft, hast du gehört? Ich habe heißen Haferbrei gekocht. Ich habe die Eier so gebraten, wie du sie am liebsten magst.«
»Ich vermute, ich bin einfach zu nervös, Nina. Sei mir bitte nicht böse«, sagte ich.
Sie nahm die Hände von den Hüften, kniff die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf. »Nina ist dir nicht böse.« Sie dachte einen Moment lang nach, dann kam sie auf mich zu und zog etwas aus ihrer Tasche. »Das gebe ich dir jetzt, ehe ich es vergesse«, sagte sie und reichte mir ein Zehncentstück mit einem Loch darin, durch das eine Schnur gefädelt war.
»Was ist das?«
»Trag es um den linken Knöchel, hörst du, und keine bösen Geister werden dich verfolgen. Mach schon, bind es dir um den Knöchel«, befahl sie mir. Ich warf einen Blick auf die Tür, um sicherzugehen, daß niemand mir zusah, und dann tat ich eilig, was sie mir gesagt hatte. Sie schien erleichtert zu sein.
»Danke, Nina.«
»In diesem Haus sind überall böse Geister. Man muß auf der Hut sein«, warnte sie und ging zurück in die Küche. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die Amuletten und Talismanen mißtrauen, die Aberglauben und Rituale ablehnen. Meine Grandmère Catherine war eine der angesehensten Heilerinnen im Bayou gewesen, sie hatte böse Geister vertreiben und Menschen von allen möglichen Leiden heilen können. Sie hatte sogar Frauen, die nicht schwanger werden konnten, dazu verholfen, schwanger zu werden. Alle im Bayou, unser Geistlicher inbegriffen, hatten tiefe Hochachtung vor Grandmère gehabt. In der Cajun-Welt, der ich entstamme, vereinen sich Voodoo-Rituale und andere religiöse Haltungen häufig, um eine Weltsicht zu erschaffen, die tröstlicher ist.
»Ich kann diesen Rock nicht leiden«, hörte ich Gisselle klagen, als Daddy sie ins Eßzimmer schob. »Er ist zu lang, und ich komme mir darin vor, als hätte man mir eine Decke über die Beine gebreitet. Du hast ihn nur ausgesucht, weil du meine Beine häßlich findest, stimmt’s?« beschuldigte sie mich.
»Als wir gestern abend deine Kleider herausgelegt haben, warst du damit einverstanden, ihn zu tragen«, erinnerte ich sie.
»Gestern abend wollte ich es einfach hinter mich bringen, damit ich dich nicht länger zu sehen brauchte.«
»Was hättest du gern zum Frühstück, Schätzchen?« fragte Daddy sie.
»Ein Glas Arsen.«
Er verzog das Gesicht. »Gisselle, warum mußt du es uns schwerer machen, als es ohnehin schon ist.«
»Weil ich es hasse, ein Krüppel zu sein, und weil mir die Vorstellung verhaßt ist, in diese Schule abgeschoben zu werden, in der ich keine Menschenseele kenne«, wetterte sie.
Daddy seufzte und sah mich an.
»Gisselle, iß jetzt etwas, damit wir aufbrechen können. Bitte«, flehte ich.
»Ich habe keinen Hunger.« Sie schmollte einen Moment lang und rollte sich dann an den Tisch.
»Was ißt du denn da? Ich nehme dasselbe«, sagte sie zu Edgar. Er verdrehte die Augen und verschwand in die Küche.
Sowie wir gefrühstückt hatten, ging Daddy, um sich um unser Gepäck zu kümmern. Edgar und einer der Gärtner mußten viermal laufen, um alles nach unten zu tragen. Gisselle hatte drei Truhen, zwei Kisten, drei Taschen und ihren Plattenspieler. Ich hatte nur einen einzigen Koffer. Da Gisselle darauf bestand, so viel mitzunehmen, hatte Daddy jemanden engagieren müssen, der uns in dem Lieferwagen folgte.
Als ich Gisselle auf die Veranda schob, von der aus wir beobachten konnten, wie das Gepäck in die Wagen geladen wurde, tauchte Daphne auf dem oberen Treppenabsatz auf. Sie rief uns und kam ein paar Stufen herunter. Sie hatte ihr rotblondes Haar aufgesteckt und trug einen roten chinesischen Morgenmantel und Pantoffeln.
»Ehe ihr aufbrecht«, sagte sie, »möchte ich euch beiden raten, euch ausgezeichnet zu benehmen. Der Umstand, daß ihr beträchtlich weit von hier entfernt sein werdet, heißt noch lange nicht, daß ihr euch aufführen könnt, wie ihr wollt. Ihr müßt immer daran denken, daß ihr Dumas seid und daß alles, was ihr tut, auf den Namen und den Ruf der Familie zurückfällt.«
»Was sollten wir schon anstellen?« ächzte Gisselle. »Es ist ja doch nur eine blöde Mädchenschule.«
»Sei nicht unverschämt, Gisselle. Ihr beide könntet diese Familie in Verruf bringen, ganz gleich, wohin ihr geht. Denkt daran, daß wir Freunde haben, deren Kinder auch dort sind; daher bin ich sicher, daß wir über euer Betragen unterrichtet werden«, drohte sie.
»Wenn du solche Angst davor hast, wie wir uns woanders benehmen könnten, dann schick uns nicht fort«, gab Gisselle zurück. Manchmal hatte ich meinen Spaß an meiner verzogenen Zwillingsschwester – vor allem dann, wenn sie unsere Stiefmutter ärgerte.
Daphne richtete sich abrupt auf und funkelte uns mit ihren blauen, zu Eis gefrorenen Augen an.
»Wenn bei euch beiden überhaupt noch irgend etwas hilft«, sagte sie bedächtig, »dann ist es diese Schule, denn euch fehlt es an Disziplin. Ihr seid von eurem Vater fürchterlich verzogen worden. Das Beste, was euch passieren kann, ist, ihn nicht mehr um euch zu haben.«
»Nein«, entgegnete ich. »Das Beste, was uns passieren kann, ist, dich nicht mehr um uns zu haben, Mutter.« Ich wandte mich ab und schob Gisselle zur Tür.
»Denkt an meine Warnung!« schrie sie, aber ich drehte mich nicht um. Mein Herz pochte, und Tränen der Wut brannten unter meinen Lidern.
»Hast du gehört, was sie gesagt hat?« murmelte Gisselle. »Disziplin. Sie schicken uns in eine Besserungsanstalt. Wahrscheinlich gibt es dort Gitter vor den Fenstern und häßliche alte Matronen, die uns mit dem Lineal auf die Finger schlagen.«
»O Gisselle, jetzt hör aber auf«, bat ich. Sie redete unermüdlich weiter, malte aus, wie furchtbar das alles werden würde, aber ich hörte ihr nicht zu. Statt dessen glitten meine Blicke immer wieder auf die Straße, und ich lauschte, ob nicht doch der Motor eines Sportwagens zu vernehmen war. Beau hatte versprochen herzukommen, ehe wir aufbrachen. Er wußte, daß wir vorhatten, uns gegen zehn auf den Weg zu machen; es war bereits zehn vor zehn, und er war immer noch nicht aufgetaucht.
»Wahrscheinlich kommt er nicht«, spottete Gisselle, als sie mich dabei ertappte, wie ich auf meine Armbanduhr sah. »Ich bin sicher, er hat beschlossen, seine Zeit nicht zu vergeuden. Wahrscheinlich hat er sich für heute schon mit einem anderen Mädchen verabredet. Du weißt ja selbst, daß seine Eltern genau das von ihm erwarten.«
Trotz der tapferen Fassade, die ich aufrechterhielt, fürchtete ich mich wider Willen, sie könnte recht haben. Ich nahm an, daß seine Eltern ihn daran hinderten, sich von mir zu verabschieden.
Aber plötzlich bog sein Sportwagen in die Straße ein. Der Motor dröhnte, und die Bremsen quietschten, als er vor unserem Haus anhielt und aus dem Wagen sprang. Er kam auf die Veranda gelaufen. Gisselle schien tief enttäuscht zu sein. Ich ließ sie allein und eilte ihm entgegen. Wir trafen uns auf halber Höhe der Treppe und umarmten einander.
»Hallo, Gisselle«, sagte er und winkte ihr zu, und dann gingen wir ein paar Schritte, um einen Moment lang allein zu sein. Er sah sich nach dem Gepäck um, das in den Lieferwagen geladen wurde, und schüttelte den Kopf.
»Ihr geht also wirklich fort«, sagte er betrübt.
»Ja.«
»Für mich wird es hier jetzt unerträglich werden. Wenn du gehst, bleibt ein klaffendes Loch in meinem Leben zurück. Die Korridore in der Schule werden mir menschenleer erscheinen. Wenn ich mir vorstelle, auf dem Footballplatz zu sein und dich nicht als Zuschauerin in den Rängen stehen zu sehen ... Geh nicht fort«, flehte er mich an. »Weigere dich einfach.«
»Ich muß, Beau. Mein Vater will es so. Ich werde dir schreiben und dich anrufen und ... «
»Und ich werde kommen und dich besuchen, sooft ich kann«, versprach er. »Aber für mich wird es nicht dasselbe sein wie jetzt, wo ich jeden Morgen beim Aufstehen weiß, daß ich dich bald sehen werde.«
»Mach es mir bitte nicht noch schwerer, als es ohnehin schon ist, Beau.«
Er nickte, und wir liefen weiter durch den Garten. Zwei graue Eichhörnchen huschten rechts neben uns her und beobachteten uns interessiert. Kolibris flatterten um die purpurne Günselranke, während ein Häher, der sich auf einem der unteren Zweige eines Magnolienstrauchs niederließ, nervös mit den Flügeln schlug. In der Ferne trieb eine Schar Wolken auf einer Brise vom Meer her nach Osten, zur Golfküste von Florida. Ansonsten war der Himmel von einem zarten, hellen Blau.
»Es tut mir leid, daß ich es dir so schwermache. Ich bin egoistisch, aber ich kann nichts dafür«, sagte er. Dann seufzte er resigniert und strich sich Strähnen seines goldblonden Haars aus der Stirn. »Dann wirst du jetzt also in eine stinkvornehme Schule gehen. Ich wette, dort lernst du eine Menge reicher junger Männer kennen, Söhne von Ölmagnaten, die dich umgarnen werden.«
Ich lachte.
»Was ist daran so komisch?«
»Gisselle hat mir heute morgen angedroht, daß du dich hier in ein anderes Mädchen verlieben wirst, und jetzt erzählst du mir, daß ich diejenige bin, die sich in einen anderen verlieben wird.«
»In meinem Herzen ist kein Platz für eine andere«, sagte Beau. »Du nimmst zuviel Platz darin ein.«
Wir blieben vor dem alten Stall stehen. Daddy hatte mir erzählt, daß seit mehr als zwanzig Jahren kein Pferd mehr dort untergebracht gewesen sei. Weiter rechts stutzte ein Gärtner einen Bananenbaum, die Wedel stapelten sich bereits neben ihm. Beaus Worte hingen zwischen uns in der Luft. Mir tat das Herz weh, und Tränen des Glücks und der Traurigkeit traten in meine Augen.
»Es ist mein Ernst«, sagte Beau leise. »Ich glaube nicht, daß auch nur eine Nacht vergeht, in der ich nicht an uns beide in deinem Atelier denke.«
»Sag das nicht, Beau«, erwiderte ich und legte einen Finger auf seine Lippen. Er küßte ihn schnell und schmiegte seine Wange an meine Hand.
»Sie können tun, was sie wollen. Sie können sagen, was sie wollen. Sie können dich fortschicken, mich fortschicken, sie können alle erdenklichen Drohungen ausstoßen, aber sie können dich nicht von hier entfernen«, sagte er und preßte meine Hand gegen seine Schläfe. »Und auch von hier nicht«, fügte er hinzu und legte meine Hand auf sein Herz. Ich fühlte seinen beschleunigten Herzschlag und sah mich um, weil ich sichergehen wollte, daß niemand uns beobachtete, als er mich an sich zog und seinen Mund auf meine Lippen preßte.
Es war ein langer, aber zarter Kuß, einer von der Sorte, die meinen Nacken prickeln ließ und meinen Busen wärmte. Seine Küsse waren kleine, elektrisierende Erinnerungen an die Leidenschaft, die uns jetzt miteinander verband. Sie weckten die Erinnerung an seine Berührungen, seine Hände auf meinen Armen, meinen Schultern und schließlich auch auf meinen Brüsten. Sein warmer Atem auf meinen Augen ließ das Bild seines nackten Körpers an jenem Tag wieder vor mir erstehen, an dem er mich gezwungen hatte, ihn zu zeichnen. Wie sehr meine Finger gezittert hatten; und wie sehr sie jetzt zitterten! Meine Regungen waren so enorm, daß sie mir Angst einjagten, denn mir war zumute, als könnte ich dem Haus einfach den Rücken kehren und mit ihm fortlaufen; wir würden rennen, rennen, rennen, bis wir an einem dunklen, weichen Platz ankämen, an dem wir allein wären und einander näher denn je sein würden. Beau weckte Gefühle in mir, von denen ich nicht gewußt hatte, daß sie existierten, Gefühle, die stärker waren, als jede Warnung, jede vernünftige Überlegung jemals hätte sein können. Wenn diese Gefühle freigesetzt worden wären, wäre es unmöglich gewesen, sie jemals wieder im Zaum zu halten.
Ich wich zurück und sagte: »Ich muß jetzt gehen.«
Er nickte, aber als ich mich auf den Rückweg machen wollte, zog er an meiner Hand.
»Warte«, bat er. »Ich möchte dir etwas geben, ohne von einem halben Dutzend von Augenpaaren beobachtet zu werden.« Er steckte die Hand tief in die Tasche und zog ein kleines weißes Schächtelchen heraus, das mit einer winzigen rosa Schleife verschnürt war.
»Was ist das?«
»Pack es aus«, sagte er und drückte es mir in die Hand.
Ich öffnete langsam das Schächtelchen und zog eine Goldkette mit einem Medaillon heraus. Ein winziger, von Diamantsplittern eingefaßter Rubin zierte das Medaillon.
»O Beau, es ist wunderschön! Aber es muß sehr teuer gewesen sein.«
Er zuckte die Achseln, doch sein Lächeln sprach Bände.
»Und jetzt öffne das Medaillon«, sagte er, und ich tat es.
Darin befand sich ein Bild von ihm und daneben eines von mir. Ich lachte und drückte ihm einen Kuß auf die
Wange.
»Danke, Beau. Das ist ein wunderschönes Geschenk. Ich möchte es gleich tragen. Hilf mir mit dem Verschluß.« Ich reichte ihm die Kette und drehte mich um. Er drapierte das Medaillon zwischen meinen Brüsten und ließ den Verschluß der Kette einschnappen. Dann küßte er mich auf den Nacken.
»Wenn irgendein anderer Junge dir nahekommt, muß er jetzt durch mich hindurchgehen, um zu deinem Herzen zu gelangen«, flüsterte er.
»Niemand wird mir so nahe kommen, Beau«, versprach ich.
»Ruby«, hörten wir Daddy rufen. »Es ist an der Zeit, Schätzchen.«
»Ich komme schon, Daddy.«
Wir machten uns auf den Rückweg. Daddy und Edgar holten Gisselle von der Veranda und bugsierten sie auf den Rücksitz des Rolls-Royce. Der Rollstuhl wurde zusammengeklappt und im Lieferwagen verstaut.
»Guten Morgen, Beau«, grüßte Daddy.
»Guten Morgen, Monsieur.«
»Wie geht es deiner Familie?«
»Gut«, sagte er. Obwohl viel Zeit vergangen war und die Wunden verheilt waren, fiel es Daddy und Beau immer noch schwer, miteinander zu reden. Daphne hatte alles daran gesetzt, die Situation zu überspitzen und ihn unmöglich zu machen.
»Bist du fertig, Ruby?« fragte Daddy und schaute von Beau zu mir. Er wußte, was es bedeutete, einen geliebten Menschen zurückzulassen. Seine Augen waren voller Mitgefühl.
»Ja, Daddy.«
Daddy stieg in seinen Wagen, und ich drehte mich zu einem Abschiedskuß zu Beau um. Gisselle hatte den Kopf aus dem Fenster gestreckt.
»Jetzt komm endlich. Ich kann es nicht ausstehen, im Wagen zu sitzen und dann doch nicht loszufahren.«
Beau lächelte sie an und küßte mich.
»Ich rufe an, sowie es geht«, flüsterte ich.
»Und ich komme zu Besuch, sowie es geht. Ich liebe dich.«
»Ich dich auch«, sagte ich eilig und lief um den Wagen herum, um einzusteigen.
»Du könntest mir ruhig auch einen Abschiedskuß geben, Beau Andreas. So lange ist es nun auch noch nicht her, daß du es nicht erwarten konntest, mich zu küssen, sowie es sich nur irgend ergeben hat«, maulte Gisselle.
»Ich werde diese Küsse nie vergessen«, spottete Beau und beugte sich in den Wagen, um ihr einen flüchtigen Kuß zu geben.
»Das war kein Kuß«, sagte sie. »Vielleicht hast du vergessen, wie das geht. Vielleicht brauchst du eine Expertin, die es dir wieder beibringt.« Sie warf einen Blick auf mich und fügte dann hinzu: »Vielleicht wirst du ja üben, solange wir fort sind.« Sie lachte und lehnte sich zurück.
Daddy sprach sich mit dem Fahrer des Lieferwagens ab und ging für den Fall, daß wir voneinander getrennt wurden, die Route nach Baton Rouge noch einmal mit ihm durch.
»Was ist denn das?« fragte Gisselle, als sie das Medaillon sah.
»Ein Geschenk von Beau.«
»Zeig mal her.« Sie beugte sich vor, um das Medaillon in die Hand zu nehmen. Ich mußte mich nach hinten lehnen, damit sie mir die Kette nicht vom Hals zog.
»Sei vorsichtig«, sagte ich.
Sie öffnete das Medaillon und sah unsere Bilder. Ihr Mund sprang auf, und sie warf einen Blick auf Beau, der dastand und sich mit Edgar unterhielt.
»So ein Geschenk hat er mir nie gemacht. Genaugenommen«, schnaubte sie erbost, »hat er mir nie etwas geschenkt.«
»Vielleicht hat er geglaubt, du hättest alles, was du willst.«
Sie ließ das Medaillon los, sank auf dem Sitz zurück und schmollte. Daddy stieg in den Wagen und sah uns an.
»Seid ihr bereit?« fragte er.
»Nein«, erwiderte Gisselle. »Ich werde nie dazu bereit sein.«
»Wir sind bereit zum Aufbruch, Daddy«, sagte ich. Ich blickte Beau an, und meine Lippen bildeten stumm die Worte: »Auf Wiedersehen. Ich liebe dich.« Er nickte. Daddy ließ den Motor an, und wir setzten uns in Bewegung.
Als ich durch die Heckscheibe schaute, sah ich Nina und Wendy auf der Veranda stehen und winken. Ich winkte ihnen, Edgar und Beau zu. Gisselle weigerte sich, sich umzudrehen und Abschied zu nehmen. Sie saß da und schaute haßerfüllt vor sich hin.
Als wir das Tor erreichten, ließ ich meinen Blick langsam über die Fassade des großen Hauses gleiten, bis zu einem Fenster, von dem die Vorhänge zurückgezogen waren. Ich schaute genauer hin und erkannte Daphne, die dort stand und auf uns herunterblickte.
Auf ihrem Gesicht lag ein Lächeln, das tiefe Zufriedenheit ausdrückte.
2.
Noch weiter fort vom Bayou
Als wir aus dem Garden District hinausfuhren und den Weg zum Highway nach Baton Rouge einschlugen, wurde Gisselle unerwartet ruhig. Sie preßte das Gesicht an die Fensterscheibe und schaute auf die olivgrüne Straßenbahn hinaus, die klappernd durch die Esplanade fuhr, und mit hungrigen Blicken beobachtete sie die Leute, die in den Straßencafés saßen, als könnte sie den Kaffee und das frisch gebackene Brot riechen. In New Orleans schien es immer von Touristen zu wimmeln, von Männern und Frauen mit Kameras um den Hals und Reiseführern in der Hand, die von den Villen oder den Statuen angezogen wurden. In manchen Stadtteilen herrschte ein ruhiger, träger Rhythmus, in anderen ging es hektisch und geschäftig zu. Aber die Stadt hatte Charakter und ihre Eigenart, und es war unmöglich, hier zu leben und nicht Teil dieser Stadt zu sein oder sie daran zu hindern, daß sie ein Teil von einem selbst wurde.
Als wir unter dem langen Baldachin von dichtbelaubten Eichen durchfuhren und an den grandiosen Villen und Gärten vorbeikamen, in denen Massen von Kamelien und Magnolien blühten, befiel mich Melancholie. Dieses Gefühl überraschte mich. Mir war nicht klar gewesen, daß ich mich inzwischen hier zu Hause fühlte. Vielleicht lag es an Daddy, vielleicht an Nina, Edgar und Wendy, aber ganz bestimmt lag es an Beau. Ich hatte plötzlich das Gefühl zu wissen, wo ich hingehörte. Ich begriff, daß ich diesen Teil der Welt, den ich vor knapp einem Jahr für mich beansprucht hatte, vermissen würde.
Ich würde Ninas leckere Gerichte vermissen, ihren Aberglauben und ihre Rituale gegen das Böse. Ich würde es vermissen zu hören, wie sie mit Edgar plauderte oder über die Macht eines Krautes oder des bösen Auges stritt. Ich würde vermissen, wie Wendy bei der Arbeit vor sich hin sang, und ich würde Daddys strahlendes und liebevolles Lächeln vermissen, mit dem er mich jeden Morgen begrüßt hatte.
Trotz der Spannung, die Daphne vom Augenblick meiner Ankunft in New Orleans an über unseren Köpfen hatte schweben lassen, wußte ich, daß ich die prächtige Villa mit ihrer riesigen Eingangshalle, den beeindruckenden Gemälden und Statuen und den wertvollen antiken Möbeln vermissen würde. Wie berauschend es für mich in der ersten Zeit gewesen war, mein Zimmer zu verlassen und wie eine Prinzessin in einem Schloß die gewundene Treppe hinunter zu steigen. Würde ich je diesen ersten Abend vergessen, als Daddy mich in das Zimmer geführt hatte, das von da an meins sein sollte? Wie er die Tür geöffnet hatte und mein Blick auf dieses riesige Bett mit den flauschigen Kissen und den Chintzbezügen gefallen war? Ich würde das Gemälde über meinem Bett vermissen, das Bild der wunderschönen jungen Frau, die vor dem Hintergrund eines Gartens einen Papageien fütterte. Ich würde meine großen Kleiderschränke und mein enormes Badezimmer mit der Wanne vermissen, in der ich stundenlang genüßlich liegen konnte.
Ich hatte mich in unserem Haus so wohl gefühlt, und, ja, ich mußte eingestehen, daß ich jetzt verwöhnter war als vorher. Nachdem ich in einem Pfahlbau der Cajun aufgewachsen war, einer Hütte aus dem Holz der Sumpfzypresse mit einem Blechdach, einem Haus, in dem die Zimmer nicht größer gewesen waren als manche der Abstellkammern im Haus der Dumas, hatte ich zwangsläufig vor Ehrfurcht erstarren müssen, als ich mit dem konfrontiert wurde, was von Rechts wegen auch mein Zuhause war. Mit Sicherheit würde ich die Abende vermissen, an denen ich im Garten auf der Terrasse gesessen und gelesen hatte, während die Häher und Spottdrosseln um mich herum flatterten und sich auf den Geländern der Laube niederließen, um neugierig zu schauen. Ich würde es vermissen, die Seeluft zu riechen und gelegentlich in der Ferne ein Nebelhorn zu hören.
Und doch hatte ich kein Recht darauf, unglücklich zu sein. Daddy gab eine Menge Geld dafür aus, uns in diese Privatschule zu schicken, und er tat es, um uns freudlose, triste Tage zu ersparen. Er wollte, daß wir unsere Jahre als Teenager unbeschwert von der finsteren Last früherer Sünden verbringen konnten, Sünden, die wir erst noch verstehen lernen, vielleicht sogar erst noch entdecken mußten. Vielleicht würde mit der Zeit wieder ein wenig Freude in Daddys Leben einkehren. Vielleicht konnten wir dann wieder alle zusammen sein.
Da saß ich nun und glaubte an den blauen Himmel, obwohl sich nur Wolken am Horizont abzeichneten, und ich glaubte an Vergebung, wo nur Zorn und Neid und Selbstsucht waren. Hätte Nina doch wirklich ein magisches Ritual zur Verfügung gehabt, eine Litanei, ein Kraut oder einen alten Knochen, den wir über dem Haus und seinen Bewohnern hätten schwenken können, um die dunklen Schatten zu vertreiben, die in unseren Herzen lebten!
Wir bogen ab und mußten anhalten, um einen Leichenzug passieren zu lassen, und dieser Anblick bestärkte mich in meiner plötzlich aufkeimenden Verzweiflung.
»Na, das ist ja toll«, beschwerte sich Gisselle.
»Es wird nur einen Moment dauern«, sagte Daddy.
Ein halbes Dutzend Farbiger in schwarzen Anzügen spielten Blasinstrumente und wiegten sich zu der Musik. Die Trauergäste, die ihnen folgten, taten es ihnen gleich. Ich wußte, daß Nina darin ein böses Omen gesehen und eines ihrer magischen Pulver in die Luft geworfen hätte. Später hätte sie eine blaue Kerze angezündet, nur um ganz sicherzugehen. Instinktiv bückte ich mich und berührte das magische Zehncentstück, das sie mir geschenkt hatte.
»Was ist das?« fragte Gisselle.
»Nichts weiter, nur ein Talisman, den Nina mir gegeben hat.«
Gisselle verzog höhnisch das Gesicht. »Du glaubst immer noch an dieses dumme Zeug? Das ist mir wirklich peinlich. Leg das Ding ab. Ich will nicht, daß meine neuen Freundinnen wissen, wie rückständig meine Schwester ist«, befahl sie mir.
»Du glaubst an das, woran du glauben willst, Gisselle, und ich glaube an das, woran ich glauben will.«
»Daddy, würdest du ihr bitte sagen, daß sie dieses alberne Amulett und dieses Zeug nicht nach Greenwood mitnehmen kann? Das ist peinlich für die ganze Familie.« Sie wandte sich wieder an mich. »Es wird schon schwer genug sein, deine Herkunft geheimzuhalten«, behauptete sie.
»Ich habe dich nicht gebeten, irgend etwas davon geheimzuhalten, Gisselle. Ich schäme mich meiner Vergangenheit nicht.«
»Das solltest du aber«, sagte sie mürrisch und schaute finster den Trauerzug an, als ärgerte es sie, daß jemand die Unverschämtheit besaß, genau dann zu sterben und beerdigt zu werden, wenn sie eine Straße passieren wollte.
Sowie der Leichenzug vorübergezogen war, fuhr Daddy weiter. In diesem Augenblick ging Gisselle schlagartig wieder auf, daß all das wirklich geschah.
»Ich lasse all meine Freunde zurück. Es dauert Jahre, enge Freundschaften zu schließen, und jetzt habe ich sie alle verloren. «