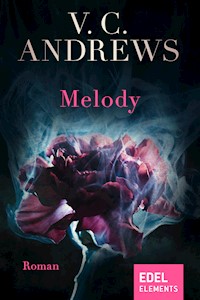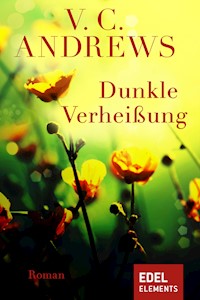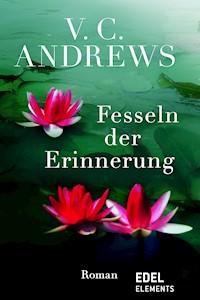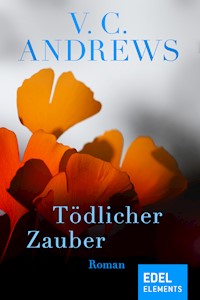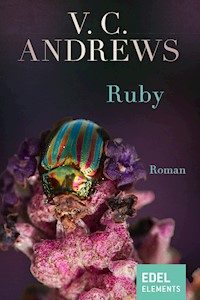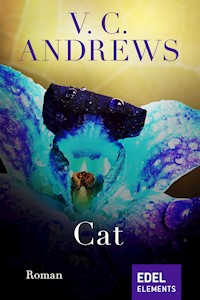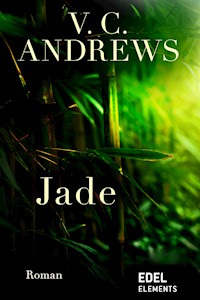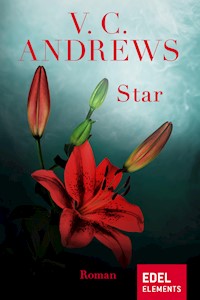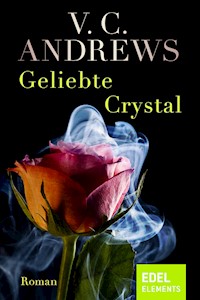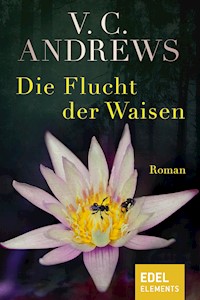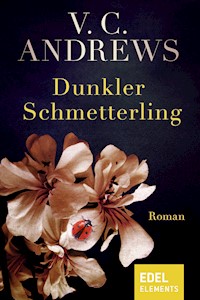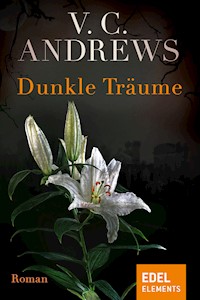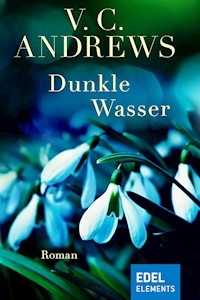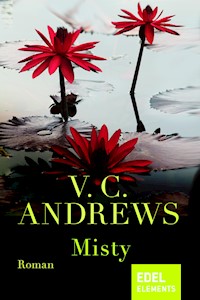V.C. Andrews – eine der erfolgreichsten Bestsellerautorinnen der Welt. Und eine Meisterin der romantischen Spannung!
Mit dem tragischen Tod ihres Vaters findet Melody Morgans geborgene Kindheit ein jähes Ende. Die Familie ihres Vaters nimmt sie auf, doch im Grunde bleibt sie dort eine Fremde. Als Melodys Mutter verschwindet, erfährt sie, daß ein dunkler Schatten auf der Vergangenheit der Eltern ruht und auch ihr eigenes Leben zu bestimmen droht. Melody muss nun lernen, um ihr Glück zu kämpfen ...
Ein spannender Roman voller Romantik und dunkler Geheimnisse – V.C. Andrews´ erfolgreiche Logan-Saga!
1.
Die Liebesfalle
Als ich ein kleines Mädchen war, glaubte ich, die Menschen könnten alles bekommen, was sie wollten, wenn sie es sich nur lange und inbrünstig genug wünschten und brav genug waren. Obwohl ich jetzt fünfzehn bin und schon lange nicht mehr an Feen, den Nikolaus und den Osterhasen glaube, habe ich doch nie aufgehört zu glauben, daß der Welt um uns herum ein ganz bestimmter Zauber innewohnt. Irgendwo gibt es Engel, die über uns wachen, die unsere Wünsche und Träume bedenken und uns gelegentlich, wenn der Zeitpunkt gerade richtig ist und wenn wir es verdient haben, einen Wunsch erfüllen.
Das hat mir Daddy beigebracht. Als ich noch klein genug war, um bequem auf seinem muskulösen rechten Unterarm Platz zu finden und wie eine kleine Prinzessin herumgetragen zu werden, sagte er immer wieder zu mir, ich solle die Augen ganz fest zudrücken und mir etwas wünschen, bis ich meinen Engel aus der Nähe sähe, wie er dicht vor mir mit den Flügeln flatterte wie eine Hummel.
Daddy sagte, jeder hätte einen Engel, der ihm schon bei der Geburt zugeteilt würde, und die Engel täten alles, was sie könnten, um den Menschen Glauben einzuflößen. Er erzählte mir, solange wir noch ganz klein wären, sei es viel leichter, an Dinge zu glauben, die die Erwachsenen als Phantasien bezeichnen würden. Deshalb zeigen die Engel sich uns manchmal, wenn wir klein sind. Ich glaube, manche von uns klammern sich etwas länger oder etwas fester an diese Welt
der Einbildung. Einige von uns scheuen sich nicht, sich selbst und anderen zu gestehen, daß wir immer noch träumen, obwohl wir schon älter sind. Wir wünschen uns tatsächlich etwas, wenn wir die Kerzen auf unserem Geburtstagskuchen ausblasen oder eine Sternschnuppe sehen, und wir warten und hoffen und rechnen sogar fest damit, daß unser Wunsch in Erfüllung gehen wird.
Während ich heranwuchs, habe ich mir so viel gewünscht, daß ich ganz sicher war, mein Engel sei überlastet. Ich konnte nichts dafür. Immer wieder wünschte ich, mein Daddy müsse nicht in die Kohlenbergwerke meilenweit unter der Erde fahren und fern von der Sonne in feuchten, dunklen Höhlen voller Staub arbeiten. Genauso wie die Kinder aller anderen Grubenarbeiter hatte ich in den Eingängen der stillgelegten alten Bergwerke gespielt, und ich konnte mir nicht annäherungsweise ausmalen, wie es wohl sein mußte, tief nach unten zu fahren und einen ganzen Tag unter der Erde und ohne jede frische Luft zu verbringen. Aber genau das mußte der arme Daddy tun.
Solange ich zurückdenken kann, wünschte ich mir, in einem richtigen Haus und nicht in einem Wohnwagen zu leben, obwohl in dem Wohnwagen direkt neben uns Papa George und Mama Arlene lebten, die ich beide von ganzem Herzen liebte. Jedesmal, wenn ich mir ein richtiges Haus für uns wünschte, weitete ich diesen Wunsch noch ein wenig aus und wünschte mir, sie würden unsere Nachbarn im Nebenhaus sein. Wir würden richtige Vorgärten haben, aber auch Gärten hinter dem Haus mit einem gepflegten Rasen und großen Eichen und Ahorn. Papa George würde mir beim Fiedelspiel helfen, und wenn starke Regenfälle herabgingen, würde ich mir nicht mehr so vorkommen, als lebten wir in einer Blechtrommel. Und wenn es windig war, würde ich nicht fürchten müssen, von einer Seite auf die andere geweht zu werden, während ich schlafend in meinem Bett lag.
Meine Wunschliste setzte sich endlos fort. Ich bildete mir ein, wenn ich mir je die Zeit genommen hätte, all meine Wünsche niederzuschreiben, würde das Blatt Papier von einem Ende unseres Wohnwagens zum anderen reichen.
Ich wünschte mir inbrünstig, Mommy wäre nicht ständig so unglücklich gewesen. Sie klagte darüber, daß sie in Francines Frisiersalon arbeiten und anderen Frauen die Haare waschen und ihnen Dauerwellen legen mußte, obwohl alle behaupteten, sie sei eine ganz ausgezeichnete Friseuse. Was sie wirklich liebte, das war der Klatsch, den sie dort zu hören bekam, und sie lauschte auch gern den reichen Frauen, wenn sie von ihren Reisen und den Dingen berichteten, die sie sich gekauft hatten. Aber sie war wie ein kleines Mädchen, das sich die schönen Sachen nur im Schaufenster ansehen konnte und niemals dazu kam, sich selbst etwas zu kaufen.
Selbst dann, wenn sie traurig war, war Mommy immer noch wunderschön. Einer meiner häufigsten Wünsche war der, so hübsch zu werden wie sie, wenn ich erst einmal erwachsen war. Als ich noch kleiner war, hockte ich häufig in ihrem Schlafzimmer und sah zu, wie sie sich vor ihrer Frisierkommode akribisch schminkte und sich das Haar bürstete. Während sie das tat, predigte sie über die große Bedeutung der Schönheitspflege und erzählte mir von all den Frauen in ihrem Bekanntenkreis, die zwar attraktiv waren, sich jedoch vernachlässigten und einfach furchtbar aussahen. Sie sagte zu mir, wenn man hübsch auf die Welt käme, brächte das die Verpflichtung mit sich, daß man sich immer dann, wenn man sich in der Öffentlichkeit zeigte, hübsch zurechtmachte.
»Deshalb verwende ich soviel Zeit auf mein Haar und auf meine Nägel, und deshalb muß ich auch soviel Geld für diese ganz speziellen Hautcremes ausgeben«, erklärte sie mir. Auch mir brachte sie immer Proben von Shampoos und Festigern mit.
Sie besaß parfümierte Badeöle und räkelte sich mehr als eine
Stunde in unserer kleinen Wanne. Ich wusch ihr den Rücken, und als ich alt genug war, lackierte ich ihr die Zehennägel, während sie sich mit der Maniküre befaßte. Gelegentlich lackierte sie auch mir die Fußnägel und frisierte kunstvoll mein Haar.
Die Leute sagten, wir sähen eher wie Schwestern aus und nicht wie Mutter und Tochter. Ich hatte die puppenhaften Gesichtszüge von ihr geerbt, insbesondere die zierliche Stupsnase, aber mein Haar hatte einen helleren Braunton als das ihre, fast schon strohblond. Einmal bat ich sie, mein Haar in demselben Farbton wie ihres zu färben, doch sie schüttelte nur den Kopf und sagte, das solle ich sein lassen, denn mein Haar hätte doch schon eine hübsche Farbe. Ich war jedoch nicht so selbstbewußt im Hinblick auf mein Äußeres wie sie, obgleich Daddy immer wieder zu mir sagte, wie eilig er es hätte, von der Arbeit nach Hause zu kommen, da ihn jetzt bei seiner Rückkehr sogar zwei schöne Frauen erwarteten.
Mein Daddy maß einen Meter neunzig und wog fast fünfundachtzig Kilo, reines Muskelgewebe von den langen Jahren, die er im Kohlebergwerk gearbeitet hatte. Es konnte zwar vorkommen, daß er nach einem sehr langen Tag in der Grube von Schmerzen geplagt wurde und sich nur langsam bewegte, wenn er von der Arbeit heimkam, doch er klagte nie. Wenn sein Blick auf mich fiel, breitete sich immer ein glückliches Strahlen auf seinem Gesicht aus. Ganz gleich, wie müde seine starken Arme auch sein mochten, er breitete sie immer für mich aus und hob mich mühelos in die Luft.
Als ich noch klein war, konnte ich es kaum erwarten, bis er sich über die rissige und gesprungene Schotterstraße schleppte, die vom Bergwerk zu unserem Wohnwagen im Wohnwagenpark Mineral Acres führte. Urplötzlich ließen seine Einsneunzig sein dichtes hellbraunes Haar über dem Hügelgrat auftauchen, und dann sah ich, wie er mit seinen langen Beinen weit ausschritt. Sein Gesicht und seine Hände waren mit Kohlenstaub beschmiert. Er wirkte wie ein Soldat, der von der
Schlacht heimkehrt. Unter den rechten Arm hatte er sich wie einen Fußball seinen Essenskorb geklemmt. Am frühen Morgen schmierte er sich selbst die belegten Brote, weil Mommy immer noch schlief, wenn er aufstand, um sich für die Arbeit fertig zu machen.
Manchmal hob Daddy den Kopf schon vor dem Tor von Mineral Acres und sah, daß ich ihm zuwinkte. Unser Wohnwagen stand nicht weit vom Eingang entfernt, und wenn man davorstand, sah man die Straße, die von Sewell herführte. Wenn er mich sah, beschleunigte Daddy seine Schritte und schwenkte seinen Grubenarbeiterhelm wie eine Flagge. Bis ich etwa zwölf Jahre alt war, mußte ich in der Nähe des Wohnwagens von Papa George und Mama Arlene auf ihn warten, da Mommy im allgemeinen noch nicht von ihrer Arbeit zurückgekehrt war. Oft ging sie danach noch aus und schaffte es nicht, rechtzeitig zum Abendessen nach Hause zu kommen. Meistens suchte sie mit ihren Kollegen und Freundinnen Frankies Bar und Grillroom auf und hörte sich dort die Musik an, die aus der Jukebox dröhnte. Aber Daddy war ein sehr guter Koch, und ich lernte mit der Zeit, selbst recht passabel zu kochen. Daddy und ich aßen mindestens jeden zweiten Tag allein miteinander.
Daddy klagte nicht über Mommys Fernbleiben, und wenn ich mich beschwerte, drängte er mich, mehr Verständnis für sie aufzubringen. »Deine Mutter und ich haben zu jung geheiratet, Melody«, sagte er zu mir.
»Aber wart ihr denn nicht schrecklich ineinander verliebt, Daddy?« Ich hatte Romeo und Julia gelesen und wußte, daß das Alter keine Rolle spielte, wenn man rasend verliebt war. Zu Alice Morgan, meiner besten Freundin, sagte ich, ich würde niemals heiraten, solange ich nicht bis über beide Ohren verliebt war und kaum noch Luft bekam. Sie hielt das für eine Übertreibung und glaubte, wahrscheinlich würde ich mich viele Male verlieben, ehe ich schließlich heiraten würde. Daddys Stimme klang wehmütig. »Oh, doch, das waren wir, aber
wir wollten nicht auf weisere ältere Leute hören. Wir sind ganz einfach ausgerissen und haben heimlich geheiratet, ohne uns Gedanken über die Folgen zu machen. Wir waren beide schrecklich aufgeregt und haben nicht genau über die Zukunft nachgedacht. Für mich war es leichter. Ich war schon immer gesetzter, aber deine Mutter hatte schon bald darauf das Gefühl, irgend etwas verpaßt zu haben. Sie arbeitet in diesem Kosmetiksalon und hört dort, wie die reichen Damen über ihre Reisen und über ihre schönen Häuser reden, und das frustriert sie. Wir müssen ihr eine gewisse Freiheit zugestehen, damit sie nicht das Gefühl hat, wir wollten sie mit all unserer Liebe erdrücken.«
»Wie kann sich jemand von Liebe erdrückt fühlen, Daddy?« fragte ich.
Er lächelte sein strahlendes und liebevolles Lächeln. Wenn er das tat, zog immer ein Schleier vor seine grünen Augen, die träumerisch in die Ferne zu blicken schienen. Dann löste sich sein Blick von meinem Gesicht und fiel auf ein Fenster oder manchmal auch einfach nur auf eine Wand, als sähe er dort Bilder aus der mysteriösen Vergangenheit vorüberziehen. »Nun ja… wenn man einen Menschen so sehr liebt, wie wir beide Mommy lieben, dann möchte man ihn ständig um sich haben. Es ist, als sperrte man ein wunderschönes Vögelchen in einen Käfig. Man fürchtet sich davor, den Vogel freizulassen, und doch weiß man auch, daß er eine noch lieblichere Melodie sänge, wenn man ihn freiließe.«
»Warum liebt sie uns nicht genauso?« fragte ich erzürnt.
»Auf ihre Art tut sie das.« Er lächelte. »Deine Mutter ist die hübscheste Frau in der ganzen Stadt – und im Umkreis von Meilen – und ich weiß, daß sie manchmal das Gefühl hat, hier zu verkümmern, weil sie nicht entsprechend gewürdigt wird. Damit läßt es sich nicht leicht leben, Melody. Immer wieder kommen Leute auf sie zu und sagen ihr, sie sollte Filmschauspielerin werden oder im Fernsehen auftreten oder als Modell
arbeiten. Sie glaubt, daß die Zeit wie im Flug vergeht und daß es bald zu spät für sie sein wird, um noch irgend etwas anderes als meine Ehefrau und deine Mutter zu sein.«
»Ich will nicht, daß sie noch etwas anderes ist als nur das, Daddy.«
»Ich weiß. Sie genügt uns so, wie sie ist. Wir sind dankbar dafür, sie zu haben, aber sie ist schon immer rastlos und impulsiv gewesen. Sie hat immer noch große Träume, und wenn man einen Menschen liebt, dann will man unter gar keinen Umständen dazu beitragen, daß seine Träume sterben.«
»Aber natürlich«, fügte er lächelnd hinzu, »habe ich allen Grund zu glauben, daß du die Berühmtheit dieser Familie werden wirst. Sieh nur, wie gut du das Fiedeln schon von Papa George erlernt hast! Und singen kannst du auch. Du wächst zu einer wunderschönen jungen Frau heran. Eines Tages wird ein Talentsucher auf dich stoßen, dich hier herausholen und dich berühmt machen.«
»O Daddy, das ist doch Unsinn. Kein Talentsucher kommt jemals auf der Suche nach Stars in die Bergarbeitersiedlungen.«
»Dann wirst du eben in New York City oder in Kalifornien das College besuchen«, sagte er mir voraus. »Das ist mein Traum. Wage also bloß nicht, ihn unter einer Müllhalde zu begraben, Melody.«
Ich lachte. Ich hatte noch zuviel Angst davor, solche Träume für mich selbst zu hegen; ich fürchtete mich zu sehr davor, enttäuscht zu werden, und ich wollte mich nicht in der Form gefangen fühlen, in der sich Mommy hier gefangen fühlte.
Ich fragte mich, warum Daddy nicht das Gefühl hatte, in der Falle zu sitzen. Ganz gleich, wie hart ihm das Leben auch mitspielte, er ertrug es mit einem Lächeln, und nie schloß er sich den anderen Bergarbeitern an, wenn sie in der Bar ihren Kummer ertränkten. Er ging allein zur Arbeit und legte auch den Rückweg allein zurück, da die anderen Bergarbeiter in den Elendsvierteln der Stadt hausten.
Wir dagegen wohnten in Sewell, einer Ortschaft, die ihr Entstehen dem Kohlebergwerk zu verdanken hatte; der Bergwerksbetrieb hatte sie auf der Sohle eines kleinen Tales erbaut. An der Hauptstraße gab es eine Kirche, ein Postamt, ein halbes Dutzend Geschäfte, zwei Restaurants, ein Bestattungsunternehmen und ein Lichtspieltheater, das nur an den Wochenenden geöffnet war. Die Baracken der Arbeiter hatten alle denselben bleichen Braunton, und sie waren aus Brettern und Latten gebaut und waren mit Teerpappe gedeckt, aber wenigstens gab es dort Kinder in meinem Alter.
Im Wohnwagenpark Mineral Acres wohnten keine Kinder, die etwa in meinem Alter waren. Wie sehr ich mir doch einen Bruder oder eine Schwester wünschte, die mir Gesellschaft hätte leisten können! Als ich diesen Wunsch einmal Mommy gegenüber äußerte, verzog sie nur das Gesicht und jammerte, sie sei selbst noch ein Kind gewesen, als sie mich bekommen hatte.
»Kaum neunzehn Jahre alt! Und es ist nicht leicht, Kinder auf die Welt zu bringen. Man tut seinem Körper einiges damit an, und dann muß man sich ständig Sorgen machen, sie könnten krank werden oder sich darum kümmern, daß sie genug zu essen und etwas Anständiges zum Anziehen haben, ganz zu schweigen von der Kindererziehung und von der nötigen Ausbildung. Ich habe mich voreilig in die Mutterschaft gestürzt. Ich hätte lieber damit warten sollen.«
»Dann wäre ich niemals geboren worden!« klagte ich.
»Natürlich wärst du geboren worden, aber eben zu einem Zeitpunkt, zu dem die Dinge besser für uns gestanden hätten und wir nicht ganz so schlecht drangewesen wären. Wir waren gerade dabei, folgenschwere Veränderungen in unserem Leben vorzunehmen. Es war alles sehr schwierig.«
Manchmal klang es fast so, als machte sie mir Vorwürfe dafür, daß ich geboren worden war. Es war, als glaubte sie, Babies trieben ziellos umher und warteten darauf, gezeugt zu werden,
und gelegentlich wurden sie ungeduldig und drängten ihre Eltern, sie zu erschaffen. Und genau das hatte ich getan.
Ich wußte, daß wir von Provincetown, Cape Cod, nach Sewell in Monongalia County, West Virginia, gezogen waren, ehe ich geboren worden war, und damals hatten wir nicht viel Geld. Mommy hatte mir erzählt, als sie damals so mittellos, wie sie waren, nach Sewell gekommen waren, sei sie entschlossen gewesen, nicht in einer schäbigen Baracke zu wohnen, und daher hätten sie und Daddy einen Wohnwagen in Mineral Acres gemietet, obwohl dort vorwiegend Rentner wie Papa George lebten.
Papa George war in Wirklichkeit gar nicht mein Großvater, und Mama Arlene war nicht meine wirkliche Großmutter, und doch sah ich die beiden als meine Großeltern an. Mama Arlene hatte oft auf mich aufgepaßt, als ich ein kleines Mädchen war. Papa George war Grubenarbeiter gewesen und war wegen Arbeitsuntauglichkeit pensioniert worden. Er hatte ein Lungenleiden, was sich nach Daddys Angaben noch zusätzlich verschlimmert hatte, weil er sich weigerte, das Rauchen aufzugeben. Seine Krankheit ließ ihn wesentlich älter wirken als zweiundsechzig Jahre. Seine Schultern waren gebeugt, tiefe Falten schnitten sich in sein bleiches, abgearbeitetes Gesicht, und er war so dürr, daß Mama Arlene behauptete, mit einem schweren Wollpullover könnte sie ihn in die Knie zwingen. Dennoch hatten Papa George und ich den größten Spaß miteinander, wenn er mir dabei half, das Fiedeln zu erlernen.
Er beklagte sich darüber, daß Mama Arlene ihn mit ihrem ewigen Nörgeln erschöpfte. Die beiden schienen einander ständig anzukeifen, und doch kannte ich keine zwei anderen Menschen, die derart aneinander hingen. Ihre Auseinandersetzungen waren auch nie wirklich gehässig. Jeder Streit endete mit Gelächter.
Daddy unterhielt sich gern mit Papa George. Vor allem an den Wochenenden konnte man die beiden oft auf ihren Schaukelstühlen
auf dem zementierten Vorplatz unter der Metallmarkise sitzen sehen, während sie leise über Politik oder die Bergbauindustrie diskutierten. Papa George war in den ungestümen Zeiten in Sewell gewesen, als sich die Gewerkschaften für Bergarbeiter bildeten, und er hatte eine Menge Geschichten zu erzählen, die nach Angaben von Mama Arlene nicht für meine Ohren bestimmt waren.
»Warum denn nicht?« protestierte er dann. »Schließlich sollte sie die Wahrheit über diese Gegend und über die Leute wissen, die hier das Sagen haben.«
»Sie hat noch lange genug Zeit, um mit den häßlichen Seiten dieser Welt vertraut zu werden, George O’Neil, ohne dein Zutun, mit dem du sie verfrüht darauf stößt. Und jetzt sei still.«
Er schwieg und murrte tonlos vor sich hin, bis sie ihn mit ihren glühenden blauen Augen ansah und er den Rest seiner zornigen Worte verschluckte.
Daddy stimmte mit Papa George darin überein, daß die Grubenarbeiter ausgebeutet wurden. Es war ein menschenunwürdiges Leben.
Ich konnte nie verstehen, warum Daddy, der in Cape Cod in einer Fischerfamilie aufgewachsen war, ausgerechnet unter Bedingungen arbeitete, die ihn zwangen, den ganzen Tag über auf die Sonne und den Himmel zu verzichten. Ich wußte, daß er das Meer vermißte, und trotzdem kehrten wir nie zum Cape zurück, und wir hatten auch nichts mit Daddys Familie zu tun. Ich wußte noch nicht einmal, wie viele Cousins und Cousinen ich hatte oder wie sie hießen, und meinen Großeltern war ich nie begegnet und hatte auch nie mit ihnen gesprochen. Das Einzige, was ich je gesehen hatte, war eine vergilbte Schwarzweißfotografie von ihnen, auf der Daddys Vater dasaß und seine Mutter hinter ihm stand, und beide schienen unglücklich darüber zu sein, daß sie fotografiert wurden. Sein Vater hatte einen Bart und schien so groß zu sein wie Daddy heute. Seine Mutter wirkte schmächtig, hatte jedoch harte, kalte Augen.
Die Familie in Provincetown zählte zu den Dingen, über die Daddy nicht redete. Er wechselte unweigerlich das Thema und sagte einfach nur: »Wir hatten eben Meinungsverschiedenheiten. Es ist besser, wenn wir einander nicht sehen. Das macht es leichter für alle Beteiligten.«
Ich konnte mir nicht vorstellen, was dadurch leichter werden sollte, doch ich erkannte, daß es für ihn zu schmerzlich war, darüber zu reden. Auch Mommy wollte nie darüber reden. Man brauchte bloß auf die Familie zu sprechen zu kommen, und schon fing sie an zu weinen und beklagte sich darüber, Daddys Familie hätte schon immer eine schlechte Meinung von ihr gehabt, weil sie ein Waisenkind war. Sie erzählte mir, sie sei von Leuten adoptiert worden, die in ihren Augen zu alt waren, um noch ein Kind großzuziehen. Sie waren beide schon in den Sechzigern, als sie ein Teenager war, und sie waren sehr streng. Sie sagte, sie hätte es kaum erwarten können, endlich auszuziehen.
Ich hätte gern mehr über ihre Pflegeeltern und auch über Daddys Familie gewußt, aber ich fürchtete, darüber könne es zu einem Streit zwischen ihr und Daddy kommen, und deshalb hörte ich nach einer Weile auf, Fragen zu stellen. Das bereitete ihren häufigen Auseinandersetzungen jedoch kein Ende.
Eines Abends hörte ich, kurz nachdem ich zu Bett gegangen war, wie sie die Stimmen gegeneinander erhoben. Sie waren in ihrem Schlafzimmer. Der Wohnwagen hatte eine kleine Küche rechts neben der Eingangstür, eine kleine Eßecke und ein Wohnzimmer. Am Ende eines schmalen Ganges war das Bad untergebracht. Mein Schlafzimmer war das erste Zimmer rechts, und Daddys und Mommys Schlafzimmer befand sich am Ende des Wohnwagens.
»Erzähl mir bloß nicht, daß ich mir das alles nur einbilde«, warnte Daddy mit gereizter Stimme. »Die Leute, die Andeutungen machen, sind keine Lügner, Haille.« Ich setzte mich im Bett auf und lauschte. Es war ohnehin schon nicht schwer,
durch die papierdünnen Wände des Wohnwagens Gespräche in Zimmerlautstärke zu belauschen, aber wenn die beiden einander anschrien, dann war es ganz so, als sei ich im selben Zimmer.
»Es sind keine Lügner. Diese Leute sind Klatschbasen, die sich in alles einmischen, weil sie mit ihrem armseligen, langweiligen Leben nichts Besseres anzufangen wissen, als sich Geschichten über andere Leute auszudenken.«
»Wenn du ihnen keine Gelegenheit dazu gibst…«
»Was soll ich denn tun, Chester? Der Mann ist Barkeeper bei Frankie. Er redet mit jedem, nicht nur mit mir«, jammerte sie.
Ich wußte, daß sie sich über Archie Marlin stritten. Ich hatte es Daddy gegenüber nie erwähnt, aber Archie hatte Mommy schon mindestens zweimal nach Hause gefahren. Archie hatte kurzgeschnittenes karottenrotes Haar und eine fahle, weißliche Haut mit Sommersprossen auf dem Kinn und auf der Stirn. Alle behaupteten, er sähe zehn Jahre jünger aus als er war, obwohl niemand sein genaues Alter kannte. Niemand wußte allzuviel über Archie Marlin. Auf Fragen, die sich um ihn selbst drehten, gab er nie eine direkte Antwort. Er beantwortete sie mit einem Scherz oder einem Achselzucken und einer albernen Bemerkung. Angeblich war er in Michigan oder Ohio aufgewachsen und hatte wegen Scheckfälschung sechs Monate im Gefängnis verbracht. Ich konnte nie verstehen, warum Mommy ihn mochte. Sie sagte, er würde viele spannende Geschichten erzählen und hätte eine Menge aufregender Orte wie Las Vegas gesehen.
Im Lauf der Auseinandersetzung im Schlafzimmer sagte sie das jetzt wieder.
»Wenigstens ist er in der Welt herumgekommen. Von ihm kann ich etwas über ferne Orte lernen«, beharrte sie.
»Das ist doch nur hohles Gerede. Der ist doch nirgends gewesen«, gab Daddy vorwurfsvoll zurück.
»Und woher willst du wissen, daß es nur hohles Gerede
ist, Chester? Schließlich bist du doch hier derjenige, der außer Cape Cod und diesem miesen Kaff, das sich Sewell nennt, noch nichts gesehen hat. Und ausgerechnet hierher mußtest du mich bringen!«
»Das hast du dir selbst zuzuschreiben, Haille«, gab er zurück. Plötzlich hörte sie auf, ihn anzukeifen und fing an zu weinen. Wenige Momente später tröstete er sie so leise, daß ich nicht hören konnte, was er sagte, und dann verstummten die beiden.
Ich verstand nicht, was das alles zu bedeuten hatte. Wieso hatte Mommy es sich selbst zuzuschreiben, daß sie hier war? Und weshalb hätte sie sich freiwillig an einen Ort begeben sollen, den sie nicht leiden konnte?
Ich lag wach und hing meinen Gedanken nach. Immer wieder setzte dieses tiefe Schweigen zwischen Mommy und Daddy ein, und beide fürchteten sich davor, diese Lücken zu füllen. Dann endete der Streit, wie auch dieser Streit geendet hatte, und alles würde wieder so sein, als sei nichts vorgefallen, als sei kein Wort gesagt worden. Es war ganz so, als schlössen die beiden immer wieder einen Waffenstillstand nach dem anderen miteinander, weil beide wußten, daß andernfalls etwas Schreckliches passieren würde, daß andernfalls irgendwelche schrecklichen Dinge ausgesprochen würden.
Nichts war in meinen Augen so geheimnisvoll wie die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Ich hatte schon für Jungen geschwärmt, die mit mir zu Schule gingen, und im Moment sah ich Bobby Lockwood gewissermaßen häufiger als alle anderen Jungen. Da meine Freundin Alice das gescheiteste Mädchen in der ganzen Schule war, dachte ich, sie könnte vielleicht etwas über die Liebe wissen, obwohl sie noch nie einen Freund gehabt hatte. Sie war nett, aber unbeliebt, weil sie mindestens zehn Kilo Übergewicht hatte und ihre Mutter sie zwang, sich Zöpfe zu flechten. Sie durfte sich auch nicht schminken, noch
nicht einmal Lippenstift auftragen. Alice las mehr als jeder andere Mensch, den ich kannte, und daher glaubte ich, sie sei vielleicht zufällig auf ein Buch gestoßen, in dem erklärt wurde, was Liebe ist.
Als ich sie danach fragte, dachte sie einen Moment lang nach. Sie erwiderte, es handele sich dabei um etwas Naturwissenschaftliches. »Anders läßt es sich nicht erklären«, behauptete sie auf ihre gewohnt pedantische Art.
»Glaubst du denn nicht, daß eine gewisse Magie dazugehört, eine Art Zauber?« fragte ich sie. Mittwochnachmittags kam sie regelmäßig nach der Schule in unseren Wohnwagen und lernte gemeinsam mit mir für die Geometriearbeit, die wir jeden Donnerstag schrieben. Mir war mit diesem gemeinsamen Lernen mehr gedient als ihr, denn es lief immer wieder darauf hinaus, daß sie mir Nachhilfeunterricht erteilte.
»Ich glaube nicht an Magie«, sagte sie trocken. Sie war nicht besonders gut darin, sich zu verstellen. Tatsächlich war ich ihre einzige echte Freundin, und das mochte teilweise an der schonungslosen Ehrlichkeit liegen, mit der sie ihre Meinung äußerte, wenn es um die anderen Mädchen in der Schule ging.
»Und woher kommt es dann«, fragte ich entrüstet, »daß ein Mann eine ganz bestimmte Frau mit anderen Augen sieht und daß es ihr ebenso ergeht und sie nur noch Augen für ihn hat? Zwischen den beiden muß sich doch etwas ganz Besonderes abspielen, oder etwa nicht?« beharrte ich.
Alice biß sich auf die dicke Unterlippe. Ihre großen, runden braunen Augen bewegten sich von links nach rechts, ganz so, als läse sie Worte, die in die Luft geschrieben waren. Sie hatte die Angewohnheit, auf der Innenseite ihrer linken Backe herumzukauen, wenn sie tief in Gedanken versunken war. Dann sagten die anderen Mädchen in der Schule kichernd: »Alice ißt sich mal wieder selbst auf.«
»Tja«, sagte sie nach einer langen Pause, »wir wissen, daß wir alle aus Protoplasma bestehen.«
»Igitt.«
»Und zwischen Zellen spielen sich chemische Vorgänge ab«, sagte sie und nickte.
»Hör bloß auf damit.«
»Daher kann es sein, daß das Protoplasma eines ganz bestimmten Mannes mit dem Protoplasma einer ganz bestimmten Frau eine chemische Reaktion eingeht. Eine Art Magnetismus. Es handelt sich dabei um nichts weiter als um positive und negative Atome, die aufeinander reagieren, aber die Leute stellen es so hin, als sei es mehr«, schloß sie.
»Es ist mehr«, beharrte ich. »Es muß mehr dahinterstecken! Glauben deine Eltern etwa nicht, daß mehr dahintersteckt?«
Alice zuckte die Achseln. »Sie vergessen nie ihren Hochzeitstag oder wann der andere Geburtstag hat«, sagte sie, und aus ihrem Munde klang es ganz so, als sei das alles, was die Liebe und die Ehe ausmacht.
William, Alices Vater, war der Zahnarzt von Sewell. Ihre Mutter war seine Sprechstundenhilfe, und daher verbrachten die beiden tatsächlich sehr viel Zeit miteinander. Doch jedesmal, wenn ich zu einer Kontrolluntersuchung in die Praxis ging, fiel mir auf, daß sie ihren Mann Doktor Morgan nannte, als sei sie nicht mit ihm verheiratet, sondern lediglich bei ihm angestellt.
Alice hatte zwei Brüder, die beide älter waren. Ihr Bruder Neal hatte bereits die Schule abgeschlossen und besuchte jetzt das College, und ihr Bruder Tommy war im letzten Schuljahr, und es stand jetzt schon fest, daß ihm die Ehre zukommen würde, die Abschlußrede zu halten.
»Streiten deine Eltern je miteinander?« fragte ich Alice. »Ich meine, streiten sie sich richtig heftig?« Ich fragte mich, ob wirklich nur meine Mommy und mein Daddy diese lautstarken Auseinandersetzungen miteinander führten.
»Ihre Streitereien sind nicht besonders schlimm, und sie streiten sich nur sehr selten im Beisein anderer«, sagte Alice. »Gewöhnlich geht es dabei um Politik.«
»Um Politik?« Ich konnte mir nicht vorstellen, daß Mommy sich für Politik interessierte. Sie ging immer weg, wenn Daddy und Papa George eine ihrer Diskussionen begannen.
»Ja.«
»Ich hoffe, wenn ich später einmal heirate«, sagte ich, »werde ich nie Streit mit meinem Ehemann haben.«
»Das ist unrealistisch. Zwischen Menschen, die zusammenleben, müssen gewisse Konflikte entstehen. Das ist ganz normal.«
»Aber wenn sich Menschen streiten, die einander lieben, dann kommt es hinterher immer zur Versöhnung, und es tut beiden schrecklich leid, den anderen verletzt zu haben.«
»Ich nehme an, das kann gut sein«, ließ sich Alice jetzt erbarmen. »Aber vielleicht söhnen sie sich auch nur deshalb miteinander aus, um den Frieden zu wahren. Einmal haben meine Eltern fast eine volle Woche lang nicht miteinander geredet. Ich glaube, das war damals, als sie sich über die letzte Präsidentschaftswahl gestritten haben.«
»Eine Woche!« Ich dachte einen Moment lang nach.
Mommy und Daddy stritten sich zwar, doch es dauerte nie lange, bis sie wieder miteinander redeten und sich so benahmen, als sei nichts vorgefallen. »Haben sie einander denn auch keinen Gutenachtkuß gegeben?«
»Ich weiß es nicht. Ich glaube, das tun sie ohnehin nicht.«
»Sie geben sich nie einen Gutenachtkuß?«
Alice zuckte die Achseln. »Vielleicht doch. Natürlich müssen sie sich früher geküßt und Sex miteinander gehabt haben, denn schließlich sind meine Brüder und ich geboren worden«, sagte sie nüchtern und sachlich.
»Aber das heißt doch, daß sie sich lieben.«
»Wieso?« fragte Alice und kniff ihre braunen Augen skeptisch zusammen.
Ich erklärte ihr den Grund. »Man kann keinen Sex haben, ohne verliebt zu sein.«
»Sex hat an sich nicht das Geringste mit Liebe zu tun«, belehrte sie mich. »Die geschlechtliche Fortpflanzung ist ein natürlicher Prozeß, den alle Lebewesen vollziehen. Es ist ein eingebauter Mechanismus unserer Gattung.«
»Igitt.«
»Hör auf, alles, was ich sage, mit ›Igitt‹ zu kommentieren. Sonst erinnerst du mich noch an Thelma Cross«, sagte sie und lächelte dann. »Du solltest sie am besten fragen, wenn du etwas über Sex wissen willst.«
»Warum denn das?«
»Als ich gestern auf der Toilette war, habe ich belauscht, wie sie mit Paula Temple geredet hat.«
»Worüber?«
»Du weißt schon.«
Ich riß die Augen weit auf.
»Mit wem war sie zusammen?«
»Mit Tommy Getz. Die Dinge, die sie gesagt hat, kann ich unmöglich wiederholen«, fügte Alice errötend hinzu.
»Manchmal frage ich mich tatsächlich«, sagte ich und lehnte mich auf meinem Kissen zurück, »ob wir beide nicht die einzigen Jungfrauen in der ganzen Klasse sind.«
»Na und? Ich würde mich nicht schämen, wenn es so wäre.«
»Ich schäme mich nicht. Ich bin einfach nur…«
»Nur was?«
»Neugierig.«
»Neugier hat schon so manchem geschadet«, warnte Alice. Sie kniff die runden Augen zusammen. »Wie weit bist du mit Bobby Lockwood gegangen?«
»Nicht weit«, sagte ich. Plötzlich starrte sie mich so durchdringend an, daß ich den Blick abwenden mußte.
»Denk an Beverly Marks«, warnte sie mich.
Beverly Marks, die in derselben Klasse war wie wir, war in Verruf geraten, als sie im achten Schuljahr schwanger geworden war und fortgeschickt werden mußte. Bis zum heutigen Tage
wußte niemand, wohin man sie geschickt hatte und was aus ihr geworden war.
»Mach dir um mich keine Sorgen«, sagte ich. »Ich werde mit niemandem Sex haben, den ich nicht liebe.«
Alice zuckte skeptisch die Achseln. Ich ärgerte mich über sie. Manchmal fragte ich mich, weshalb ich überhaupt noch mit ihr befreundet war.
»Wir wollen uns jetzt lieber wieder an die Arbeit machen.« Sie schlug das Lehrbuch auf und ließ den Zeigefinger über die Seite gleiten. »Also, gut. In der Arbeit morgen geht es wahrscheinlich in erster Linie um…«
Plötzlich blickten wir beide auf und lauschten. Wagentüren wurden zugeschlagen, und irgend jemand weinte laut.
»Was hat das zu bedeuten?« Ich trat ans Fenster meines Schlafzimmers. Von dort aus konnte ich die Einfahrt der Wohnwagensiedlung sehen. Ein paar von Mommys Kolleginnen stiegen aus Lois Nortons Wagen. Lois war der Manager des Kosmetiksalons. Die hintere Tür wurde geöffnet, und Lois half Mommy beim Aussteigen. Mommy schluchzte unbeherrscht und wurde von zwei anderen Frauen gestützt, die sie zur Eingangstür unseres Wohnwagens brachten. Ein anderer Wagen, in dem zwei weitere Frauen saßen, hielt hinter Lois Nortons Wagen.
Plötzlich stieß Mommy einen durchdringenden Schrei aus. Mein Herz raste. Ich spürte, wie meine Beine versteinerten; meine Füße schienen am Boden festgenagelt zu sein. Mama Arlene und Papa George kamen aus ihrem Wohnwagen, um nachzusehen, was passiert war. Ich erkannte Martha Supple, als sie mit ihnen sprach. Plötzlich fielen Papa George und Mama Arlene einander um den Hals, und Mama Arlene schlug sich die Hand auf den Mund. Dann eilte Mama Arlene auf Mommy zu, die inzwischen die Stufen fast erreicht hatte. Tränen, die in erster Linie meiner Furcht entsprangen, liefen über meine Wangen.
Alice stand ebenfalls wie versteinert da und war von bösen Vorahnungen gepackt. »Was ist passiert?« flüsterte sie.
Ich schüttelte den Kopf. Irgendwie gelang es mir, mein Zimmer zu verlassen und in dem Moment auf die Tür zuzugehen, als sie geöffnet wurde.
Mommy holte tief Atem, als sie mich sah. »O Melody«, rief sie aus.
»Mommy! Was ist passiert?« fragte ich schluchzend.
»Ein furchtbares Unglück. Daddy und zwei andere Bergarbeiter ... sind tot.«
Ein tiefer Seufzer entrang sich Mommys Kehle. Sie wankte und wäre fast gestürzt, wenn Mama Arlene sie nicht festgehalten hätte. Ihre Augen waren erfüllt von stumpfer, trostloser Qual.
Ich schüttelte den Kopf. Es konnte einfach nicht wahr sein. Und doch stand Mommy vor mir und klammerte sich an Mama Arlene, und all ihre Freundinnen standen mit entsetzlich traurigen Gesichtern um sie herum.
»Nein!« schrie ich und bahnte mir einen Weg ins Freie. Ich schlug mir die Hände auf die Ohren und lief die Stufen hinunter, bloß fort von hier. Ich rannte, ohne zu wissen, welche Richtung ich eingeschlagen hatte, und mir war nicht bewußt, daß ich den Wohnwagen ohne einen Mantel verlassen hatte, obwohl wir Mitte Februar und einen ganz besonders kalten Winter hatten.
Ich war bis zur Biegung des Monongalia River gerannt, als Alice mich endlich einholte. Dort stand ich auf dem Hügel, schlang mir die Arme um die Schultern und keuchte und weinte gleichzeitig, während ich benommen auf die Walnußbäume und die alten Eichen am anderen Flußufer hinuntersah. Ein Reh mit weißer Blume tauchte auf und sah mich neugierig an, während es meinem Schluchzen lauschte.
Ich schüttelte den Kopf, bis ich das Gefühl hatte, er würde mir vom Hals springen, aber irgendwie wußte ich in diesem
Moment bereits, daß kein Nein auf Erden etwas ändern würde. Ich spürte, daß die Welt sich grauenhaft verändert hatte. Ich weinte, bis mir innerlich alles wehtat. Ich hörte, wie Alice meinen Namen rief, und als ich mich umdrehte, sah ich, daß sie nach Luft rang, während sie schnaufend den Hügel heraufgelaufen kam. Sie wollte mich umarmen und mich trösten, doch ich wich zurück.
»Es ist gelogen«, schrie ich hysterisch. »Es ist gelogen. Sag mir, daß sie alle lügen.«
Alice schüttelte den Kopf. »Sie haben gesagt, die Stollenwände seien eingestürzt, und als sie endlich zu deinem Vater und den anderen vordringen konnten…«
»Daddy«, stöhnte ich. »Armer, armer Daddy.«
Alice biß sich auf die Unterlippe und wartete drauf, daß ich aufhören würde zu schluchzen. »Ist dir nicht kalt?« fragte sie.
»Was macht das schon?« fauchte ich sie zornig an. »Was macht jetzt überhaupt noch irgend etwas?«
Sie nickte. Ihre Augen waren ebenfalls rot, und sie zitterte am ganzen Leib, doch was sie beben ließ, das war die Traurigkeit und nicht die winterliche Kälte.
»Laß uns zurückgehen«, sagte ich leise.
Sie lief stumm neben mir her. Ich weiß nicht, wie ich meine Beine dazu brachte, sich in Bewegung zu setzen, doch schließlich erreichten wir den Wohnwagenpark. Die Frauen, die Mommy nach Hause gebracht hatten, waren inzwischen gegangen. Alice folgte mir in den Wohnwagen.
Mommy lag mit einem feuchten Tuch auf der Stirn auf dem Sofa, und Mama Arlene saß neben ihr. Mommy streckte eine Hand nach mir aus, und ich sank vor ihr auf den Fußboden und legte den Kopf auf ihren Bauch. Ich glaubte, alles erbrechen zu müssen, was ich an diesem Tag zu mir genommen hatte. Als ich wenige Momente später wieder aufblickte, war Mommy eingeschlafen. Irgendwo tief in ihrem Innern weinte sie immer noch, dachte ich mir. Gewiß weinte und schrie sie innerlich.
»Ich werde dir jetzt eine Tasse Tee machen«, sagte Mama Arlene mit ruhiger Stimme. »Du bist ja völlig durchgefroren.«
Ich gab keine Antwort, sondern blieb stumm vor dem Sofa auf dem Fußboden sitzen und hielt weiterhin Mommys Hand. Alice stand unbeholfen neben der Tür.
»Ich gehe jetzt besser nach Hause«, sagte sie, »und erzähle meinen Eltern, was vorgefallen ist.«
Ich muß wohl genickt haben, denn Alice packte ihre Bücher zusammen und machte sich zum Gehen bereit.
»Ich komme später wieder«, sagte sie. »In Ordnung?«
Nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, ließ ich den Kopf sinken und weinte leise, bis ich Mama Arlene meinen Namen rufen hörte und sich eine Hand auf meinen Arm legte.
»Setz dich zu mir, Kind. Laß deine Mutter schlafen.«
Ich stand auf und setzte mich zu ihr an den Tisch. Sie schenkte zwei Tassen Tee ein und sagte: »Mach schon. Trink deinen Tee.«
Ich blies auf das heiße Gebräu und nahm einen Schluck.
»Als Papa George noch im Bergwerk gearbeitet hat, habe ich mir ständig Sorgen gemacht, daß so etwas passieren könnte. Es gab immer wieder Grubenunglücke. Wir sollten diese Kohlen in Frieden lassen und eine andere Energiequelle finden«, sagte sie bitter.
»Er kann nicht wirklich tot sein, Mama Arlene. Nicht Daddy.« Ich lächelte sie an und neigte den Kopf auf eine Seite. »Er wird bald nach Hause kommen, nicht wahr? Es ist alles ein Irrtum. Es dauert bestimmt nicht mehr lange, bis er mit seinem Essenskorb unter dem Arm den Hügel hinaufkommt.«
»Kind…«
»Nein, Mama Arlene. Du verstehst das nicht. Daddy hat einen Schutzengel, der über ihn wacht. Sein Engel würde nicht zulassen, daß etwas so Schreckliches passiert. Es ist alles nur ein Irrtum. Sie werden den Schacht freiräumen und Daddy finden.«
»Man hat ihn und die anderen armen Seelen bereits gefunden, Schätzchen.« Sie streckte einen Arm über den Tisch und nahm meine Hand. »Du mußt jetzt stark sein, Melody. Du mußt um deiner Mutter willen stark sein, denn sie ist ein weicher Mensch, verstehst du. In den nächsten Jahren stehen harte Zeiten bevor. Die ganze Stadt trauert.«
Ich warf einen Blick auf Mommy, die mit geschlossenen Augen dalag und die Lippen einen Spaltweit geöffnet hatte. Sie ist so hübsch, dachte ich. Sogar jetzt ist sie so hübsch. Sie ist zu jung, um Witwe zu werden.
2.
Das Grab eines Bergarbeiters
An dem Tag, als wir Daddy begruben, schneite es, doch ich nahm weder die kalten Flocken wahr, die in mein Gesicht trieben, noch den Wind, der mein Haar auf dem Weg zur Kirche und zum Friedhof zerzauste, als wir hinter den Särgen hergingen.
Die Särge von Daddy und den beiden anderen Bergarbeitern standen nebeneinander vor der Kirche und ließen sich nicht voneinander unterscheiden, obwohl ich wußte, daß Daddy der größte der drei Männer und zudem auch noch der jüngste gewesen war. In der Kirche drängten sich Bergarbeiter und ihre Familien, Ladenbesitzer und Mommys Freundinnen und Kolleginnen aus Francines Salon und einige meiner Schulfreunde. Bobby Lockwood schien sich äußerst unbehaglich zu fühlen. Er wußte nicht, ob er mich anlächeln sollte oder ob er einfach nur traurig dreinblicken sollte. Er ruckelte auf seinem Sitz herum, als säße er auf einem Ameisenhügel. Ich schenkte ihm ein winziges Lächeln, und er schien mir dankbar dafür zu sein.
Um mich herum hörte ich, wie die Leute schluchzten und sich die Nase putzten. Ganz hinten in der Kirche weinte ein Säugling. Das kleine Mädchen schluchzte während des ganzen Gottesdienstes. Mir erschien das angemessen.
Papa George sagte, es hätten mehr Vertreter der Bergwerksgesellschaft erscheinen sollen, außerdem hätte man das Bergwerk zu Ehren der Toten für ein paar Tage schließen müssen. Er
und Mama Arlene gingen neben Mommy und mir her, als wir den Särgen zum Friedhof folgten. Bis auf das knirschende Geräusch, das die Schritte der Trauernden auf dem Schnee verursachten, und das ferne Wimmern eines Zuges, der die Kohle abtransportierte, herrschte eine bedrückende Stille. Der Schwall an Klagen, den Papa George vorbrachte, war mir wahrhaftig willkommen.
Er sagte, wenn es nicht zu einem Ölembargo gekommen wäre, das nur dazu diente, Druck auf die Bergarbeiter auszuüben, dann wäre mein Daddy nicht ums Leben gekommen.
»Die Bergwerksgesellschaft hat die Dollarzeichen zu deutlich vor Augen gesehen«, sagte er vorwurfsvoll, »und deshalb haben sie die Bergarbeiter zu weit getrieben. Aber das ist nicht das erste Mal, und ich bin sicher, daß es auch nicht das letzte Mal sein wird.« Wir schritten durch den Granitbogen, der den Friedhofseingang bildete. Engel waren in den Stein gemeißelt.
Mommy hatte sich die Kapuze über den Kopf gezogen und hielt die Augen niedergeschlagen. In regelmäßigen Abständen stieß sie tiefe Seufzer aus und wiederholte: »Ich wünschte, es wäre schon vorüber. Was soll ich zu all diesen Leuten sagen?«
Mama Arlene hing sich bei Mommy ein, tätschelte behutsam ihre Hand und murmelte ihr zu: »Aber, aber, du mußt jetzt stark sein, Haille. Sei stark.«
Papa George blieb an meiner Seite, als wir die Grabstätte erreicht hatten. Tränen traten in seine gesprenkelten braunen Augen, ehe er den Kopf senkte, auf dem zwar inzwischen schneeweißes, aber immer noch dichtes Haar wuchs. Die beiden anderen Bergarbeiter, die mit Daddy zusammengewesen waren, als der Stollen eingestürzt war, wurden am nördlichen Ende desselben Friedhofs in Sewell begraben. Wir konnten hören, wie die Trauergäste Kirchenlieder sangen, denn ihre Stimmen wurden von demselben kalten Februarwind davongetragen, der die Hügel von Virginia und die Bretterbaracken unter dem grauen Himmel mit Schneeflocken überzog.
Wir hoben die Köpfe, als der Geistliche sein Gebet beendet hatte. Er eilte davon, um ein weiteres Gebet am Grab der beiden anderen Bergarbeiter zu sprechen. Mama trug Schwarz und war ungeschminkt, und trotzdem sah sie hübsch aus. Die Traurigkeit hatte schlicht und einfach eine andere Kerze in ihren Augen entzündet. Ihr üppiges kastanienbraunes Haar war zurückgesteckt. Das schlichte schwarze Kleid hatte sie eigens für das Begräbnis gekauft, und darüber trug sie ein Cape mit Kapuze. Der Saum des Kleides reichte nur wenige Zentimeter über ihre Knie, doch ihr schien nicht kalt zu sein, obwohl der Wind den Rock um ihre Beine peitschte. Ihre Benommenheit saß wesentlich tiefer als meine. Ich hielt ihre Hand viel fester umfaßt als sie die meine.
Ich stellte mir vor, wenn Mama Arlene und ich Mommys Arme losgelassen hätten, hätte der Wind sie einfach mit sich getragen, wie einen Drachen, dessen Schnur gerissen war. Ich wußte, wie sehr sich Mommy wünschte, überall auf der Welt zu sein, bloß nicht hier. Traurigkeit war ihr verhaßt. Wenn etwas geschah, was sie unglücklich machte, goß sie sich sonst immer ein Glas Gin-Tonic ein und spielte ihre Musik noch lauter, als könnte sie die Melancholie damit übertönen.
Ich warf einen letzten Blick auf Daddys Sarg, und es fiel mir immer noch schwer zu glauben, daß er tatsächlich darin lag. Schon bald, jeden Moment sogar, würde der Deckel aufspringen, und Daddy würde sich lachend aufrichten und uns erzählen, er hätte sich nur einen kleinen Scherz mit uns erlaubt. Fast hätte ich laut gelacht, als ich mich dieser Hoffnung hingab. Doch der Sarg blieb geschlossen, und die Schneeflocken tanzten über seine schimmernde Oberfläche. Einige blieben auch daran haften und schmolzen zu Tränen. Die Trauergäste defilierten an uns vorbei, und manche umarmten Mommy und mich. Andere gaben uns nur die Hand und schüttelten den Kopf. Alle sagten dasselbe: »Es tut uns leid für euch.« Mommy stand die meiste Zeit über mit gesenktem Kopf da,
deshalb mußte ich die Beileidsbekundungen entgegennehmen und mich bei den Leuten bedanken. Als Bobby mir die Hand drückte, umarmte ich ihn schnell. Diese Geste schien ihn verlegen zu machen, denn er murmelte etwas vor sich hin und eilte mit seinen Freunden davon. Ich konnte es ihm nicht vorwerfen, trotzdem fühlte ich mich wie eine Aussätzige. Mir fiel auf, daß sich die meisten Leute unbeholfen und distanziert benahmen, ganz so, als sei eine Tragödie etwas Ansteckendes, also mied man lieber den Kontakt mit den Betroffenen, um so dieser Krankheit möglichst zu entgehen.
Auf dem Rückweg vom Friedhof schneite es noch heftiger, und da das Begräbnis vorüber war, spürte ich plötzlich, wie sich die Kälte bis in meine Knochen schnitt.
Die Freunde und Angehörigen der beiden anderen Bergleute versammelten sich alle zu einem gemeinsamen Essen. Mama Arlene hatte einen Rostbraten zubereitet, weil sie davon ausgegangen war, daß wir bei ihr essen würden, aber Mommy wollte nichts davon wissen.
»Ich ertrage es keinen Moment länger, traurige Gesichter um mich herum zu sehen«, jammerte sie und schüttelte den Kopf.
»In solchen Momenten braucht man Menschen um sich«, erklärte Mama Arlene.
Daraufhin schüttelte Mommy nur wieder den Kopf und beschleunigte ihre Schritte. Plötzlich war Archie Marlin neben ihr. Er trug Lackschuhe aus Kunstleder und einen grauschillernden Anzug. Sein leuchtend rotes Haar war in der Mitte gescheitelt.
»Ich fahre dich gern nach Hause, Haille«, erbot er sich.
Mommys Augen begannen zu leuchten, und ihr Gesicht bekam wieder etwas Farbe. Nichts konnte sie so schnell aufheitern wie die Aufmerksamkeit eines Mannes. »Danke, Archie. Das ist wirklich sehr nett von dir.«
»Nicht der Rede wert. Ich wünschte, ich könnte mehr für dich tun«, bemerkte er und lächelte mich strahlend an.
Ich sah, daß die runden Augen von Alice, die hinter uns herlief, noch größer wurden.
»Komm schon, Schätzchen.« Mommy wollte mich an der Hand nehmen, doch ich wich zurück.
»Ich gehe mit Alice zu Fuß nach Hause«, sagte ich zu ihr.
»Das ist doch albern, Melody. Es ist kalt.«
»Mir ist nicht kalt«, sagte ich, mühsam das Klappern meiner Zähne unterdrückend.
»Tu, was du willst«, sagte Mommy und stieg in Archies Wagen, an dessen Rückspiegel zwei große Stoffwürfel hingen. Die Sitze hatten flauschige weiße Schonbezüge aus Kunstfaser, die stark haarten. Die krausen Fäden würden gewiß an Mommys schwarzem Kleid haften bleiben, doch das schien sie nicht zu stören. Ehe wir uns auf den Weg zur Kirche gemacht hatten, hatte sie zu mir gesagt, sie würde das Kleid sowieso in die Mülltonne werfen, sobald das alles hier vorbei war. »Ich habe nicht die Absicht, wochenlang zu trauern und schwarz zu tragen«, verkündete sie. »Traurigkeit macht alt und bringt die Toten nicht zurück. Und außerdem kann ich in diesem schwarzen Ding schließlich nicht zur Arbeit gehen.«
»Wann wirst du denn wieder arbeiten gehen, Mommy?« fragte ich erstaunt. Ich glaubte, die Welt würde aufhören, sich zu drehen, nachdem Daddy gestorben war. Wie konnte unser Leben weitergehen?
»Morgen«, sagte sie. »Mir bleibt doch gar nichts anderes übrig. Schließlich haben wir jetzt niemanden mehr, der für uns sorgt, stimmt’s? Was nicht etwa heißen soll, daß er uns eine große Stütze gewesen wäre«, murrte sie.
»Soll ich etwa gleich wieder zur Schule gehen?« fragte ich, und meine Frage entsprang viel mehr meiner Wut als dem Verlangen, die Schule wieder zu besuchen.
»Ja, selbstverständlich. Was willst du denn sonst den ganzen Tag über hier anfangen? Es macht einen nur verrückt, ständig diese vier Wände anzustarren.«
Damit hatte sie nicht ganz unrecht, trotzdem erschien es mir irgendwie nicht richtig, unser Leben einfach so weiterzuführen, als wäre Daddy noch da. Nie wieder würde ich sein Lachen hören oder ihn lächeln sehen. Wie hätte der Himmel jemals wieder blau sein können? Und wie hätte jemals wieder etwas einen süßen Geschmack haben oder schön sein können? Es würde mich nie wieder interessieren, ob ich in einer Arbeit eine Eins schrieb und wie ich mein neuerrungenes Wissen an den Mann bringen konnte. Daddy war ohnehin der einzige gewesen, der sich dafür interessierte, der einzige, der stolz auf mich war. Mommy machte auf mich den Eindruck, als hielte sie Bildung für unwichtig. Sie war der festen Überzeugung, wenn ein Mädchen erst einmal alt genug war, um sich einen Mann zu angeln, dann zählte sowieso nichts anderes mehr.
Als ich mit Alice vom Friedhof nach Hause ging, hatte ich das Gefühl, mein Herz sei zu einem dieser großen Kohlebrocken geworden, die Daddy früher tief unter der Erdoberfläche aus den Wänden der Stollen gehackt hatte: Die Kohle war es, die ihm den Tod gebracht hatte. Alice und ich sprachen unterwegs kaum ein Wort miteinander. Wir mußten die Köpfe gesenkt halten, weil die Schneeflocken, die von dem grauen Himmel fielen, in unsere Augen wehten.
»Ist alles in Ordnung mit dir?« fragte Alice. Ich nickte. »Vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn wir auch in Archie Marlins Wagen mitgefahren wären«, fügte sie kläglich hinzu. Der Wind heulte durchdringend.
»Lieber würde ich durch einen Sturm laufen, der zehnmal schlimmer ist als dieser hier, ehe ich in seinen Wagen steige«, gab ich hitzig zurück.
Als wir Mineral Acres erreichten, sahen wir Archie Marlins Wagen, der vor unserem Wohnwagen geparkt war. Und als wir näherkamen, hörten wir meine Mutter lachen.
Alice schien peinlich berührt zu sein. »Vielleicht sollte ich besser doch nach Hause gehen.«
»Ich wünschte, du könntest noch bleiben«, sagte ich. »Wir gehen in mein Zimmer und machen die Tür hinter uns zu.«
»In Ordnung.«
Als ich die Tür öffnete, fanden wir Mommy und Archie in der Eßecke vor. Auf dem Tisch standen zwei Gläser, eine Flasche Gin und ein Behälter mit Eiswürfeln.
»Bist du immer noch froh darüber, daß du zu Fuß nach Hause gelaufen bist und dir die Füße abgefroren hast?« fragte Mommy. Sie hatte das schwarze Kleid bereits ausgezogen und trug einen Morgenmantel aus blauer Seide. Das Haar fiel ihr gelöst auf die Schultern. Sie hatte Lippenstift aufgetragen.
»Ich habe diesen Spaziergang gebraucht«, sagte ich. Archie sah Alice und mich mit einem breiten Grinsen an.
»Auf dem Herd steht Wasser, falls ihr euch Tee oder eine heiße Schokolade machen wollt«, sagte Mommy.
»Nein, danke, ich möchte im Moment gar nichts.«
»Vielleicht möchte Alice etwas trinken.«
»Nein, danke, Mrs. Logan.«
»Du kannst deiner Mutter ausrichten, daß in meinem Haushalt alles sauber ist«, fauchte Mommy. Alice sah sie ratlos an.
»Sie hat mit keinem Wort das Gegenteil behauptet, Mommy.«
»Nein, wirklich nicht, Mrs. Logan, ich…«
»Schon gut«, sagte Mommy mit einem nervösen kleinen Lachen. Archie lächelte und füllte die beiden Gläser nach.
»Wir gehen in mein Zimmer«, sagte ich.
»Vielleicht hättest du doch zum Leichenschmaus gehen sollen, Melody. Verstehst du, ich habe nichts zum Abendessen im Haus.«
»Ich habe keinen Hunger«, sagte ich. Ich ging durch den kurzen Flur zu meinem Zimmer, und Alice folgte mir. Nachdem ich die Tür geschlossen hatte, warf ich mich auf das Bett und vergrub mein Gesicht im Kissen, um nicht nur mein Schluchzen zu ersticken, sondern auch die Wut, die sich in meiner Brust angestaut hatte.
Alice setzte sich auf das Bett. Sie war so verblüfft und entsetzt, daß sie kein Wort herausbrachte. Kurze Zeit später hörten wir, wie Mommy das Radio einschaltete und einen Sender mit flotter Musik fand.
»Das tut sie nur, weil ihr das Weinen inzwischen unerträglich geworden ist«, erklärte ich. Alice nickte, doch ich sah ihr an, wie unbehaglich sie sich fühlte. »Sie sagt, ich soll gleich morgen wieder in die Schule gehen.«
»Wirklich? Wahrscheinlich ist es das Beste«, fügte sie hinzu und nickte.
»Du hast leicht reden. Dein Daddy ist nicht tot.« Ich bereute meine Worte augenblicklich. »Es tut mir leid. Ich habe es nicht so gemeint.«
»Schon gut.«
»Mir ist klar, daß ich mich nicht ganz so elend fühlen werde, wenn ich so weiterlebe, als sei nichts passiert. Aber was soll ich bloß tun, wenn es an der Zeit ist, daß Daddy vom Bergwerk nach Hause kommt? Ich weiß, daß ich Tag für Tag draußen vor der Tür stehen, auf die Straße hinausschauen und darauf warten werde, daß er wie gewohnt über den Hügel kommt.«
Alices Augen füllten sich mit Tränen.
»Ich sage mir immer wieder, wenn ich lange genug dort stehe, mich genügend darauf konzentriere und all meine Hoffnungen darauf setze, dann wird mir alles nur wie ein böser Traum erscheinen, und alles wird wie früher sein.«
»Nichts wird ihn jemals wieder zurückbringen, Melody«, sagte Alice betrübt. »Seine Seele ist jetzt im Himmel.«
»Warum hat Gott ihn in den Himmel geholt?« fragte ich erbost und trommelte mit den Fäusten auf meine Oberschenkel. »Weshalb bin ich überhaupt geboren worden, wenn ich dann, wenn ich ihn am allermeisten brauche, keinen Daddy haben kann? Ich werde nie mehr in die Kirche gehen!« gelobte ich.
»Es ist albern zu glauben, man könnte Gott etwas heimzahlen«, sagte Alice.
»Das ist mir egal!«
Ihr Gesichtsausdruck besagte deutlich, daß sie mir kein Wort glaubte.
Aber es war mir ernst damit, todernst sogar. Ich holte tief Atem, als die Vergeblichkeit meiner Ausbrüche und die Sinnlosigkeit meiner Wut wie eine Woge über mich hinwegspülten. »Ich weiß nicht, wie wir ohne ihn weiterleben sollen. Vielleicht muß ich jetzt von der Schule abgehen und mir Arbeit suchen.«
»Das kannst du nicht tun!«
»Möglicherweise muß es sein. Mommy verdient nicht viel Geld mit ihrer Arbeit im Kosmetiksalon.«
Alice dachte einen Moment lang darüber nach.
»Aber ihr habt noch die Rente für Bergarbeiter und die Sozialversicherung.«
»Mommy sagt, es wird nicht reichen.«
Wir hörten, wie Mommy und Archie Marlin gleichzeitig in lautes Gelächter ausbrachen.
Alice schnitt eine Grimasse. »Mein Vater begreift nicht, daß Archie Marlin nicht längst im Gefängnis sitzt. Daddy sagt, er verdünnt den Whiskey in der Bar mit Wasser.«
»Mommy versucht nur, gegen ihre Traurigkeit anzukämpfen«, sagte ich. »Im Moment wäre ihr jede Gesellschaft lieb. Es ist reiner Zufall, daß er es ist.«
Alice nickte, schien jedoch nicht recht überzeugt zu sein.
Ich nahm meine Fiedel in die Hand und zupfte die Saiten.
»Daddy hat mir immer so gern zugehört, wenn ich gespielt habe«, sagte ich und lächelte bei dieser Erinnerung.
»Du spielst besser als jeder andere, den ich kenne«, behauptete Alice.
»Ich werde aber nie mehr Fiedel spielen.« Ich warf die Fiedel auf das Bett.
»Natürlich wirst du weiterspielen. Dein Daddy würde doch gewiß nicht wollen, daß du es aufgibst, oder?«
Ich dachte darüber nach. Sie hatte zwar recht, aber ich war im
Moment nicht dazu aufgelegt, irgend jemandem in irgendeinem Punkt zuzustimmen, ganz gleich, worum es ging. Wieder drang Archie Marlins sprudelndes Gelächter in unsere Ohren.
»Dieser Wohnwagen hat Wände aus Pappkarton«, sagte ich und preßte mir die Hände auf die Ohren.
»Du kannst gern mit zu mir kommen«, sagte Alice. »Bis auf meinen Bruder ist niemand zuhause.«
Alice wohnte in einem der schönen Häuser von Sewell. Normalerweise ging ich schrecklich gern zu ihr, aber im Moment erschien es mir als eine Sünde, etwas zu tun, was mir Spaß machte.
Plötzlich hörten wir, daß Mommy und Archie eines der Lieder im Radio mitsangen, und dann ertönte wieder das Lachen der beiden.
Ich stand auf und nahm meinen Mantel. »In Ordnung. Laß uns von hier verschwinden.«
Alice nickte. Sie folgte mir aus meinem Zimmer und durch den kurzen Korridor. Mommy räkelte sich jetzt auf dem Sofa, und Archie stand zu ihren Füßen und hielt seinen Drink in der Hand. Sie sagten kein Wort. Dann streckte Archie einen Arm nach dem Radio aus, um die Lautstärke herunterzudrehen.
»Ich gehe zu Alice.«
»Eine gute Idee, Schatz. Daddy wäre es gar nicht recht, daß du hier im Wohnwagen herumsitzt und Trübsal bläst.«
Am liebsten hätte ich gesagt, es wäre ihm auch nicht recht, daß du mit Archie Marlin lachst und singst und trinkst, doch ich verkniff mir diese Bemerkung und stapfte energisch über den dünnen Läufer zur Tür.
»Komm nicht zu spät nach Hause«, rief Mommy mir nach. Ich gab keine Antwort. Alice und ich setzten uns in Bewegung. Wir hörten, wie die Musik im Radio hinter uns wieder lauter gedreht wurde. Keine von uns beiden sagte auch nur ein Wort, ehe wir die Straßenbiegung hinter uns zurückgelassen hatten und in Richtung Hickory Hill liefen. Die Morgans wohnten
ganz oben auf dem Hügel, und die Fenster ihres Wohnzimmers und ihres Eßzimmers boten einen Ausblick auf das Tal und die eigentliche Ortschaft.
Alices Mutter war sehr stolz auf ihr Haus, von dem sie mir mehr als nur einmal erzählt hatte, es handelte sich dabei um einen sanierten Kolonialbau, ein Haus mit historischer Architektur. Es hatte insgesamt zwölf Zimmer auf zwei Stockwerken und eine Veranda vor der Haustür. Sie hatten eine Garage angebaut. Das Wohnzimmer schien größer als unser ganzer Wohnwagen zu sein, Alices Zimmer war gewiß mindestens doppelt so groß wie meines, und das Zimmer ihre Bruders Tommy war sogar noch größer. Als ich ein einziges Mal einen Blick in das Schlafzimmer ihrer Eltern und das dazugehörige Bad geworfen hatte, hatte ich geglaubt, ich sei in einem Palast.
Tommy war in der Küche, als wir das Haus betraten. Er saß auf einem Hocker, schmierte Erdnußbutter auf eine Scheibe Brot und hatte den Telefonhörer zwischen einem Ohr und einer Schulter eingeklemmt. In dem Moment, als er mich sah, wurden seine Augen groß, und er zog die Augenbrauen hoch. »Ich rufe dich später wieder an, Tina«, sagte er und legte den Hörer auf. »Das mit deinem Vater tut mir leid. Er war wirklich ein netter Kerl.«
»Danke.«
Er sah Alice an und erwartete eine Erklärung dafür, was wir hier zu suchen hatten und weshalb sie mich nach Hause mitgenommen hatte. Alle gaben mir das Gefühl, eine ansteckende Krankheit zu haben. Niemand wollte mit einem so tiefen Kummer wie dem meinen in Berührung kommen.
»Wir gehen rauf in mein Zimmer«, sagte Alice zu ihm.
Er nickte. »Wollt ihr etwas essen? Ich dachte, ich gönne mir einen Happen zwischendurch.«
Ich hatte seit Tagen keine richtige Mahlzeit mehr zu mir genommen, und dieser Vorschlag ließ meinen Magen knurren.