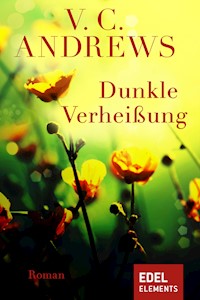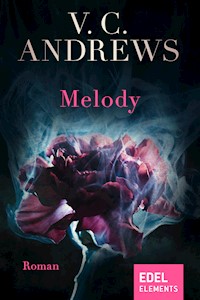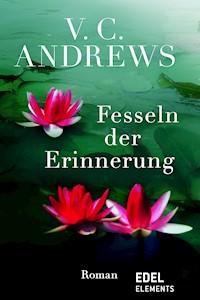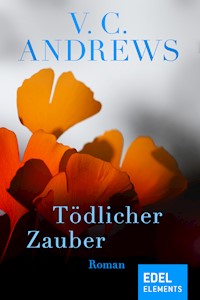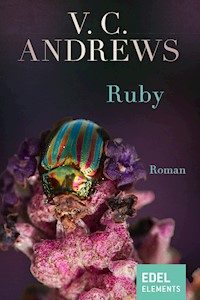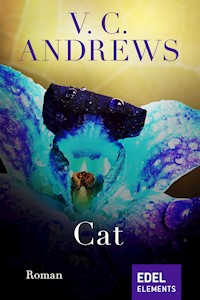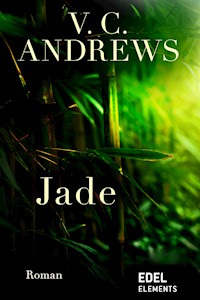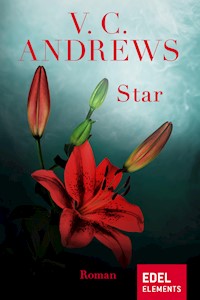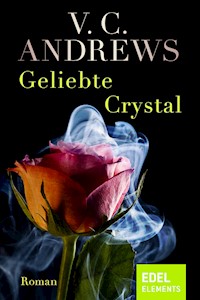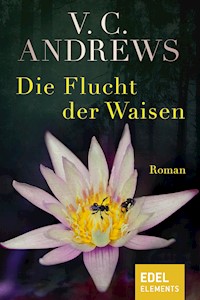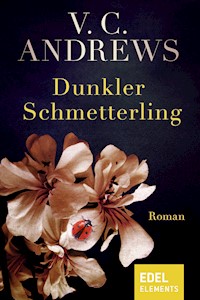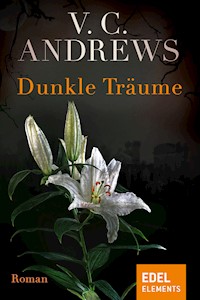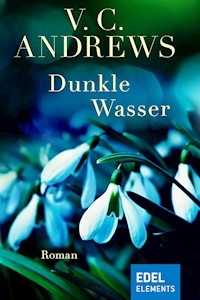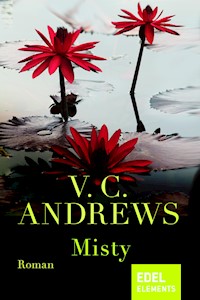V.C. Andrews – eine der erfolgreichsten Bestsellerautorinnen der Welt. Und eine Meisterin der romantischen Spannung!
Hartnäckige, schmutzige Gerüchte begleiten seit langem die ungewöhnlich enge Beziehung der 17-jährigen Logan-Zwillinge Laura und Cary. Umso glücklicher ist Laura, als sie Robert Royce kennen und lieben lernt. Aber Carys Eifersucht wirft Schatten auf ihr junges Glück. Als Lauras Großmutter Olivia schließlich den Umgang mit Robert verbietet, wird dem Mädchen klar: Ihre Liebe steht unter einem bösen Stern ...
Ein spannender Roman voller Romantik und dunkler Geheimnisse – V.C. Andrews´ erfolgreiche Logan-Saga!
Prolog
Vor langer Zeit war mein Leben wie ein Märchen. Alles um mich herum war verzaubert: die Sterne, das Meer und der Sand. Wir waren zwar erst zehn Jahre alt, Cary und ich, aber nachts liefen wir zum Anlegesteg, an dem Daddys Hummerboot festgebunden war, und dort legten wir uns auf unsere Decken und blickten zum Himmel auf. Wir stellten uns vor, wir flögen in den Weltraum hinein, passierten große und kleine Planeten, umkreisten Monde und streckten die Hände nach den Sternen aus, um sie zu berühren. Wir ließen unsere Gedanken schweifen und die Phantasie blühen. Wir sagten einander alles, und niemals schämten wir uns oder waren zu verlegen, um unsere geheimsten Gedanken zu enthüllen, unsere Träume, unsere intimsten Fragen.
Wir waren Zwillinge, aber Cary bezeichnete sich gern als meinen älteren Bruder, weil er, wie Papa sagte, zwei Minuten und neunundzwanzig Sekunden vor mir geboren war. Er benahm sich auch wie ein älterer Bruder, schon von dem Augenblick an, in dem er krabbeln lernte und mich beschützen konnte. Er weinte, wenn ich unglücklich war, und er lachte, wenn er mich lachen hörte, selbst dann, wenn er keine Ahnung hatte, worüber ich lachte. Als ich ihn einmal daraufhin ansprach, sagte er, der Klang meines Lachens sei Musik in seinen Ohren, und er hätte soviel Freude daran, daß er unwillkürlich lächeln und dann selbst auch lachen müsse. Es war, als seien wir verzauberte Kinder, die ihre eigenen Lieder hörten, Melodien, die uns von dem Meer vorgesungen wurden, das wir so sehr liebten.
Soweit ich zurückdenken kann, ist vom Wasser für mich immer ein Zauber ausgegangen. Cary watete oft hinein und kam mit den wunderlichsten Gebilden aus Seetang wieder heraus, auch mit Seesternen, Muscheln und Dingen, von denen er behauptete, das Meer hätte sie von anderen Ländern zu uns gespült. Wenn es um das Meer ging, glaubte ich ihm alles, was er sagte. Manchmal glaubte ich, Cary müßte mit Meerwasser in den Adern geboren sein. Kein anderer Mensch liebte den Ozean so sehr wie er, selbst dann, wenn er sich ungestüm gebärdete.
Wir durften nicht all unsere Entdeckungen behalten, aber diejenigen, die wir mit Daddys Erlaubnis ins Haus brachten, bewahrten wir entweder in Carys Zimmer oder in meinem auf. Wir glaubten fest daran, daß jeder dieser Gegenstände eine gewisse Macht besaß, sei es nun die Kraft, uns einen Wunsch zu erfüllen, oder die Kraft, uns durch die bloße Berührung gesünder oder glücklicher zu machen. Allem, was wir fanden, sprachen wir einen eigenen Zauber zu.
Als ich zwölf Jahre alt war und eine Kette aus den winzigen Muschelschalen trug, die wir gefunden hatten, überraschte es meine Freundinnen in der Schule, mit welcher Sicherheit ich die Muscheln auseinanderhalten konnte und was ich jeder einzelnen von ihnen zuschrieb. Ich erklärte ihnen, wie diese hier die Traurigkeit vertreiben oder eine andere die dunklen Wolken zum Weiterziehen bewegen konnte. Sie lachten, schüttelten die Köpfe und sagten, Cary und ich seien einfach albern und noch dazu unreif. Es sei an der Zeit, daß wir erwachsen würden und unsere kindlichen Vorstellungen ablegten. Für sie besaßen diese Dinge keinen Zauber.
Aber für mich war sogar ein Sandkorn verzaubert. Cary und ich saßen einmal nebeneinander, ließen den Sand durch unsere Finger rieseln und stellten uns vor, jedes einzelne Korn sei eine winzige Welt für sich. In ihr lebten Menschen wie wir, zu winzig, um jemals gesehen zu werden. Man hätte sie sogar mit einem starken Vergrößerungsglas nicht erkennen können.
»Paßt auf, wohin ihr tretet«, sagten wir zu unseren Freunden, wenn sie mit uns am Strand waren. »Ein ganzes Land könnte zerquetscht werden.«
Sie schnitten verwirrte Grimassen, schüttelten die Köpfe und liefen weiter. Wir blieben hinter ihnen zurück, in unsere eigenen Phantasien eingesponnen, Bilder, die niemand sonst sehen wollte. Wir waren so unzertrennlich, daß die Leute vermutlich glaubten, wir wären bei unserer Geburt miteinander verbunden gewesen. Ein paar neidische Freundinnen von mir dachten sich einmal eine Geschichte über mich aus. Sie behaupteten, ich hätte eine lange Narbe, die sich seitlich an meinem Körper vom Unterarm zur Taille zog, und Carys Körper wiese die gleiche Narbe auf. Dort waren wir angeblich bei unserer Geburt zusammengewachsen.
Manchmal dachte ich mir, vielleicht ist es wahr, daß unsere Loslösung voneinander in dem Moment begonnen hat, in dem wir auf die Welt gekommen sind, ein langsamer und schmerzhafter Prozeß. Gegen diese Trennung wehrte sich Cary viel heftiger als ich, später, als wir älter wurden.
Als kleines Mädchen und sogar dann noch, als ich in die höhere Schule kam, war ich dankbar für Carys aufopferungsvolle Hingabe. Es machte mich glücklich und tat mir gut. Andere Geschwister, die ich kannte, stritten miteinander und beleidigten sich gegenseitig, oft sogar in der Öffentlichkeit! Cary war nie wirklich böse auf mich, und wenn er so mit mir redete, daß seine Ungeduld oder seine Gereiztheit sich bemerkbar machten, dann bereute er es hinterher augenblicklich.
Ich wußte, daß andere Mädchen Cary kokett ansahen, mit ihm flirteten und um seine Aufmerksamkeit buhlten. Es entspringt nicht nur der Voreingenommenheit einer Schwester, wenn ich sage, daß Cary gut aussah. Von dem Tag an, an dem er eine Leine auswerfen und einen Eimer tragen konnte, begleitete er Daddy beim Hummerfang und half im Moosbeersumpf. Er war immer braungebrannt, was die Smaragde in seinen
grünen Augen hervorhob, und er trug sein prachtvolles dunkles Haar gern lang, so daß die Strähnen weich in die rechte Hälfte seiner Stirn fielen, bis dicht über die Augenbraue. Sein Haar sah derart seidig aus, daß die Mädchen neidisch darauf waren, und sie verzehrten sich alle danach, ihre Finger durch diese Mähne gleiten zu lassen.
Mein Bruder hielt sich aufrecht und hatte das Auftreten eines selbstbewußten kleinen Mannes, schon in der Grundschule. Andere Jungen machten sich immer wieder über seine Kopfhaltung und die zurückgezogenen Schultern lustig, wenn er neben mir herlief, zielstrebig ausschritt und mit verkniffenen Lippen starr in die Richtung sah, die wir eingeschlagen hatten. Sie begannen jedoch schon bald, ihn zu beneiden, und unsere Mitschülerinnen sahen ihn ganz selbstverständlich als älter und reifer an.
Es mißlang ihnen jedoch, seine Aufmerksamkeit und sein Interesse auf sich zu ziehen. Daher waren sie so frustriert, daß sie schließlich Trost darin suchten, sich über uns lustig zu machen. In der höheren Schule fingen sie schnell an, Cary »Opa« zu nennen. Ihm schien das nichts auszumachen, falls er es überhaupt wahrnahm. Ich war sicher, daß es mich mehr störte als ihn. Man mußte Cary schon Beleidigungen ins Gesicht sagen oder mich in seiner Gegenwart verletzen, um ihm eine Reaktion zu entlocken, aber dann reagierte er nahezu gewalttätig. Dabei spielte es überhaupt keine Rolle, ob der andere Junge größer war als er oder ob es mehrere waren. Cary war von Natur aus aufbrausend, und wenn seine Wut einmal entfacht war, dann wirkte sie sich so verheerend aus wie ein Orkan. Seine Augen wurden glasig, und seine Lippen spannten sich, bis die Mundwinkel weiß wurden. Jeder, der ihn vorsätzlich provozierte, wußte, daß es auf eine Prügelei hinauslaufen würde.
Natürlich brachte sich Cary immer wieder in Schwierigkeiten, auch wenn seine Reaktion noch so gerechtfertigt sein mochte. Immer wieder war er derjenige, der die Selbstbeherrschung
verlor, und gewöhnlich war es auch er, der seinen Gegnern den größten Schaden zufügte. Fast jedesmal, wenn er vom Unterricht suspendiert wurde, bekam er von Daddy eine Tracht Prügel und wurde in sein Zimmer gesperrt, aber nichts, was Daddy tun konnte, und keine Strafe, die die Schule über ihn verhängen würde, hätte ihn zurückgehalten, wenn er glaubte, meine Ehre sei in irgendeiner Weise angegriffen worden.
Da ich einen so hingebungsvollen und anhänglichen Beschützer hatte, der über mich wachte, hielten andere Jungen Abstand von mir. Erst als wir in die Highschool eingeschult wurden, begriff ich, wie unantastbar ich in ihren Augen war. Viele Mädchen in meinem Alter waren in Jungen verknallt oder hatten Freunde, aber kein einziger Junge wagte es, mir im Unterricht einen Zettel zuzustecken, und keiner von ihnen schloß sich mir in den Korridoren an, wenn wir von einem Klassenzimmer zum anderen gingen, ganz zu schweigen davon, daß mich einer von ihnen nach Hause begleitet hätte. Ich lief neben anderen Mädchen her, oder Cary war an meiner Seite, und wenn ich mit anderen Mädchen zusammen war, dann folgte Cary uns im allgemeinen wie mein Wachhund.
Im zweiten Jahr in der Highschool wollte ich jedoch, wie die meisten meiner Freundinnen, einen Jungen, der ernsthaftes Interesse an mir zeigte. Es gab einen Jungen, den ich sehr attraktiv fand: Er hieß Stephen Daniel und lebte erst seit einem Jahr in Provincetown. Ich wünschte mir, er würde mit mir reden, mich auf dem Schulweg begleiten oder mich sogar zu einer Verabredung auffordern. Ich glaubte auch, daß er das wollte, denn er sah mich oft an, aber er sprach mich trotzdem nie an. Damals erzählten mir all meine Freundinnen, er hätte gern mit mir geredet, aber sie sagten auch, er täte es wegen meines Bruders nicht. Stephen fürchtete sich vor Cary.
Das erwähnte ich Cary gegenüber, und er sagte, Stephen Daniels sei dumm und würde mit jedem Mädchen ausgehen, von dem er bekam, was er wollte. Er sagte, das wüßte er, weil
er selbst im Umkleideraum gehört hätte, wie er darüber redete. Später fand ich dann heraus, daß Cary tatsächlich auf ihn zugegangen war und ihn gewarnt hatte, er würde ihm das Genick brechen, wenn er mich auch nur ansah. Natürlich war ich enttäuscht, und doch fragte ich mich unwillkürlich, ob Cary nicht vielleicht doch recht gehabt hatte.
Abends, nachdem wir unsere Hausaufgaben gemacht und Mom mit May geholfen hatten, unserer kleinen Schwester, die taub geboren worden war und eine Sonderschule für Behinderte besuchte, sprachen Cary und ich über unsere Mitschüler.
Er fand an all meinen Freundinnen etwas auszusetzen. Das einzige Mädchen, an dem er keine Kritik übte, war Theresa Patterson, Roy Pattersons älteste Tochter. Theresas Vater Roy arbeitete zusammen mit Daddy auf dem Hummerboot. Die Pattersons waren Bravas, halb Afroamerikaner, halb Portugiesen. Die anderen Schülerinnen rümpften verächtlich die Nase, wenn es um Bravas ging, vor allem diejenigen, die aus sogenannten blaublütigen Familien stammten, Familien, die ihren Stammbaum auf die Pilgerväter zurückverfolgen konnten, Familien wie die, der Großmama Olivia entstammte, Daddys Mutter, die wie eine Königinwitwe über uns herrschte.
Cary mochte Theresa und genoß es, mit ihr befreundet zu sein, denn ihm gefiel, wie sie und die anderen Bravas ihren Mitschülern die Stirn boten. Als ich ihn fragte, ob er sich Theresa als seine Freundin vorstellen könnte, zog er die Augenbrauen hoch, als hätte ich etwas unglaublich Albernes gesagt, und dann erwiderte er: »Sei nicht so dumm, Laura. Theresa ist wie eine zweite Schwester für mich.«
So war es vermutlich auch, aber als ich älter wurde und Carys Schatten sich immer deutlicher über mich legte, begann ich mir zu wünschen, er fände ein anderes Mädchen, das seine Aufmerksamkeit von mir ablenkte. Ich tat mein Bestes, ihm die eine oder andere wärmstens ans Herz zu legen, aber was ich auch sagte, es änderte nicht das Geringste an seinem Verhalten ihnen
gegenüber. Wenn überhaupt, fand er jedes Mädchen, das ich als eine mögliche Freundin für ihn vorschlug, plötzlich häßlich oder dumm. Ich begriff, daß es das Beste wäre, der Natur einfach ihren Lauf zu lassen.
Nur nahm die Natur ihren Lauf nicht.
Oft sagte ich mir, die Natur müßte Cary wohl übergangen haben. Sie kam wohl eines Tages vorbei, als er gerade mit dem Fischerboot draußen war oder so was. Andere Jungen in seinem Alter bemühten sich um Verabredungen mit Mädchen, trieben sich in der Stadt herum und prahlten, um die Aufmerksamkeit eines Mädchens auf sich zu ziehen. Sie forderten Mädchen auf, etwas mit ihnen zu unternehmen, aber Cary … Cary verbrachte seine gesamte Freizeit mit mir oder mit seinen Schiffsmodellen in seiner Werkstatt oben auf dem Dachboden, der direkt über meinem Zimmer lag.
Schließlich erwähnte ich eines Tages beim Mittagessen Theresa gegenüber meine wachsende Sorge. Sie verdrehte ihre dunklen Augen und sah mich an, als sei ich frisch aus dem Ei geschlüpft.
»Hörst du denn nicht, was hinter deinem Rücken geredet wird? Dieses Geflüster und all das Gerede? Es gibt nicht ein einziges Mädchen in dieser Schule, das Cary für normal hält, Laura. Und die meisten Jungen haben ihre Zweifel, was dich angeht. Mit mir sprechen sie zwar nicht darüber, aber ich höre doch, was geredet wird.«
»Wie meinst du das? Was erzählen sie sich denn über uns?« fragte ich und zitterte in banger Erwartung.
»Sie sagen, du und dein Bruder, ihr wäret ein Paar, Laura«, erwiderte sie zögernd.
Mein Herz setzte einen Schlag lang aus, und ich erinnere mich noch daran, wie ich mich an jenem Tag in der Cafeteria umsah und glaubte, alle sähen uns triefend vor Verachtung an. Ich schüttelte den Kopf, und erst jetzt nahmen diese Erkenntnisse Gestalt an, wie abscheuliche Bestien, die aus einem Alptraum
herausgekrochen waren und sich inzwischen am hellichten Tag in meinen Gedanken breitmachten.
»Sieh dich doch an«, fuhr Theresa fort. »Du bist fünfzehn und eines der hübschesten Mädchen in der ganzen Schule, aber hast du etwa einen Freund? Nein. Lädt dich jemand zu den Tanzveranstaltungen in der Schule ein? Nein. Wenn du überhaupt hingehst, dann mit Cary.«
»Aber …«
»Es gibt kein Aber, Laura. Es liegt an Cary«, sagte sie. »Und daran, wie er dich anhimmelt. Es tut mir leid«, fügte sie hinzu. »Ich dachte wirklich, du weißt das alles und machst dir nichts daraus.«
»Was soll ich bloß tun?« stöhnte ich.
Sie versetzte mir einen Knuff, wie sie es meistens tat, wenn sie gleich darauf etwas Häßliches über eine unserer Mitschülerinnen sagen würde.
»Er braucht eine Freundin, die seine Hormone in Wallung bringt, und schon ist alles klar«, sagte sie.
Ich erinnere mich noch daran, daß sie danach aufstand und sich ihren Brava-Freundinnen anschloß. Ich saß da und fühlte mich plötzlich sehr allein und unglücklich. In dem Moment betrat Cary die Cafeteria und sah sich schnell um. Sein Blick fiel auf mich, und er kam sofort auf mich zu.
»Tut mir leid, daß ich mich verspätet habe«, sagte er. »Mr. Corkren hat mich wieder wegen meiner Hausaufgaben nach dem Unterricht länger dabehalten. Was ist los?« Er sah mich genau an, als ich nichts darauf erwiderte. »Ist etwas passiert?« Ich schüttelte nur den Kopf. Ich fragte mich, wie ich es ihm sagen konnte, ohne ihn zu verletzen.
Ich schob den Versuch auf und bemühte mich auch später nie, es ihm wirklich klarzumachen, bis im Jahr darauf Robert Royce und seine Familie das alte Sea Marina Hotel kauften und Robert in unsere Schule kam.
Für mich und Robert war es Liebe auf den ersten Blick, und
1
Junge Liebe
Den ganzen Tag hatte mein Herz schneller geschlagen als normal, und es hatte so laut gepocht, daß ich sicher war, Cary müßte das Echo in seiner Brust hören. Wenn ich lief, war es, als berührten meine Füße den Boden nicht. Ich schwebte auf einer Wolke dahin und hüpfte mit federnden Schritten. Ich war vollkommen sicher, daß ich am Morgen mit einem Lächeln im Gesicht aufgewacht war, und als ich mich im Spiegel über meinem Frisiertisch betrachtete, sah ich, wie nicht anders zu erwarten, daß meine Wangen vor Aufregung gerötet waren. Diese Aufregung entsprang wunderbaren Träumen, die sich im Wachen fortsetzten. Träume, die mich auf einem fliegenden Teppich trugen wie eine arabische Prinzessin im Märchen.
Alles um mich herum nahm einen neuen und veränderten Glanz an. Farben, an die ich mich im Lauf der Zeit gewöhnt hatte, waren leuchtender und tiefer und setzten sich stärker gegen andere Farben ab. Jeder Laut wurde zum Teil einer grandiosen Symphonie, ob es das Quietschen der Stufen war, als ich nach unten ging, um Mommy bei den Vorbereitungen für das Frühstück zu helfen, oder das Klappern von Geschirr und Pfannen, das Plätschern des Wassers, das in das Spülbecken einlief, das Öffnen und Schließen von Kühlschrank und Herd oder das Tappen der Schritte von Daddy, May und Cary im Korridor, und erst all ihre Stimmen! Ihre Stimmen wurden plötzlich zu einem Chor, mit dem die Musik unterlegt war.
»Du siehst heute sehr hübsch aus, mein Liebes«, sagte Mommy beim Frühstück. Daddy warf einen Blick auf mich und nickte. Ich hielt den Atem an, weil ich einen ganz kleinen Hauch
Lippenstift aufgetragen hatte und Daddy Schminke haßte. Er sagte, da hätte der Teufel die Hand im Spiel, und eine aufrichtige Frau würde niemals versuchen, einen Mann zum Narren zu halten, indem sie sich Farbe ins Gesicht schmierte. Ich hatte ein leuchtend blaues Kleid mit einem weißen Kragen gewählt und trug mein goldenes Armband mit den Glücksbringern, das Mommy und Daddy mir kürzlich zu meinem sechzehnten Geburtstag geschenkt hatten. Cary hatten sie eine teure Taschenuhr an einer goldenen Kette geschenkt, die »Onward Christian Soldiers« spielte, wenn man den Deckel aufklappte.
Cary blickte von seiner Schale Hafergrütze auf.
»Hast du keine Angst, einen Teil von diesem Lippenstift zu schlucken?« fragte er und sandte damit einen unheilverkündenden Blitz durch den warmen Sonnenschein meines Vormittags.
Ich sah Daddy an, aber der war vertieft in seine Zeitung. Dann warf ich Cary einen wütenden Blick zu, und er richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf seine Hafergrütze.
Als wir aus dem Haus gingen, um uns auf den Schulweg zu machen, blieb ich in der Tür stehen, spürte den Sonnenschein auf meinem Gesicht und schloß die Augen. Ich drückte mir die Bücher an die Brüste und wünschte, nichts von alledem sei ein Traum.
»Was tust du da?« fragte Cary mit scharfer Stimme. »Du willst wohl, daß May zu spät zur Schule kommt?«
»Entschuldige«, sagte ich und sprang hinter den beiden her. Cary hielt May fest an der Hand. Meine kleine Schwester, in ihrer Stille eingeschlossen, blickte mit einem Funkeln in den Augen zu mir auf, als wüßte sie alles, als hätte sie ihr hübsches kleines Gesicht letzte Nacht in einen meiner Träume gesteckt und mein Glück gesehen. Ich nahm sie an der anderen Hand, und wir setzten unseren Weg fort. Ich kam mir vor wie Alice im Wunderland.
»Du benimmst dich genauso wie all die anderen doofen Mädchen in unserer Schule«, murrte Cary und warf mir einen
vorwurfsvollen Blick zu. »Jetzt machst du dich auch schon wegen irgendeines Jungen lächerlich.«
Daraufhin lächelte ich ihn nur an. Heute, dachte ich, heute bin ich von schützenden Sylphen umgeben, von winzigen feenartigen Geschöpfen, die alle Pfeile des Unglücks von mir abwenden und in eine andere Richtung lenken würden.
Es waren Wolken am Himmel, aber in meinen Augen war er wolkenlos blau. Es war zwar schon Anfang Mai, doch die Luft war kühl, eine Nachwirkung des gestrigen Nordostwinds. Die Schaumkronen wuchsen auf der Meeresoberfläche wie Seerosen, und sogar so weit von der Küste entfernt konnten wir das Dröhnen der Brandung hören. Im Sonnenschein hatte der Sand die Farbe von Herbstgold. Die Seeschwalben sahen aus, als liefen sie auf Zehenspitzen über offenliegende Schätze, während sie sich ihr Morgenmahl zusammensuchten.
Mein Haar war mit Nadeln zurückgesteckt, aber ein paar lose Strähnen wehten sanft gegen meine Stirn und meine Wangen. May trug einen hellblauen Haarreifen, der ihr das Haar aus dem Gesicht hielt.
Cary war vollkommen egal, wie zerzaust er war, wenn er die Schule betrat. Er fuhr sich einfach mit den Fingern durch das Haar, und er dachte auch gar nicht daran, in den Toilettenvorraum zu gehen wie all die anderen jungen Männer, um sich vor einem Spiegel zu kämmen oder zu bürsten. Statt dessen begleitete er mich zu meinem Spind und wartete, bis ich meine Bücher herausgeholt hatte, ehe er sich zu seinem eigenen Spind begab. Er blieb sogar dann hinter mir stehen, wenn Robert Royce auf mich zukam. Mit unglücklichen, argwöhnischen, finsteren Blicken und ohne ein Wort zu sagen trieb er sich wie eine wütende Gewitterwolke in unserer Nähe herum und ließ mich nicht aus den Augen. Das war das Einzige, was derzeit Dunkelheit in mein Herz brachte.
»Wach endlich aus diesen Tagträumen auf«, herrschte mich Cary an, als ein Wagen an uns vorbeiraste.
Die Invasion der Touristen hatte allmählich begonnen und zeigte sich in Kleinigkeiten. An den Wochenenden war jetzt mehr los, aber an den Wochentagen kroch der Verkehr weiterhin träge durch die Commercial Street. Unsere morgendliche Route führte uns durch Seitenstraßen zu Mays Schule. Am Tor gaben wir ihr beide einen Kuß und verabschiedeten uns in Zeichensprache von ihr. Cary bemühte sich, einen väterlichen Gesichtsausdruck aufzusetzen, als Warnung, damit sie sich benahm. Als ob sie jemals eine solche Warnung gebraucht hätte! Es gab kein reizenderes, sanfteres, zerbrechlicheres und liebevolleres Wesen als unsere May. Doktor Nolan versicherte uns zwar, ihre Taubheit hätte nichts damit zu tun, aber May hatte Wachstumsstörungen. Sie war intelligent und klug und machte sich in der Schule immer gut, aber sie war winzig für ihr Alter, und ihre Gesichtszüge wirkten wie die einer Puppe. Ihre Hände waren so klein, daß sie kaum unsere Handflächen bedeckten, wenn Cary und ich sie an beiden Händen hielten.
Wir alle liebten sie heiß und innig und beschützten sie nach Kräften, aber manchmal ertappte ich Daddy dabei, daß er sie ansah, wenn er nicht merkte, daß er selbst beobachtet wurde, und dann sah ich einen Ausdruck entsetzlicher Traurigkeit auf seinem Gesicht. Tränen, die er zurückhielt, ließen seine Augen glasig werden, und seine Unterlippe bebte gerade so sehr, daß man es wahrnehmen konnte. Dann merkte er, was er tat, und er nahm ruckartig eine starre Haltung ein und wischte sich jede Gefühlsregung aus dem Gesicht. Ich hatte Daddy nie wirklich weinen sehen, und mit gesenktem Kopf sah ich ihn nur beim Beten oder nach einem besonders harten Tag auf dem Boot.
Dicht hinter dem Schultor drehte sich May noch einmal um und lächelte schelmisch, als sie mir in Zeichensprache bedeutete: »Küß Robert nicht zu oft.« Dann kicherte sie und rannte gemeinsam mit den anderen Kindern in das Gebäude. Ich warf einen Blick auf Cary, aber er tat so, als hätte er nichts gesehen.
Als wir weitergingen, waren seine Schritte so schwer, daß ich glaubte, er würde Fußabdrücke im Bürgersteig hinterlassen.
Es war Freitag, und heute abend fand der Frühlingstanz der Schule statt. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich für eine Schulparty einen echten Begleiter. Robert Royce hatte mich gefragt, ob ich mit ihm hinginge. Das würde unsere erste formelle Verabredung sein. Bisher waren wir einander nur zufällig begegnet oder hatten uns getroffen, nachdem wir beide schüchterne Andeutungen hatten fallenlassen, wo sich einer von uns zu einem bestimmten Zeitpunkt aufhalten würde.
Robert besuchte seit Ende Februar unsere Schule. Seine Eltern hatten das Sea Marina gekauft, ein Hotel mit fünfzig Zimmern am nordwestlichen Ende der Stadt. Sowie der Frühling kam, hatten sie mit der Restaurierung des alten Hauses begonnen. Robert war ein Einzelkind, und daher gab es keine anderen Kinder, die Charles und Jayne Royce hätten helfen können. Robert erklärte mir, seine Familie hätte den größten Teil ihres Geldes in den Erwerb des Anwesens gesteckt und müßte die meisten Arbeiten selbst übernehmen. Daher machte er sich an den meisten Tagen gleich nach der Schule auf den Heimweg und hatte an den Wochenenden sehr viel zu tun, vor allem jetzt, da die Sommersaison schnell nahte.
Ich hatte gehofft, Cary würde Roberts Familiensinn und die Hingabe, die er in den Familienbetrieb steckte, als bewunderungswürdig ansehen. Er und Robert hatten wirklich viel miteinander gemeinsam, aber von dem Moment an, in dem Robert den Mut aufgebracht hatte, in Carys Gegenwart im Korridor auf mich zuzukommen und vor seinen Augen ein Gespräch mit mir zu beginnen, wurden Carys Augen jedesmal klein und dunkel, wenn er Robert in meiner Nähe sah.
Robert bemühte sich immer, ihn in das Gespräch einzubeziehen, aber Cary reagierte kurz angebunden und manchmal sogar schroff, mit einem Murren oder einem Achselzucken. Ich fürchtete, Robert würde sich entweder abschrecken lassen oder sich
derart an Carys Benehmen stören, daß er nicht mehr mit mir reden und meine Nähe meiden würde, doch statt dessen wurde er immer kühner, und an einem Samstag nahm er sich sogar von den Arbeiten am Hotel frei und besuchte mich zu Hause.
Cary war zum Anlegesteg runtergegangen, um mit Daddy und Roy Patterson den Motor des Fischerboots zu überholen. Ich konnte Robert in Ruhe Mommy und May vorstellen, und May verliebte sich noch schneller in ihn als ich. Robert stellte sich auch sehr geschickt dabei an, die Zeichensprache zu verstehen. Als er sich an jenem Nachmittag verabschiedete, hatte er bereits gelernt, wie man »Hallo«, »Auf Wiedersehen« und »Ich habe wirklich großen Hunger« in Zeichensprache ausdrückt.
Als Cary später zurückkam und Mommy ihm und Daddy berichtete, ich hätte Besuch gehabt, wurde Cary erst kreidebleich und lief dann knallrot an, als er mich fragte, warum ich nicht mit Robert zum Anlegesteg gekommen war.
»Ich wollte euch nicht stören«, erklärte ich. In Wirklichkeit war ich dankbar dafür, daß wir endlich einmal ungestört gewesen waren und Cary sich nicht ständig in unserer Nähe herumgetrieben hatte.
Er wirkte erst verletzt, dann zornig.
»Dir ist wohl peinlich, womit wir unser Geld verdienen?« fragte er.
»Nein, natürlich nicht«, protestierte ich. »Und außerdem hast du selbst schon mit Robert gesprochen. Du weißt, daß er nicht so ist. Er stammt nicht aus einer dieser snobistischen Familien, Cary. Wenn jemand eine versnobte Familie hat, dann sind wir das.«
Cary knurrte unwillig, denn es widerstrebte ihm zuzugeben, daß ich recht hatte.
»Wahrscheinlich hat er gewußt, daß ich den ganzen Tag auf dem Anlegesteg sein werde«, murmelte er.
»Was? Weshalb sollte das eine Rolle spielen, Cary?«
»Es spielt eine Rolle«, sagte er. »Glaub mir, all diese Typen nutzen andere aus, Laura. Du bist zu vertrauensselig. Und gerade deshalb muß ich auf dich aufpassen«, behauptete er.
»Nein, du brauchst nicht auf mich aufzupassen, nicht, wenn es um Robert geht, und außerdem bin ich nicht vertrauensselig, Cary Logan. Du kennst mich nicht in- und auswendig, und mit Romantik kennst du dich ohnehin nicht aus«, sagte ich aufbrausend. Dann stapfte ich die Treppe zu meinem Zimmer hinauf und schloß die Tür hinter mir.
Als mein Herz nicht mehr ganz so heftig pochte und ich wieder ruhiger wurde, ließ ich mich auf mein Bett zurücksinken und dachte an den wunderbaren Nachmittag, den ich mit Robert verbracht hatte. Wir waren Hand in Hand am Strand spazierengegangen und hatten miteinander geredet. Jeder von uns hatte dem anderen mehr über sich erzählt. Es wunderte ihn, daß wir keinen Fernseher besaßen, aber er verkniff sich jede Kritik an Daddy, als er erfuhr, daß es Daddys Entscheidung war.
»Wahrscheinlich hat dein Vater recht«, sagte er. »Du liest tatsächlich mehr als alle anderen Leute, die ich kenne, und du bist eine ausgezeichnete Schülerin.«
Er lächelte ein Lächeln von der Sorte, die man nicht vergißt – es schlägt vor dem geistigen Auge Wurzeln, gräbt sich ins Gedächtnis ein und flackert jedesmal von neuem hinter den Augenlidern auf, wenn man daran denkt. Er hatte azurblaue Augen, die immer dann dunkler wurden, wenn er über tiefgehende und ernste Dinge mit mir sprach, doch wenn er lächelte, strahlten seine Augen, als hätten sie den Sonnenschein in sich aufgesogen. Es war ein Lächeln von der Art, die einem warm ums Herz werden läßt, ein ansteckendes Lächeln, das alle Spinnweben der Düsternis fortfegte.
Robert war etwa zwei bis drei Zentimeter größer als Cary und ebenso breitschultrig wie er. Er hatte längere Arme, war aber nicht ganz so muskulös. Sein hellbraunes Haar trug er kurz geschnitten, und es war immer ordentlich gebürstet und lag
seitlich glatt an seinem Kopf an. Nur in die Stirn fiel ihm eine kleine Tolle. Da er ein Jahr älter als wir und im letzten Schuljahr war, hatten wir keine gemeinsamen Unterrichtsstunden, aber ich wußte, daß er ein guter Schüler war und daß seine Lehrer ihn mochten, weil er zuvorkommend und interessiert war.
Cary war nie ein besonders guter Schüler gewesen. Er nahm die Schule hin wie eine Hose, die ihm zwei Nummern zu klein war. Es widerstrebte ihm, sie anzuziehen, und wenn er sie erst einmal anhatte, fühlte er sich bei allem Bemühen nicht wohl darin und war erleichtert, wenn nach der letzten Stunde das Läuten ertönte. Es war ihm verhaßt, in einem Raum eingesperrt zu sein und sich von Vorschriften und der Uhr regieren zu lassen. In der Schule war er wahrhaftig ein Fisch auf dem Trockenen.
Demzufolge lehnte Cary Robert Royce auch wegen seiner schulischen Leistungen ab. Es war ihm immer wieder ein Greuel, wenn Robert und ich uns auf eine Diskussion über Geschichte oder über ein Buch einließen, das wir für den Unterricht gelesen hatten. Für Cary war das, als hätten wir begonnen, in einer Fremdsprache zu reden. Gelegentlich, wenn auch sehr selten, versuchte Robert allerdings, über die Probleme zu reden, die seine Familie mit dem Hotel hatte. Dann ging es um die Schwierigkeiten beim Wiederaufbau und um die Verwendung bestimmter Werkzeuge und Farben, Dinge, von denen Cary etwas verstand und die er zu würdigen wußte. Fast so widerstrebend wie ein Mensch, der auf einem Zahnarztstuhl sitzt, ließ sich Cary dann in das Gespräch hineinziehen und brachte seine Vorschläge und Anregungen so trocken und schnell wie möglich vor.
Hinterher sagte Cary dann zu mir, Robert sollte lieber seine Aufgaben in Geschichte machen und in Prüfungen glänzen, die echte Arbeit dagegen Männern überlassen, die eine größere Eignung dafür mitbrachten. Daraufhin lächelte ich nur, und Cary sah mich verwirrt an.
»Was ist?« fragte er barsch. »Was ist daran so komisch,
Laura? Ich schwöre es dir, derzeit läufst du den ganzen Tag mit einem dämlichen Grinsen im Gesicht durch die Gegend. Du hast keine Ahnung, wie albern das aussieht.«
»Du kannst ganz einfach nicht zugeben, daß du ihn magst, stimmt’s, Cary?« sagte ich, und er wurde rot.
»Ich kann ihn nicht leiden«, beharrte er. »Da gibt es nichts zuzugeben.«
Trotz dieser finsteren Prognose hoffte und betete ich, Cary würde sich schließlich doch noch mit Robert anfreunden, vor allem, nachdem Robert mich zum Schultanz eingeladen hatte.
Mommy mochte Robert wirklich, aber Daddy hatte ihn bisher noch nicht kennengelernt, und ich wußte, daß er mir nicht erlauben würde, die Tanzveranstaltung mit Robert zu besuchen, ehe er ihm vorgestellt worden war. Als er mich fragte, ob ich die Party mit ihm besuchen würde, lud ich ihn daher für den darauffolgenden Sonntag zu uns zum Mittagessen ein.
Robert bezauberte Mommy von neuem, indem er ihr eine Schachtel Pralinen mitbrachte. Cary bezeichnete das als Bestechungsversuch, doch ich erklärte ihm geduldig, es sei lediglich eine höfliche Geste, etwas, was Leute, die zum Mittagessen oder zum Abendessen eingeladen wurden, häufig taten. Wie üblich brummte er unwillig und wandte sich ab, statt einzugestehen, daß ich recht haben könnte.
Beim Mittagessen saß Robert neben mir und gegenüber von Cary, der die Augen niederschlug und sich weigerte, am Gespräch teilzunehmen. Wir begannen unsere Mahlzeit wie üblich mit einer Bibellesung. Ich hatte Robert vorgewarnt, weil Daddy das immer tat. Daddy wollte die Heilige Schrift aufschlagen, doch dann hielt er inne und sah Robert an.
»Vielleicht hat unser Gast einen Vorschlag«, sagte er. Auf Carys Gesicht breitete sich ein Lächeln aus. Das war Daddys kleiner Test. Er hielt uns laufend Vorträge darüber, daß junge Menschen heute deshalb schneller in die Sünde abglitten, weil sie die Bibel nicht lasen.
Robert dachte einen Moment lang nach und sagte dann: »Mir gefällt Matthäus, Kapitel sieben.« Daddy zog die Augenbrauen hoch. Er warf einen Blick auf Cary, der plötzlich verdrossen zu sein schien.
»Du kennst den Text, Cary?« fragte Daddy.
Cary blieb stumm, und dann reichte Daddy Robert die Bibel. Robert schlug sie auf, lächelte mich an und warf einen Blick auf Cary, ehe er mit einer sanften, einschmeichelnden Stimme begann.
»›Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden …‹«
Er las weiter und blickte dann auf. Daddy nickte.
»Gut«, sagte er. »Worte, die man sich merken sollte.«
»Ja, Sir, das ist wahr«, sagte Robert, und Daddy und er begannen ein Gespräch über den Touristenrummel, das alte Sea Marina und darüber, wie Daddy das Hotel von früher in Erinnerung hatte. Ich fürchtete schon, Daddy würde ausufernd auf seinen liebsten Groll zu sprechen kommen, einen Punkt, in dem er sich mit Großmama Olivia einig war, nämlich, wie sehr die Touristen das Cape ruinierten, doch er besaß den Anstand, sich nicht kritisch zu äußern.
Cary saß zurückgelehnt da und schmollte, und er sagte nur dann etwas, wenn er wollte, daß ihm jemand eine Schüssel reichte.
Robert gestand, daß er so gut wie nichts über die Hummerfischerei wußte und sich mit dem Meer und Booten noch weniger auskannte.
»Wir hatten soviel damit zu tun, das Haus herzurichten, daß ich kaum Zeit für etwas anderes gefunden habe«, erklärte er.
»Das macht doch nichts. Im Moment brauchen dich in erster Linie deine Eltern. Vielleicht kannst du nach dem Mittagessen zum Anlegesteg runterkommen und dir unseren Kahn ansehen«, sagte Daddy und sah Cary an, aber nach dem Mittagessen
behauptete Cary, er müsse dringend an einem seiner Schiffsmodelle arbeiten und hätte diese Woche ohnehin schon genug Zeit auf dem Boot verbracht.
Ich nahm May an der Hand, und Robert nahm ihre andere Hand, wie Cary es sonst immer tat. Zu dritt folgten wir Daddy zum Anlegesteg. Als ich mich umdrehte und einen Blick auf das Haus zurückwarf, glaubte ich, Cary zu sehen, der aus einem der Fenster im oberen Stockwerk schaute. Einen Moment lang war mir danach zumute, in Tränen auszubrechen, aber Roberts Lächeln vertrieb dieses Gefühl schnell wieder, und wir setzten unseren Weg fort.
Das Wichtigste war, daß Daddy an jenem Tag eine gute Meinung von Robert gewann, und heute war es endlich soweit. Heute abend würde ich mit meinem allerersten Freund die Tanzveranstaltung in der Schule besuchen. Den ganzen Tag über ging es in der Schule zu wie in einem Bienenstock. Im Unterricht rutschten alle unruhig auf ihren Plätzen herum, und der Geräuschpegel in der Cafeteria ließ den Eindruck entstehen, an jenem Morgen hätten sich weitere hundert Schüler eingeschrieben. Nur Cary schlich trübsinnig durch die Korridore, mit bleichem Gesicht und verdüsterten Augen. In der Cafeteria saß er stumm da und nahm bedrückt sein Essen zu sich.
»Warum fragst du nicht Millie Stargel, ob sie heute abend mit dir tanzen geht, Cary?« schlug ich vor, als Robert und ich uns zu ihm setzten. »Ich weiß genau, daß sie bisher noch keiner eingeladen hat.«
Cary unterbrach sich beim Kauen und blickte mit einem solchen Schmerz in den Augen zu mir auf, daß sich ein Kloß in meiner Kehle bildete und ich einen Moment lang nicht schlucken konnte.
»Millie Stargel?« Er lachte. Es war ein ungestümes, lautes und beängstigendes Gelächter. »Wessen Idee war das? Seine?« sagte er und wies mit einer Kopfbewegung auf Robert.
»Nein, ich dachte mir nur …«
»Sie ist ein hübsches Mädchen«, sagte Robert, »und ich wette, sie käme heute abend liebend gern.«
»Warum gehst du dann nicht mit ihr hin?« gab Cary zurück.
Robert sah mich mit einem zärtlichen Lächeln an.
»Ich habe schon eine Verabredung«, sagte er.
»Und warum siehst du dich dann nach anderen Mädchen um?« warf Cary ihm an den Kopf.
»Das tue ich doch gar nicht. Ich habe nur gesagt …«
»Siehst du, ich habe dich gleich gewarnt«, sagte Cary zu mir und stand auf. »Diese Tanzveranstaltungen sind ohnehin doof«, sagte er. »Ich weiß sowieso nicht, weshalb es den Leuten Spaß macht, in der Turnhalle rumzustehen. Ich habe jedenfalls keine Lust. Wenn ich mich mit einem Mädchen verabrede, dann ist das der letzte Ort, an den ich sie brächte.«
»Cary«, rief ich ihm nach, als er ging. Er sah mich finster über die Schulter an und verließ die Cafeteria.
»Er wir sich schon wieder beruhigen«, sagte Robert und legte seine Hand auf meine. »Eines Tages wird er jemanden treffen, und dann wird sein Herz so heftig pochen wie meines, als ich dich das erste Mal gesehen habe.«
Ich nickte.
Ich war allerdings weniger zuversichtlich, daß es Cary in absehbarer Zeit so ergehen würde.
Keinen Moment lang glaubte ich daran. Und ich wußte, daß es mir sehr schwerfallen würde, glücklich zu sein, solange Cary nicht auch glücklich war.
Mir kam es vor, als liefe Cary auf dem Heimweg von der Schule absichtlich wesentlich langsamer als sonst. Man brauchte kein Genie zu sein, um mir anzusehen, wie eilig ich es hatte, nach Hause zu kommen.
»May wartet bestimmt schon auf uns«, klagte ich. »Wenn du noch länger trödelst, warte ich nicht auf dich«, fügte ich hinzu.
»Dann lauf doch allein los«, sagte er, und ich beschleunigte sofort meine Schritte.
May kam tatsächlich gerade erst aus dem Schulgebäude, als ich dort eintraf. Ich bedeutete ihr, sie solle sich beeilen, als wir uns auf den Heimweg machten. Cary war so weit hinter mir zurückgeblieben, daß nichts von ihm zu sehen war. May fragte mich nach ihm, und ich erwiderte, er sei heute ekelhaft. Sie sah sich verwirrt um, aber sie lief nicht langsamer. Sie wußte, warum ich es so eilig hatte, und sie war fast so aufgeregt wie ich. Als wir zu Hause ankamen, fragte sie, ob sie mir bei den Vorbereitungen für den Abend helfen könnte, und ich bedeutete ihr daraufhin, ich würde jede Hilfe annehmen, die mir angeboten wurde. May lachte und bedeutete mir, ihrer Meinung nach sei ich jetzt schon wunderschön und bräuchte daher gar keine Hilfe.
Trotz ihrer Ermutigung wollte ich etwas ganz Besonderes mit meinem Haar tun. Ich hatte Mommy das Bild von einem Mädchen in Seventeen, einem Modemagazin, gezeigt und gesagt, diese Frisur wollte ich haben. Sie versprach, mir dabei zu helfen. In diesen Dingen stellte sie sich fast so geschickt an wie eine echte Friseurin und Kosmetikerin. Nachdem ich geduscht und mein Haar gewaschen hatte, setzte ich mich vor meine Frisierkommode, und Mommy begann, mein Haar auszubürsten und es zu schneiden. May saß auf einem Hocker neben mir und beobachtete uns aufgeregt. Sie hatte zahllose Fragen.
Warum, wollte sie wissen, brauchte ich eine neue Frisur? »Das ist ein ganz besonderer Anlaß«, erklärte ich ihr. »Ich möchte mich bemühen, möglichst gut auszusehen.«
»Du wirst wunderschön sein, Laura«, sagte Mommy. »Du bist ohnehin das hübscheste Mädchen in der ganzen Schule.«
»O Mommy.«
»Es ist doch wahr. Cary sagt das auch.«
»Er ist … voreingenommen«, sagte ich.
»Ich erinnere mich noch an meine eigene Schulzeit und an
ein Mädchen, das Elaine Whiting hieß und mit mir zur Schule gegangen ist. Sie war so hübsch, daß alle glaubten, sie würde später einmal ein Filmstar werden. Jeder Junge wollte der erste sein, der sie zu einer Tanzveranstaltung einlädt. Ich habe nie erlebt, daß ihre Frisur schief saß oder daß auch nur ein Haar verrutscht wäre, und es gab nicht einen einzigen Jungen, dem nicht der Kopf geschwirrt hat, wenn sie vorbeigekommen ist. Ich wette, dir geht es genauso«, sagte Mommy mit einem glücklichen Lächeln. Sie sah mich im Spiegel an, doch ihre Blicke schienen in ihrer Phantasie zu weilen. Ihr war deutlich anzumerken, daß weder sie noch Daddy jemals etwas von diesem widerlichen Getuschel über Cary und mich gehört hatten. Es hätte ihr das Herz gebrochen, wenn sie gewußt hätte, was einige unserer Mitschüler und Mitschülerinnen dachten. Mit häßlichen Gerüchten konnte es sich verhalten wie mit ansteckenden Krankheiten. Selbst die gesündesten Seelen wurden von ihnen befallen, erkrankten und verfaulten.
»Mit welchen Jungen bist du tanzen gegangen, Mommy?« fragte ich sie.
»Oh, mich hat nie jemand zu diesen Veranstaltungen eingeladen. Ich war das, was man ein Mauerblümchen nennen würde«, sagte sie lächelnd.
»Ich bin ganz sicher, daß es nicht so war, Mommy.«
»Ich war schrecklich schüchtern, vor allem in Gegenwart von Jungen. Ich war froh, als mein Vater und Samuel meine Heirat mit deinem Vater beschlossen haben.«
»Was? Eure Heirat ist von euren Vätern arrangiert worden?«
»Ich nehme an, so könnte man es sagen, aber in Wirklichkeit war es nicht so schlimm, wie es klingt. Unsere Väter haben es miteinander abgesprochen, und ich vermute, Großpapa Samuel hat deinem Vater den Entschluß mitgeteilt, zu dem sie gelangt sind. Dein Vater fand mich wohl in Ordnung und hat von diesem Moment an Interesse an mir gezeigt.«
Sie unterbrach sich und lachte, als ihr etwas einfiel.
»Was ist?«
»Ich habe gerade daran gedacht, wie dein Vater mich zum ersten Mal angesprochen hat. Ich war auf dem Heimweg von der Arbeit in Grays Apotheke, als er in seinem Lastwagen an mir vorbeigekommen ist. Er ist langsamer gefahren und hat mich gefragt, ob er mich mitnehmen soll. Ich wußte, wer er war. Jeder hat die Logans gekannt. Jedenfalls habe ich ihm keine Antwort gegeben. Ich bin weitergelaufen und habe mich nicht getraut, den Kopf nach ihm umzudrehen. Er ist ein paar Meter weitergefahren und hat angehalten und gewartet, bis ich auf seiner Höhe war, und dann hat er den Kopf aus dem Fenster gestreckt und mich noch mal gefragt. Ich habe wortlos den Kopf geschüttelt und bin weitergelaufen.«
»Und was ist dann passiert?« fragte ich mit angehaltenem Atem.
»Er ist losgefahren, und ich dachte, das sei es gewesen, aber als ich um die Ecke gebogen bin, stand er da. Er hatte seinen Lastwagen geparkt, und jetzt lehnte er an der Tür und wartete auf mich. Ich kann dir sagen, mir hat gegraut«, gestand sie und warf dann einen Blick auf May, die den Kopf auf die Seite gelegt hatte und sich fragte, worüber Mommy wohl so lange redete.
»Fast hätte ich kehrtgemacht und wäre in die entgegengesetzte Richtung gelaufen, aber dann habe ich meinen Heimweg doch fortgesetzt, und als ich ihn erreicht hatte, hat er sich mir in den Weg gestellt und gesagt: ›Es freut mich, daß du mein Angebot nicht auf Anhieb angenommen hast, Sara. Das zeigt, daß du keine kokette junge Dame bist. Unsere Väter haben sich darüber unterhalten, daß wir beide ein gutes Paar abgeben könnten. Ich hätte gern die Erlaubnis, dich am nächsten Samstag besuchen zu dürfen, in aller Form.‹
Also, in dem Moment hat es mir regelrecht den Atem verschlagen«, sagte sie. »Verstehst du, bis zu diesem Augenblick habe ich nichts von den Plänen meines Vaters geahnt. Ich wußte
noch nicht einmal, daß er mit Samuel Logan befreundet war. Als ich mich von dem ersten Schreck erholt hatte, hat dein Vater gefragt: ›Habe ich dein Einverständnis?‹, und ich habe genickt. ›Danke‹, hat er daraufhin gesagt und ist fortgefahren, und ich bin sicher, daß ich unglaublich belemmert dagestanden haben muß.«
»Hat er dich am kommenden Samstag besucht?«
»Ja, und danach haben wir begonnen, miteinander auszugehen. Unsere Väter hatten unsere Heirat miteinander vereinbart, aber es hat eine ganze Weile gedauert, ehe Jacob mich Olivia vorgestellt hat. Sie hat keineswegs darauf bestanden, daß er mich in ihr Haus mitbringt«, fügte sie hinzu.
»Und warum nicht?«
»Ich glaube, Olivia Logan hatte jemand anderen für deinen Vater im Sinne, ein … ein wohlhabenderes Mädchen mit einem gewissen gesellschaftlichen Status«, sagte sie. »Aber Großpapa Samuel hatte ohne ihre Zustimmung alles mit meinem Vater abgemacht, und da Jacob mich mochte, war es eine beschlossene Sache. Aber heute spielt das alles keine Rolle mehr«, sagte sie und winkte mit der Hand ab. »Das gehört längst alles der Vergangenheit an. Und jetzt wollen wir uns wieder um deine Frisur kümmern«, sagte sie aufgeregt.
»Habt ihr eine schöne Hochzeit gehabt, Mommy?« fragte ich, denn dieser erste Einblick, den ich in die Anfangszeiten der Beziehung zwischen meinen Eltern gewonnen hatte, genügte mir nicht.
»Es war eine schlichte Hochzeit, im Haus von Olivia und Samuel. Richter Childs hat uns getraut.«
»Ich habe dich nie über deine Flitterwochen reden hören, Mommy.«
»Das liegt daran, daß wir keine Flitterwochen hatten.«
»Ihr hattet keine Flitterwochen miteinander?«
»Nicht wirklich. Dein Vater mußte am nächsten Tag wieder arbeiten. Wir haben uns gesagt, wir würden bald Ferien machen,
aber dazu ist es nie gekommen. Das Leben«, sagte sie seufzend, »das Leben nimmt seinen Lauf. Ehe ich wußte, wie mir geschah, war ich mit dir und Cary schwanger. Schau nicht so traurig, Laura«, sagte sie mit einem Blick in den Spiegel. »Ich bin keine unglückliche Frau.«
»Das weiß ich, Mommy, aber ich wünschte trotzdem, du hättest Gelegenheit, zu reisen und deinen Spaß zu haben. Ich wünschte, du kämest wenigstens ein einziges Mal aus Provincetown heraus. Niemand in unserer Familie geht je von hier fort … Niemand außer Onkel Chester und Tante Haille. Mommy, ich habe nie verstanden, warum Daddy nicht mehr mit Onkel Chester redet und warum Onkel Chester und Tante Haille Provincetown verlassen haben«, sagte ich.
»Dein Vater will nicht, daß wir über die beiden reden, Laura. Das weißt du doch.«
»Ja, ich weiß, aber …«
»Heute ist ein so schöner Tag. Bitte, Liebes«, flehte sie. Sie schloß die Augen und öffnete sie dann wieder, wie sie es oft tat, wenn sie etwas Unerfreuliches vergessen oder übergehen wollte. Ich wollte nicht, daß sie sich unbehaglich fühlte, aber Onkel Chester und Tante Haille waren nach wie vor das große Geheimnis unserer Familie, und ich fragte mich natürlich, welche Schwierigkeiten in ihrer Liebesbeziehung und in ihrer Ehe dazu geführt hatten, daß sie von unserer Familie ausgestoßen worden waren.
Aber Mommy hatte recht: Heute nachmittag war nicht der rechte Zeitpunkt, um auf Antworten zu bestehen.
»In Ordnung, Mommy«, sagte ich. Sie sah mich dankbar an. Ich lächelte und wandte mich an May, die sich in Zeichensprache danach erkundigte, worüber wir so lange geredet hatten. Während ich ihr antwortete, hörte ich das Knirschen der Bodendielen über uns und begriff, daß Cary sich in seiner Werkstatt auf dem Dachboden aufhielt. Ich warf einen Blick zur Decke und dachte an ihn. Ich sagte mir, daß er einen der
wundervollsten Abende meines Lebens allein und erbittert verbringen würde.
Plötzlich sah ich wie durch ein Nadelöhr einen Lichtstrahl aus der Decke dringen. Mein Atem stockte, und ich schlug mir eine Hand auf die Brust.
»Was ist los, Liebes?« fragte Mommy.
»Was? Oh, nichts«, sagte ich. »Die Frisur gefällt mir, Mommy. Und jetzt sollte ich besser meine Sachen zum Anziehen bereitlegen«, fügte ich eilig hinzu.
Sie trat zurück und nickte. Ich sah noch einmal zur Decke auf. Der Lichtstrahl war verschwunden, als hätte jemand die Öffnung bedeckt. Warum war mir das vorher nie aufgefallen, fragte ich mich. Meine Finger zitterten, als ich mein schönstes Kleid aus dem Kleiderschrank zog, das Kleid aus rosa Taft, das Mommy mir genäht hatte. Es war das einzige elegante, das ich besaß.
Auch zum Tanzen eignete es sich gut. Die ganze Woche über hatte ich in diesem Kleid tanzen geübt. May hatte auf dem Bett gesessen und mir zugesehen, und schließlich hatte sie ihren Mut zusammengerafft, sich mir angeschlossen und meine Bewegungen nachgeahmt. Wir hatten gelacht, bis uns schwindlig wurde.
Jetzt dachte ich an das kleine Loch in der Decke und fragte mich, ob Cary uns die ganze Zeit beobachtet hatte. Fühlte er sich derart ausgeschlossen? Tat er es deshalb? Wie lange war dieses Loch schon dort? Die Vorstellung, daß Cary mich beobachtete, brachte mich einen Moment lang aus der Fassung, und ich stand mit dem Kleid in der Hand verwirrt da.
»Bist du glücklich mit diesem Kleid, Laura?« fragte Mommy. »Ich weiß, daß es nicht so kostbar ist wie die Kleider, die einige der anderen Mädchen tragen werden.«
»Was? Ach so. Ja, Mommy. Ich liebe dieses Kleid.«
Ich legte es auf das Bett und zog meine Schuhe aus.
»Ich gehe jetzt besser nach unten und mache mich an die
Arbeit. Schließlich muß ich für deinen Vater, für Cary und für May das Abendessen kochen. Ruf mich, wenn du fertig bist«, sagte sie. »Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Ach ja, noch etwas. Ich möchte, daß du heute abend meine Kette trägst«, sagte sie.
Ich schüttelte den Kopf. Mommys Halskette war das einzige wirklich kostbare Schmuckstück, das sie besaß. Selbst ihr Ehering war nicht so teuer gewesen, weil Daddy fand, es sei Geldverschwendung, einen kunstvoll gefertigten Ring zu kaufen, wenn ein schmales Silberband denselben Zweck erfüllte.
»Das kann ich unmöglich tun, Mommy.«
»Natürlich kannst du das tun, Schätzchen. Wann habe ich schon Gelegenheit, sie zu tragen? Ich möchte, daß du sie heute an meiner Stelle trägst, einverstanden?«
Ich nickte zaghaft.
»Komm mit, May«, bedeutete sie meiner kleinen Schwester, »und hilf mir, das Abendessen vorzubereiten. Laura hat zuviel zu tun.«
»Oh, nein, ich kann dir dabei helfen, Mommy.«
»Das kommt gar nicht in Frage, Schätzchen. Ich habe dir doch erzählt, daß ich selbst in meiner Schulzeit nie eine der Tanzveranstaltungen besucht habe, aber ich habe es mir damals sehr gewünscht. Heute abend«, sagte sie mit einem tiefen Seufzen, »gehst du nicht nur um deinetwillen hin, sondern auch an meiner Stelle.«
»O Mommy, ich danke dir«, sagte ich. Sie breitete die Arme aus, und ich umarmte sie.
Ich spürte Tränen unter meinen Lidern brennen, und daher gab ich ihr schnell einen Kuß auf die Wange und wandte mich dann ab, um tief Luft zu holen. Nachdem sie und May gegangen waren, setzte ich mich vor meine Frisierkommode und begann, mir die Fingernägel zu lackieren. Ich gab mich Tagträumen hin und malte mir aus, wie es sein würde, in Roberts Armen zu tanzen, unter den Luftballons und Lichtern dahinzuschweben
und zu spüren, wie er mich festhielt, mich an sich preßte und gelegentlich mit seinen Lippen mein Haar streifte.
Ein neuerliches Quietschen in der Decke riß mich aus meinen Tagträumen heraus, und erinnerte mich wieder an das Guckloch über mir. Ich sah die Decke an, und dann stand ich auf und ging ins Bad. Ich war wütend, aber andererseits tat mir Cary auch leid. Ich wußte, daß ich ihn aus einem Teil meines Lebens aussperrte, einem Teil, zu dem er nie wieder Zutritt haben würde, und doch mußte er verstehen, daß ich erwachsen wurde und daß die Dinge, an denen ich früher einmal Spaß gehabt hatte, die Dinge, an denen wir beide jahrelang unseren Spaß gehabt hatten, nicht mehr genügten. Er wird es bald begreifen, versuchte ich mir einzureden. Er muß es einfach begreifen. Bis dahin wollte ich nicht noch mehr dazu beitragen, ihm das Herz zu brechen.
Meine Gedanken kehrten zu dem bevorstehenden Abend zurück. Ich war so aufgeregt, daß ich mich hinlegen und eine Zeitlang ausruhen mußte, ehe ich mich anzog. Ich wußte, daß ich fast eine Stunde vor mich hindöste, ehe ich plötzlich die Augen aufriß und mich aufsetzte, denn ich fürchtete, ich hätte zu lange geschlafen. Ich hatte nur zwanzig Minuten tief geschlafen, und doch hatte ich es jetzt eilig, mein Kleid anzuziehen. Dann trug ich etwas mehr Lippenstift auf als je zuvor und brachte meine Frisur in Ordnung, ehe ich tief Atem holte und mich im Spiegel ansah.
War ich wirklich hübsch, so hübsch, wie Mommy es behauptete? Robert fand mich natürlich hübsch, und Cary auch, aber ich kam mir nie vor wie das Mädchen, das Mommy geschildert hatte. Ich hatte nie das Gefühl, daß alle Jungen mich ansahen oder daß sich auch nur ein Kopf nach mir umdrehte. Ich war nicht gerade häßlich, entschied ich, aber ich war bei weitem keine umwerfende Schönheit, und ich sah auch nicht aus wie ein Filmstar. Ich mußte mit den Füßen auf dem Boden bleiben und aufpassen, daß ich kein übertriebenes Selbstbewußtsein
entwickelte, wie so viele andere Mädchen, die ich in der Schule kennengelernt hatte.
Als ich nach unten kam, saßen alle am Tisch und hatten schon zu Abend gegessen. Mommy schlug die Hände zusammen und stieß einen bewundernden Ruf aus, sowie ich das Eßzimmer betrat. Daddy lehnte sich zurück und nickte, und May strahlte von einem Ohr zum anderen. Carys Miene war finster, und auf seinem Gesicht stand ein ganz seltsamer Ausdruck.
»Du siehst wunderschön aus, Schätzchen. Wunderschön. Meinst du nicht auch, Jacob?« sagte Mommy.
»Eitelkeit ist eine Sünde, Sara. Sie sieht nett aus, aber es besteht kein Anlaß, ihr übertrieben zuzureden, bis sie es eines Tages selbst glaubt«, schalt Daddy sie aus, doch auch auf seinem Gesicht sah ich Stolz und Freude.
»Warte«, sagte Mommy und eilte aus dem Eßzimmer.
»Wie sehe ich aus, Cary?« fragte ich ihn. Es war mir unerträglich, daß er betont nicht in meine Richtung sah.
»Gut«, sagte er eilig und ließ den Blick auf seinen Teller sinken.
»Ich hätte gedacht, daß du auch zu der Tanzveranstaltung gehst«, sagte Daddy zu ihm.
»Das ist mir zu blöd«, murmelte Cary.
»Und wieso das?«
»Ich habe kein Interesse an diesem Blödsinn«, fauchte er. Daddy zog die Augenbrauen hoch.
»Ich weiß nicht, was du hast. Es geht doch anständig und ordentlich zu dort, oder etwa nicht? Und die Lehrer sind auch da, nicht wahr?«
»Was ändert das schon, Dad?« sagte Cary mit einem hämischen Lächeln. »In der Schule sind die Lehrer auch, und trotzdem rauchen die Schüler auf der Toilette und treiben sonst auch noch so einiges.«
»Was treiben sie sonst noch?«
»Noch andere Dinge«, sagte Cary und merkte selbst, daß er
sich eine Grube grub, aus der er nicht so leicht wieder heraussteigen konnte. Er sah mich an, aber ich sagte nichts. »Die blödsinnigen Dinge, die Jugendliche anstellen.«
»Laura ist ein braves Mädchen«, sagte Daddy und sah mich an. »Sie täte nichts, was diese Familie in Verlegenheit brächte.« Cary grinste hämisch und wandte den Blick ab.
»Natürlich bringe ich die Familie nicht in Verlegenheit, Daddy«, sagte ich und sah Cary dabei fest an. Mommy kam mit ihrer Kette in der Hand zurück.
»Ich wollte, daß sie heute abend meine Kette trägt, Jacob«, sagte sie und sah ihn an, weil sie auf seine Zustimmung wartete. Er nickte, und sie legte mir die Kette um, hakte behutsam den Verschluß zu und ließ dann ihre Finger über die Granaten und den funkelnden Diamanten gleiten. »Steht sie ihr nicht gut?«
»Paß gut darauf auf«, warnte mich Daddy.
»Ganz bestimmt. Danke, Mommy.«
Wir hörten, wie an der Tür geläutet wurde.
»Das wird Robert sein«, sagte ich.
»Oh, sie sollte eine Stola haben, meinst du nicht auch, Jacob?«
»Gewiß. Nachts wird es noch ziemlich kühl«, sagte Daddy.
Mommy ging zum Kleiderschrank, um mir ihre Stola zu holen, und ich ging an die Tür, um Robert zu öffnen.
Mit Jackett und Krawatte sah er unglaublich gut aus. Er hielt ein kleines Päckchen in der Hand.
»Das ist ein Ansteckbukett«, erklärte er.
»Oh, das ist aber wirklich sehr aufmerksam«, sagte Mommy. Robert begrüßte in Zeichensprache May, die strahlend neben mir stand. Dann öffnete er das Päckchen und holte das Bukett aus roten Rosen heraus, meine Lieblingsblumen. Sie paßten ganz ausgezeichnet zu den Granaten.
»Du wirst es mir anstecken müssen«, sagte ich zu Robert. Er sah Mommy einen Moment lang hilflos an, und dann versuchte
er es, aber er war so nervös, daß seine Finger sich ungeschickt anstellten.
»Ich mache das schon«, sagte Mommy und kam zu unserer Rettung. Robert lächelte erleichtert, trat einen Schritt zurück und sah zu, wie sie mir die Blumen ansteckte.
»Das sieht wirklich sehr hübsch aus«, sagte Mommy.
»Danke, Mommy.«
»Wir sollten uns auf den Weg machen«, sagte Robert. »Ich möchte den Eröffnungstanz nicht verpassen.«
»Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend«, sagte Mommy. Daddy tauchte hinter ihr auf und musterte Robert.