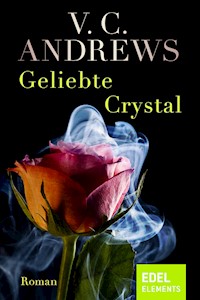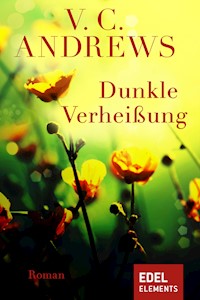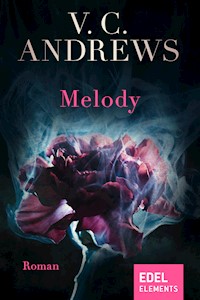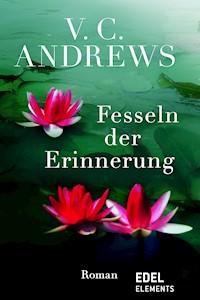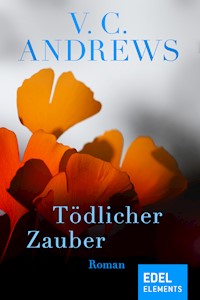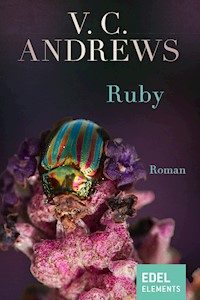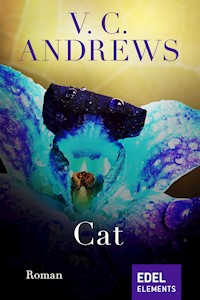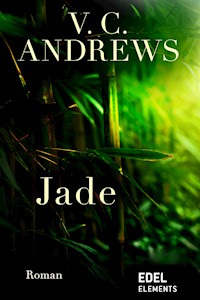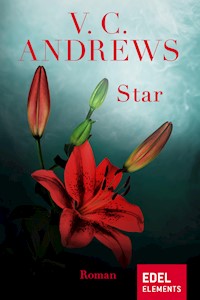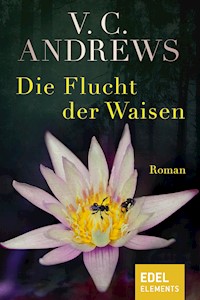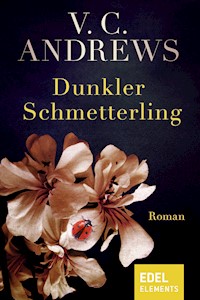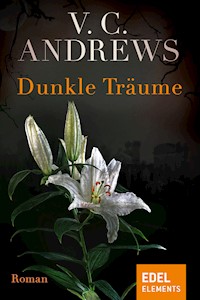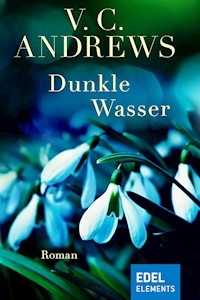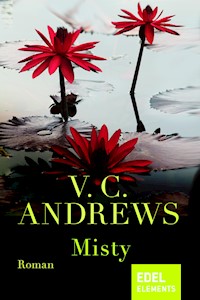V.C. Andrews – eine der erfolgreichsten Bestsellerautorinnen der Welt. Und eine Meisterin der romantischen Spannung!
Alles, was Crystal sich wünscht, ist eine Familie, die sie ihre eigene nennen kann. Doch sie ist nur ein Waisenkind unter vielen, und sie ist furchtbar einsam. Doch sie hört nicht auf, von einem glänzenden Leben zu träumen. Von Liebe, Glück und Freiheit. Dazu muss sie um jeden Preis die dunklen Hinterlassenschaften ihrer Vergangenheit vergessen …
Ein bewegender Roman voller Leidenschaft, Hass und dunkler Intrigen – V.C. Andrews´ dramatische Orphan-Saga!
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel “Crystal”
Edel eBooks
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2015 Edel Germany GmbH
Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright der Originalausgabe © 1998 by the Vanda General Partnership
Ins Deutsche übertragen von Susanne Althoetmar-Smarczyk
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 1999 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, ein Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Jouve
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-649-6
facebook.com/edel.ebooks
Inhaltsverzeichnis
TiteleiImpressumProlog1234567891011Epilog
Prolog
Eines Abends vergaß Mr. Philips seine Schlüssel. Obwohl ich erst elf Jahre alt war, hatte ich wie üblich im Verwaltungsbüro geholfen und Bestellungen, Quittungen und Reparaturaufträge abgeheftet. Ich hatte Molly Stuarts Uhr in Mr. Philips’ Toilette liegen lassen, als ich sie abgemacht hatte, um mir die Hände zu waschen. Eine eigene Uhr besaß ich nicht, und sie lieh mir ihre hin und wieder. Als ihr auffiel, dass ich die Uhr nicht mehr am Handgelenk trug, fragte sie mich danach, und ich erinnerte mich daran. Das war nach dem Abendessen, als wir alle in unseren Zimmern waren und die Hausaufgaben erledigten. Ich sagte ihr, sie sollte sich keine Sorgen machen, ich wüsste, wo sie sei. Sie kochte vor Wut, bis sie im Gesicht puterrot angelaufen war. Sie war sich ganz sicher, dass die Uhr mittlerweile gestohlen worden war, weil die Tür zu Mr. Philips Büro nie abgeschlossen wurde. Daher verließ ich mein Zimmer und lief nach unten. Im Büro machte ich Licht und sah in der Toilette nach. Sie lag auf dem Waschbecken, wo ich sie vergessen hatte.
Ich wollte schon wieder gehen, als ich Mr. Philips Schlüsselbund auf dem Schreibtisch liegen sah. Ich wusste, dass das die Schlüssel zu den Geheimakten waren, den Akten mit Informationen über jeden einzelnen von uns. Ständig fragten andere Kinder mich, ob ich diese Akten bei meiner Arbeit im Büro je gesehen hätte. Das hatte ich nicht.
Mein Herzschlag setzte aus. Ich blickte zur Tür und dann zurück auf jene magischen Schlüssel. Für eine Waise war es nahezu unmöglich, vor dem achtzehnten Geburtstag etwas
über die leiblichen Eltern zu erfahren. Alles, was man mir je gesagt hatte, war, dass meine Mutter zu krank gewesen sei, um mich zu behalten, und dass ich keinen Vater hätte.
Mein ganzes Leben lang hatte ich noch nichts Unehrliches getan, aber dies war meiner Meinung nach etwas anderes. Es war ja kein Diebstahl. Ich verschaffte mir nur etwas, das mir wirklich gehörte: Informationen über meine eigene Vergangenheit. Leise schloss ich die Eingangstür, nahm die Schlüssel vom Schreibtisch und suchte denjenigen heraus, mit dem ich den Schrank mit den Geheimakten öffnen konnte.
Seltsam, ich stand davor und hatte Angst, die Akte zu berühren, auf der mein Name stand. Hatte ich Angst, eine Regel zu brechen, oder fürchtete ich mich davor, etwas über mich selbst zu erfahren? Endlich brachte ich genug Mut auf, um die Akte herauszuziehen. Sie war dicker, als ich erwartet hatte. Ich machte das Licht aus, damit niemand auf mich aufmerksam würde, und setzte mich neben der Toilettentür auf den Boden. Ein schmaler Lichtstrahl fiel durch den Türspalt, gerade genug, um die Seiten lesen zu können. Die ersten enthielten Informationen, die mir bereits bekannt waren: meine Krankengeschichte, meine Zeugnisse. Aber unten befand sich ein Stapel Papiere, die die dunklen Türen zu meiner Vergangenheit aufstießen und Informationen enthüllten, die mich sowohl überraschten als auch ängstigten.
Nach dieser Akte hatte man bei meiner Mutter, Amanda Perry, bereits mit fünfzehn oder sechzehn eine manische Depression diagnostiziert. Mit siebzehn wurde sie nach wiederholten Selbstmordversuchen in eine Anstalt eingewiesen. Einmal hatte sie versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden, zweimal nahm sie eine Überdosis Schlaftabletten.
Ich las weiter und erfuhr, dass meine Mutter in der psychiatrischen Anstalt von einem Krankenpfleger geschwängert
worden war. Offensichtlich fand man nie heraus, um welchen Pfleger es sich handelte. Also war irgend so ein Schwein da draußen mein Vater – so es mir nicht gelang mir einzureden, dass meine Mutter und dieser Pfleger zwischen Medikamententherapien und Elektroschocks eine wundervolle, romantische Liebesaffäre erlebt hatten.
Als feststand, dass meine Mutter schwanger war, traf jemand die Entscheidung, keine Abtreibung vorzunehmen. Nach meiner Geburt wollten meine Großeltern mütterlicherseits nichts mit mir zu tun haben. Und da auch mein Erzeuger sich nicht zu erkennen gab, bekam ich sofort einen Amtsvormund. Aus meinen Papieren ging nicht hervor, wer mir den Namen Crystal gegeben hatte. Ich liebte die Vorstellung, dass dies das einzige Geschenk war, das meine bedauernswerte Mutter mir je gemacht hatte. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wer ich war, bis es mir gelang, heimlich diese Akten einzusehen.
Mein Blick fiel auf eine einfache Notiz über den Tod meiner Mutter im Alter von zweiundzwanzig Jahren. Ihr letzter Selbstmordversuch war erfolgreich gewesen. Ich würde sie nie kennen lernen, auch später nicht, wenn ich längst erwachsen war.
Ich erinnere mich daran, dass mir durch diese Enthüllungen die Hände zitterten und ich ein flaues Gefühl im Magen hatte. Würde ich die psychischen Probleme meiner Mutter erben? Würde ich die Niederträchtigkeit meines Vaters erben? Nachdem ich die Akte zurückgestellt, den Schrank abgeschlossen, die Schlüssel zurückgelegt und das Büro verlassen hatte, lief ich direkt ins Badezimmer, weil ich das Gefühl hatte, mich übergeben zu müssen.
Es gelang mir, mein Abendessen bei mir zu behalten, aber ich wusch mir das Gesicht mit kaltem Wasser, um mich zu beruhigen. Als ich dann in den Spiegel sah, prüfte ich meine Gesichtszüge eingehend und suchte nach Anzeichen für Böses. Ich fühlte mich wie Dr. Jekyll auf der Spur von Mr.
Hyde. Seit diesem Tag hatte ich Albträume. Darin erlebte ich, wie ich geisteskrank wurde und so schwer erkrankte, dass ich in eine Klinik eingewiesen und bis ans Ende meiner Tage unter Verschluss gehalten wurde.
Ich glaube, jeder Psychologe, der meine Herkunft kannte, hätte sich gefragt, ob ich irgendwelche Charakterzüge meiner Eltern geerbt hatte. Den Akten entnahm ich, dass meine Mutter ihre Probleme oft in der Schule auslebte und daher für alle Lehrer eine sehr schwierige Schülerin war. Ständig war sie in Schwierigkeiten. So war ich nie. Erst kürzlich habe ich gelesen, dass solch ein Verhalten ebenso wie ein Selbstmordversuch ein Hilfeschrei ist.
Die Welt erschien angesichts all dieser Hilferufe wie ein riesiger Ozean, in dem viele ertranken und aus dem die Lebensretter willkürlich den einen oder anderen herausfischten. Natürlich werden immer die Reichen gerettet oder zumindest wirft man ihnen eine Rettungsleine zu. Leute wie ich werden in Irrenanstalten, Pflegeheime, Waisenhäuser und Gefängnisse abgeschoben. Mit vielen anderen werden wir unter einen Teppich gekehrt. Ich fragte mich nur, wie andere darüber gehen konnten.
Natürlich erzählte ich niemandem, was ich erfahren hatte, aber ich begriff, warum nur so wenige potenzielle Eltern Interesse an mir zeigten. Wahrscheinlich wurden sie über meine Herkunft informiert und entschieden sich, solch ein Risiko nicht einzugehen.
Einmal, als ich noch in einem anderen Waisenhaus lebte, saß ich draußen und las Das Tagebuch der Anne Frank. (In meiner Lektüre war ich den Kindern meines Alters immer weit voraus.) Plötzlich spürte ich über mir einen Schatten und blickte auf. Ich sah einen Luftballon, der durch die Luft trieb, das Band baumelte wie ein Schwanz hinterher. Ein kleines Kind hatte wohl seinen Griff gelockert, und er war davongeflogen. Jetzt trieb er ziellos dahin, an niemanden gebunden, dazu verdammt, nie mehr zu seinem Besitzer zurückzukehren.
Als er über einer Reihe von Baumkronen verschwand, dachte ich, so ergeht es uns allen. Wir sind Ballons, die jemand absichtlich oder unabsichtlich losgelassen hat, arme verlorene Seelen, die im Wind dahintreiben und auf eine Hand warten, die sie ergreift und zur Erde zurückbringt.
Drei weitere Jahre gingen ins Land, ohne dass ich adoptiert oder auch nur zu Pflegeeltern gegeben worden wäre. Immer noch half ich Mr. Philips in seinem Büro, und vor einem Jahr begann er, mich das kleine Fräulein Tüchtig zu nennen. Mir machte das nichts aus, selbst wenn er damit seine Mitarbeiter ärgerte. Ständig sagte er Sachen wie: »Warum können Sie nicht so verantwortungsbewusst oder so sorgfältig wie Crystal sein?« Selbst zu seiner Sekretärin Mrs. Mills sagte er so etwas hin und wieder.
Mrs. Mills sah immer aus, als ertränke sie in Durchschlägen. Ihre Finger waren blau oder schwarz von Farbbändern, Tintenkartuschen und Toner, die sie zu wechseln hatte. Morgens kam sie stets in makellosem Zustand zur Arbeit, jede Strähne ihres blaugrauen Haares lag an ihrem Platz, ihr Make-up war perfekt, die Kleidung sauber und faltenfrei, aber gegen Ende des Arbeitstages hing ihr der Pony über die Augen, ihre Bluse hatte gewöhnlich einen oder zwei Flecken, der Lippenstift war auf der Wange verschmiert. Ich weiß, dass sie nie Vorbehalte gegen mich hatte. Stets begrüßte sie mich freudig und wusste meine Arbeit zu schätzen – Arbeit, die sonst sie hätte erledigen müssen.
Für mein Alter wusste ich eine Menge über Psychologie. Ich begann mich dafür zu interessieren, nachdem ich von meiner Mutter gelesen hatte. Vielleicht werde ich eines Tages Ärztin, außerdem ist es sowieso gut, so viel wie möglich über Psychologie zu wissen. Besonders in Waisenhäusern ist das sehr nützlich.
Aber es ist nicht immer von Vorteil, klüger zu sein als andere
Leute oder verantwortungsbewusster. Das gilt besonders für Waisenkinder. Je hilfloser man erscheint, desto größer sind die Chancen, adoptiert zu werden. Wenn du so aussiehst, als könntest du auf dich selbst aufpassen, wer will dich dann schon? Zumindest ist das eine meiner Erklärungen, warum ich so lange eine Gefangene dieses Systems war. Mögliche Adoptiveltern fühlen sich nicht gerne ihrem Adoptivkind unterlegen. Das habe ich selbst erlebt.
Da war zum Beispiel dieses Paar, das sich ausdrücklich nach mir erkundigt hatte. Sie wollten gerne ein älteres Kind haben. Die Frau, die übrigens Chastity hieß, lächelte dümmlich. Ihr Mann nannte sie Chas, und sie nannte ihn Arn als Kurzform von Arnold. Mich hätten sie wahrscheinlich Crys genannt. Offensichtlich fiel es ihnen schwer, ganze Worte auszusprechen. Bei Sätzen war es dasselbe Problem. Stets blieb das Satzende unausgesprochen, beispielsweise als Chas mich fragte: »Was willst du einmal werden, wenn du –«
»Wenn ich was?«, zwang ich sie zu sagen.
»Älter wirst. Deinen Abschluss machst –«
»Am College oder an der High School oder beim Militär oder an der höheren Handelsschule?«, zählte ich auf. Ich hatte eine spontane Abneigung gegen sie gefasst. Sie kicherte ständig, und er sah von Anfang an so aus, als wäre er lieber anderswo.
»Ja«, kicherte sie.
»Ich glaube, ich würde gerne Ärztin, aber vielleicht werde ich auch Schriftstellerin. Ich bin mir noch nicht völlig sicher. Was möchten Sie denn gerne werden?«, fragte ich sie, und sie klimperte völlig verwirrt mit den Wimpern.
»Was?«
»Wenn Sie –« Ich schaute Arn an, und er grinste.
Ihr Lächeln welkte wie eine Blume und löste sich schließlich völlig in Luft auf. Ihr Blick wurde bedrohlich und strahlte bald eine nervöse Energie aus. Ich konnte gar nicht zählen, wie oft sie voller Sehnsucht zur Tür schaute.
Als das Gespräch endlich beendet war, wirkten sie sehr erleichtert. Bis vor einer Woche fanden dann keine weiteren Gespräche mit mir statt. Aber ich freute mich wirklich, Thelma und Karl Morris kennen zu lernen. Offensichtlich ließen sie sich von meiner Herkunft nicht abschrecken, und sie ärgerten sich auch nicht über mein altkluges Benehmen. Hinterher erzählte mir Mr. Philips, dass ich genau ihren Vorstellungen entspräche: eine Jugendliche, die keine Probleme machen würde, die sie nicht zu sehr beanspruchen würde, die schon eine gewisse Unabhängigkeit besaß und gesund war.
Thelma schien davon überzeugt zu sein, dass jeglicher Schaden, den ich im Waisenhaus erlitten haben könnte, nach ein paar Wochen bei ihr und Karl wieder behoben sein würde. Ich liebte ihren blauäugigen Optimismus. Sie war eine kleine Frau Ende Zwanzig mit sehr krausem hellbraunem Haar und haselnussbraunen Augen, die so hell und unschuldig strahlten wie die einer Sechsjährigen.
Karl war nicht viel größer als sie, hatte schütteres dunkelbraunes Haar und matte braune Augen. Er wirkte viel älter, war aber erst Anfang dreißig. Sein sanftes, freundliches Lächeln wirkte auf seinem dicklichen Gesicht wie Beeren in geschlagener Sahne. Er war untersetzt und hatte kleine Hände mit Wurstfingern.
Er war Buchhalter, sie Hausfrau. Aber sie hatten vor langer Zeit beschlossen, dass dies auch ein Job sei, für den sie ein Gehalt bezog. In guten Jahren erhielt sie sogar eine Gehaltserhöhung. Sie hörten gar nicht auf, über sich selbst zu reden. Als wollten sie beim ersten Treffen ihr gesamtes Leben vor mir ausbreiten.
Am besten gefiel mir, dass sie absolut nichts Gekünsteltes, Verschlagenes, Bedrohliches an sich hatten. Was man sah, war echt. Das gefiel mir. Dabei fühlte ich mich wohl. Während des Gespräches hatte es manchmal mehr den Anschein, als sollte ich entscheiden, ob ich sie adoptieren sollte.
»Hier ist alles viel zu ernst«, meinte Thelma am Ende des Gespräches. Sie verzog ihr Gesicht zu einer Grimasse und schürzte die Lippen missbilligend. »An so einem ernsten Ort kann sich doch ein junger Mensch nicht zu Hause fühlen. Ich höre hier niemanden lachen. Ich sehe keine lächelnden Gesichter.«
Dann wurde sie selbst plötzlich sehr ernst und beugte sich flüsternd zu mir herüber. »Du hast doch noch keinen Freund, oder? Ich fände es schrecklich, eine aufkeimende Romanze zu zerstören.«
»Wohl kaum«, entgegnete ich. »Die meisten Jungen hier sind schrecklich unreif.« Das gefiel ihr, offensichtlich war sie erleichtert.
1
Ein neuer Anfang
Mit den Morris nach Hause zu fahren war wie eine Besichtigungstour durch ihr Leben. Sie fuhren eine nicht besonders teure Limousine, die sie wegen ihres niedrigen Benzinverbrauchs und ihrer hohen Bewertung im Warentest ausgewählt hatten.
»Karl trifft bei allen Einkäufen die Entscheidung«, erläuterte Thelma mit dem kleinen Lachen, das auf alle ihre Äußerungen folgte. »Er sagt, ein informierter Verbraucher sei ein geschützter Verbraucher. Der Werbung kann man nicht glauben. Anzeigen und insbesondere Fernsehspots stecken voller Fehlinformationen, nicht wahr, Karl?«
»Genau, meine Liebe«, pflichtete Karl ihr bei.
Ich saß hinten. Thelma hatte sich so herumgedreht, dass sie sich auf dem ganzen Weg mit mir unterhalten konnte – dem Weg in mein neues Zuhause in Wappinger Falls, New York.
»Karl und ich kennen uns schon aus dem Sandkasten, wusstest du das?«
Sie redete weiter, bevor ich ihr sagen konnte, dass sie mir das bereits erzählt hatte.
»Seit der zehnten Klasse gingen wir miteinander, und als Karl das College besuchte, blieb ich ihm treu, und er blieb mir treu. Nach dem Examen, als er seine Stelle bei dieser Computerfirma bekommen hatte, planten wir unsere Hochzeit. Karl half meinen Eltern bei den Vorbereitungen, bis hin zur Wahl des besten Blumengeschäfts, nicht wahr, Karl?«
»Das stimmt«, sagte er und nickte bestätigend. Dabei wandte er den Blick nicht von der Straße.
»Karl führt beim Autofahren nicht gerne lange Gespräche«, erklärte Thelma und sah ihn lächelnd an. »Er sagt, die Leute vergessen, dass Autofahren volle Konzentration erfordert.«
»Besonders heutzutage«, dozierte Karl, »da so viel mehr Autos auf den Straßen unterwegs sind, und viel mehr jugendliche und ältere Fahrer. Diese beiden Altersgruppen sind für über sechzig Prozent aller Unfälle verantwortlich.«
»Karl hat ständig alle möglichen Statistiken parat«, verkündete Thelma stolz. »Erst letzte Woche hatte ich die Idee, unseren alten Gasherd durch einen neuen Elektroherd zu ersetzen. Da rechnete Karl die Wärmeeinheiten – stimmt das, Karl? Wärmeeinheiten?«
»Ja.«
»Die Wärmeeinheiten in Kosten um und zeigte mir, dass der Gasherd viel günstiger ist. Ist es nicht wunderbar, einen Mann wie Karl zu haben, der verhindert, dass du die falschen Entscheidungen triffst?«
Ich lächelte und sah zum Fenster hinaus. Das Waisenhaus war nur etwa achtzig Kilometer von dem Ort entfernt, an dem meine neuen Eltern lebten, aber ich war noch nie so weit in den Norden gekommen. Abgesehen von einigen Ausflügen mit der Schule war ich überhaupt noch nicht viel herumgekommen. Schon das Waisenhaus zu verlassen und dreißig Kilometer weit zu fahren war ein Abenteuer.
Es war Spätsommer, die kühleren Herbstwinde kamen bereits von Norden herunter. Die Blätter färbten sich rostrot und orange. Das Farbspiel der dicht bewaldeten Berge in der Ferne war atemberaubend schön. Es war ein sonniger Tag, vor dem tiefblauen Himmel trieben Wolken im Wind dahin, dehnten sich aus und wurden dünn wie Gaze. Richtung Süden verwandelte sich ein Flugzeug in einen silbernen Punkt und verschwand dann in den Wolken.
Ich war glücklich und voller Hoffnungen. Ich hatte ein Zuhause, einen Ort, an den ich gehörte, jemanden außer mir
selbst, um den ich mich kümmern konnte, und, wie ich hoffte, jemanden, der sich um mich kümmerte. Wie einfach das war, und wie selbstverständlich für die meisten, aber wie wundervoll und neu und kostbar für eine Waise wie mich.
»Karl ist der älteste von drei Brüdern und der einzige, der verheiratet ist. Sein mittlerer Bruder, Stuart, ist Vertreter für einen Klimaanlagenhersteller in Albany, und sein jüngster Bruder, Gary, hat in Poughkeepsie, wo Karls Vater lebt, eine Kochausbildung absolviert. Gary hat als Koch auf einem Kreuzfahrtschiff angeheuert, also hören und sehen wir nur wenig von ihm.«
»Karl und seine Brüder sind ungefähr im selbem Alter, aber sie stehen sich nicht sehr nahe. Niemand aus Karls Familie tut das, nicht wahr, Karl?«
Karl wollte sich umdrehen, um sie anzuschauen. Sein Kopf hielt jedoch in der Bewegung inne, als etwa fünfzig Meter vor uns ein Auto aus einer Einfahrt herausfuhr und wir abbremsen mussten.
»Wenn sie nicht gelegentlich miteinander telefonieren würden, wüssten sie gar nicht, wer aus der Familie überhaupt noch lebt. Karls Vater lebt noch, aber seine Mutter starb vor – zwei Jahren, Karl?«
»Morgen vor einem Jahr und elf Monaten«, erwiderte Karl mechanisch.
»Vor einem Jahr und elf Monaten«, wiederholte sie wie ein Übersetzer.
Also habe ich zwei Onkel und einen Großvater auf Karls Seite, dachte ich. Bevor ich sie nach ihrer Familie fragen konnte, rückte sie schon mit den entsprechenden Informationen heraus.
»Ich habe keine Geschwister«, sagte Thelma. »Meine Mutter sollte keine Kinder bekommen. Sie hatte Brustkrebs, als sie erst siebzehn war, und die Ärzte rieten ihr, keine Kinder zu bekommen. Dann wurde sie Anfang Dreißig doch noch schwanger. Mein Vater war damals einundvierzig.
Meine Mutter ist jetzt achtundfünfzig und mein Vater neunundsechzig.«
»Ich wette, du hast dich schon gefragt, warum wir keine eigenen Kinder haben. Außer dir, meine ich«, fügte sie rasch hinzu.
»Das geht mich doch nichts an«, sagte ich.
»Aber natürlich. Alles, was uns angeht, geht jetzt auch dich etwas an. Wir wollen doch eine Familie sein, also müssen wir alles miteinander teilen und aufrichtig zueinander sein, nicht wahr, Karl?«
»Absolut«, sagte er und blinkte, um die Spur zu wechseln und den Wagen vor ihnen zu überholen.
»Karls Spermazahl ist zu gering«, sagte sie mit einem Lächeln, als sei sie entzückt darüber.
»Ich weiß nicht, ob wir darüber reden müssen, Thelma.« Karls Genick wurde vor Verlegenheit rot.
»Aber natürlich können wir das. Sie ist alt genug und weiß vermutlich alles darüber, was es zu wissen gibt. Kinder sind heutzutage sehr weit in ihrer Entwicklung. Wie können sie auch anders, bei all dem im Fernsehen? Siehst du viel fern, Crystal?«
»Nein«, antwortete ich.
»Oh«, machte sie, und zum ersten Mal, seit wir uns kennen gelernt hatten, schien ihre Begeisterung zu schwinden. Ihre Augen wirkten wie winzige Taschenlampen, deren Batterien schwach wurden. Dann kam ihr ein Gedanke und sie lächelte wieder. »Wahrscheinlich hattest du in einem Heim mit so vielen anderen Kindern keine Gelegenheit dazu. Auf jeden Fall haben wir versucht, Kinder zu bekommen. Sobald Karl der Ansicht war, dass es vom finanziellen Standpunkt für uns vernünftig war, haben wir es versucht, nicht wahr, Karl?«
Er nickte.
»Nichts geschah, ganz gleich wie sorgfältig wir es planten. Ich benutzte ein Thermometer, um meine Temperatur
zu messen, markierte die fruchtbaren Tage in meinem Kalender und bereitete sogar einige besonders romantische Abende vor«, gestand sie errötend. Sie zuckte die Achseln. »Nichts geschah. Wir dachten schon, wir schössen am Ziel vorbei. Ziel doch besser, sagte ich ihm immer, nicht wahr, Karl?«
»Thelma, das ist mir peinlich«, bekannte er.
»Ach, Unsinn. Wir sind eine Familie. Da ist nichts peinlich«, betonte sie.
Mit welcher Schlichtheit und Aufrichtigkeit sie über die intimsten Einzelheiten ihres Lebens redete, faszinierte mich.
»Auf jeden Fall«, fuhr sie fort und drehte sich mir wieder zu, »hat Karl darüber nachgelesen und erfahren, dass er seinen Hodensack kühl halten sollte. Er mied enge Kleidung, badete nicht mehr heiß und versuchte, sich kühl zu halten, besonders wenn wir ein Baby machen wollten. Wir machten zwischen den Versuchen sogar längere Pausen, weil sexuelle Enthaltsamkeit normalerweise die Menge und die Fortpflanzungsfähigkeit des Spermas erhöht, nicht wahr, Karl?«
»Du musst doch nicht unbedingt in alle Einzelheiten gehen, Thelma.«
»O doch. Ich will, dass Crystal es versteht. Neulich las ich eine Elternzeitschrift und darin stand, dass besonders Mütter und Töchter offen und ehrlich in allem sein sollten, damit sich zwischen ihnen Vertrauen bildet.«
»Wo war ich stehen geblieben?«, fragte sie. »Ach ja, Menge und Fortpflanzungsfähigkeit des Spermas. Also, als das nicht klappte, gingen wir zum Arzt. Wusstest du, dass ein Mann im Durchschnitt zwischen 120 und 600 Millionen Spermien pro Ejakulation produziert?«
»So viele andere Fakten und Statistiken bereiten dir Probleme, Thelma. Wie kommt es, dass du diese nicht vergisst?«, fragte Karl leise.
»Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich kann man sie