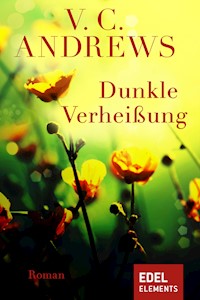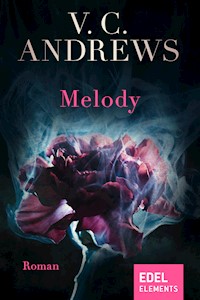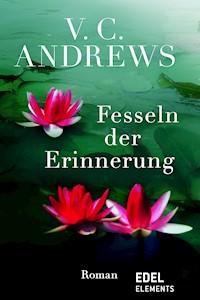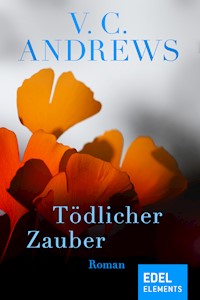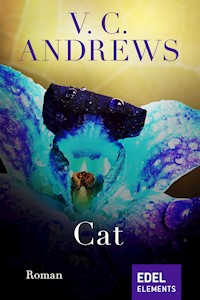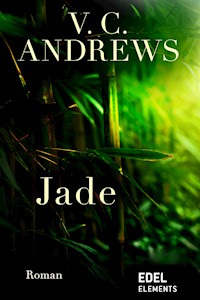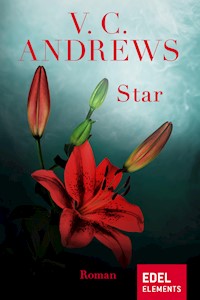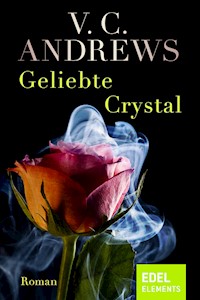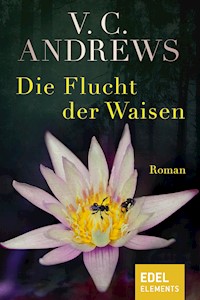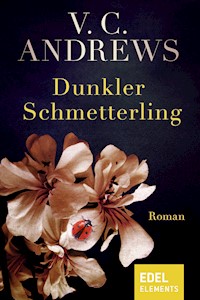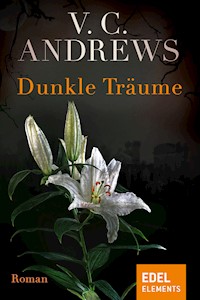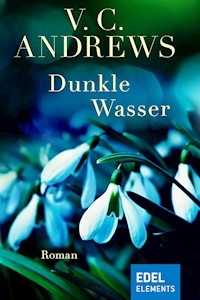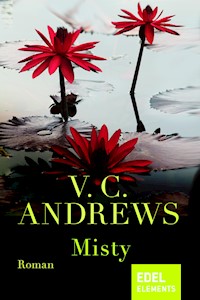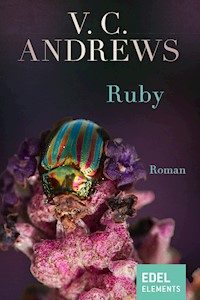
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Landry-Saga
- Sprache: Deutsch
"Der erste Band der Landry-Saga, ein Roman voller dunkler Geheimnisse im Herzen der Südstaaten. Ruby Landry kämpft um die Verwirklichung ihrer Träume. Als sie feststellen muß, daß der Mann, den sie liebt, für sie unerreichbar ist, widmet sie sich ganz ihrem großen Lebensziel: dem Malen. Bis sie eines Tages die Wahrheit über ihre Herkunft erfährt. Auf der Suche nach ihrem geheimnisumwitterten Vater reist sie nach New Orleans. Doch in dem alten Herrenhaus der Familie gerät Ruby in ein Netz aus Lügen, Hinterlist und Verrat. Original-Text Taschenbuch Der erste Band der Landry-Saga Ruby Landry wächst im Herzen der Bayous von Louisiana in der Obhut ihrer Großmutter auf. Als sich das junge Mädchen in den charmanten Paul Tate verliebt, scheint für sie eine wunderbare Zeit anzubrechen. Aber Pauls reiche Eltern stellen sich mit aller Macht gegen die Verbindung und Ruby widmet sich ihrem größten Traum: eine berühmte Malerin zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 797
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
V.C. Andrews – eine der erfolgreichsten Bestsellerautorinnen der Welt. Und eine Meisterin der romantischen Spannung!
Ruby Landry kämpft um die Verwirklichung ihrer Träume. Als sie feststellen muß, daß der Mann, den sie liebt, für sie unerreichbar ist, widmet sie sich ganz ihrem großen Lebensziel: dem Malen. Bis sie eines Tages die Wahrheit über ihre Herkunft erfährt. Auf der Suche nach ihrem geheimnisumwitterten Vater reist sie nach New Orleans. Doch in dem alten Herrenhaus der Familie gerät Ruby in ein unentwirrbares Netz aus Lügen, Hinterlist und Verrat.
Ein fesselnder Roman voller Leidenschaft und dunkler Geheimisse aus dem Herzen der Südstaaten – V.C. Andrews´ große "Landry-Saga"!
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel “Ruby” Edel eBooks Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2015 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © der Originalausgabe 1996 by the Virginia C. Andrews Trust Copyright © der deutschssprachigen Ausgabe 1998 by Wilhelm Goldmann Verlag, München.
Ins Deutsche übertragen von Uschi Gnade
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-695-3
facebook.com/edel.ebooks
Prolog
In den ersten fünfzehn Jahren meines Lebens waren meine Geburt und die Umstände, von denen sie begleitet war, ein Geheimnis, ein ebenso großes Geheimnis wie die Zahl der Sterne, die am Nachthimmel über dem Bayou, dem sumpfigen Altwasser, leuchteten, oder wo sich die silbrigen Katzenwelse an den Tagen versteckten, an denen Grandpère nicht einmal den einen angeln konnte, der lebensnotwendig war. Meine Mutter kannte ich nur aus den Geschichten, die Grandmère Catherine und Grandpère Jack mir erzählten, und von den wenigen verblichenen Sepiadrucken in Zinnrahmen – mehr Fotografien besaßen wir nicht von ihr. Es schien, als hätte ich mich, solange ich zurückdenken konnte, immer reumütig gefühlt, wenn ich an ihrem Grab stand und den schlichten Grabstein mit der Inschrift ansah, die lautete:
Gabrielle Landry geboren am 1. Mai 1927 gestorben am 27. Oktober 1947
denn das Datum meiner Geburt und das ihres Todes war ein und dasselbe. Tag und Nacht litt ich in tiefster Seele unter quälendem Schuldbewußtsein, wenn mein Geburtstag nahte, und das trotz der großen Anstrengungen, die Grandmère unternahm, um den Tag für mich schön zu gestalten. Ich wußte, daß es ihr ebenso schwerfiel wie mir, an diesem Tag fröhlich und unbeschwert zu sein
Aber über den tieftraurigen Tod meiner Mutter bei meiner Geburt hinaus gab es mysteriöse Fragen, die ich niemals hätte stellen können, selbst dann nicht, wenn ich gewußt hätte, wie ich sie formulieren sollte, denn ich hatte viel zu große Angst davor, das Gesicht meiner Großmutter, das normalerweise so liebevoll war, könnte diesen verschlossenen und abweisenden Ausdruck annehmen, vor dem mir graute. An manchen Tagen saß sie stumm auf ihrem Schaukelstuhl und starrte mich unentwegt an, so daß mir der Zeitraum wie Stunden vorkam. Wie immer die Antworten auch lauten mochten, meine Großeltern waren daran zerbrochen. Damals war Grandpère Jack in den Sumpf gegangen, um dort allein in einer Hütte zu leben. Und von dem Tag an konnte Grandmère Catherine nicht mehr an ihn denken, ohne daß ihre Augen vor Zorn funkelten und ihr Herz vor Kummer brannte.
Dieses Unbekannte schwebte über unserem Haus in Bayou; es hing in den Spinnweben, die die Sümpfe in mondhellen Nächten in eine juwelenglitzernde Welt verwandelten; es rankte sich wie das spanische Moos, das an ihren Ästen hing, an den Zypressen hoch. Ich hörte es in dem Säuseln der lauen Sommerwinde und in dem Wasser, das gegen den Lehm schwappte. Ich fühlte es sogar in dem durchdringenden Blick des Sumpffalken, dessen gelbumrandete Augen jeder meiner Bewegungen folgten.
Ich floh in demselben Maß vor den Antworten, in dem ich danach lechzte, sie zu erfahren. Worte, die genug Gewicht und Macht besaßen, zwei Menschen, die einander hätten lieben und schätzen sollen, auseinanderzubringen, konnten mich nur mit Furcht erfüllen.
Oft saß ich in warmen Frühlingsnächten am Fenster, starrte in die Dunkelheit über dem Sumpf hinaus und ließ mir von der Brise, die vom Golf von Mexiko über die Sümpfe wehte, das Gesicht kühlen; und dann lauschte ich der Eule.
ERSTES BUCH
1
Grandmères Kräfte
Lautes und eindringliches Pochen an der Fliegengittertür, die auf unsere Veranda führte, hallte durch das Haus und zog meine Aufmerksamkeit und die von Grandmère Catherine auf sich, obwohl wir beide in unsere Arbeit vertieft waren. An jenem Abend waren wir oben im Grenier, der Webstube, und webten aus der gelblichen Baumwolle Decken, die wir an den Wochenenden, wenn die Touristen ins Bayou hinausfuhren, an dem Stand vor unserem Haus verkauften. Ich hielt den Atem an. Es wurde wieder angeklopft, diesmal lauter und nachdrücklicher.
»Geh runter, und schau nach, wer da ist«, sagte Grandmère Catherine in einem lauten Flüsterton zu mir. Mach schnell. Und wenn es dein Grandpère Jack ist, der sich in diesem Sumpfwhiskey ertränkt hat, dann mach die Tür, so schnell du kannst, wieder zu«, fügte sie noch an, aber ihre dunklen Augen, die ganz groß geworden waren, drückten deutlich das Wissen aus, daß jemand anderes vor der Tür stand und daß etwas weitaus Erschreckenderes und Unerfreulicheres auf uns zukam.
Eine kräftige Brise war hinter den dichten, dunklen Wolkenschichten aufgekommen, die uns wie ein Leichentuch einhüllten und am Aprilhimmel von Louisiana die Mondsichel und die Sterne verbargen. Die Tage und Nächte waren so heiß und schwül, daß ich morgens Schimmel auf meinen Schuhen vorfand. Um die Mittagszeit ließ die Sonne dann die Goldruten glitzern und versetzte die Stechmücken und Fliegen auf ihrer Suche nach kühlem Schatten in einen rasenden Taumel. In klaren Nächten konnte ich sehen, wo die Spinnen aus dem Sumpf herausgekommen waren, um ihre gigantischen Netze zu spinnen, in denen sie nachts Käfer und Moskitos erbeuteten. Wir hatten Stoff vor den Fenstern gespannt, der die Insekten fernhielt, aber jede kühle Brise durchließ, die vom Golf kam.
Ich eilte die Treppe hinunter und durch den schmalen Gang, der von der Rückseite des Hauses direkt zur Vordertür führte. Der Anblick von Theresa Rodrigues’ Gesicht, das mit der Nase ans Fliegengitter gepreßt war, ließ mich abrupt stehenbleiben, und meine Füße wurden bleischwer. Sie war so weiß wie eine Seerose, ihr kaffeeschwarzes Haar war wüst zerzaust, und in ihren Augen stand blankes Entsetzen.
»Wo ist deine Grandmère?« schrie sie in heller Panik.
Ich rief meine Großmutter und ging dann an die Tür. Theresa war ein klein gewachsenes, stämmiges Mädchen, das drei Jahre älter war als ich. Mit ihren achtzehn Jahren war sie das älteste von fünf Kindern. Ich wußte, daß ihre Mutter gerade schon wieder ein Kind bekam. »Was ist passiert, Theresa?« fragte ich und trat zu ihr auf die Veranda. »Ist etwas mit deiner Mutter?«
Augenblicklich brach sie in Tränen aus, und ihr schwerer Busen hob und senkte sich, als sie die Hände vor das Gesicht schlug und schluchzte. Ich schaute mich gerade in dem Moment um, in dem Grandmère Catherine die Treppe herunterkam, einen Blick auf Theresa warf und sich sofort bekreuzigte.
»Sprich, Kind, sag schnell, was passiert ist«, rief Grandmère Catherine und eilte zur Tür.
»Meine Mama hat ... ein totes Baby ... geboren«, jammerte Theresa.
»Mon Dieu«, sagte Grandmère Catherine und bekreuzigte sich noch einmal. »Das hatte ich im Gespür«, murmelte sie und wandte mir den Blick zu. Ich erinnerte mich an die Momente, während wir webten, in denen sie aufgeblickt hatte und in die Nacht zu lauschen schien. Der Schrei eines Waschbären hatte wie der Schrei eines Babys geklungen.
»Mein Vater hat mich geschickt, damit ich Sie hole«, stöhnte Theresa schluchzend. Grandmère Catherine nickte und drückte Theresa tröstlich die Hand
»Ich komme sofort.«
»Ich danke Ihnen, Mrs. Landry. Ich danke Ihnen«, sagte Theresa und eilte von der Veranda in die Nacht hinaus. Ich blieb verwirrt und verängstigt zurück. Grandmère Catherine packte bereits ihre Sachen zusammen und füllte einen Korb aus Eichengeflecht damit. Ich lief schnell wieder ins Haus.
»Was will Mr. Rodrigues, Grandmère? Was kannst du jetzt noch für seine Frau tun?«
Wenn Grandmère nachts aus dem Haus gerufen wurde, dann hieß das gewöhnlich, daß jemand sehr krank war oder große Schmerzen hatte. Ganz gleich, was passiert war – mein Magen prickelte jedesmal, als hätte ich ein Dutzend Fliegen geschluckt, die jetzt in mir herumschwirrten und surrten.
»Hol die Butangaslampe«, ordnete sie anstelle einer Antwort an. Ich lief eilig los, um ihrem Wunsch Folge zu leisten. Im Gegensatz zu Theresa Rodrigues, die in einer solchen Panikstimmung war, daß das Grauen ihr den Weg durch die Dunkelheit erhellte, würden wir die Laterne brauchen, um von der Veranda über das Sumpfgras zu der tintig schwarzen Schotterstraße zu finden. Für Grandmère war der bedeckte Nachthimmel ein böses Omen, heute mehr denn je. Sowie wir ins Freie traten und sie aufblickte, schüttelte sie den Kopf und murmelte: »Kein gutes Zeichen.«
Hinter und neben uns schienen ihre finsteren Worte den Sumpf zum Leben zu erwecken. Frösche quakten, Nachtvögel krächzten, und Alligatoren schlitterten über den kühlen Schlamm.
Mit meinen fünfzehn Jahren war ich bereits fünf Zentimeter größer als Grandmère Catherine, die in ihren Mokassins gerade einen Meter sechzig maß. Sie mochte zwar kleingewachsen sein, aber sie war die stärkste Frau, die ich kannte, denn neben ihrer Weisheit und ihrem Mut besaß sie die Kräfte eines Traiteur, eines Heilers; sie hatte spirituelle Heilkräfte und fürchtete sich nicht davor, den Kampf gegen das Böse aufzunehmen, ganz gleich, wie finster oder heimtückisch es auch sein mochte. Grandmère schien immer eine Lösung parat zu haben und in ihrem Fundus an Allheilmitteln und Ritualen immer die richtige Vorgehensweise finden zu können. Es waren ungeschriebene Kenntnisse, die an sie weitergegeben worden waren, und wenn ihr etwas zufällig nicht überliefert worden war, dann fiel es ihr auf magische Weise von allein zu.
Grandmère war Linkshänderin, was für uns Cajuns hieß, daß sie durchaus spirituelle Kräfte besitzen konnte. Ich glaubte jedoch, daß ihre Kräfte ihren dunklen Onyxaugen entsprangen. Sie fürchtete sich nie vor irgend etwas. Man erzählte sich über sie, sie hätte eines Nachts im Sumpf dem Sensenmann persönlich gegenübergestanden und dem Tod so fest ins Angesicht gestarrt, daß er die Auen niederschlagen mußte und begriff, daß es noch zu früh war, mit ihr zu ringen.
Die Leute aus dem Bayou kamen zu ihr, um ihre Warzen und ihren Rheumatismus behandeln zu lassen. Sie hatte ihre geheime Medizin gegen Husten und Erkältungen, und es hieß, sie wüßte sogar, womit man das Altern verhindert, hätte dieses Mittel aber nie eingesetzt, weil es gegen die natürliche Ordnung der Dinge verstieß. Die Natur war Grandmère Catherine heilig. Sie stellte all ihre Heilmittel aus den Extrakten von Pflanzen und Kräutern her, von Bäumen und Tieren, die in der Nähe oder in den Sümpfen lebten.
»Warum gehen wir zu den Rodrigues, Grandmère? Ist es dazu nicht schon zu spät?« »Couchemal«, murmelte sie und nuschelte tonlos ein Gebet vor sich hin. Die Art, wie sie betete, ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen, und trotz der Schwüle fröstelte ich. Ich biß die Zähne zusammen, so fest ich konnte, weil ich hoffte, daß sie dann nicht klappern würden. Ich war fest entschlossen, so furchtlos wie Grandmère zu sein, und meistens gelang es mir auch.
»Ich finde, du bist alt genug, daß ich es dir sagen kann«, sagte sie so leise, daß ich mich anstrengen mußte, um sie verstehen zu können. »Ein Couchemal ist ein böser Geist, der sich herumtreibt, wenn ein ungetauftes Baby stirbt. Wenn wir ihn nicht verjagen, wird er die Familie heimsuchen und ihr Unglück bringen«, erklärte sie. »Sie hätten mich gleich rufen sollen, als bei Mrs. Rodrigues die Wehen einsetzten. Vor allem in so einer Nacht«, fügte sie finster hinzu.
Vor uns ließ der Schein der Butangaslampe die Schatten tanzen und sich im Takt der Melodie wiegen, die Grandpère Jack »Der Song der Sümpfe« nannte, ein Lied, das nicht nur aus den Lauten von Tieren bestand, sondern auch aus dem eigenartigen tiefen Pfeifen, das manchmal aus den knorrigen Stämmen und den herabhängenden Flechten aufstieg, die wir Cajuns Spanischer Bart nennen, wenn der Wind hindurchblies. Ich bemühte mich, so dicht wie möglich an Grandmères Seite zu bleiben, ohne sie anzustoßen, und meine Füße bewegten sich, so schnell sie konnten, um mit ihr Schritt zu halten. Grandmère war so sehr auf unser Ziel und die erstaunliche Aufgabe fixiert, die uns bevorstand, daß sie den Eindruck machte, als könnte sie blind durch das pechschwarze Dunkel laufen.
In ihrem geflochtenen Eichenkorb hatte Grandmère ein halbes Dutzend Totems von der Jungfrau Maria, eine Flasche geweihtes Wasser und ein paar ausgewählte Kräuter und Pflanzen. Die Gebete und Anrufungen trug sie ständig in ihrem Kopf mit sich.
»Grandmère«, setzte ich an, denn ich mußte den Klang meiner eigenen Stimme dringend hören. Qu’est-ce...«
»Sprich englisch«, ermahnte sie mich eilig. »Du darfst nur englisch sprechen.« Grandmère bestand immer darauf, daß wir englisch sprachen, vor allem, wenn wir aus dem Haus gingen, obwohl wir Cajuns eigentlich französisch sprachen. »Eines Tages wirst du aus diesem Bayou fortgehen«, prophezeite sie, »und dann wirst du in einer Welt leben, die möglicherweise auf unsere Cajun-Sprache und unsere Cajun-Sitten herabsieht.«
»Weshalb sollte ich je aus dem Bayou fortgehen, Grandmère?« fragte ich. »Und weshalb sollte ich unter Menschen sein wollen, die auf uns herabblicken?«
»So wird es eben kommen«, erwiderte sie auf ihre typische unklare Art. »So wird es einfach kommen.«
»Grandmère«, setzte ich noch einmal an, »weshalb sollte überhaupt ein Geist die Rodrigues heimsuchen? Was haben sie denn Böses getan?«
»Sie haben nichts Böses getan. Das Baby ist tot geboren worden. Er ist in den Körper des Säuglings gefahren, aber der Geist war ungetauft und hat jetzt keinen Ort, an den er gehen kann, und daher wird er sie nicht in Ruhe lassen und ihnen Unglück bringen.«
Ich sah mich um. Hinter uns fiel die Nacht wie ein bleierner Vorhang herab, der uns voranstieß. Als wir um die Biegung kamen, war ich froh, daß ich die erleuchteten Fenster der Butes sah, unserer nächsten Nachbarn. Dieser Anblick erlaubte es mir, so zu tun, als sei alles ganz normal.
»Hast du das schon oft getan, Grandmère?« Ich wußte, daß meine Großmutter zu vielen Ritualen herangezogen wurde, sei es nun, um ein neuerbautes Haus zu segnen oder um einem Fischer Glück zu bringen, der Krabben oder Austern fing. Mütter von jungen Bräuten, die keine Kinder bekommen konnten, riefen sie hinzu, damit sie tat, was sie konnte, um sie fruchtbar zu machen. Meistens wurden sie hinterher schwanger. Ich wußte von all diesen Dingen, aber bis heute nacht hatte ich noch nie etwas von einem Couchemal gehört.
»Leider schon oft«, erwiderte sie. »Wie schon die Heiler vor mir, nicht nur hier, sondern schon in unseren Zeiten im alten Land.«
»Und ist es dir immer gelungen, den bösen Geist zu vertreiben?«
»Immer«, erwiderte sie in einem so zuversichtlichen Tonfall, daß ich mich plötzlich sicher fühlte.
Grandmère Catherine und ich lebten allein in unserem Häuschen, das auf riesigen Zahnstochern stand und ein Blechdach und eine zurückversetzte Veranda hatte. Wir lebten in Houma, Louisiana, das zum Bezirk Terrebonne gehörte. Die Leute sagten, dieser Bezirk sei nur zwei Autostunden von New Orleans entfernt, aber ich wußte nicht, ob das stimmte, da ich nie in New Orleans gewesen war. Ich war noch nie in meinem Leben aus dem Bayou herausgekommen.
Grandpère Jack hatte unser Haus vor mehr als dreißig Jahren selbst gebaut, als er und Grandmère Catherine gerade erst geheiratet hatten. Wie die meisten Häuser der Cajuns stand unser Haus auf Pfählen, damit wir gegen Kriechtiere, Überflutungen und die Feuchtigkeit geschützt waren. Die Wände waren aus Zypressenholz gezimmert, und das Dach war aus Wellblech. Immer, wenn es regnete prasselten die Tropfen auf unser Haus, als sei es eine Trommel. Die wenigen Fremden, die ab und zu in unser Haus kamen, störten sich daran, aber wir waren an dieses Trommeln so gewöhnt wie an die Schreie der Sumpffalken.
»Wohin geht der Geist, wenn wir ihn vertreiben?« fragte ich.
»Zurück in die Vorhölle, wo er braven, gottesfürchtigen Leuten nichts antun kann«, erwiderte sie.
Wir Cajuns, Abkömmlinge der Arkadier, die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts aus Kanada vertrieben worden waren, glaubten an eine Spiritualität, die den Katholizismus mit vorchristlichen Gebräuchen verband. Wir gingen in die Kirche und beteten zu Heiligen wie Sankt Medad, aber wir hielten ebenso sehr an unserem Aberglauben und an unseren ewig alten Anschauungen fest. Manche klammerten sich noch mehr daran als andere, zum Beispiel Grandpère Jack. Oft beteiligte er sich an irgendwelchen Aktivitäten, die Unglück abwehren sollten, und er besaß eine ganze Sammlung von Talismanen wie Alligatorzähne und getrocknete Ohren von Rotwild, die er zeitweise um den Hals trug oder an seinem Gürtel hängen hatte. Grandmère sagte, kein anderer Mann im Bayou hätte sie nötiger als er.
Die Schotterstraße erstreckte sich gewunden vor uns, aber bei dem Tempo, das wir eingeschlagen hatten, ragte das Haus der Rodrigues, das ebenfalls aus dem Holz von Sumpfzypressen erbaut und jetzt ausgebleicht war und eine grauweiße Patina hatte, schon bald vor uns auf. Wir hörten Klagelaute aus dem Haus dringen und sahen Mr. Rodrigues mit Theresas vierjährigem Bruder im Arm auf der Veranda vor dem Haus. Er saß auf einem Korbstuhl aus Eiche und starrte in die Nacht hinaus, als hätte er den bösen Geist bereits gesehen. Das ließ mich noch mehr frösteln, aber ich bewegte mich ebenso schnell voran wie Grandmère Catherine. In dem Moment, in dem sein Blick auf uns fiel, wich sein Ausdruck des Kummers und der Furcht einer gewissen Hoffnung. Es tat gut zu sehen, wie sehr Grandmère respektiert wurde.
»Ich danke Ihnen, daß Sie so schnell gekommen sind, Mrs. Landry« sagte er und erhob sich eilig. »Theresa«, rief er, und Theresa kam aus dem Haus und nahm ihm ihren kleinen Bruder ab. Er hielt meiner Großmutter die Tür auf, und nachdem ich die Lampe abgestellt hatte, folgte ich ihr hinein.
Grandmère Catherine war schon im Haus der Rodrigues gewesen und begab sich direkt in Mrs. Rodrigues’ Schlafzimmer. Sie lag mit geschlossenen Augen und aschfahlem Gesicht da, und ihr schwarzes Haar war auf dem Kissen ausgebreitet. Grandmère nahm ihre Hand, und Mrs. Rodrigues blickte matt zu ihr auf. Grandmère Catherine richtete ihren Blick fest auf Mrs. Rodrigues und starrte sie so gebannt an, als suchte sie nach einem Zeichen. Mrs. Rodrigues mühte sich damit ab, sich aufzusetzen.
»Ruh dich aus, Delores«, sagte Grandmère Catherine. »Ich bin gekommen, um dir zu helfen.«
»Ja«, sagte Mrs. Rodrigues in einem lauten Flüsterton. Sie umklammerte Grandmères Handgelenk. »Ich habe es gefühlt, Catherine. Ich habe gefühlt, wie sein Herz zu schlagen begonnen und dann wieder aufgehört hat. Ich habe gespürt, wie der Couchemal hinausgeschlüpft ist. Ich habe es deutlich gespürt...«
»Ruh dich aus, Delores. Ich werde tun, was getan werden muß«, versprach Grandmère Catherine. Sie tätschelte ihre Hand, dann nickte sie mir zu, und ich folgte ihr auf die Terrasse, auf der Theresa und die anderen Kinder der Rodrigues mit weit aufgerissenen Augen warteten.
Grandmère Catherine griff in ihren geflochtenen Eichenkorb und holte eine ihrer Flaschen mit Weihwasser heraus. Sie öffnete sie behutsam und wandte sich an mich.
»Nimm die Lampe, und führ mich um das Haus«, sagte sie. »Jede Wassertonne, jedes Faß und jeder Topf mit Regenwasser braucht ein oder zwei Tropfen Weihwasser, Ruby. Paß gut auf, daß wir nichts übersehen«, warnte sie mich. Ich nickte mit zitternden Knien, und wir begannen unseren Rundgang.
In der Dunkelheit schrie eine Eule, aber als wir um die Hausecke bogen, hörte ich, wie etwas durch das Gras kroch. Mein Herz schlug so heftig, daß ich glaubte, ich würde die Lampe fallen lassen. Würde der böse Geist den Versuch unternehmen, uns an unserem Vorhaben zu hindern? Als sollte meine Frage sogleich beantwortet werden, glitt in der Dunkelheit etwas Kühles und Nasses an mir vorbei und streifte flüchtig meine Wange. Ich keuchte hörbar. Grandmère Catherine drehte sich um und redete mir gut zu.
»Der Geist verbirgt sich in einem Faß, einem Blumentopf oder einer Tonne. Er muß sich im Wasser verstecken. Hab keine Angst«, beschwichtigte sie mich, und dann blieb sie vor einer Wassertonne stehen, die dazu benutzt wurde, Regenwasser aufzufangen, das vom Hausdach der Rodrigues rann. Sie öffnete ihre Flasche und kippte sie so behutsam, daß nur ein oder zwei Tropfen hineinflossen, und dann schloß sie die Augen und murmelte ein Gebet. Dasselbe taten wir mit jedem Faß und jeder Tonne, bis wir das Haus umrundet hatten und wieder zur Eingangstür zurückkehrten vor der Mr. Rodrigues, Theresa und die beiden anderen Kinder uns besorgt erwarteten.
»Es tut mir leid, Mrs. Landry«, sagte Mr. Rodrigues, »aber Theresa hat mir soeben gesagt, daß die Kinder hinter dem Haus noch einen Eibischtopf haben. Sicher befindet sich von dem heftigen Regenguß heute nachmittag noch Regenwasser darin.«
»Zeig ihn mir«, wies Grandmère Theresa an, die nickte und ihr den Weg zeigte. Sie war so nervös, daß sie den Baum nicht auf Anhieb fand.
»Wir müssen ihn finden«, warnte Grandmère Catherine. Theresa fing an zu weinen.
»Laß dir Zeit, Theresa«, sagte ich zu ihr und drückte sachte ihren Arm, um sie zu beruhigen. Sie holte tief Atem und nickte. Dann biß sie sich auf die Unterlippe und konzentrierte sich, bis ihr der genaue Standort wieder eingefallen war und sie uns hinführte. Grandmère kniete sich hin, tropfte Weihwasser hinein und flüsterte dabei ihr Gebet.
Vielleicht spielte mir meine überstrapazierte Einbildungskraft einen Streich, vielleicht aber auch nicht; jedenfalls glaubte ich, etwas Blaßgraues, was Ähnlichkeit mit einem Baby zu haben schien, auf und davon fliegen zu sehen. Ich erstickte einen Aufschrei, weil ich fürchtete, Theresa noch mehr zu verängstigen. Grandmère Catherine stand auf, und wir kehrten zum Haus zurück, um noch ein letztes Mal unser Beileid zu bekunden. Sie befestigte ein Totem der Jungfrau Maria an der Haustür und sagte Mr. Rodrigues, er solle sichergehen, daß es vierzig Tage und vierzig Nächte dortblieb. Sie gab ihm noch ein weiteres Totem und sagte ihm, er solle es am Fußende des Bettes anbringen, in dem er und seine Frau schliefen, und es müsse dort ebensolange bleiben. Dann machten wir uns auf den Rückweg nach Hause.
»Glaubst du, daß du ihn vertrieben hast, Grandmère?«
fragte ich, als wir weit genug vom Haus entfernt waren und von keinem Familienmitglied der Rodrigues mehr gehört werden konnten.
»Ja«, sagte sie. Dann drehte sie sich zu mir um und fügte hinzu: »Ich wünschte, es stünde in meiner Macht, den bösen Geist, der in deinem Großvater haust, ebenso leicht zu vertreiben. Wenn ich glaubte, daß es etwas brächte, würde ich ihn in Weihwasser baden. Das Bad könnte er weiß Gott ohnehin gebrauchen.«
Ich lächelte, aber gleichzeitig traten Tränen in meine Augen. Grandpère Jack hatte nämlich, soweit ich zurückdenken konnte, getrennt von uns in seiner Fallenstellerhütte im Sumpf gelebt. Die meiste Zeit hatte Grandmère Catherine nur Schlechtes über ihn zu sagen und weigerte sich jedesmal, wenn er bei uns vorbeikam, ihn auch nur zu sehen, aber manchmal wurde ihre Stimme sanfter, ihre Augen wurden wärmer, und sie wünschte dann, er täte dies oder jenes, was ihm helfen oder seine Lebensweise ändern könnte. Sie mochte es nicht, wenn ich mit einer Piroge durch die Sümpfe stakte und ihn besuchte.
»Gott bewahre dich davor, daß dieses wacklige Kanu umkippt oder du herausfällst. Wahrscheinlich hat er soviel Whiskey im Bauch, daß er deine Hilferufe nicht hört, und dann sind da die Schlangen und Alligatoren, mit denen man zu kämpfen hat, Ruby. Er ist es nicht wert, daß du diese mühsame Reise unternimmst«, murrte sie immer wieder, doch sie hielt mich nie zurück, und obwohl sie so tat, als sei er ihr egal und als wollte sie nichts von ihm wissen, fiel mir doch auf, daß sie immer zuhörte, wenn ich ihr von einem meiner Besuche bei Grandpère berichtete.
Wie viele Nächte hatte ich am Fenster gesessen und zum Mond aufgeblickt, der zwischen zwei Wolken herauslugte, und mir dabei gewünscht und gebetet, wir könnten irgendwie zu einer Familie werden. Ich hatte keine Mutter und keinen Vater, sondern nur Grandmère Catherine, die mir eine Mutter gewesen war und es selbst heute noch war. Grandmère sagte immer, Grandpère könne kaum für sich selbst sorgen, ganz zu schweigen davon, daß er mir einen Vater ersetzen könnte. Dennoch träumte ich weiter. Wenn sie wieder zusammenkämen... wenn wir alle zusammen in unserem Haus leben könnten, wären wir wie eine ganz normale Familie. Vielleicht würde Grandpère Jack dann nicht mehr trinken und spielen. Alle meine Schulfreundinnen fanden richtige Familien mit Brüdern und Schwestern und zwei Elternteilen, die sie liebten, vor, wenn sie nach Hause kamen.
Aber meine Mutter lag eine halbe Meile entfernt auf dem Friedhof begraben, und mein Vater... mein Vater war ein gesichtsloser Mann ohne Namen, ein Fremder, der durch das Bayou gekommen war und meine Mutter bei einem Fais Dodo kennengelernt hatte, einer Tanzveranstaltung der Cajuns. Nach Angaben meiner Grandmère Catherine hatte die Liebe, die sie in jener Nacht so wild und sorglos geteilt hatten, meine Geburt nach sich gezogen. Was mir außer dem tragischen Tod meiner Mutter noch weh tat, war die Erkenntnis, daß irgendwo ein Mann lebte, der nie erfahren hatte, daß er eine Tochter hatte, daß es mich gab. Wir würden einander nie zu sehen bekommen, nie ein Wort miteinander wechseln. Keiner von uns beiden würde auch nur die Silhouette oder den Schatten des anderen je sehen, wie zwei Fischerboote, die in der Nacht aneinander vorüberfuhren.
Als ich noch ein kleines Mädchen war, erfand ich ein Spiel: das Daddy-Spiel. Ich betrachtete mich selbst im Spiegel und versuchte dann, meine charakteristischen Gesichtszüge auf einen Mann zu übertragen. Ich setzte mich an meinen Zeichentisch und skizzierte sein Gesicht. Noch schwerer war es, den Rest von ihm heraufzubeschwören. Manchmal geriet er bei mir ganz groß, so groß wie Grandpère Jack, aber manchmal war er auch nur wenige Zentimeter größer als ich. Immer war er ein gut gebauter und muskulöser Mann. Schon vor langer Zeit hatte ich beschlossen, er müßte sehr gut ausgesehen haben und sehr charmant gewesen sein, wenn er das Herz meiner Mutter so schnell erobert hatte.
Aus manchen der Zeichnungen wurden Aquarelle. Auf einem von ihnen malte ich meinen Vater in einem Fais-Dodo-Saal, wie er an der Wand lehnte und lächelte, weil ihm gerade zum ersten Mal meine Mutter unter die Augen gekommen war. Er wirkte sexy und gefährlich, genauso, wie er ausgesehen haben mußte, um meine wunderschöne Mutter zu verführen. Auf einem anderen Bild ließ ich ihn auf einer Straße laufen, doch er drehte sich um und winkte zum Abschied. Ich fand immer, auf diesem Bild stünde ein Versprechen in seinem Gesicht, das Versprechen wiederzukommen.
Auf den meisten meiner Bilder gab es einen Mann, der in meiner Vorstellung mein Vater war. Er war entweder auf einem Fischerboot auf Krabbenfang oder stakte eine Piroge durch einen der Kanäle oder über einen der Tümpel. Grandmère Catherine wußte, warum der Mann in meinen Bildern auftauchte. Ich sah, wie traurig sie das machte, aber ich konnte nichts dagegen tun. In der letzten Zeit hatte sie mich gedrängt, öfter Sumpftiere und Sumpfvögel als Menschen zu malen.
An den Wochenenden trugen wir gemeinsam mit unseren gewebten Decken, der Bettwäsche und den Handtüchern, unseren geflochtenen Eichenkörben und den Palmwedelhüten einige meiner Gemälde vor das Haus. Grandmère brachte auch ihre Gläser mit Kräuterheilmitteln gegen Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und Husten heraus. Manchmal hatten wir auch eine konservierte Schlange oder einen großen Ochsenfrosch in einem Glas, weil die vorbeikommenden Touristen diese Dinge mit Begeisterung kauften. Viele aßen mit Vergnügen Grandmères Gumbo oder Jambalaya. Sie füllte kleine Schalen damit, und dann saßen sie auf Bänken an Tischen vor unserem Haus und genossen zum Mittagessen die typische Cajun-Küche.
Alles in allem vermute ich, daß mein Leben im Bayou nicht so schlecht war wie das Leben, das manche Kinder führten, die weder Mutter noch Vater hatten. Grandmère Catherine und ich hatten keinen nennenswerten materiellen Besitz, aber wir hatten unser sicheres kleines Heim und konnten uns mit unseren Web- und Flechtarbeiten durchschlagen. Von Zeit zu Zeit, wenn auch zugegebenermaßen nicht oft genug, kam Grandpère Jack vorbei, um uns einen Teil seines Verdienstes abzugeben, zu dem er derzeit hauptsächlich durch das Fangen von Bisamratten kam. Grandmère Catherine war entweder zu stolz oder zu wütend auf ihn, um das Geld taktvoll anzunehmen. Daher nahm ich es an, oder Grandpère ließ es einfach auf dem Küchentisch liegen.
»Ich erwarte keinen Dank von ihr«, raunte er mir dann zu, »aber sie könnte wenigstens anerkennen, daß ich ihr das verdammte Geld dalasse. Es ist schwer verdientes Geld, wahrhaft schwer verdient, erklärte er mit lauter Stimme auf den Stufen vor dem Haus. Grandmère Catherine sagte nichts darauf, sondern ging im allgemeinen unbeirrt im Haus ihrer Beschäftigung nach.
»Danke, Grandpère«, sagte ich dann zu ihm.
»Ach, deinen Dank will ich nicht. Ich verlange doch gar nicht deinen Dank, Ruby. Ich will doch nur, daß jemand weiß, daß ich nicht tot und begraben oder von einem Alligator verschlungen worden bin. Daß jemand wenigstens den Anstand besitzt, mich anzusehen«, klagte er oft laut genug, daß Grandmère ihn hören konnte.
Manchmal tauchte sie in der Tür auf, wenn er etwas sagte, was ihr unter die Haut ging.
»Anstand«, schrie sie durch das Fliegengitter. »Habe ich dich, Jack Landry, gerade von Anstand reden hören?«
»Ach ...« Grandpère Jack wedelte mit seinem langen Arm in ihre Richtung und wandte sich ab, um wieder in den Sumpf zurückzukehren.
»Warte, Grandpère«, rief ich und rannte ihm nach.
»Warten? Worauf? Wer keine Cajun-Frau erlebt hat, die eine Meinung gefaßt hat, weiß nicht, was Sturheit ist. Ich wüßte nicht, worauf ich warten sollte«, erklärte er und lief weiter, und seine Gummistiefel, die bis zu den Oberschenkeln reichten, bewegten sich mit saugenden Geräuschen durch das schwammige Gras und die sumpfige Erde. Gewöhnlich trug er seine rote Jacke, die eine Mischung aus einer Weste und dem Regenmantel eines Feuerwehrmannes war und riesige eingenähte Taschen hatte, die über seinen Rücken liefen und von zwei Seiten über große Schlitze zugänglich waren. Sie wurden Rattentaschen genannt, denn dort packte er seine Bisamratten hinein.
Jedesmal, wenn er zornig davonstapfte, flog sein langes weißes Haar um seinen Kopf herum und sah aus wie weiße Flammen. Er war ein dunkelhäutiger Mann. Von den Landrys hieß es, sie hätten Indianerblut. Aber er hatte smaragdgrüne Augen, in denen ein schelmischer Charme blitzte, wenn er nüchtern und gutgelaunt war. Grandpère Jack war groß und schlaksig und stark genug, um mit einem Alligator zu ringen, und im Bayou war er eine legendäre Gestalt. Wenige Männer nährten sich so gut wie er von den Sümpfen.
Aber Grandmère Catherine fiel immer über die Landrys her und brachte mich oft zum Weinen, wenn sie den Tag verfluchte, an dem sie Grandpère geheiratet hatte.
»Laß dir das eine Lehre sein, Ruby«, sagte sie eines Tages zu mir. »Eine Lehre, wie das Herz den Verstand verwirken, überlisten und reinlegen kann. Das Herz will, was das Herz will. Aber ehe du dich einem Mann hingibst, mußt du eine klare Vorstellung davon haben, wohin er dich führen wird. Manchmal besteht die einfachste Weise, in die Zukunft zu schauen, darin, sich die Vergangenheit anzusehen«, riet mir Grandmère. »Ich hätte auf das hören sollen, was mir alle über die Landrys erzählt haben. Sie haben soviel schlechtes Blut... sie waren schon schlecht, als die ersten Landrys sich hier niedergelassen haben. Es hat nicht lange gedauert, bis hier in dieser Gegend Schilder angebracht worden sind, auf denen stand: Kein Zutritt für Landrys. Wenn das nicht deutlich besagt, was Schlechtigkeit ist und wohin es einen führt, wenn man auf sein junges Herz und nicht auf die Weisheit Älterer hört.«
Aber du mußt Grandpère doch früher einmal geliebt haben. Du mußt etwas Gutes in ihm gesehen haben«, beharrte ich.
»Ich habe gesehen, was ich sehen wollte«, erwiderte sie. Sie war starrköpfig, wenn es um ihn ging, aber aus Gründen, die ich noch nicht verstehen konnte. An jenem Tag mußte mich Widerspruchsgeist oder Tapferkeit gepackt haben, denn ich versuchte, die Vergangenheit zu ergründen.
»Grandmère, warum ist er fortgezogen? Lag es nur an seiner Trunksucht? Ich glaube nämlich, daß er damit aufhören würde, wenn er wieder bei uns leben würde.«
Der Blick, mit dem sie mich ansah, war schneidend. Nein, es war nicht nur wegen seiner Trinkerei« Sie schwieg einen Moment lang. »Obwohl das wahrhaft ein ausreichender Grund ist.«
»Liegt es daran, wie er sein Geld verspielt?«
»Das Spielen ist noch nicht das Schlimmste«, fauchte sie mit einer Stimme, die entschieden besagte, ich solle nicht weiterbohren. Aber aus irgendwelchen Gründen konnte ich es nicht lassen.
»Weshalb dann, Grandmère? Was hat er denn so Furchtbares getan?«
Ihr Gesicht wurde finster und hellte sich dann wieder ein wenig auf. »Das ist eine Angelegenheit zwischen ihm und mir«, sagte sie. »Das geht dich nichts an. Du bist noch zu jung, um alles zu verstehen, Ruby. Wenn es Grandpère Jack bestimmt gewesen wäre, mit uns zu leben... dann wäre alles anders gewesen«, beharrte sie, und ich war so verwirrt und frustriert wie vorher auch schon.
Grandmère Catherine besaß solche Weisheit und solche Kräfte. Warum konnte sie nichts unternehmen, um unsere Familie wieder zusammenzuführen? Warum konnte sie Grandpère nicht verzeihen und ihre Kräfte dafür einsetzen, ihn so zu ändern, daß er wieder mit uns zusammenleben konnte? Warum konnten wir keine richtige Familie sein?
Ganz gleich, was Grandpère Jack mir und anderen Leuten erzählte, ganz gleich, wie sehr er fluchte und tobte und wütete – ich wußte, daß er ein einsamer Mann sein mußte, der ganz allein im Sumpf lebte. Nur wenige Menschen besuchten ihn, und sein Heim war kaum mehr als eine schäbige Hütte, die knapp zwei Meter vom Sumpf auf Pfählen stand. Er hatte eine Tonne, um Regenwasser aufzufangen, und Butangaslampen als Beleuchtung. Es gab einen Holzofen, in dem Bauholzabfälle und Treibholz verbrannt werden konnten. Abends saß er auf der Veranda, spielte auf seinem Akkordeon melancholische Lieder und trank seinen Whiskey.
Er war nicht wirklich glücklich, und Grandmère Catherine war es ebensowenig. Jetzt kehrten wir vom Haus der Rodrigues zurück, nachdem wir einen bösen Geist vertrieben hatten, und doch konnten wir den bösen Geist nicht verjagen, der in den Schatten unseres eigenen Heims hauste. In meinem Herzen fand ich, Grandmère Catherine sei wie ein Schuhmacher ohne Schuhe. Sie konnte anderen soviel Gutes tun, doch sie schien unfähig zu sein, dieselben Dinge für sich selbst zu tun.
War das das Los einer Heilerin? Ein Preis, den sie für ihre Kräfte zahlen mußte?
Würde das auch mein Los sein – anderen zu helfen, aber mir selbst nicht helfen zu können?
Das Bayou war eine Welt, in der es von mysteriösen Dingen wimmelte. Jeder Abstecher in diese Welt förderte etwas Überraschendes zutage. Ein Geheimnis, das bis zu diesem Augenblick noch nicht entdeckt worden war. Aber die Geheimnisse, die wir in unseren eigenen Herzen trugen, waren die Geheimnisse, die zu erfahren mir das größte Anliegen war.
Kurz bevor wir zu Hause ankamen, sagte Grandmère Catherine: »Vor dem Haus ist jemand.« In mißbilligendem Tonfall fügte sie hinzu: »Das ist schon wieder dieser kleine Tate.«
Paul saß auf den Stufen zur Veranda und spielte Mundharmonika. Sein Motorroller lehnte an dem Zypressenstumpf. In dem Moment, in dem er unsere Laterne sah, hörte er auf zu spielen und erhob sich, um uns zu begrüßen.
Paul war der siebzehnjährige Sohn von Octavious Tate, einem der reichsten Männer von Houma. Den Tates gehörte eine Fabrik, in der Krabbenkonserven hergestellt wurden, und sie lebten in einem großen Haus. Sie hatten eine Vergnügungsjacht und kostspielige Wagen. Paul hatte zwei jüngere Schwestern, Jeanne, die in meine Schulklasse ging, und Toby, die zwei Jahre jünger war. Paul und ich hatten einander unser Leben lang gekannt, aber erst seit kurzem hatten wir begonnen, mehr Zeit miteinander zu verbringen. Ich wußte, daß das seinen Eltern gar nicht recht war. Pauls Vater hatte mehr als eine Auseinandersetzung mit Grandpère Jack gehabt und mochte die Landrys nicht.
»Alles in Ordnung, Ruby?« fragte Paul eilig, als wir näher kamen. Er trug ein hellblaues Polohemd aus Baumwolle, eine Khakihose und Lederstiefel, die fest zugeschnürt waren. An jenem Abend erschien er mir größer und breiter gebaut und auch älter.
»Grandmère und ich haben die Rodrigues aufgesucht. Mrs. Rodrigues’ Baby ist tot geboren worden, berichtete ich ihm.
»Oh, das ist ja entsetzlich«, sagte Paul leise. Von allen Jungen, die ich in der Schule kannte, schien Paul der aufrichtigste und der reifste zu sein, obgleich er einer der schüchternsten war. Mit Sicherheit gehörte er jedoch mit seinen himmelblauen Augen und dem dichten braunen Haar mit den blonden Strähnen zu denen, die am besten aussahen. »Guten Abend, Mrs. Landry«, sagte er zu Grandmère Catherine.
Sie sah sich mit dem argwöhnischen Blick nach ihm um, mit dem sie ihn schon bedachte, seit Paul mich das erste Mal von der Schule nach Hause begleitet hatte. Da er inzwischen öfter herkam, musterte sie ihn noch genauer, und das empfand ich als peinlich. Paul schien sich darüber zu amüsieren, aber auch etwas Angst vor ihr zu haben. Die meisten Leute glaubten an Grandmères prophetische und mystische Kräfte.
»Guten Abend«, sagte sie bedächtig. »Heute nacht könnte noch ein Regenguß herunterkommen«, sagte sie voraus. »Sie sollten nicht mit diesem unsicheren Ding durch die Gegend fahren.«
»Ja, Ma’am«, sagte Paul.
Grandmère Catherine sah mich an. »Wir müssen die Webarbeiten, mit denen wir vorhin begonnen haben, noch fertigstellen«, ermahnte sie mich.
»Ja, Grandmère, ich komme gleich nach.«
Sie sah Paul noch einmal an und ging dann ins Haus.
»Ist deine Großmutter sehr verstimmt, weil sie das Baby der Rodrigues nicht retten konnte?« fragte er.
»Sie ist nicht zur Entbindung hinzugerufen worden«, erwiderte ich und erzählte ihm, warum man sie geholt hatte und was wir getan hatten. Er hörte interessiert zu und schüttelte den Kopf.
»Mein Vater glaubt an all das nicht. Er sagt, der Aberglaube und überlieferte Bräuche sind das, was die Cajuns rückständig macht und andere Leute glauben läßt, wir seien ignorant. Aber ich bin nicht seiner Meinung«, fügte er eilig hinzu.
»Grandmère Catherine ist alles andere als ignorant«, merkte ich an, ohne meine Entrüstung zu verbergen. »Ignorant ist es, keine Vorkehrungen gegen böse Geister und Unglück zu treffen.«
Paul nickte. »Hast du... etwas gesehen?« fragte er mich.
»Ich habe gespürt, wie etwas an meinem Gesicht vorbeigeflogen ist«, sagte ich und legte eine Hand auf meine Wange. »Es hat mich hier berührt. Und dann habe ich gesehen, wie es entflohen ist.«
Paul stieß einen leisen Pfiff aus.
»Du mußt sehr tapfer gewesen sein«, sagte er.
»Nur weil Grandmère Catherine dabei war«, gestand ich.
»Ich wünschte, ich wäre eher gekommen und hätte mitgehen können ... um dafür zu sorgen, daß dir nichts Böses zustößt«, fügte er hinzu. Ich spürte, wie sein Verlangen, mich zu beschützen, mir die Röte in die Wangen trieb.
»Mir ist nichts zugestoßen, aber ich bin froh, daß wir es hinter uns haben«, gab ich zu. Paul lachte.
Im matten Schein der Beleuchtung unserer Veranda wirkte sein Gesicht weicher, seine Augen wärmer. Wir hatten nicht viel mehr getan, als Händchen zu halten, und ein halbes dutzendmal hatten wir uns geküßt, davon nur zweimal auf die Lippen aber die Erinnerung an diese Küsse ließ mein Herz jetzt flattern, wenn ich ihn ansah und so dicht neben ihm stand. Der Wind wehte sachte ein paar Haarsträhnen zurück, die ihm in die Stirn gefallen waren. Hinter dem Haus schwappte das Wasser der Sümpfe ans Ufer, und ein Nachtvogel, der vor dem dunklen Himmel unsichtbar war, schlug über uns mit den Flügeln.
»Ich war enttäuscht, als ich hergekommen bin und du nicht zu Hause warst«, sagte er. »Ich wollte gerade wieder losfahren, als ich das Licht eurer Laterne gesehen habe.«
»Ich bin froh, daß du gewartet hast«, erwiderte ich, und sein Lächeln wurde strahlender. »Aber ich kann dich nicht ins Haus bitten, weil Grandmère will, daß wir die Decken fertigweben, die wir morgen zum Verkauf ausstellen. Sie glaubt, daß an diesem Wochenende viel los sein wird, und im allgemeinen hat sie recht. Sie erinnert sich immer genau daran, an welchen Wochenenden im Vorjahr besonders viel los war. Niemand hat ein besseres Gedächtnis für solche Dinge«, fügte ich hinzu.
»Ich muß morgen den ganzen Tag in der Fabrik arbeiten, aber vielleicht kann ich morgen nach dem Abendessen vorbeikommen, und wir können einen Spaziergang in die Stadt machen und ein Eisgetränk trinken«, schlug Paul vor.
»Das wäre schön«, sagte ich. Paul kam näher und sah mir fest ins Gesicht. Einen Moment lang verschmolzen unsere Blicke miteinander, ehe er den Mut fand zu sagen, weshalb er wirklich hergekommen war. »In Wirklichkeit möchte ich am nächsten Samstag mit dir zum Fais Dodo gehen«, sprudelte er dann heraus.
Ich hatte bisher noch kein echtes Rendezvous gehabt. Schon allein die Vorstellung ließ mich ganz aufgeregt werden. Die meisten Mädchen in meinem Alter würden mit ihren Familien zum Fais Dodo gehen und mit Jungen tanzen, die sie dort trafen, aber von Paul abgeholt zu werden, ihn als meinen Begleiter zu haben und den ganzen Abend nur mit ihm zu tanzen ... bei dem Gedanken schwirrte mir der Kopf.
»Ich muß Grandmère Catherine fragen«, sagte ich und fügte eilig hinzu: »Aber es würde mir großen Spaß machen.
»Gut«, sagte er. »Schön.« Dann ging er auf seinen Motorroller zu. Ich sollte jetzt besser losfahren, ehe es zu regnen anfängt.« Er ließ mich beim Gehen nicht aus den Augen, verfing sich mit dem Absatz in einer Wurzel und fiel hin.
»Ist dir etwas passiert?« rief ich und eilte zu ihm. Er lachte verlegen.
»Mir fehlt nichts, nur mein Hinterteil ist naß geworden«, fügte er hinzu und lachte. Er nahm die Hand, die ich ihm hinhielt, und ließ sich auf die Füße helfen, und als er stand, trennten uns nur wenige Zentimeter voneinander. Langsam, millimeterweise, näherten sich unsere Lippen einander, bis sie sich trafen. Es war nur ein kurzer Kuß, aber von jedem von uns fester und selbstbewußter. Ich hatte mich auf die Zehenspitzen gestellt, um meine Lippen seinen näher zu bringen, und meine Brüste streiften seinen Brustkorb. Dieser unerwartete Kontakt und die Elektrizität unseres Kusses sandten mir eine Woge warmer, köstlicher Erregung durch das Rückgrat.
»Ruby«, sagte er und schäumte jetzt vor Gefühl über. »Du bist das hübscheste und netteste Mädchen im ganzen Bayou.«
»O nein, das bin ich nicht, Paul. Das kann nicht sein. Es gibt soviel hübschere Mädchen, Mädchen, die kostspielige Kleider und wertvollen Schmuck tragen und ...«
»Mir ist egal, ob sie die größten Diamanten und schönsten Kleider aus Paris haben. Nichts könnte sie hübscher machen, als du es ohnehin bist«, platzte er heraus. Ich wußte, daß er nicht den Mut gehabt hätte, diese Dinge zu sagen, wenn wir nicht im Dunkeln gestanden hätten, wo ich ihn nicht so genau sehen konnte. Ich war sicher, daß sein Gesicht knallrot angelaufen war.
»Ruby!« rief meine Großmutter aus einem Fenster. »Ich will nicht die ganze Nacht aufbleiben, um die Decken fertigzuweben.«
»Ich komme schon, Grandmère. Gute Nacht, Paul«, sagte ich und beugte mich vor, um ihm noch einen schnellen Kuß auf die Lippen zu drücken, ehe ich mich abwandte und ihn im Dunkeln stehenließ. Ich hörte, wie er seinen Motorroller anließ und losfuhr, und dann eilte ich auf den Grenier, um Grandmère Catherine zu helfen.
Lange Zeit sagte sie kein Wort. Sie arbeitete und hielt den Blick starr auf den Webstuhl gerichtet. Dann sah sie mich an und schürzte die Lippen, wie sie es oft tat, wenn sie tief in Gedanken versunken war.
»Der kleine Tate hat dich in letzter Zeit ziemlich häufig besucht, stimmt’s?«
»Ja, Grandmère.«
»Und wie denken seine Eltern darüber?« fragte sie und kam wie immer ohne Umschweife zur Sache.
»Ich weiß es nicht, Grandmère«, sagte ich und schlug die Augen nieder.
»Ich glaube, du weißt es doch, Ruby.«
»Paul mag mich, und ich mag ihn«, sagte ich hastig. »Wie seine Eltern darüber denken, ist nicht wichtig.«
»Er ist im letzten Jahr ein großes Stück gewachsen; er ist ein Mann. Und du bist kein kleines Mädchen mehr, Ruby. Auch du bist gewachsen. Ich sehe doch, wie ihr beide einander anschaut. Ich kenne diesen Blick zu gut, und ich weiß zu genau, wohin er führen kann«, fügte sie noch hinzu.
»Er wird zu nichts Bösem führen. Paul ist der netteste Junge in der ganzen Schule«, beharrte ich. Sie nickte, hielt ihre dunklen Augen aber weiterhin auf mich gerichtet. »Gib mir nicht das Gefühl, ein ungezogenes Mädchen zu sein, Grandmère. Ich habe nichts getan, weswegen du dich für mich schämen müßtest.«
»Noch nicht«, sagte sie, »aber du hast Landry-Blut in dir, und Blut kann einen anstecken und verderben. Das habe ich bei deiner Mutter gesehen; ich will es bei dir nicht noch einmal mit ansehen.«
Mein Kinn begann zu zittern.
»Ich sage diese Dinge nicht, um dir weh zu tun, Kind. »Ich sage sie, um zu verhindern, daß dir weh getan wird«, sagte sie und streckte die Hand aus, um sie auf meine zu legen.
»Darf ich rein und züchtig einen Menschen lieben, Grandmère? Oder bin ich verflucht, weil ich Grandpère Jacks Blut in den Adern habe? Was ist mit deinem Blut? Wird es mir nicht die Weisheit geben, die ich brauche, um mich vor Schwierigkeiten zu bewahren?« fragte ich. Sie schüttelte den Kopf und lächelte.
»Mich hat es nicht daran gehindert, mich in Schwierigkeiten zu bringen, fürchte ich. Ich habe ihn einst geheiratet und mit ihm zusammengelebt«, sagte sie und seufzte. »Aber du könntest recht haben. Vielleicht bist du in mancher Hinsicht stärker und weiser. Mit Sicherheit bist du viel klüger, als ich es in deinem Alter war, und auch viel begabter. Wenn ich nur an deine Zeichnungen und an deine Gemälde denke...«
»O nein, Grandmère, ich bin...«
»Doch, das bist du, Ruby. Du bist talentiert. Eines Tages wird jemand dein Talent entdecken und dir eine Menge Geld dafür anbieten«, prophezeite sie. »Ich will nur nicht, daß du etwas tust, womit du dir die Chance nimmst, von hier fortzugehen, Kind, und dich über den Sumpf und das Bayou zu erheben.«
»Ist es denn so schlecht hier, Grandmère?«
»Für dich ja, Kind.«
»Aber warum, Grandmère?«
»Es ist eben so«, sagte sie und nahm ihre Webarbeit wieder auf. Ich war erneut, wie schon so oft, in einem Meer von unlösbaren Rätseln gestrandet.
»Paul hat mich gebeten, am Samstag der kommenden Woche mit ihm zum Fais Dodo zu gehen. Ich möchte sehr gern mit ihm hingehen, Grandmère«, fügte ich hinzu.
»Werden seine Eltern ihm das erlauben?« fragte sie schnell.
»Ich weiß es nicht. Paul rechnet damit, glaube ich. Können wir ihn am Sonntag abend zum Essen einladen, Grandmère? Geht das?
»Ich habe nie jemanden von meinem Tisch verwiesen«, sagte Grandmère, aber ich habe nicht vor, die Tanzveranstaltung zu besuchen. Ich kenne die Tates, und ich möchte nicht erleben, daß dir jemand weh tut.«
»Oh, mir wird schon niemand weh tun, Grandmère«, sagte ich und hopste vor Aufregung fast auf meinem Stuhl herum. »Dann darf Paul also zum Abendessen kommen?«
»Ich habe gesagt, daß ich ihn nicht vor die Tür setzen werde«, erwiderte sie.
»Oh, Grandmère, ich danke dir. Vielen Dank.« Ich schlang ihr die Arme um den Hals. Sie schüttelte den Kopf.
»Wenn du so weitermachst, sitzen wir noch die ganze Nacht da, Ruby«, sagte sie, küßte mich aber auf die Wange. »Meine kleine Ruby, mein Liebling, mein kleines Mädchen, du wächst so schnell zu einer Frau heran, daß ich besser nicht mit der Wimper zucke, weil ich es sonst verpasse«, sagte sie. Wir umarmten einander noch einmal, und dann machten wir uns wieder an die Arbeit. Meine Hände bewegten sich mit neugewonnener Energie, und mein Herz war mit einer bislang unbekannten Freude erfüllt – und das trotz der unheilvollen Warnungen von Grandmère Catherine.
2
Kein Zutritt für Landrys
Eine köstliche Duftmischung stieg aus der Küche auf, wehte in mein Zimmer und bewirkte, daß ich die Augen aufschlug und mein Magen vor Vorfreude in Aufruhr geriet. Ich konnte den aromatischen Cajun-Kaffee riechen, der auf dem Herd sprudelte, und die Mischung aus Krabben und Hühnergumbo, die Grandmère Catherine in ihren schwarzen gußeisernen Töpfen vorbereitete, um sie an unserem Straßenstand zu verkaufen. Ich setzte mich auf und atmete die herrlichen Gerüche tief ein.
Die Sonne wob sich einen Weg durch die Sumpfzypressen, und das Laub der Mangroven, von denen das Haus umgeben war, wurde durch den Stoff vor meinem Fenster gefiltert und warf einen warmen, hellen Schein in mein kleines Schlafzimmer, in dem gerade genug Platz für mein weißgestrichenes Bett, einen kleinen Nachttisch für die Lampe nah an meinem Kopfkissen und eine große Truhe für meine Kleidung war. Ein Chor von Reisvögeln setzte zu seiner rituellen Symphonie an, zirpte und sang und drängte mich aufzustehen, mich zu waschen und mich anzukleiden, damit ich mich ihnen bei der feierlichen Begrüßung eines neuen Tages anschließen konnte.
Ganz gleich, wie sehr ich mich bemühte, ich schaffte es nie, vor Grandmère Catherine aus dem Bett zu kommen und vor ihr in der Küche zu sein. Nur selten hatte ich Gelegenheit, sie mit einer Kanne frisch gebrühtem Kaffee, mit heißen Biskuits und Eiern zu überraschen. Gewöhnlich stand sie mit den ersten Sonnenstrahlen auf, die die Decke der Dunkelheit wegzuschieben begannen, und sie bewegte sich so leise und geschmeidig durch das Haus, daß ich ihre Schritte im Korridor oder auf der Treppe, die im allgemeinen laut knarrte, wenn ich die Stufen hinunterstieg, nicht hörte. An den Wochenenden stand Grandmère Catherine morgens besonders früh auf, um alles für unseren Straßenstand vorzubereiten.
Ich eilte nach unten, um mich zu ihr zu gesellen.
»Warum hast du mich nicht geweckt?« fragte ich.
»Ich hätte dich dann geweckt, wenn ich dich brauche, falls du bis dahin nicht von allein aufgestanden wärst, Ruby«, sagte sie und gab mir damit dieselbe Antwort wie immer. Aber ich wußte, daß sie sich lieber zusätzliche Arbeit aufgebürdet hätte, als mich wachzurütteln und aus den Armen des Schlafs zu reißen.
»Ich falte unsere neuen Decken zusammen und mache sie soweit fertig, daß wir sie raustragen können«, sagte ich.
»Jetzt wirst du erst einmal frühstücken. Wir haben noch genug Zeit, die Sachen aus dem Haus zu schaffen. Du weißt doch selbst, daß die Touristen so bald noch nicht vorbeikommen. Die einzigen, die so früh am Morgen aufstehen, sind die Fischer, und die interessieren sich nicht für die Dinge, die wir anzubieten haben. Jetzt mach schon, setz dich hin«, ordnete Grandmère Catherine an.
Wir hatten einen einfachen Tisch, der aus den breiten Zypressenbrettern getischlert war, aus denen auch die Wände unseres Hauses und die Stühle mit ihren geriffelten Stuhlbeinen bestanden. Das Möbelstück, das Grandmères größter Stolz war, war ihr Kleiderschrank aus Eiche. Ihr Vater hatte ihn gezimmert. Alles andere, was wir hatten, war gewöhnlich und unterschied sich nicht von der Einrichtung aller anderen Cajun-Familien, die im Bayou lebten.
»Mr. Rodrigues hat heute morgen diesen Korb mit frischen Eiern gebracht, sagte Grandmère Catherine und wies mit einer Kopfbewegung auf den Korb, der auf der Anrichte unter dem Fenster stand. »Ich finde es sehr nett von ihm, daß er in Zeiten an uns denkt, in denen er selbst so viele Sorgen hat«.
Sie erwartete nie mehr als ein schlichtes Dankeschön für die Wunder, die sie wirkte. Sie sah ihre Kräfte nicht als etwas an, was ihr gehörte; sie sah darin etwas, was den Gajuns schlechthin gehörte. Sie glaubte daran, daß sie auf dieser Erde den Zweck zu erfüllen hatte, denen zu dienen und zu helfen, die weniger glücklich dran waren, und die Freude, die es ihr bereitete, anderen zu helfen, war ihr Lohn genug.
Sie schlug zwei Eier für mich in die Pfanne.
»Vergiß nicht, deine neuesten Bilder heute draußen hinzustellen. Ich finde das ganz großartig, auf dem der Reiher aus dem Wasser kommt, sagte sie lächelnd
»Wenn du es großartig findest, Grandmère, dann sollte ich es nicht verkaufen. Ich sollte es dir schenken«.
»Unsinn, Kind. Ich will, daß alle deine Bilder zu sehen bekommen, vor allem Leute in New Orleans«, erklärte sie. Das hatte sie schon oft gesagt und jedesmal mit demselben Nachdruck.
»Warum? Warum sind diese Leute denn so wichtig?« fragte ich.
»Dort gibt es Dutzende und Aberdutzende von Kunstgalerien und auch berühmte Künstler, die deine Arbeiten sehen und deinen Namen in Umlauf bringen werden, und dann wollen alle reichen Kreolen eins deiner Gemälde bei sich zu Hause hängen haben«, erklärte sie.
Ich schüttelte den Kopf. Es sah ihr gar nicht ähnlich, sich zu wünschen, daß Bekanntheit und Ruhm über unser einfaches kleines Häuschen im Bayou hereinbrächen. Wenn wir an den Wochenenden unsere Handarbeiten und sonstigen Waren vor das Haus trugen, dann taten wir das für unseren Unterhalt, aber ich wußte, daß Grandmère Catherine all die Fremden, die vorbeikamen, eigentlich gar nicht behagten, obwohl manche unter ihnen sich für ihr Essen begeisterten und sie mit Komplimenten überschütteten. Es steckte etwas anderes dahinter, wenn Grandmère Catherine mich drängte, meine Werke auszustellen, ein geheimnisvoller Grund.
Das Bild mit dem Reiher war auch für mich etwas ganz Besonderes. Ich hatte eines Tages im Zwielicht am Ufer des Teichs hinter unserem Haus geständen, als ich diesen Kernbeißer sah, einen Nachtreiher, wie er so plötzlich und unerwartet vom Wasser aufflog, daß es schien, als käme er aus dem Wasser. Auf seinen breiten dunkelvioletten Schwingen schwebte er davon und erhob sich über die Zypressen. Ich nahm in seinen Bewegungen etwas Poetisches und Wunderschönes wahr und konnte es kaum erwarten, einen Teil dessen in einem Gemälde einzufangen. Später, als Grandmère Catherine das fertige Werk zu sehen bekam, war sie einen Moment lang sprachlos. Tränen glitzerten in ihren Augen, und sie gestand, daß meine Mutter den blauen Reiher allen anderen Sumpfvögeln vorgezogen hatte.
»Das ist noch ein Grund mehr dafür, daß wir das Bild behalten sollten«, sagte ich.
Aber Grandmère Catherine war nicht meiner Meinung und sagte: »Das ist erst recht ein Grund dafür, alles zu tun, damit es nach New Orleans gebracht wird.« Es war fast so, als wollte sie durch mein Werk jemandem in New Orleans eine hintergründige Botschaft zukommen lassen.
Nachdem ich gefrühstückt hatte, begann ich, die Handarbeiten und die Waren, die wir an diesem Tag gern verkaufen wollten, aus dem Haus zu tragen, während Grandmère Catherine noch die Saucen ihrer Gerichte band. Ein Roux gehörte zu den ersten Dingen, die ein junges Cajun-Mädchen herzustellen lernte. Dabei handelte es sich um nichts anderes als Mehl, das in Butter, Öl oder tierisches Fett eingerührt werden und eine nußbraune Färbung annehmen soll, aber nicht so heiß werden darf, daß es schwarz wird. Nachdem man diese Mehlschwitze zubereitet hatte, wurden Meeresfrüchte oder Huhn, manchmal auch Ente, Gans oder Perlhuhnfleisch, ab und zu gar Wild mit Wurst oder Muscheln hineingerührt, um das Gumbo herzustellen. Zur Fastenzeit bereitete Grandmère ein grünes Gumbo zu, in das nur Gemüse und kein Fleisch gerührt wurde.
Grandmère hatte recht gehabt. Viel früher als sonst trafen die ersten Kunden ein. Manche der Leute, die vorbeischauten, waren Freunde von ihr oder andere Cajuns, die von dem Couche mal erfahren hatten und sich die Geschichte von ihr selbst erzählen lassen wollten. Einige ihrer älteren Freundinnen saßen da und riefen sich vergleichbare Geschichten ins Gedächtnis zurück, die sie von ihren Eltern und Großeltern gehört hatten.
Kurz vor der Mittagszeit sahen wir zu unserem Erstaunen eine lange und schicke silbergraue Limousine vorbeifahren. Plötzlich hielt sie an und setzte dann in hohem Tempo zurück, bis sie direkt vor unserem Stand anhielt. Die hintere Tür wurde aufgerissen, und ein großer, schlaksiger Mann mit graubraunem Haar und einem leicht olivfarbenen Teint stieg aus. Das Lachen einer Frau drang hinter ihm aus der Limousine.
»Jetzt sei schon ruhig«, sagte er, und dann drehte er sich um und lächelte mich an.
Eine attraktive blonde Dame mit stark geschminkten Augen, dick aufgetragenem Wangenrouge und Lippenstift streckte den Kopf durch die offene Tür. Eine lange Perlenkette baumelte an ihrem Hals. Sie trug eine Bluse aus grellrosa Seide. Die obersten Knöpfe standen offen, und daher konnte ich nicht umhin zu bemerken, daß ihre Brüste weitgehend entblößt waren.
»Beeil dich, Dominique. Ich will heute abend unbedingt bei Arnaud’s essen«, quengelte sie.
»Reg dich nicht auf. Wir haben jede Menge Zeit«, sagte er, ohne sich zu ihr umzuwenden. Seine Aufmerksamkeit galt ausschließlich meinen Gemälden. »Von wem sind die?« fragte er.
»Von mir, Sir«, sagte ich. Er trug ein kostspieliges weißes Hemd aus der schneeweißesten und weichsten Baumwolle, die ich je gesehen hatte, und einen anthrazitfarbenen Anzug.
»Wirklich?«
Ich nickte; und er trat näher, um das Bild mit dem Reiher hochzuheben. Er hielt es auf Armeslänge von sich und nickte. »Du besitzt Instinkt«, sagte er. »Noch primitiv, aber schon recht bemerkenswert. Hast du Unterricht genommen?«
»Nur in der Schule ein bißchen, und manches habe ich beim Lesen alter Kunstzeitschriften gelernt«, erwiderte ich.
»Bemerkenswert.«
»Dominique!«
»Sei so nett, und halt mal die Luft an.« Er grinste mich an, als wollte er damit sagen: »Stör dich nicht an ihr«, und dann sah er sich zwei weitere meiner Gemälde an. Ich hatte fünf zum Verkauf ausgestellt. »Wieviel verlangst du für deine Gemälde?« fragte er.
Ich sah Grandmère Catherine an, die mit Mrs. Thibodeau dastand und, seit die Limousine vorgefahren war, das Gespräch abgebrochen hatte. In Grandmère Catherines Augen stand ein merkwürdiger Ausdruck. Es schien, als schaute sie tief in diesen gutaussehenden, wohlhabenden Fremden hinein und suchte nach etwas, was ihr sagte, daß er nicht nur einer dieser einfältigen Touristen war, die sich über das Lokalkolorit amüsierten.
»Ich verlange fünf Dollar pro Stück«, sagte ich.
»Fünf Dollar!« Er lachte. »Erstens einmal solltest du nicht für jedes Bild denselben Preis verlangen«, belehrte er mich. »In diesem hier mit dem Reiher steckt eindeutig mehr Arbeit drin als in den anderen«, erklärte er selbstsicher und sah Grandmère Catherine und Mrs. Thibodeau an, als seien sie seine Schülerinnen. Dann wandte er sich wieder an mich. »Du brauchst dir doch nur die Feinheiten anzusehen... wie du das Wasser und die Bewegung in den Schwingen des Reihers eingefangen hast.« Er kniff die Augen zusammen und schürzte die Lippen, als er die Gemälde ansah, und dann nickte er, als wollte er sich selbst bestätigen. »Ich gebe dir als Anzahlung für alle fünf fünfzig Dollar«, verkündete er.
»Fünfzig Dollar. Aber...«
»Was soll das heißen, als Anzahlung?« fragte Grandmère Catherine und trat näher.
»Entschuldigen Sie bitte«, sagte der Gentleman. »Ich hätte mich vorstellen sollen, wie es sich gehört. Ich heiße Dominique LeGrand. Ich besitze eine Kunstgalerie im Französischen Viertel, die schlicht und einfach Dominique’s heißt. Hier«, sagte er, griff in eine Hosentasche und holte eine Visitenkarte heraus. Grandmère nahm die Karte zwischen ihre kleinen Finger, um sie sich anzusehen.
»Und was hat es mit dieser... Anzahlung auf sich?«
»Ich glaube, daß ich für diese Gemälde weit mehr erzielen kann. Normalerweise stelle ich die Arbeiten eines Künstlers in meiner Galerie aus, ohne vorher etwas zu bezahlen, aber ich möchte in irgendeiner Form ausdrücken, wie sehr ich die Arbeiten dieses jungen Mädchens schätze. Ist das Ihre Enkelin?« erkundigte sich Dominique.
»Ja«, sagte Grandmère Catherine. »Ruby Landry. Werden Sie auch bestimmt dafür sorgen, daß ihr Name in Verbindung mit den Bildern genannt wird?« fragte sie zu meinem Erstaunen.
»Selbstverständlich«, sagte Dominique LeGrand lächelnd. »Wie ich sehe, hat sie ihre Initialen unten rechts stehen«, sagte er und wandte sich dann an mich. »Schreib aber in Zukunft deinen vollen Namen hin«, wies er mich an. »Und ich glaube wirklich, daß dir eine Zukunft bevorsteht, Mademoiselle Ruby.«
Er zog einen Packen Geld aus der Tasche und zählte davon fünfzig Dollar ab, mehr Geld, als ich bisher mit dem Verkauf all meiner Gemälde eingenommen hatte. Ich sah zu Grandmère Catherine, die nickte, und dann nahm ich das Geld an.
»Dominique!« rief seine Begleiterin wieder.
»Ich komme schon, ich komme schon. Philip«, rief er, und der Chauffeur kam um den Wagen herum, um meine Gemälde im Kofferraum der Limousine zu verstauen. »Gehen Sie behutsam damit um«, sagte er zu ihm. Dann schrieb er sich unsere Adresse auf. »Sie hören von mir«, sagte er, als er wieder in seine Limousine stieg. Grandmère Catherine und ich standen nebeneinander und sahen dem Wagen nach, als er losfuhr, bis er um die erste Biegung verschwand.
»Fünfzig Dollar, Grandmère!« sagte ich und schwenkte das Geld durch die Luft. Mrs. Thibodeau war reichlich beeindruckt, aber meine Großmutter wirkte eher nachdenklich als glücklich. Ich hatte sogar den Eindruck, daß sie ein wenig traurig zu sein schien.
»Das war der Anfang«, sagte sie mit einer Stimme, die kaum mehr als ein Flüstern war, und ihre Augen sahen starr in die Richtung, die die Limousine eingeschlagen hatte.
»Der Anfang wovon, Grandmère?«