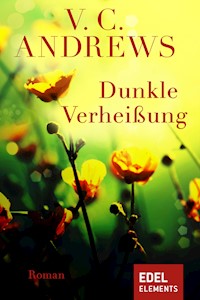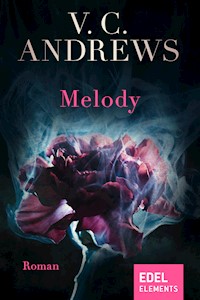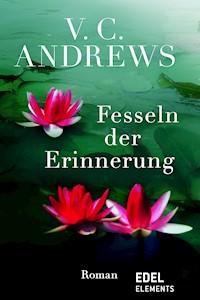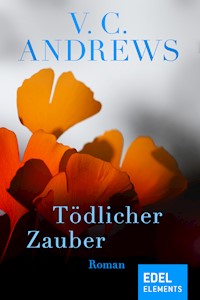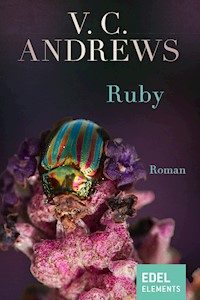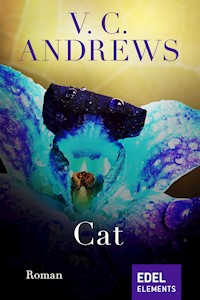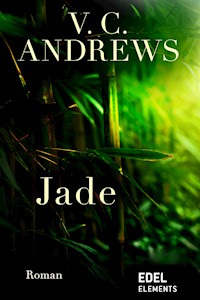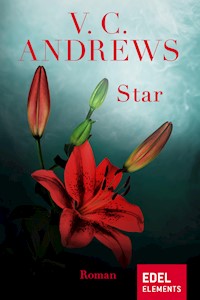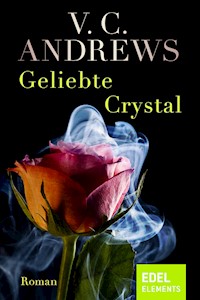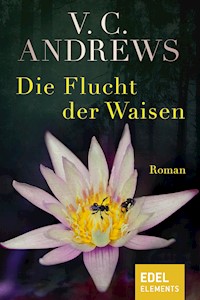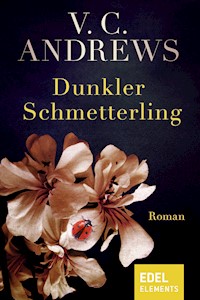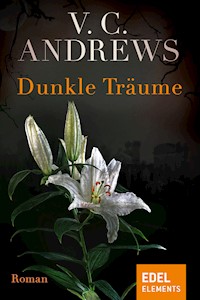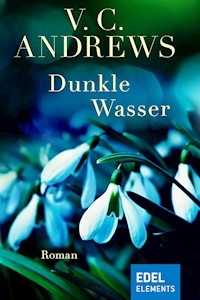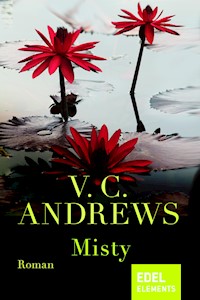V.C. Andrews – eine der erfolgreichsten Bestsellerautorinnen der Welt. Und eine Meisterin der romantischen Spannung!
Unter der liebevollen und geduldigen Anleitung ihres Psychiaters Dr. Marlowe haben Misty, Star, Jade und Cat allmählich gelernt, einander zu vertrauen. Zum ersten Mal fanden die vier jungen Frauen den Mut, offen von den schrecklichen Erlebnissen in ihrer Kindheit zu erzählen. Es war wie eine Befreiung: Endlich, nach all den Jahren der Einsamkeit, erkannten Dr. Marlowes Patientinnen, dass sie mit ihren schmerzlichen Erfahrungen nicht allein waren. Doch sie alle haben ihre dunkelsten Geheimnisse bislang noch zurückgehalten – nun wird es allmählich Zeit, die ganze Wahrheit auszusprechen...
Ein spannender Roman voller Liebe, Hass und dunkler Geheimnisse – V.C. Andrews´ bewegende Wildflower-Saga!
PROLOG
Immer wenn ich Geschichten über Mädchen meines Alters lese, frage ich mich, was mit meiner Kindheit passiert ist. Ich wurde geboren, und jetzt bin ich einfach da – Cathy Carson, siebzehn. Die Erinnerungen an die Jahre davor sind verschwommen. Natürlich wusste ich warum. Ich will mich nicht daran erinnern, nicht nach all dem, was geschehen ist, nicht nach dem, was mein Vater mir angetan hat.
Er ist aus unserem Leben verschwunden, aber nicht wirklich weg. Er ist nie weit entfernt. Ich muss nur die Augen schließen, und da ist er wieder – lächelt, flüstert mir leise zu, wie hübsch ich bin, und berührt mich dann.
Ich schaudere, als würde mir Eis über den Rücken laufen. Dann schüttele ich heftig den Kopf, um diese Bilder durcheinander zu wirbeln und dadurch den Schmerz zu lindern. Er verschwindet, und eine Weile bin ich sicher.
Nach monatelangen Besuchen bei meiner Therapeutin Dr. Marlowe und der Gruppentherapie mit den anderen »Waisen mit Eltern« Jade, Star und Misty konnte ich mich wieder dem normalen Leben zuwenden. Ich hatte mein erstes Jahr an der St. Jude’s High School beendet und die Gruppentherapie hinter mich gebracht. Noch eine
weitere Sitzung bei meiner Therapeutin sollte folgen, dafür war aber noch kein Termin festgesetzt worden.
Als unsere Gruppensitzungen endeten, glaubte ich nicht, dass die anderen Mädchen mich wirklich zur Freundin haben und mit mir in Kontakt bleiben wollten, obwohl wir das verabredet hatten und Jade alle unsere Telefonnummern notiert hatte. Wir hatten einander so viele intime Geheimnisse anvertraut. Manchmal bindet es Menschen eng aneinander, solche Dinge miteinander zu teilen, schafft Bande, die fast nicht zu zerreißen sind.
Aber manchmal, wenn dir klar wird, was du enthüllt hast, kannst du dem Zuhörer nicht wieder ins Gesicht sehen. Es ist dir peinlich, dass er deinen Schmerz und deine Erniedrigung sieht, wenn er dich anschaut. Du wendest dich ab. Du wünschst, er würde weggehen, und du vermeidest, mit ihm in Kontakt zu treten. Am liebsten möchtest du ihn wieder zu einem Fremden machen. Vielleicht trefft ihr euch zufällig irgendwo, starrt einander ausdruckslos ins Gesicht und tut so, als sähet ihr einander nicht.
Eine Hälfte von mir hoffte, das würde geschehen, aber die andere Hälfte, die Hälfte, die sich nach Freundinnen und verwandten Seelen sehnte, hoffte, das würde nicht geschehen. Niemand außer meinem Vater, der seine Gründe dafür hatte, hat je ein Versprechen mir gegenüber gehalten. Ich erwartete nicht, dass die Mädchen es tun würden. Jede von ihnen hatte ihre eigenen Probleme, und jede war bestimmt beschäftigt und abgelenkt.
Misty Fosters Eltern hatten eine üble Scheidung hinter sich; ihr Vater hatte eine Affäre mit einer viel jüngeren Frau. Ihre Mutter traf sich mit anderen Männern, ging aber völlig darin auf, jung und schön zu sein. Die arme Misty fühlte sich so allein, dass sie die Idee hatte, sich und uns die »Waisen mit Eltern« oder WMEs zu nennen.
Es war ein komischer Einfall, aber nach einer Weile gefiel er mir, weil ich noch nie Mitglied irgendeiner Organisation oder eines Clubs gewesen war, noch nie in einem Stück oder einer Mannschaft mitgespielt hatte. Es handelte sich nicht um die Art Clubmitgliedschaft, die irgendjemand anstrebte, aber zumindest gab es so etwas wie Gemeinschaftssinn, das Gefühl, etwas zu teilen.
Star Fisher lebte mit ihrem achtjährigen Bruder Rodney bei ihrer Großmutter Pearl Anthony, der Mutter ihrer Mutter, nachdem zuerst ihr Vater die Familie verlassen hatte und dann ihre Mutter mit einem Freund davongelaufen war. Dennoch war Star die Stolzeste und in mancher Hinsicht die Stärkste von uns. Als ich sie kennen lernte, hatte ich Angst vor ihr. Sie wirkte so hart und sogar gemein, aber nachdem ich ihre Geschichte und sie unsere gehört hatte, schien sie weicher zu werden und mich und die anderen sogar beschützen zu wollen. Ich wollte in vieler Hinsicht so sein wie sie.
Und dann war da noch die Präsidentin unseres Clubs, Jade Lester, ein schönes und reiches Mädchen, das in einer Villa in Beverly Hills lebte. Ihre Eltern behandelten sie wie ein Besitzstück, einen Aktivposten, um den sie sich während ihrer unschönen Scheidung stritten. Die Eltern waren starke und unabhängige Persönlichkeiten: der Vater ein berühmter und erfolgreicher Architekt, die Mutter, Managerin in einer Kosmetikfirma, widmete sich ihrer Karriere mit Leidenschaft und ließ sich von ihrer Verantwortung als Mutter bei ihrem Aufstieg auf der Karriereleiter nicht in die Quere kommen. Als wir unsere Gruppentherapie beendeten, handelten ihre Eltern gerade einen Kompromiss in der Frage des Sorgerechtes aus, hatten ihn aber noch nicht erzielt.
So schlimm meine Geschichte auch war, am Ende taten
mir die anderen Leid. Die anderen schienen hingegen mehr Mitgefühl für mich als für sich selbst aufzubringen. Dabei kannten sie nicht einmal die ganze Wahrheit über meine Familie.
Familie ist solch ein seltsames Wort in meiner Situation. Ich war adoptiert worden, hatte das aber erst entdeckt, nachdem mein Vater begonnen hatte, sich mir aufzuzwingen. Die anderen Mädchen waren es, die mich auf die Frage brachten, warum meine Mutter überhaupt ein Kind hatte adoptieren wollen. Sie schien sich nicht wohl zu fühlen mit mir und hasste die Verantwortung als Mutter. Ich hatte mich schon früher gefragt, was sie veranlasst hatte, ein Kind zu wollen, aber nicht mit solchem Nachdruck und solcher Dringlichkeit, die die Mädchen in mir angestachelt hatten. Schließlich stellte ich meine Mutter zur Rede und zwang sie, mir die Wahrheit zu erzählen oder was ich als die schmutzige Wahrheit entdeckte.
Ich war nicht wirklich ihre Adoptivtochter, sondern ihre Halbschwester. Unsere Mutter hatte, als sie über vierzig war, eine Liebesaffäre gehabt und war schwanger geworden. Meine Halbschwester war gezwungen worden, Howard Carson zu heiraten und mich zu adoptieren. Es gab noch vieles, was ich nicht wusste, aber diese Enthüllung reichte aus, dass mir ganz schlecht wurde und ich mich noch unerwünschter und verwirrter fühlte.
Was war ich? Wer war ich? Zu erfahren, dass man ein bedauerlicher Fehltritt war, eine Sünde, eine Peinlichkeit, ist grauenhaft, aber ich musste noch mehr erfahren.
Meine Halbschwester Geraldine (es bereitet mir jetzt große Schwierigkeiten, an sie als meine Mutter zu denken) hat mich immer gewarnt, der Wahrheit zu nahe zu kommen. Sie behauptete, dass es dich nicht befreit. Sie sagte:
»Es ist wie bei allem Guten. Es lässt dich im Dunkeln zurück. Stell nicht so viele Fragen.«
Einmal als ich ihr eine meiner endlosen Litaneien von Fragen stellte und ihr sagte, ich müsse die Wahrheit wissen, die Wahrheit sei wichtig, reagierte Geraldine, indem sie mich fragte: »Was wäre, wenn du schrecklich hässlich wärst, aber in einer Welt lebtest, in der es keine Spiegel, keine reflektierenden Flächen gibt, keinerlei Möglichkeit, dich selbst zu sehen und es zu erfahren? Wärst du besser dran, wenn jemand dir einen Spiegel mitbrächte und dir dein Gesicht zeigte? Das ist auch die Wahrheit, und sie bringt nur Schmerzen.«
Hatte sie Recht? Hatte ich sie gezwungen, einen Spiegel hochzuhalten? War mein Schmerz mein eigenes Werk? Vielleicht hasste sie es deshalb, in Spiegel zu schauen und sich um ihr Aussehen zu kümmern. Vielleicht kritisierte sie deshalb die meisten Frauen als krankhaft selbstverliebt, erlaubte mir nur bestimmte Bücher und Zeitschriften, als ich jünger war, und gestattete mir nicht, bestimmte Fernsehprogramme anzuschauen. Vielleicht schimpfte sie deshalb über manche Werbespots und verlangte von mir, dass ich alles Menschenmögliche tat, um meine Brüste zu verstecken, als sie sich viel zu früh entwickelten.
Aber vielleicht gab es einen anderen Grund, einen tiefer liegenden Grund, einen Grund, den sie noch mehr fürchtete als die Wahrheiten, die sie bereits preisgegeben hatte. Unser Haus steckte voller Geheimnisse, unausgesprochenen finsteren Gedanken, die in Ecken lauerten oder wie Insekten unter Teppichen oder in verschlossenen Schränken hausten. Sollte ich sie herausholen? Sollte ich tun, wovor sie mich gewarnt hatte? Sollte ich mich weiter an das Schweigen klammern, fortschauen, die Augen schließen?
Ich erinnerte mich, wie Star ihre Fantasiewelt beschrieb, ihren fliegenden Teppich, der sie von ihrem Unglück fortträgt. Dazu war ich nie imstande. Es war mir immer zu schwierig, das hauchdünne Gewebe meiner Träume wurde zu leicht zerstört von Geraldines Stimme oder Blick. Meine Fantasien waren wie ein Ballon, der vom Boden abheben wollte und explodierte oder die Luft verlor und mich hart auf den Boden knallen und tief in meiner Einsamkeit Wurzeln schlagen ließ.
Uhren tickten, Tag wurde zu Nacht und wieder zu Tag. Ich erfüllte meine Pflichten, als sei ich hypnotisiert, mechanisch, ohne jegliche innere Regung, erschreckt vom Geräusch meines eigenen Gelächters, falls es je ertönte, und sogar überrascht von meinen eigenen Tränen und Schluchzern.
Nachdem Geraldine mir zögernd einen Teil der Wahrheit erzählt hatte, fühlte ich mich noch entfremdeter und allein. Ich starrte aus meinem Fenster auf die Straße hinaus und beobachtete, wie die Autos vorbeifuhren, fragte mich, wer diese Leute waren und wohin sie fuhren. Ich hielt auch Ausschau nach Anzeichen auf meinen Stiefvater. Für immer und ewig lauerte er drohend dort draußen.
Geraldine glaubte, er würde es nicht wagen aufzutauchen, aber insgeheim fürchtete ich, er würde zurückkommen. Vielleicht würde ich als Erstes seine Hände sehen, diese langen Spinnenfinger, dann träte er aus der Dunkelheit, lächelte und griff nach mir. Ich würde meinen Körper schließen wie eine Faust und den Atem anhalten.
KAPITEL EINS
Verbotene Freuden
Als Jade mich anrief, um mich ebenso wie Misty und Star zu unserem ersten offiziellen Treffen der »Waisen mit Eltern« einzuladen, erwachte mein Herz und Glück durchströmte meine Adern. Mein ganzer Körper wurde lebendig und erhob sich, als ob seine schweren Ketten gesprengt worden wären. Ich konnte beinahe hören, wie sie zerbarsten und zu meinen Füßen aufschlugen.
Geraldine war eifrig damit beschäftigt, unser Abendessen vorzubereiten. Aber die ganze Zeit hörte sie mit einem Ohr zu, was um sie herum geschah. Unser Telefon im Erdgeschoss hing an der Küchenwand nahe der Tür. Ich selbst hatte kein eigenes Telefon in meinem Zimmer. Vertrauliche Gespräche konnte ich nur führen, wenn sie oben war, außer Haus oder auf der Toilette. Sobald ich den Hörer wieder auflegte, wirbelte sie auf dem Absatz herum und wollte wissen, wer angerufen hatte.
»Es war Jade«, verkündete ich, außer Stande, meine Aufregung zu verbergen. »Sie hat mich zu sich nach Hause zum Brunch eingeladen.«
»Jade?« Geraldine kniff die Augen zu misstrauischen Schlitzen zusammen, ein finsterer Blick voller Anschuldigungen, Ängsten und Drohungen. »Ist das nicht eine von denen?«
Geraldine bezog sich auf die anderen Mädchen in meiner Therapiegruppe gewöhnlich als »die«. Das klang so, als handelte es sich um monströse außerirdische Geschöpfe. Wenn sie Monster waren, was war ich dann, fragte ich mich. Sie gab meinem Vater an allem die Schuld, wenn sie darüber sprach, falls sie je darüber sprach. Aber tief in meinem Innersten war ich überzeugt davon, dass sie auch mir die Schuld gab. Ich konnte es sehen und spüren an der Art, wie sie ihren Blick wie zwei winzige anklagende Scheinwerfer auf mir ruhen ließ.
Schließlich hatte sie mir das Gefühl gegeben, als sei ich verseucht, weil ich als Produkt einer ehebrecherischen Beziehung geboren worden war, selbst wenn die Ehebrecherin ihre eigene Mutter war. Sünde hatte in Geraldines Augen immer etwas Ansteckendes. Warum sollte sie also nicht glauben, ich hätte die Neigung dazu geerbt?
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie mich jemals erfreut angeschaut hätte und ganz bestimmt nie voller Stolz. Ständig suchte sie nach etwas, das sie kritisieren konnte, als sei ihr die Verantwortung übertragen worden, dafür zu sorgen, dass ich nie vom Pfad der Tugend abwich, ihrer Tugend. Meine frühreife üppige Figur verstärkte ihr Bild von mir. Einmal warf sie mir sogar vor, das deute auf Sexbesessenheit hin. Über Sex sprach sie immer, als handelte es sich um eine Seuche. Oft versuchte sie mich dazu zu bringen, mich meines Aussehens zu schämen. Sie hinderte mich sogar so lange wie möglich, meine weibliche Figur zu zeigen, indem sie meinen Körper in Korsagen quetschte, als er anfing, sich zu entwickeln.
»Sie ist eine von den Mädchen, ja«, bestätigte ich schließlich und hoffte, sie würde nicht wie schon so oft in der Vergangenheit anfangen, Jade und die anderen zu kritisieren.
»Die Mädchen? Du meinst, diese Mädchen aus Dr. Marlowes Klinik?«, fragte sie und verzog das Gesicht, als hätte sie in eine verschimmelte Walnuss gebissen.
Geraldine hatte diese Therapiesitzungen nie gebilligt. Sie hasste die Vorstellung, dass Fremde irgendwelche intimen Dinge über uns wussten. Am liebsten hätte sie alles in mir eingeschlossen, ganz gleich welchen Schaden das bei mir anrichtete. Nach ihrer Denkweise schluckte man das Schlechte mit dem Guten, schloss es in sich ein und arbeitete, arbeitete, arbeitete, war ständig beschäftigt, um zu vergessen, was unerfreulich oder hässlich war.
»Dr. Marlowe nannte es nie eine Klinik, Mutter. Du weißt, dass wir das Behandlungszimmer in ihrem Wohnhaus benutzen. Bei dir hört sich das schrecklich an, wie ein Krankenhaus oder ein Forschungslabor oder so was, in dem wir vier wie Versuchskaninchen behandelt wurden«, sagte ich.
Wieder schnitt sie eine Grimasse, nur diesmal angeekelt. Geraldine konnte ihren Mund verziehen, dass er beinahe wie ein Korkenzieher aussah. Sie war in der letzten Zeit so dünn geworden, dass sie die Wangen kaum noch einziehen konnte, aber wenn sie die Lippen verzog, wölbten sie sich in der Mitte nach innen wie Untertassen.
»Das ist nur ein Haufen Hokuspokus, dieser ganze psychologische Humbug. Was machten die Menschen denn, bevor es diese ganzen Therapeuten und Analysen gab, hm? Das werde ich dir sagen.« Wie so oft hatte Geraldine eine Frage gestellt, die sie für sich schon zufrieden stellend beantwortet hatte. »Sie bissen die Zähne zusammen und ertrugen es. Das machte sie stärker.
Heutzutage jammern und stöhnen alle herum, beklagen sich, sobald die geringste Schwierigkeit auftaucht. Man sieht sie sogar im Fernsehen – im Fernsehen! Und warum?
Um die allerpersönlichsten Dinge auszuplaudern! Die Menschen haben kein Schamgefühl mehr. Sie sind bereit, völlig Fremden ihre privatesten Geheimnisse und Angelegenheiten anzuvertrauen, damit alle Welt es sieht und weiß. Ekelhaft.
Mit all dieser Dummheit verwässern wir unser Blut«, beharrte sie. »Verwässern das Blut, machen uns schwach und bemitleidenswert. Es gibt keine Entschlossenheit, keinen Mut mehr. Die Menschen besitzen keinerlei Selbstachtung, und diese so genannten Ärzte fördern das alles.«
»Dr. Marlowe hat uns geholfen, Mutter, uns allen in einer sehr schweren Zeit beigestanden«, widersprach ich.
»Hm«, brummte sie zähneknirschend. »Auf jeden Fall will ich nicht, dass du mit solchen Mädchen Umgang pflegst. Mir gefällt die Vorstellung überhaupt nicht, dass diese Ärztin euch alle zusammengebracht hat. Das war nicht gesund.«
»Aber ich mag sie und sie mögen mich. Wir haben …«
»Was?«, fauchte sie. »Was habt ihr?«
»Viel gemeinsam«, erwiderte ich.
»Du meinst, sie … ihre Daddys …«
»Nein, jede hat ein anderes Problem, keines davon ist genau wie meines«, warf ich rasch ein.
Sie atmete tief und richtete ihren Oberkörper schlagartig gerade auf, als hätte sie einen Spazierstock verschluckt. Sie hasste alles, das auch nur vage daran erinnerte, was vorgefallen war.
»Was soll denn Gutes dabei herauskommen, wenn du mit Mädchen zusammen bist, die Probleme haben, Cathy? Sie werden den Brunnen nur noch mehr vergiften. Sie können keinen guten Einfluss auf dich ausüben. Wenn du Lungenentzündung hättest, würde es dir dann gut tun,
mit Patienten zusammen zu sein, die an Tuberkulose leiden? Nein, natürlich nicht. Wenn diese Dr. Marlowe glaubte, du brauchtest Hilfe, warum bringt sie dich mit anderen Mädchen zusammen, die auch krank sind? Um schneller Geld zu verdienen, das ist es«, behauptete sie triumphierend.
»Nein, das stimmt nicht. Es ist eine Technik …«
»Technik«, fauchte sie. »Sie haben alle möglichen Worte, um die Wahrheit zu kaschieren und mit ihrem Hokuspokus davonzukommen. Ich will nicht, dass du noch irgendetwas mit diesen Mädchen zu tun hast, hörst du?«
»Aber –«
»Kein Aber, Cathy. Ich trage jetzt die ganze Verantwortung für dich. Habe es schon immer getan«, giftete sie. »Du gehst los und gerätst mit einigen gestörten Teenagern in Schwierigkeiten, und ich muss dann mit noch mehr fertig werden. Es reicht schon, dass ich diesen Haushalt führe und dafür sorge, dass du alles bekommst, was du brauchst.«
»Aber ich brauche auch Freunde!«
»Freunde ja, aber keine geisteskranken«, beharrte sie und wandte mir den Rücken zu.
»Sie sind nicht geisteskrank. Wenn sie geisteskrank sind, was bin ich denn dann?«
Sie schwieg.
»Ich gehe«, versicherte ich ihr.
Sie knallte einen Topf so heftig auf die Arbeitsplatte, dass mir die Eingeweide bis zum Hals sprangen. Dann drehte sie sich zu mir um und schwenkte drohend den Topf, den sie wie einen Knüppel umklammert hielt.
»Du wirst mir jetzt gehorchen«, warnte sie mich. »Ich bin gesetzlich deine Mutter und immer noch verantwortlich für dich, hörst du?«
Ich starrte sie an. Plötzlich wechselte ihre Farbe von Knallrot zu Leichenblass; sie taumelte gegen die Arbeitsplatte.
»Mutter, was ist los?«, rief ich.
Sie winkte ab.
»Nichts«, wehrte sie ab und holte anscheinend unter Schmerzen tief Luft. »Es ist nur ein kleiner Schwindelanfall. Geh und kümmere dich um deine Aufgaben. Ich rufe dich bald, um den Tisch zu decken.«
Sie umklammerte Bauch und Brust, als wollte sie alles in sich bewahren, und kehrte mir den Rücken zu. Ich wartete und sah zu, wie sie diesmal ihre knochigen Schultern mit größerer Anstrengung straffte und sich dann wieder ihrer Arbeit zuwandte. Sie stöhnte leise, sagte aber nichts mehr. Ich beobachtete sie noch einen Augenblick, bevor ich die Küche verließ.
Ich war fest entschlossen, zu Jade zu fahren. Ich wollte nicht ausgeschlossen sein. Ich hatte Geraldine nicht gesagt, dass der Brunch bereits morgen stattfinden sollte. Ich würde mich hinausstehlen und einfach gehen nach ihrer goldenen Regel: Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Die Wahrheit verbergen. Die Wahrheit kann Schmerzen bringen. Warum sollte ich ihr Schmerzen bereiten? Manchmal ist es freundlicher zu lügen.
Weil ich nicht mehr über den Brunch redete, erwähnte auch Geraldine das Thema nicht mehr, das sich wie so viele unangenehme Gedanken und Worte in diesem Haus verflüchtigte. Manchmal wenn ich mich zu Hause umschaute, hatte ich den Eindruck, die bereits dunklen Wände würden noch dunkler, weil so viele gemeine, üble und hässliche Worte sich über sie ergossen hatten.
Geraldine gefiel das Haus so. Den größten Teil des Tages hielt sie die Vorhänge dicht zugezogen, »damit die Leute
nicht durch das Fenster starren und schnüffeln«. Als ob es irgendjemanden interessierte, was in unserem Zuhause vor sich ging. Wir waren bestimmt die langweiligsten Leute in der ganzen Straße. Wer würde denn etwas über uns wissen wollen? Geraldine nahm nie an irgendwelchen gesellschaftlichen Ereignissen teil und sprach mit kaum jemandem. Sie blieb gerne für sich, das Licht gedämpft, die Türen fest geschlossen, die Welt in Schach gehalten.
Nach dem Abendessen gelang es mir, ans Telefon zu gehen, ohne dass Geraldine mithörte. Sie war nach oben ins Badezimmer gegangen. Schon immer hatte sie Angst gehabt, ich oder mein Adoptivvater, als er noch da war, könnten sie hören. Aus diesem Grund schrie sie mich immer an, wenn ich unten die Toilette benutzte: »Wenn du gehst, wirf erst etwas Klopapier in das Wasser, damit keine ekelhaften Geräusche zu hören sind. Diese Wände und Türen sind so dünn, dass du den Magen eines anderen gurgeln hören kannst.«
Ich hätte sie fragen sollen: »Warum hast du nie gehört, was hinter meinen Wänden und Türen vor sich ging, wenn sie doch so dünn sind?« Sie hatte mich nicht gehört, als ich sie am meisten brauchte, und als ich jetzt zum Hörer griff, hoffte ich, ihre freiwillige Taubheit würde andauern.
»Hier ist Cathy. Ich habe ein Problem«, begann ich, als Jade ans Telefon kam.
»Oh, nein«, rief sie. »Ich wusste, deine Mutter würde dich nicht kommen lassen. Und ich lasse diesen tollen Brunch für uns vorbereiten. Star und Misty kommen ganz bestimmt. Bitte sag nicht, du kannst nicht kommen.«
»Nein«, erwiderte ich und lachte über ihre Skepsis. »Ich komme auch. Ich muss es nur im Augenblick vor meiner
Mutter geheim halten. Sie möchte nicht, dass ich dich besuche.«
»Warum?«, wollte sie wissen. Ich hörte die Empörung in ihrer Stimme, die sich wie eine Blase mit jedem Atemzug breiter in ihr machte. Nur Star konnte der darauf folgenden Explosion standhalten. »Hält sie sich für etwas Besseres als mich und meine Familie?«
»Sie war nie dafür, dass ich Dr. Marlowe besuche, erinnerst du dich? Sie glaubt, wir würden alle einen schlechten Einfluss aufeinander ausüben.«
»Was ist denn mit ihr? Was ist denn mit ihrem Einfluss oder besser gesagt ihrem Mangel an Einfluss? Sie hat doch zugelassen, dass all das direkt vor ihrer Nase mit dir geschah. Sie hat die denkbar schlechteste Ausrede für eine Mutter –«
»Bitte«, bettelte ich und dachte: »Wenn sie die Wahrheit wüsste.«
»Also, was soll ich tun?«
»Sag deinem Fahrer, dass ich an der Ecke warte, nicht vor meinem Haus.« Ich nannte ihr den Namen der Straße und versicherte ihr, dass ich da sein würde, wenn er kam. »Toll«, meinte sie. »Morgen kommt die Polizei und beschuldigt mich und meinen Chauffeur, dich gekidnappt zu haben. Deine Mutter wird bestimmt Anzeige erstatten.«
»Nein, das wird sie nicht«, beruhigte ich sie lachend.
»In Ordnung«, erklärte sie abschließend. »Zumindest hast du den Mumm, das Richtige zu tun und dich nicht einschüchtern zu lassen. Die Mädchen werden stolz auf dich sein«, fügte sie hinzu.
Es gab mir ein gutes Gefühl, sie das sagen zu hören, und mir wurde klar, dass ich mir nichts so sehr wünschte wie ihre Achtung. Viel mehr als Geraldines.
»Danke. Soll ich irgendetwas mitbringen?«
»Ja«, meinte sie, »dich.«
Ich lachte wieder und legte rasch auf, als ich Geraldines Schritte auf der Treppe hörte. Ich wusste, wie gut sie mir an den Augen ablesen konnte, wenn ich sie hinterging, deshalb räumte ich schnell das Geschirr weg und sagte ihr, ich hätte Kopfschmerzen und wollte mich hinlegen. Das war eine Entschuldigung, die sie immer akzeptierte. Vermutlich weil sie selbst so häufig unter Kopfschmerzen litt.
»In Ordnung«, sagte sie und zog sich ins Wohnzimmer zurück, um sich etwas »Anständiges« im Fernsehen anzusehen. »Vergiss nicht: Morgen früh erledige ich die Einkäufe für die Woche.«
Ich bot nicht an mitzugehen, und sie bat mich nicht darum. Wir machten so wenig gemeinsam. Wir gingen nie essen, ins Kino oder auch nur ins Einkaufscenter. Es machte sie nervös, wenn ich sie in die Geschäfte begleitete, weil sie stets beobachtete, wie die Männer mich anschauten, und mir dann befahl, den Mantel weiter zu schließen oder meine Arme höher zu halten, damit mein Oberkörper nicht so sehr hin- und herschwang. Sie machte mich so befangen, dass ich gar nicht gerne mit ihr zusammen war.
So bald wie möglich ging ich in mein Zimmer hinauf und schloss die Tür. Das war eine unserer Hausregeln … halt deine Tür geschlossen, schütze deine Intimsphäre, stell dich nicht zur Schau und bereite niemandem dadurch Unbehagen. Was für einen Sinn hatte das denn jetzt noch, da mein Vater weg war und nur noch sie und ich hier wohnten? Obwohl ich mich darüber wunderte, stellte ich ihre Anweisungen nicht in Frage. Es war einfacher, sie ihre Verhaltensregeln diktieren zu lassen.
In jener Nacht träumte ich von den Mädchen, davon,
richtige Freundinnen zu haben und mich zusammen mit ihnen zu amüsieren, vielleicht sogar auf Partys zu gehen und Jungen zu treffen.
Ich lernte Misty, Star und Jade kennen, als Dr. Marlowe uns zu einer Gruppentherapie zusammenbrachte. Wir waren alle so verschieden, und dennoch waren wir in einer Hinsicht gleich: Wir waren alle von unseren eigenen Eltern zu Opfern gemacht worden.
Es war eine ganze Weile her, seit wir uns zuletzt gesehen hatten. Jedes Mal, wenn das Telefon klingelte, was nicht häufig der Fall war, hoffte ich, es sei eine von ihnen. Wer sonst würde sich die Mühe machen, mich anzurufen? Geraldine hatte nur mich, weder Schwestern noch Brüder. Unsere Mutter und ihr Vater waren schon lange verstorben, und die Familienangehörigen meines Adoptivvaters, die sowieso nichts mit ihm zu tun haben wollten, waren jetzt ebenso wie er Persona non grata. Es kam so weit, dass ich Anrufe von Rechtsanwälten begrüßte, nur weil ich dann eine andere Stimme am Telefon hörte. Geraldine war immer direkt in der Nähe und beschwor mich: »Leg auf, leg auf, leg auf!«
Endlich hatte Jade angerufen. Sie hatte angerufen!
Am schwierigsten war es für mich, am nächsten Morgen meine Aufregung zu verbergen. Ich wählte den leichtesten Ausweg. Da Geraldine nie etwas über meine Periode wissen wollte, hatte sie keine Ahnung, wann sie kommen sollte. Ich klagte über Menstruationskrämpfe und erzählte ihr, dass ich keinen großen Appetit hätte. Wie üblich, wenn ich so etwas sagte, legte sie die Hände auf die Ohren und schloss die Augen.
»Ich habe es dir nicht einmal, ich habe es dir hundert Mal gesagt, Cathy. Man redet nicht über solche Dinge. Solche Dinge sind persönlich und sollten in deinem Kopf
eingeschlossen bleiben. Sie sind nicht für die Ohren von Fremden bestimmt.«
»Du bist keine Fremde, Mutter«, erklärte ich ihr, obwohl ich fand, dass sie sich manchmal wie eine benahm.
Sie schüttelte den Kopf.
»Das ist nicht der entscheidende Punkt. Was in deinem Körper passiert, geht niemanden etwas an, nicht einmal mich«, beharrte sie.
Die gleiche Diskussion hatten wir schon oft geführt. Manchmal tat ich das gerne, nur um sie auf die Palme zu bringen, nur um zu sehen und zu hören, wie sie die gleichen Dinge sagte. Als brauchte ich einen Beweis, dass sie so war, wie sie war, und tatsächlich die seltsamsten Dinge glaubte, die sie sagte.
Einmal sagte ich: »Aber wenn nun etwas nicht in Ordnung ist? Wie erfahre ich das, wenn ich es dir nicht erzähle?«
»Du wirst es wissen«, beharrte sie. »Dein Körper kann das selbst am besten beurteilen.«
Am liebsten hätte ich darauf geantwortet: »Wenn das stimmte, machte ich mich am besten direkt auf den Weg in die nächste psychiatrische Anstalt«, aber ich versiegelte meine Lippen und gab auf.
Um weitere Diskussionen zu vermeiden und vor allem irgendwelchen Einzelheiten aus dem Weg zu gehen, die mir vielleicht noch herausrutschen würden, nach dem, was ich heute Morgen über meine Periode gesagt hatte, beeilte Geraldine sich und stürzte sich in ihre häuslichen Pflichten wie jemand, der in einen Swimming-Pool springt, um der heißen Sonne zu entkommen. Sie hatte bereits gefrühstückt, normalerweise eine Scheibe Toast und eine Tasse Tee, gefolgt von einem ihrer Kräuterallheilmittel. Mein Vater hatte sich immer lustig darüber
gemacht, aber sie hatte ihn ignoriert. Ich schluckte diese Mittel nie, sie bot sie mir auch nie an oder ermutigte mich, sie zu nehmen. Als hätte sie ein geheimes Supermittel für alles und wollte das nicht teilen.
Heute Morgen trank ich nur ein wenig Saft und aß ein Schälchen mit Cornflakes. Bevor sie nach oben ging, um sich für die Öffentlichkeit angemessen anzukleiden, wie sie es nannte, teilte sie mir mit, dass ich die Speisekammer sauber machen sollte.
»Nimm alles aus den Regalen, wisch dort Staub und leg eine Bestandsliste an. Ich habe natürlich eine gewisse Vorstellung davon, was wir haben und was wir brauchen, aber ich möchte es gerne besser organisiert haben«, wies sie mich an.
Geraldine führte den Haushalt wie ein Atom-U-Boot. Sie polierte, reinigte, kontrollierte und überprüfte jede Ecke und jeden Winkel. Manchmal gab sie mir das Gefühl, ich sei ein Offizier der unteren Dienstgrade oder, noch schlimmer, nur ein gewöhnlicher Marineinfanterist. Während die meisten Mädchen meines Alters ihre Sommerferien genossen, an den Strand, zum Einkaufsbummel oder ins Kino gingen, sich mit Freunden trafen oder Partys feierten, arbeitete ich im Garten, im Patio, im Haus und räumte Sachen auf, die ich erst vor einer Woche schon einmal aufgeräumt hatte. Als ich einmal beobachtete, wie ein Eichhörnchen eifrig damit beschäftigt war, einen Futtervorrat anzulegen, und dabei mechanisch immer wieder das Gleiche tat, dachte ich mir, dass wir uns nicht sehr unterschieden. Vielleicht hielt es deshalb manchmal inne, starrte mich an und fuhr dann ganz unbeirrt mit seiner Arbeit fort.
Am besten war es, direkt in die Speisekammer zu gehen, damit sie dachte, alles liefe wie am Schnürchen. Sie kam
fertig angezogen nach unten, ihre Einkaufstasche in der Hand, und schaute zu mir herein.
»Gut«, lobte sie, als sie sah, wie ich eines der Regalbretter abwischte. »Lass dir Zeit und mach es gründlich. Ich brauche nicht länger als üblich.«
Ich wartete, bis ich hörte, dass sich die Haustür schloss, dann ging ich rasch hinauf in mein Zimmer, um mir etwas Nettes zum Anziehen auszusuchen. Es war warm, aber ich besaß keine Shorts. Geraldine kaufte mir einfach keine. Aber ich hatte eine Jeans, die ich ohne ihr Wissen an den Knien abgeschnitten hatte. Um sie vor ihr zu verstecken, stopfte ich sie in das Hosenbein einer anderen Jeans.
Ich zog sie an und fand einen blassrosa Baumwollsweater, den sie noch nicht weggeworfen hatte. Sie schaute oft meine spärliche Garderobe durch auf der Suche nach etwas, aus dem ich herausgewachsen war, und schenkte es dem Secondhandladen oder warf es einfach in den Müll. Alles was zu eng geworden sein könnte oder auch nur geringfügig zu kurz erschien, war dem Untergang geweiht.
Die Mädchen bei Dr. Marlowe hatten meine Frisur immer kritisiert. Das war nicht allein meine Schuld. Geraldine schnitt das Haar ungleichmäßig und ließ mich nicht zu einem Friseur gehen. Sie hielt das für eine Riesengeldverschwendung.
»Sie nennen sich Stylisten«, schimpfte sie. »Und dann knöpfen sie dir doppelt so viel Geld ab, wie sie sollten. Meistens schauen sie nur in irgendwelche Zeitschriften und versuchen zu kopieren, was sie sehen, auch wenn es gar nicht zu dir passt.«
Ich stritt mich nicht mit ihr. Sie schaute nicht einmal auf, um festzustellen, ob ich nickte oder aussah, als sei ich anderer Meinung. Geraldine erwartete stets, dass die Worte der Weisheit, die sie in meine Richtung ausstreute, in meinem
Netz landeten und von mir geschätzt wurden. Warum sollte sie das auch nicht glauben? Ich gab ihr kaum je Anlass, das zu bezweifeln. Anders als die meisten Mädchen meines Alters, vermied ich zumindest bis jetzt Auseinandersetzungen, Widerworte oder Trotzreaktionen.
Als ich das Haus verließ, klopfte mein Herz so stark, dass sich meine Beine wie gekochte Spaghetti anfühlten und ich befürchtete, auf dem Boden zusammenzusacken. Sie würde nach Hause kommen und mich auf dem Boden liegend vorfinden. Dann würde sie mir sagen, das käme davon, wenn ich ihren Wünschen zuwiderhandelte. Ich rechnete fest damit, einen elektrischen Schlag zu spüren, als ich nach dem polierten Messingtürknopf griff und ihn drehte. Ich holte tief Luft, schloss die Augen, und als ich sie wieder öffnete, trat ich aus dem Haus in den strahlenden warmen Sonnenschein.
Es war ein prachtvoller Tag, bestimmt nicht einer, den man eingepfercht in einer Speisekammer mit dem Putzen und Polieren von Regalbrettern und dem Anlegen von Inventarlisten verbringen sollte. Die Wolken wirkten wie dicke Kleckse Schlagsahne auf blauer Tortenglasur. Die Trottoirs und Straßen glitzerten, von Santa Ana wehte warm und sanft eine Brise herüber. All das gab mir Mut. Ich eilte unseren schmalen Fußweg hinab zur Straße, wandte mich nach rechts und ging schnell davon, ohne mich noch einmal umzuschauen. Wenn ich das täte, würde ich vielleicht zögern und wieder nach Hause zurückkehren.
Ich hoffte, die Limousine wäre bereits da und ich müsste nicht warten, aber das war nicht der Fall. Sekunden erschienen eher wie Minuten. Ich reckte den Hals, um die Straße hinunterzuspähen nach Anzeichen auf den langen schwarzen Wagen, den ich gesehen hatte, als er Jade zu
Dr. Marlowe brachte oder hinterher auf sie wartete. Er war nicht in Sicht.
Ich warf einen Blick auf meine Armbanduhr und schaute ängstlich in die Richtung, aus der Geraldine zurückkommen würde. Es war noch zu früh für ihre Rückkehr, aber dennoch machte ich mir Sorgen, dass sie etwas vergessen haben könnte oder sich einfach entschlossen hatte, nach Hause zu kommen, um mich zu kontrollieren. Sie hatte häufig diese Anfälle von Paranoia, sprang auf, um zu überprüfen, ob Türen und Fenster verschlossen waren oder ob ich die Aufgaben erfüllte, die ich erledigen sollte. Es war bestimmt nur meine Einbildung, aber ich hatte das Gefühl, jeder vorüberfahrende Fahrer schaute mich misstrauisch an und fragte sich, warum ich an der Ecke herumlungerte. Glücklicherweise hatte Geraldine kein Interesse an unseren Nachbarn, deshalb brauchte ich mir keine Sorgen zu machen, dass einer von ihnen sie anrief oder ihr erzählte, dass sie mich gesehen hatten. Sie hasste Tratschen und verglich es mit Hunden, die sich ankläfften, oder fauchenden Katzen. Es war ihrer Meinung nach eine sinnlose Vergeudung von Zeit und Energie und führte nur zu Unglück und Schwierigkeiten. Müßiges Geschwätz war noch schlimmer als müßige Hände. Geraldines Motto lautete zu schweigen, wenn man nichts Wichtiges zu sagen hatte.
Endlich sah ich die glänzende schwarze Limousine in der Straße auftauchen und auf die Ecke zugleiten, an der ich wartete. Der Chauffeur verlangsamte das Tempo und fuhr an den Straßenrand. Bevor er aussteigen konnte, um die Tür zu öffnen, flog sie auf und Misty rief: »Rein mit dir, Cat!«
Ich warf einen Blick auf unser Haus und hechtete dann förmlich in das Riesenauto. Star saß dort kühl und beherrscht,
ihre wunderschöne mattschimmernde schwarze Haut hatte nie strahlender und glatter gewirkt, ihre Augen funkelten wie schwarze Diamanten. Das Haar war frisch geflochten, sie trug einen knielangen khakifarbenen Baumwollrock und eine dazu passende Baumwollbluse. Ich schlüpfte neben sie, und Misty schloss die Tür. »Weiter«, rief sie.
Der Fahrer nickte und lächelte, und wir fuhren los.
Misty trug eine Leggins mit einem T-Shirt in Übergröße, das die Aufschrift trug: »Wie findest du meinen Gang? Telefon: 555-4545«. Sie war ein zierliches Mädchen, das sich darüber beklagte, seine Figur sei zu knabenhaft. Ich wäre bereit, jederzeit mit ihr zu tauschen. Ihre blauen Augen funkelten vor spitzbübischer Freude, als sie mich sah. »Das ist doch nicht deine richtige Telefonnummer, oder?«, fragte ich sie schnell und nickte in Richtung T-Shirt.
»Nein. Das ist die Nummer des Motor-Vehicle-Büros. Ich habe es mir an der Strandpromenade von Venice Beach machen lassen.«
»Kannst du deshalb keine Schwierigkeiten bekommen?«, fragte ich sie.
»Wie sollte sie denn deshalb in Schwierigkeiten geraten?«, fragte Star. »Cat, du bist ja so ängstlich wie eine Kirchenmaus. Ich wette, du überquerst nur an Zebrastreifen die Straße.«
»Das stimmt tatsächlich«, gab ich zu.
Star lachte.
»Hör auf, auf ihr herumzuhacken«, befahl Misty und drehte sich zu mir um. »Wie geht es dir?«, rief sie und beugte sich vor, um mir die Hand zu drücken. »Kannst du es glauben, dass wir uns wirklich treffen? Und was hältst du von dieser Limousine?«
»Ihr hättet sehen sollen, wie sie bei mir zu Hause vorfuhr«, sagte Star. »Die Nachbarn glotzten alle, und Granny schüttelte den Kopf und murmelte: ›Mein Gott, mein Gott. Meine Enkelin fährt mit so einer Karosse.‹«
Ich konnte mir diese Szene leicht ausmalen.
»Was wirst du den Leuten erzählen, wenn du wiederkommst?«, fragte Misty sie.
»Ich weiß es nicht. Vielleicht erzähle ich ihnen, ich hätte in einem Film mitgespielt«, schlug sie vor.
»Was passiert, wenn sie herausfinden, dass das nicht stimmt?«, hakte ich nach.
»Wen kümmert das schon?«, erwiderte sie. »Sie haben doch sowieso kein Recht, ihre Nasen in meine Angelegenheiten zu stecken, oder?«, meinte sie. Ihre weit aufgerissenen Augen funkelten zornig.
Ich zuckte die Achseln.
Sie starrte mich einen Augenblick immer noch wütend an, dann lächelte sie und lachte schließlich.
»Du benimmst dich so, als sei das Trottoir aus dünnem Eis und du aus Blei und schweren Steinen. Du hast keinerlei Grund, noch länger vor irgendjemandem Angst zu haben. Du bist Mitglied der WME. Na los, sag’s ihr, Misty«, forderte sie sie auf.
»Das stimmt«, bestätigte Misty. Einen Augenblick lang wurde sie ernst. »Hast du Dr. Marlowe noch einmal besucht?«
»Noch nicht«, antwortete ich. »Sie rief an und sprach mit meiner Mutter, aber ein Termin ist noch nicht vereinbart worden. Was ist mit euch beiden?«
»Ich bin noch einmal bei ihr gewesen«, sagte Star. »Aber ich bin jetzt fertig damit.«
»Ich auch«, sagte Misty. »Ich glaube, Jade auch. Du bist als Einzige übrig.«
»Sie sagte mir, ich könnte sie jederzeit anrufen«, berichtete Star, »aber ich hoffe, ich brauche das nicht.« Sie schaute mich an. »Besuch sie einfach und bring es hinter dich«, fuhr sie fort. »Je länger du etwas hinausschiebst, vor dem du Angst hast oder das du für unerfreulich hältst, desto schlimmer erscheint es dir.«
»Sie hat Recht«, bestätigte Misty.
»Natürlich habe ich Recht. Ich brauche dich nicht, um allen zu erzählen, dass ich Recht habe.«
Misty zuckte nur leicht mit den Achseln und warf ihr eines ihrer hübschen kleinen Lächeln zu.
»Ich habe Hunger«, stellte sie fest. »Beim Frühstück habe ich absichtlich nur ein bisschen gepickt, damit ich jetzt richtig Appetit habe. Jade sagte, sie würde dafür sorgen, dass wir ein ganz besonderes Büfett bekommen. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie es sein wird.«
»Es ist einfach nur Essen, egal ob eine Spitzenköchin aus Frankreich es zubereitet hat oder nicht.«
»Falsch«, trällerte Misty und malte mit dem rechten Zeigefinger ein X in die Luft.
»Was soll das heißen?«, wollte Star wissen.
»Ich halte mich auf dem Laufenden über deine Schnitzer«, erwiderte Misty.
Star rutschte auf ihrem Platz hin und her, schüttelte den Kopf und schaute mich an.
»Was hast du in der letzten Zeit so angefangen? Du sitzt stumm da wie ein Buddha, während wir kollern wie die Truthähne.«
»Im Haus geholfen, gelesen, manchmal einen Spaziergang gemacht. Im Garten ist viel zu tun. Meine Mutter hat unseren Gärtner gefeuert. Sie sagt, wir müssten sparsam sein, weil wir nur von unsren Zinsen leben müssen.«
»Warum geht sie denn nicht los und besorgt sich einen Job?«, fragte Star.
»Es klingt bei ihr immer so, als sei es dramatisch, aber ich weiß, dass wir ein gutes Einkommen haben. Sie hat, abgesehen von dem Geld, das mein Vater uns aushändigen musste, Geld geerbt.«
»Er hätte euch mehr aushändigen sollen als nur Geld«, murmelte Star. »Du weißt, worauf ich mich beziehe, Cat.« Ich spürte, wie mir die Hitze rasch den Hals hinaufstieg bis ins Gesicht, und ich rot wurde.
Misty warf ihr einen vorwurfsvollen Blick zu, und Star wandte sich ab, um aus dem Fenster zu schauen. Wir schwiegen alle einen Augenblick, aber Misty hasste Stillschweigen. Es machte sie zappelig.
»Das ist ein schöner Pullover«, meinte sie.
»Ja«, bestätigte Star. »So wie der sitzt, bin ich überrascht, dass deine Mutter dich ihn überhaupt tragen lässt.«
»Sie weiß es nicht«, sagte ich. »Sie weiß nicht einmal, dass ich diese abgeschnittenen Jeans besitze.«
»Du hast dich hinausgeschlichen, stimmt’s?«, wurde Star plötzlich klar. »Deshalb wolltest du an der Ecke abgeholt werden?«, erkundigte sie sich.
»Ja«, bestätigte ich.
»Was passiert, wenn sie das herausfindet?«, fragte Misty.
»Ich weiß es nicht.«
»Gar nichts wird passieren«, beschwichtigte Star uns. »Mach sie nicht noch ängstlicher, als sie ohnehin schon ist.« Sie wandte sich mir zu. »Sie wird ein bisschen meckern, und dann wird ihr klar werden, dass sie dich nicht mehr wie ein Kleinkind behandeln kann.
Auch Eltern«, fügte sie nickend hinzu, »müssen erwachsen werden.«
»Amen!«, rief Misty und äffte sie damit nach.
Star warf ihr einen ihrer Starblicke zu, dann lächelte sie und schüttelte den Kopf.
»Schau dir das an«, sagte sie. Wir beugten uns vor, um durch das Fenster einen Blick auf das Wachhäuschen und das Tor zu werfen, durch das wir in Jades Nachbarschaft gelangten. »Das Mädchen lebt ja wie eine Prinzessin. Kein Wunder, dass sie total verwöhnt ist.«
Die Wache winkte uns durch, das große Tor schwang auf. Wir alle starrten die wunderschönen riesigen Häuser an, die alle nach Maß entworfen waren.
»Wow«, sagte Misty. »Im Vergleich dazu wirkt unser Haus wie ein mickriger Bungalow.«
»Was soll ich denn da sagen? Dass wir bei meiner Großmutter in einer Hundehütte leben?«, sagte Star.
Die Straßen waren breit und von Palmen gesäumt. Es gab sogar ein Trottoir. Gelegentlich befanden sich zwischen den Häusern freie Flächen, Bäume und Rasenanlagen; in der Mitte war ein See, um den herum alle Häuser gebaut waren. Hinter allen Häusern erstreckten sich Gärten von beträchtlicher Größe.
»Sind wir noch in Amerika?«, rief Misty.
»Nicht in meinem Amerika«, sagte Star.
Die Limousine verlangsamte das Tempo und bog in eine halbkreisförmige Auffahrt ein. Wir starrten noch immer nach draußen, als Jades Haus ins Blickfeld kam. Es war so groß, wie sie es geschildert hatte. Ich erinnerte mich daran, wie stolz sie es beschrieben hatte.
Ich war völlig gebannt davon. Die Limousine blieb stehen, der Chauffeur stieg rasch aus, um uns die Tür zu öffnen. Einen Augenblick lang rührte sich keine von uns. Wir starrten nur hinaus.
»Also, warum benehmen wir uns eigentlich wie ein Haufen verrückter Touristen?«, rief Star. »Es ist einfach ein
großes Haus. Nun kommt schon«, forderte sie uns auf und stieg als Erste aus.
Misty und ich folgten ihr gaffend. Als wir auf die riesige doppelflügelige Haustür zugingen, wurde sie aufgerissen und Jade erschien.
»Ich bin völlig ausgehungert«, verkündete sie, die Hände auf die Hüften gestützt. »Ich habe das Frühstück ausgelassen, weil ich auf euch Jungs gewartet habe. Zumindest könntet ihr einen Schritt schneller gehen«, fügte sie hinzu. Jade war wirklich der eleganteste Teenager, den ich kannte. Sie hatte langes, üppiges, braunes Haar mit einem leichten Rotstich, das ihr sanft über die Schultern floss. Ihre mandelförmigen Augen waren grün. Die hohen Wangenknochen verliehen ihrem Gesicht eine eindrucksvolle eckige Linie, die sich anmutig bis zum Kinn und den vollkommen geformten Lippen schwang. Ihre Nase war ein wenig zu klein und auch ein kleines bisschen nach oben gebogen. Stets war sie modisch gekleidet und perfekt geschminkt.
»Es ist nicht unsere Schuld, dass du hier draußen in der finsteren Provinz lebst«, spöttelte Star.
»Finstere Provinz! Das ist vermutlich die begehrteste Wohngegend in Los Angeles, wenn nicht an der ganzen Westküste!«, prahlte Jade.
Star schaute sich um, als wollte sie entscheiden, ob sie hineingehen wollte oder nicht.
»Hm. Zumindest gibt es keine Graffiti«, stellte sie fest, und Jade lachte.
»Kommt schon. Alles ist für uns hinten aufgebaut. Habt ihr eure Badeanzüge mitgebracht?«, fragte Jade.
»Davon hat mir niemand etwas gesagt«, stellte Star fest.
»Ich habe nicht daran gedacht«, gestand Misty und schüttelte den Kopf.
Ich schämte mich zuzugeben, dass ich nicht einmal einen besaß.
KAPITEL ZWEI
Wieder vereint
Die Eingangshalle in Jades Haus war fast so groß wie unser Wohnzimmer. Auf dem Boden glitzerten üppige goldbraune Fliesen. Zur Rechten hing ein ovaler Spiegel in Wandgröße, in dem wir drei uns spiegelten, als wir die breiteste, eindrucksvollste Treppe anstarrten, die ich je im wirklichen Leben gesehen hatte. Die Stufen waren mit rotem Samt ausgeschlagen.
»Ich habe das Gefühl, gerade Vom Winde verweht betreten zu haben«, verkündete Misty.
An der Wand links von der Treppe hing ein gewaltiges Ölgemälde einer feuchten Weide mit einer Art Mühle im Hintergrund unter einem stürmischen Himmel.
»Das ist das größte Gemälde, das ich je gesehen habe«, staunte Star beeindruckt.
»Das ist ein Jonathan Sandler. Er ist ein amerikanischer Künstler, der im späten neunzehnten Jahrhundert arbeitete und die niederländischen Landschaftsmaler imitierte. Mein Vater bekam es als Teil eines Deals mit einem reichen Bauunternehmer in Virginia. In diesem Haus gibt es viele Gemälde«, fuhr sie fort. Ihr beiläufiger Ton ließ es eher so klingen, als sei sie gelangweilt, und nicht, als wollte sie angeben. »Manche hat meine Mutter gekauft, andere hat mein Vater angeschafft, daher ist es eine Mischung
aus Stilen. Sie waren sich nie bei irgendetwas einig, warum sollte das bei Bildern anders sein?«
Misty nickte wissend. In dieser Hinsicht unterschieden sich ihre Eltern nicht sehr von Jades.
Alle Zimmer des Hauses waren riesig und üppig ausgestattet. Außer den Kunstwerken an den Wänden standen fast überall Vasen und Uhren, Kristallwaren und Statuetten. Ich sah nicht viel leeren Raum, daher kam es mir so groß und so voll wie ein Museum vor.
Wir drei gafften immer weiter, während Jade uns durch das Haus zum Fernsehzimmer führte, einem lang gestreckten Raum mit getäfelten Wänden, einem eingebauten Fernseher mit Großbildschirm und einer Wand mit Bücherregalen, die fast bis zur Decke reichten. Sie führte uns durch die Terrassentür in einen großen gefliesten Patio. Auf der rechten Seite des Patios waren lange schmale Tische zusammengestellt, auf denen sich ein Büfett türmte. Ein Hausmädchen und der Butler warteten darauf, uns zu bedienen.
Es sah aus, als reichte das Essen für eine ganze Hochzeitsgesellschaft. Ein Tisch war beladen mit Salaten, eingerahmt von Brot und Brötchen, auf einem anderen Tisch standen Platten mit Fleisch, Schrimps und sogar kleinen Hummerschwänzen. Auf einem dritten Tisch gab es Limonade und Säfte sowie Desserts: Törtchen, Kekse, zwei Kuchen und Schüsseln mit Obstsalat.
»Wer kommt denn alles?«, fragte Star atemlos vor Ehrfurcht.
»Wer kommt? Niemand kommt. Meine Mutter ist auf einer Geschäftsreise, und mein Vater ist in Nashville, um mit Investoren zu verhandeln, die ein Musiktheater bauen wollen.«
»Du meinst, das ist alles für uns?«, fragte Star.
»Ich war mir nicht sicher, was ihr mögt, deshalb habe ich sie gebeten, eine Auswahl vorzubereiten.«
»Eine Auswahl? Manche Supermärkte haben nicht so viel Auswahl. Was passiert mit all dem Essen, das wir nicht aufessen?«, wollte Star wissen.
»Ich weiß es nicht«, sagte Jade, die allmählich ärgerlich wurde. »Dienstboten machen irgendwas mit den Resten. Deshalb sind sie ja da. Kommt, wir holen uns etwas zu essen und setzen uns hin.«
»Bin ich froh, dass ich nicht viel zum Frühstück gegessen habe«, rief Misty und ging zum Büfett. Das Hausmädchen reichte ihr sofort einen Teller, und der Butler wartete nur darauf, ihre Wünsche zu hören. Dann bediente er sie.
Ich wusste nicht, für was ich mich als Erstes entscheiden sollte. Ich versuchte von allem ein bisschen zu probieren, aber der Butler legte zu große Portionen von allem auf meinen Teller.
Jade nahm am wenigsten von uns allen. Wir setzten uns an einen großen Tisch unter einen Sonnenschirm. Der Butler und das Hausmädchen brachten uns dort, was immer wir zu trinken wünschten. Dann stellten sie sich wieder an das Büfett und warteten darauf, ob eine von uns noch etwas wollte.
»Isst du immer so?«, erkundigte Star sich. »Mit Dienstboten und allem?«
»Nein. Meistens nehme ich nur einen Obstshake oder einen Joghurt, aber dies ist ein besonderer Anlass.«
»Donnerwetter. Ich wusste gar nicht, wie besonders dieser Anlass ist«, sagte Star, und wir alle lachten, sogar ich. Während wir dort saßen, aßen und uns unterhielten, starrte ich die wunderschöne Gartenanlage an. Der Rasen wirkte eher wie ein Teppich. Die Büsche und Blumen waren perfekt arrangiert und beschnitten. Als ob einer der
berühmten Künstler, deren Bilder drinnen an den Wänden hingen, den Garten gestaltet hätte. Der nierenförmige Swimming-Pool endete in einem Whirlpool, von dem aus das blaugrüne Wasser in den eigentlichen Pool zurückfloss. Um den Patio herum standen Liegestühle mit dicken Kissen und ein kleines Zelt mit einer Außendusche.
»Es ist wirklich wunderschön hier«, platzte ich plötzlich heraus. Die anderen hörten auf zu reden, schauten einander an und lachten.
»Du hörst dich an, als seist du gerade aufgewacht«, meinte Star.
»Ich weiß nicht, ob ich wache oder träume.«
»Willst du sie noch eingebildeter machen, als sie ohnehin schon ist?«, warnte Star mich und nickte in Jades Richtung.
»Mach dir darüber keine Sorgen, Star. Wenn ich vom rechten Weg abweiche, bist du ja da, um mich mit deinen Sprüchen umzuhauen.«
»Das ist wahr«, bestätigte Star. Misty lachte, und wir alle schwiegen eine ganze Weile.
»Ich kann nichts dafür. Ich habe immer noch das Gefühl, als wären wir bei Dr. Marlowe«, sagte Misty. »Ständig rechne ich damit, dass eine von uns beginnt, über ihre familiären Probleme zu reden.«
»Dann wollen wir doch direkt eine weitere Regel festlegen … wir reden nicht über dieses Zeug, es sei denn, wir alle beschließen, dass es okay ist, einverstanden?«
»Worüber sollen wir denn reden?«, fragte Misty.
»Es gibt noch eine Menge anderer Dinge außer unserem elenden Familienleben«, beharrte Jade. »Hat beispielsweise eine von euch jemanden kennen gelernt?«
Sie schaute sich am Tisch um.
»Ich nicht. Noch nicht«, ergänzte Star geheimnisvoll.
»Was soll das heißen ›noch nicht‹?«, hakte Jade nach. Ihre perfekt gezupften Augenbrauen neigten sich gegeneinander.
»Also neulich war ich bei Lily Porter und sah dort ein Foto ihres Cousins Larry. Er ist bei der Armee. Er hat ihr dieses Bild in Uniform, wie er neben einem Panzer steht, geschickt. Im Moment ist er noch in Deutschland stationiert, kommt aber bald zurück.«
»Und?«, sagte Jade.
»Und ich fand ihn toll. Sie sagte mir, soweit sie wüsste, hat er hier keine Beziehung mit einem Mädchen. Sie wird mich ihm vorstellen, sobald er wieder zu Hause ist. Sie meinte, sie würde eine Party geben und so was.«
»Genau. Und in dem Augenblick, in dem er dich erblickt, haut es ihn um«, höhnte Jade.
Star kniff die Augen einen Moment zusammen, dann lächelte sie.
»Tja, vielleicht leihe ich mir ja eins von deinen teuren Outfits und blende ihn, so wie du jeden Mann blendest, der dich sieht.«
Jade lachte.
»Klar. Such dir aus, was du haben möchtest. Ich habe Zauberkleider, mit denen du garantiert den Mann, den du liebst, erringen kannst.«
»Was ist denn mit dir? Hat jemand in letzter Zeit dein Herz in Flammen gesetzt?«, wollte Star wissen.
Misty und ich waren wie Zuschauer in diesem verbalen Tennismatsch. Unsere Köpfe drehten sich von einer Seite zur anderen.
»Nein. Meine Mutter nahm mich vor zwei Tagen mit zu einer Nachmittagsparty bei den Nelsons, damit ich ihren Sohn Sanford kennen lernte, der gerade vom Studium in
Europa heimgekehrt war. Er ist reich und sehr intelligent, hat aber die Persönlichkeit einer Warze auf der Nase. Wo wir gerade über eingebildet reden … Dieser Bursche schaut Mädchen nur in die Augen, um dort sein eigenes Spiegelbild zu sehen.«
Wir lachten alle. Wie sehr wünschte ich mir, ich hätte auch ein paar Geschichten, ein paar Erfahrungen zu berichten, aber ich konnte nur zuhören und neidisch sein.
»Wollen wir wirklich einen Club gründen?«, fragte Misty, als wir alle schwiegen.
»Club hört sich so kindisch an«, meinte Jade. »Lasst es uns irgendwie anders nennen.«
»Wie denn?«, fragte Star.
»Ich weiß es nicht. Irgendeiner muss eine Idee haben. Mir fällt nichts ein.«
»Ich bin überrascht, dass du so etwas zugibst«, murmelte Star.
Wir schwiegen alle und dachten nach.
»Warum nennen wir uns nicht einfach Schwestern«, schlug ich vor.
Sie wandten sich mir zu.
»Ich meine nicht wirkliche Schwestern, sondern …«
»Mir gefällt das«, sagte Jade. »Die WMEs, Schwestern des Unglücks.« Sie warf Star einen Blick zu.
»Wie ist es?«, fragte Misty. »Kann ich uns T-Shirts machen lassen?«
»Wie würdest du das deinen Eltern erklären?«, fragte Star.
»Ich weiß es nicht. Keiner von ihnen fragt mich je, was meine T-Shirts bedeuten. Sie tun so, als sähen sie sie gar nicht. Dieses hier wäre genauso.«
»T-Shirts reichen nicht aus, um uns zu Schwestern zu machen«, gab Jade zu bedenken.
Plötzlich wirkte sie anders, finsterer, tiefer in Gedanken versunken. »Es gibt etwas, das ich Dr. Marlowe nie erzählt habe.«
»Was denn?«, fragte Star.
Jade wandte sich nach rechts und schaute am Haus hoch. »Ich habe meine eigene private Welt. Ein Raum im Dachboden mit nur einem kleinen Fensterchen. Dort gehe ich hin, wenn ich das Gefühl haben möchte, ich …«
»Was?«, fragte Misty.
»Ich bin weit weg von allem«, sagte sie mit einer wischenden Handbewegung. »Wir werden nach oben gehen und die Zeremonie durchführen.«
»Zeremonie? Welche Zeremonie?«, fragte Misty mit weit aufgerissenen Augen.
»Dieses Ritual wird uns das Gefühl geben, enger zusammenzugehören, eher wie Schwestern zu sein.« Als sie Star einen Blick zuwarf, hatte ich das Gefühl, die beiden hatten vorher bereits darüber gesprochen. Stars Lippen entspannten sich zu einem kleinen Lächeln.
»Ritual?«, fragte Misty mit besorgtem Gesichtsausdruck.
»Du hast doch keine Angst, oder?«, neckte Jade sie.
»Nein, nein. Natürlich nicht. Was ist mit dir, Cat?«, fragte sie mich rasch.
»Ich glaube, nicht einmal Jade, ja nicht einmal Jade und Star zusammen könnten sich irgendetwas ausdenken, das mich mehr ängstigt als meine eigenen Erinnerungen«, sagte ich.
Alle wurden ernst und nickten.
»Deshalb brauchen wir das«, sagte Jade. »Deshalb habe ich euch alle hierher eingeladen. Deshalb ist Schwestern nicht wirklich eine Übertreibung. Wir sind mehr als Freunde. Wir sind eine Familie.«
Sie starrte in den wunderschönen Garten hinaus.
»Vielleicht sind wir ja die einzige Familie, die wir haben.« »Dann lass uns damit anfangen«, meinte Star.
»Können wir nicht zuerst das Dessert essen?«, rief Misty, die die Kuchen und Kekse beäugte.
Alle lachten, aber es war anders, ein Lachen voller Nervosität, dünn und zerbrechlich wie wir alle.
Vielleicht war es das, was uns wirklich zu Schwestern machte, dachte ich.
Nachdem wir das Essen beendet hatten, betraten wir wieder das Haus. Dabei sprachen wir alle leiser und dämpften unsere Stimmen, als hätten wir gerade eine Kirche betreten. Jade führte uns zurück zu der prachtvollen Treppe und erzählte uns, wie sie den Raum im Dachboden entdeckt hatte, als sie sieben Jahre alt war, und wie sie ihre kostbaren Schätze dort aufbewahrt hatte. Als ihr Vater ihr Treiben entdeckte, fand er das amüsant. Er ließ den Raum für sie herrichten, reinigen und tapezieren und fand sogar spezielle Möbel dafür.
Plötzlich blieb sie am Fuß der Treppe stehen und warf uns allen einen drohenden Blick zu.
»Wir wollen jetzt eine weitere Regel festlegen und uns daran halten. Wir wollen versprechen, einander nie zu belügen oder zu vermeiden, ihr etwas Unangenehmes zu sagen, wenn wir tief im Herzen das Gefühl haben, es sei das Beste für unsere Schwester. Entweder sind wir anders als alle anderen da draußen oder wir sind es nicht. Entweder sind wir wirklich aufrichtig zueinander und wachsen wirklich zu einer Familie zusammen oder nicht«, betonte sie. »Nun?« Sie schaute Star direkt ins Gesicht.
»Finde ich in Ordnung«, sagte Star. »Ich habe dich noch nie über etwas belogen, das mit dir nicht in Ordnung ist.« »Das gilt auch umgekehrt.«
»Das sollte es auch«, entgegnete Star.
»Cat?«
Ich nickte, obwohl ich das Gefühl hatte, die größte Zielscheibe für die kritischen Pfeile der anderen abzugeben.
»Misty?«
»Für mich ist das in Ordnung. Mir ist es egal, was jemand über mich sagt«, fügte sie hinzu.
»Na bitte! Das ist eine Lüge«, beschuldigte Jade sie und hielt ihr den Zeigefinger anklagend vors Gesicht. »Also?« »Okay. Es ist eine Lüge. Was ich meinte, ist, mir ist es egal, was eine von euch hier über mich sagt. Ich meine, es macht mir schon etwas aus, aber ich bin bereit, es hinzunehmen. Ist das in Ordnung?«
»Schon besser«, gab Jade zu, »aber es ist noch nicht aufrichtig genug. Wie auch immer«, fuhr sie fort und wandte sich dabei von Misty ab, die aufatmete und den Kopf schüttelte. »Mein Vater fand all diese Spielsachen für mich und machte mir mein eigenes Puppenhaus zurecht. Manchmal fühlte ich mich selbst wie eine Puppe. Es gibt dort kleine Lampen und Tische, Bücherregale und natürlich kleine Teller, Tassen und Gläser.
Aber ich habe dort noch andere Sachen; Sachen, die eine besondere Bedeutung für mich besitzen, und das sind nicht nur Kleinigkeiten. Ich halte den Raum stets verschlossen. Das Hausmädchen darf nicht einmal dort hinein, um sauber zu machen, was meine Mutter verabscheut. Ich kümmere mich selbst um dieses Zimmer.«
»Wow«, staunte Star mit übertriebener Überraschung, während wir oben den Flur entlanggingen, »du machst tatsächlich ein Zimmer selbst sauber?«
»Okay«, gab Jade zu, »ich bin ein verzogener Fratz.« Sie lächelte. »Aber ich leugne nicht, dass ich es genossen habe.«
»Verabscheut ihr nicht alle diese Wahrheit?«, fragte Star Misty und mich.
Mit einigem Zögern lachten wir beide.
Als wir am Schlafzimmer von Jades Mutter vorbeigingen, warfen wir einen Blick durch die Doppeltür und sahen ein riesiges Himmelbett mit einem Kopfteil, das aussah wie aus Perlen gewirkt. Es erhob sich bis halb zur Decke. Rechts daneben entdeckte ich ein ganzes weiteres Zimmer, einen Wohnraum mit einem Fernseher. Ich fragte sie danach, aber Jade war im Augenblick nicht bereit, stehen zu bleiben, um uns etwas zu zeigen.
Am Ende des Flures befand sich eine schmale Treppe, die uns in den Speicher führte. Rechts war Jades Puppenhaus, links ein Lagerraum. Sie holte einen Schlüssel aus der Tasche, schloss das Vorhängeschloss auf, öffnete die Tür und trat zurück, damit wir hineingehen konnten.
Drinnen blieben wir alle stehen. Es war, als wären wir durch einen Brunnen in das Land Oz oder ein anderes Märchenland gefallen. Vor das kleine Fenster war ein rotweißer Vorhang drapiert. Der Boden war mit einem dicken, cremefarbenen Teppich bedeckt, der ebenfalls rote Streifen hatte. Wie sie es beschrieben hatte, war der Raum mit kleinen weißen Tischen und Stühlen, einem Sofa und niedrigen Stehlampen möbliert. In einem kleinen Schrank stand sogar ein Miniaturfernseher. An den Wänden mit den paradiesapfelroten und weißen Tapeten hingen Bilder von Clowns und Pferden, Landschaftsbilder und Darstellungen einiger Zeichentrickfiguren. Ich fühlte mich genau wie Gulliver in Lilliput, ein Riese unter Zwergen. Ich hatte Angst, mich zu rühren, Angst, ich könnte auf etwas treten oder mit einer unbeholfenen Bewegung etwas zerschlagen.
»Wir müssen die Möbel nicht benutzen«, meinte Jade, als
sie sah, dass wir zögernd am Eingang stehen blieben. »Wir können uns auf den Boden setzen. Das tue ich normalerweise auch, wenn ich hier oben bin.«
Sie schloss die Tür hinter sich und ging zu dem kleinen Bereich, wo ein Esstisch mit Puppengeschirr und -besteck gedeckt war. Dahinter befand sich eine Miniaturküche mit Schränken, einer Spüle und einem Herd. Keine von uns, nicht einmal Misty passte auf diese winzigen Küchenstühle. Eine wunderschöne Puppe mit langem, fließendem goldenem Haar hatte den Vorsitz am Kopf des Tisches. Auf den anderen Stühlen saßen Gestalten aus verschiedenen Kindergeschichten. Natürlich erkannte ich Pinocchio und Dorothy aus dem Zauberer von Oz ebenso wie Pocahontas.