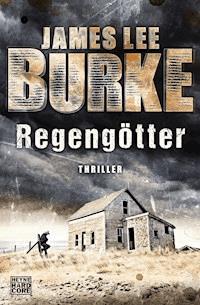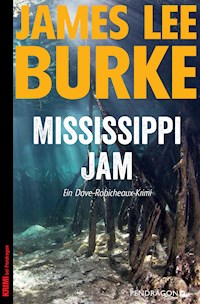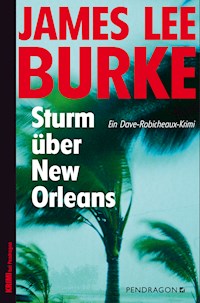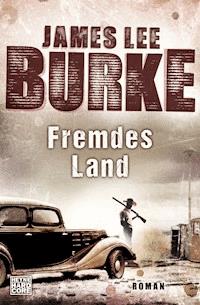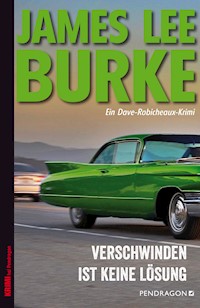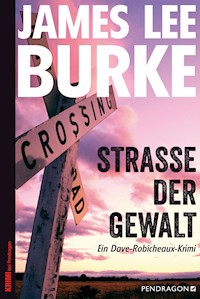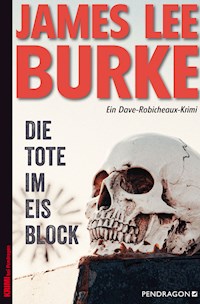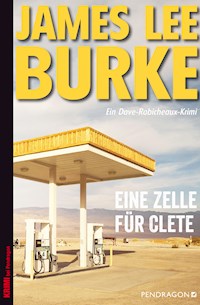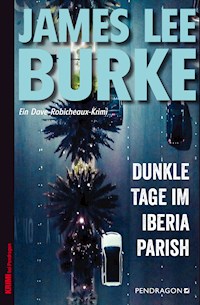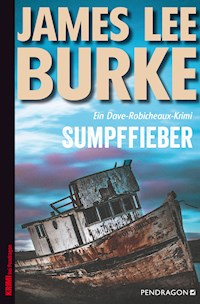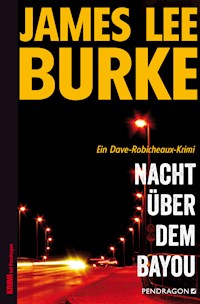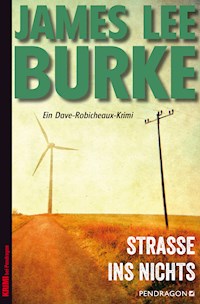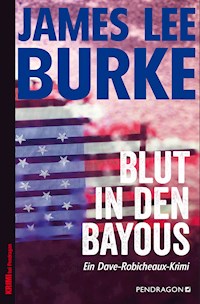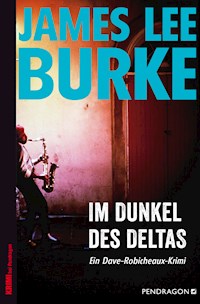13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Texas im Jahr 1952: Die Gesellschaft ist tief gespalten. Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst. Rassismus ist allgegenwärtig. Der Koreakrieg wirft seinen Schatten. Mitten in diesem angespannten Klima sucht der junge Aaron Holland Brussard seinen Platz im Leben. Dabei macht er sich Gary Harrelson zum Feind, den Sohn eines reichen Bohrunternehmers und Reismühlenbesitzers. Die Harrelsons sind skrupellose Geschäftsleute mit Verbindungen zur Mafia. Bald ist nicht nur Aarons Leben in Gefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 684
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Ein Frühlingstag im Jahr 1952. Valerie Epstein sitzt in einem pinkfarbenen Cadillac-Cabrio und isst Pommes Frites mit den Fingern. Der siebzehnjährige Aaron beobachtet sie dabei und ist sofort verliebt. Doch Valerie hat einen Freund: Gary Harrelson ist der Sohn eines steinreichen Bohrunternehmers mit Verbindungen zur Mafia. Als Aaron Zeuge eines Streits zwischen Gary und Valerie wird, geht er kurzentschlossen dazwischen. Aarons Einschreiten setzt eine ungeahnte Kette von Ereignissen in Gang, die nicht nur ihn und Valerie in tödliche Gefahr bringt.
Dunkler Sommer spielt im Amerika der Fünfzigerjahre vor dem Hintergrund sozialer Ungleichheit, Drogen, des Koreakriegs, Antisemitismus, Rassismus und Rassentrennung, den Nachwirkungen der Weltkriege, McCarthy, Mafiagewalt und häuslicher Gewalt. Gemeinsam mit Fremdes Land und Vater und Sohn bildet der Roman eine Art Trilogie, ist aber auch als eigenständiges Buch lesbar. Burke greift dabei wieder auf die Holland-Familie zurück; so ist Aaron Holland Broussard ein Enkel von Hackberry Holland aus Vater und Sohn.
»Was ist James Lee Burke doch für ein großartiger Stilist.« Stephen King
Der Autor
James Lee Burke, 1936 in Louisiana geboren, wurde bereits Ende der Sechzigerjahre von der Literaturkritik als neue Stimme aus dem Süden gefeiert. Nach drei erfolgreichen Romanen wandte er sich Mitte der Achtzigerjahre dem Kriminalroman zu, in dem er die unvergleichliche Atmosphäre von New Orleans mit packenden Storys verband. Burke wurde als einer von wenigen Autoren zweimal mit dem Edgar-Allan-Poe-Preis für den besten Kriminalroman des Jahres ausgezeichnet. 2015 erhielt er für Regengötter den Deutschen Krimi Preis. Er lebt in Missoula, Montana.
James Lee Burke
Dunkler Sommer
Roman
Aus dem Amerikanischen von Daniel Müller
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Für Deen Kogan, aus Dank für ihre immerwährende Unterstützung der Künste.
Kapitel 1
Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich jeden Morgen von Angst und Beklemmungen erfüllt aufwachte, ohne zu wissen, warum. Angst war für mich eine gegebene Tatsache, eine Konstante, die ich fest in meinen Tagesablauf einkalkulierte, wie einen kleinen Stein im Schuh, den man einfach nicht loswird. Ein Erwachsener mag das rückblickend als eine Form von Mut bezeichnen. Möglich, dass es das war, sonderlich spaßig fühlte es sich allerdings nicht an.
Meine Geschichte beginnt an einem Samstag im Jahr 1952. Es war Frühling, mein Junior-Jahr an der Highschool neigte sich dem Ende zu, und ich hatte mir den Wagen meines Vaters geliehen, um ins fünfzig Meilen südlich von Houston gelegene Galveston zu fahren, wo ich mich mit meinen Highschool-Freunden am Strand treffen wollte. Eigentlich gehörte das Auto gar nicht meinem Vater, sondern war eine Leihgabe seiner Firma; ausschließlich von ihm selbst und nur für Dienstfahrten zu benutzen. Dass er mir den Wagen auslieh, war ein enormer Vertrauensbeweis. Meine Freunde und ich verbrachten einen wunderbaren Tag am Strand, wo wir Touch-Football im Sand spielten. Als sie gegen Abend ein Lagerfeuer errichteten, beschloss ich zur dritten Sandbank südlich der Insel hinauszuschwimmen, der letzten Stelle vor dem offenen Meer, an der die Füße noch den Boden berührten. Das Wasser dort war nicht nur tief und kalt, sondern auch Hammerhairevier. Noch nie zuvor hatte ich das allein versucht, und als ich einmal zusammen mit einer Gruppe von Freunden bis zur dritten Sandbank hinausgeschwommen war, hatten die meisten von uns bereits einiges intus gehabt.
Ich watete durch die Brandung, holte tief Luft, tauchte durch die erste Welle und begann zu schwimmen. Ich erreichte die erste Sandbank, dann die zweite, aber ich hielt nicht an. Ich schwamm weiter und drehte mein Gesicht zwischen den Zügen zur Seite, um Luft zu holen. Dann erblickte ich die letzte Sandbank und sah, wie die Wellen über die Untiefe spülten und die Möwen im Schaum nach Futter pickten.
Ich stellte mich aufrecht hin. Auf meinem Rücken kribbelte der Sonnenbrand. Die einzigen Geräusche, die ich hörte, waren das Gekreische der Möwen und das Platschen des gegen meine Lenden schlagenden Wassers. Ich konnte ein Frachtschiff mit einem Schleppkahn dahinter sehen, die kurz darauf am Horizont verschwanden. Ich warf mich kopfüber in eine Welle und sah unter mir den sandigen Boden in die Dunkelheit gleiten. Das Wasser war plötzlich kühler als zuvor, die Wellen hart wie Beton. Die Hotels, die Palmen und auch das Vergnügungspier am Strand waren auf Miniaturgröße geschrumpft. Eine dreieckige Flosse schnitt durch die Dünung, tauchte in einer Welle unter und hinterließ eine Blasenkette an der Wasseroberfläche.
Dann schnürte sich mein Herz zusammen, aber nicht wegen des Haifischs. Ich war mitten in einen Schwarm von Quallen hineingeschwommen. Es waren große Exemplare mit bläulich-rosafarben schimmernden Gasblasen und hauchzarten Tentakeln, die sich um Hals oder Schenkel eines Menschen schlingen und dort problemlos Schäden anrichten konnten, wie sie auch ein Schwarm gereizter Wespen zustande bringt.
Das Erlebnis mit den Quallen schien wie ein Symbol für mein Leben zu sein: Ganz gleich, wie sonnendurchflutet der Tag auch scheinen mochte, ich wurde stets von einem Gefühl der Gefahr begleitet. Und das war keineswegs eingebildet. Das dumpf dröhnende Brummen einer frisierten Auspuffanlage an einem aufgemotzten Ford Coupé, gefolgt von einem achtlosen Blick in Richtung der Jungs mit den Ducktail-Frisuren, den Velourslederschuhen und den Drapes, und in Sekundenschnelle konnte man zu Brei geschlagen werden. Schon mal eine Dokumentation über die Fünfziger gesehen? Was für ein Witz.
Ein Psychologe würde wahrscheinlich sagen, dass meine Ängste eine Externalisierung der Probleme in meinem Elternhaus waren, und vielleicht hätte er damit sogar recht. Andererseits habe ich mich stets gefragt, wie viele Psychologen schon gegen fünf oder sechs mit Ketten, Spring- oder Rasiermessern bewaffnete Kerle angetreten sind; Kerle, die es nicht interessiert, ob sie leben oder sterben, und die Schmerz wie Eiscreme runterschlucken. Vielleicht sah ich die Welt aber auch nur als undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel, und war in Wahrheit selbst das Problem. Tatsache ist, dass ich immer Angst hatte. Wie an jenem Abend, als ich durch die Quallen schwamm. Die Berührung mit nur einer von ihnen war so gefährlich, wie ein Elektrokabel anzufassen, und meine Furcht so groß, dass ich mir beim Schwimmen in die Badehose pinkelte und spürte, wie der warme Urin über die Innenseite meiner Oberschenkel glitt. Selbst als ich den Quallen entkommen war und mich zu meinen Highschool-Freunden am Lagerfeuer gesellt hatte, wo ich mit einer kühlen Flasche Jax in der Hand den Funken des Feuers dabei zusah, wie sie in einen türkisfarbenen Himmel aufstiegen, konnte ich das hartnäckige Gefühl von Angst und Schrecken nicht abschütteln, das wie glühende Kohlen in meinem Magen brannte.
Über meine Familie und das Leben bei uns zu Hause sprach ich so gut wie nie mit meinen Freunden. Meine Mutter konsultierte regelmäßig Wahrsager, belauschte die Telefongespräche der Nachbarn über den Gemeinschaftsanschluss und hatte mir als Kind ohne Unterlass Einläufe verabreicht. Sie verriegelte die Türen, hielt die Jalousien geschlossen und wetterte oft gegen den Alkohol und dessen Wirkung auf meinen Vater. Theatralik, Depression und tief empfundener Gram waren ihre ständigen Begleiter. Gelegentlich sah ich einen warnenden Ausdruck in den Augen unserer Nachbarn aufblitzen, wenn meine Eltern in einem Gespräch erwähnt wurden, und dann wirkte es stets, als würden sie mich davor beschützen wollen, die ganze Wahrheit über mein Zuhause zu erfahren. In diesen Momenten empfand ich Scham, Schuld und Wut, ohne genau zu wissen, warum. Dann saß ich in meinem Zimmer und hätte am liebsten etwas Hartes und Schweres in der Hand gehalten, aber ich wusste nicht, was. Mein Onkel Cody war ein Geschäftspartner von Frankie Carbo, einem Mitglied von Murder Incorporated, und hatte mich mal Benjamin »Bugsy« Siegel vorgestellt, als dieser mit Virginia Hill im Shamrock Hotel logierte. Manchmal dachte ich über diese Gangster nach – sinnierte über das Selbstvertrauen in ihren Gesichtern und die Kälte in ihren Augen, wenn sie jemanden ansahen, den sie nicht leiden konnten – und fragte mich, wie ich mich wohl verhalten würde, wenn ich in ihre Haut schlüpfen und über ihre Macht verfügen könnte.
Der Tag, an dem ich unbeschadet durch die Quallen schwamm, ohne verletzt zu werden, war der Tag, der mein Leben für immer veränderte. Denn an diesem Tag betrat ich ein Land, das weder Flagge noch Grenzen hat; einen Ort, an dem man seine Schutzinstinkte und seine Vorsicht vergisst und sein Herz auf einem Steinaltar offenbart. Ich spreche von dem Moment, an dem man sich zum ersten Mal Hals über Kopf verliebt und nicht im Entferntesten daran denkt, dass einem das Herz gebrochen werden könnte.
Ihr Name war Valerie Epstein. Sie saß in einem pinkfarbenen Cabrio, einem dieser lang gezogenen Cadillacs, die man damals nur »Boat« nannte. Der Wagen parkte vor einem Drive-in mit neonfarbener Fassade, das sich in der Nähe des Strandes befand. Ihre Schultern waren nackt und von einem leichten Sonnenbrand überzogen. Ihr kastanienbraunes Haar war voll und dicht, frisch gewaschen, von goldenen Strähnen durchzogen und mit einem Bandana auf dem Kopf zusammengebunden, wie bei den Frauen, die während des Krieges in den Rüstungsbetrieben gearbeitet hatten. Sie aß Pommes frites mit den Fingern und hörte dem großen, gut aussehenden Burschen zu, der neben ihr auf dem Fahrersitz des Cadillacs saß. Sein Haar war leicht gegelt und sonnengebleicht, seine Haut blass und frei von Tätowierungen. Er trug eine dunkle Brille, obwohl die Sonne bereits zerschmolzen und tief im Himmel stand und der Tag sich abzukühlen begann. Er ließ eine Vierteldollarmünze über die Fingerknochen seiner linken Hand wandern, wie ein Zocker aus Las Vegas oder ein Mensch, der den einen oder anderen geheimnisvollen Trick draufhatte. Sein Name war Grady Harrelson. Er war zwei Jahre älter als ich und hatte die Highschool bereits abgeschlossen, was bedeutete, dass ich wusste, wer er war, wohingegen er keine Ahnung hatte, wer ich war. Grady hatte breite, knochige Schultern, wie ein Basketballspieler, und trug ein verwaschenes lilafarbenes T-Shirt, das an ihm jedoch irgendwie stylish aussah. In der Highschool war er zum bestaussehenden Jungen gewählt worden, und zwar nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Für jemanden wie mich war es ein Leichtes, einen Kerl wie Grady zu hassen.
Ich weiß nicht, warum ich überhaupt ausstieg. Ich war müde, mein Rücken fühlte sich steif an, unter meinem Hemd bedeckte eine trockene Schicht aus Sand und Salz meinen Körper, und ich hatte noch fünfzig Meilen nach Houston vor mir, da ich den Wagen vor Einbruch der Dunkelheit meinem Vater zurückbringen musste. Am Horizont glitzerte bereits der Abendstern in einem blauen Lichtstreifen. Ich hatte Valerie Epstein schon zweimal aus der Ferne gesehen, aber noch nie aus nächster Nähe. Vielleicht wertete ich die Tatsache, dass ich sicher durch einen Schwarm Quallen geschwommen war, unbewusst als eine Art Omen. Valerie Epstein war Junior an der Reagan Highschool in Nord-Houston, eine als Spitzenschülerin bekannte Elftklässlerin mit süßem Lächeln und toller Gesangsstimme. Selbst die Halbstarken mit den Pomadenfrisuren, die Ketten unter ihren Autositzen deponierten und mit Springmessern in ihren Hosentaschen durch die Gegend liefen, behandelten sie wie eine Adlige.
Setz dich wieder ins Auto, iss deinen Krabbenburger, und fahr nach Hause, sagte eine Stimme in mir.
Für mich war geringes Selbstbewusstsein kein Schritt zurück, sondern einer nach vorn. Und obwohl ich vollkommen allein war, wollte ich noch nicht nach Hause fahren. Es war Samstag, und ich wusste, dass mein Vater irgendwann in der Dämmerung aus dem Icehouse kommen und nach Hause torkeln würde, während die Nachbarn ihre Gärten wässerten und so taten, als könnten sie ihn nicht sehen. Ich hatte Freunde, aber die meisten von ihnen kannten mich nicht wirklich, und eigentlich kannte ich sie ebenso wenig. Am liebsten hätte ich diese Hülle aus Raum und Zeit, in der sich mein Leben abspielte, auf einen anderen Planeten katapultiert.
Ich ging zur Toilette. Der Weg dorthin führte zwischen der Beifahrerseite von Gradys Cabrio und einem silberfarbenen Metallpfeiler entlang, auf dem ein Lautsprecher montiert war. »Red Sails In The Sunset« lief gerade. In Höhe des Cabrio bemerkte ich, dass Valerie sich gerade mit Grady stritt und kurz davorstand, in Tränen auszubrechen.
»Alles in Ordnung bei euch?«, sagte ich.
Grady drehte den Kopf zu mir und starrte mich mit ausgestrecktem Hals und ungläubigem Zwinkern an. »Was hast du gesagt?«
»Ich dachte nur, ich frag eben, ob alles in Ordnung ist.«
»Verzieh dich, Sattelratte.«
»Was ist eine Sattelratte?«
»Bist du taub, oder was?«
»Ich will nur wissen, was eine Sattelratte ist.«
»Ein Kerl, dem einer abgeht, wenn er an Fahrradsätteln von kleinen Mädchen schnuppert. Und jetzt zieh Leine.«
Die Musik verstummte. Meine Ohren knackten. Ich sah, wie sich die Lippen der Menschen in den anderen Autos bewegten, aber ich konnte nichts hören. Dann sagte ich: »Hab ich aber keine Lust drauf.«
»Ich glaub, ich hab mich gerade verhört!«
»Ist ein freies Land.«
»Nicht für neugierige Blasenbeißer wie dich.«
»Lass ihn zufrieden, Grady«, sagte Valerie.
»Was ist ein Blasenbeißer?«, sagte ich.
»Ein Kerl, der in der Badewanne furzt und die Blasen mit dem Mund auffängt. Hat dir jemand Geld gegeben, damit du hier den Affen machst?«
»Ich wollte nur auf die Toilette gehen.«
»Dann geh, verdammt.«
Dieses Mal erwiderte ich nichts. Irgendjemand, wahrscheinlich einer von Gradys Freunden, schnipste mir eine brennende Zigarette in den Nacken. Grady öffnete die Fahrertür, sodass er sich zu mir wenden und mit mir sprechen konnte, ohne sich den Hals verrenken zu müssen. »Wie heißt du überhaupt, Hamsterfresse?«
»Aaron Holland Broussard.«
»Dann pass mal auf, Aaron Holland Broussard! Ich steh kurz davor, dir den Kopf abzureißen, ihn in die Kloschüssel zu stopfen und noch mal draufzupissen, bevor ich spüle. Na, was hältst du davon?«
Das Knacken in meinen Ohren begann erneut. Der Parkplatz und das über die Autos ragende Vordach des Drive-in schienen zur Seite zu kippen, die knalligen Rot- und Gelbtöne der Restaurantfassade wie schmelzendes Lakritz an den Fenstern herunterzulaufen.
»Zunge verschluckt, oder was?«, fragte Grady.
»Eine Mitschülerin hat mir neulich erzählt, warum du zum bestaussehenden Jungen gewählt wurdest. Die Mädchen hielten dich für einen Schwulenmagnet und hatten Mitleid mit dir. Ein paar von den Jungs aus der Footballmannschaft haben mir dasselbe berichtet. Sie meinten, du hättest unter den Tribünen im Footballstadion jede Menge Riemen poliert.«
Ich hatte keine Ahnung, woher die Worte kamen. Es schien fast so, als wäre die Verbindung zwischen meinen Gedanken und meinem Mund gekappt. Einem älteren Jungen gegenüber eine große Klappe riskieren – das gab es an meiner Highschool nicht. Ganz besonders dann nicht, wenn dieser Kerl in River Oaks wohnte und sein Vater sechs Reismühlen und ein Ölbohrunternehmen besaß. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Ich stand neben Gradys Cabrio und starrte wie hypnotisiert in die Augen von Valerie Epstein. Tiefliegend, leuchtend und von violetter Farbe – es waren die schönsten und geheimnisvollsten Augen, die ich je gesehen hatte. Und sie machten etwas mit mir, das ich nie für möglich gehalten hätte, denn plötzlich schaltete mein kleiner Freund mitten auf dem Parkplatz des Drive-in auf Autopilot. Ich schob meine Hand in die Hosentasche und versuchte die Beule unter meinem Hosenschlitz zur Seite zu drücken.
»Hast du jetzt etwa ’nen Steifen gekriegt?«, sagte Grady fassungslos.
»Das sind meine Autoschlüssel. Da ist ein Loch in meiner Hosentasche.«
»Sicher doch«, sagte er. Ein Lachen begann sein Gesicht zu verzerren. »Alle mal aufgepasst, ihr werdet diesen Kerl lieben! Der Junge schlägt hier tatsächlich in aller Öffentlichkeit ein Zelt auf. Hat jemand vielleicht eine Kamera dabei? Ist wohl schon lange her, dass du das letzte Mal einen weggesteckt hast, oder, Sattelratte?«
Mein Gesicht stand in Flammen. Ich hatte das Gefühl, in einem dieser Träume gefangen zu sein, in denen man vor der Klasse steht und sich in die Hose macht. Dann tat Valerie Epstein etwas, für das ich ihr ewig dankbar sein werde und das mich wohl davor bewahrte, mir die Pulsadern aufzuschneiden. Sie warf Grady ihre Pommes frites samt Ketchup ins Gesicht. Zuerst war er zu schockiert, um glauben zu können, was sie getan hatte. Dann begann er die Pommes von seiner Haut und seinem Hemd zu zupfen, als wären es dicke Blutegel, und warf sie auf den Asphalt. »Okay, Schwamm drüber. Du bist ganz offensichtlich gerade nicht du selbst. Aber bitte beruhige dich wieder. Willst du vielleicht, dass ich mich bei diesem Jungen entschuldige? Gut, pass auf. Hey, Kumpel. Tschuldigung, hörst du? Ja, du bist gemeint, Arschgesicht. Hier, willst du auch ein paar Pommes? Ich steck dir gleich welche in die Nase.«
Sie stieg aus dem Wagen und schlug die Tür zu. »Du bist erbärmlich«, sagte sie, riss sich die Kette mit dem Absolventenring vom Hals und warf sie auf den Sitz des Cabrio. »Du brauchst nicht mehr anzurufen oder vorbeizukommen. Du brauchst auch keine Briefe zu schicken. Und wehe, deine Freunde tauchen bei mir auf, um Entschuldigungen für dich aufzusagen.«
»Ach, komm schon, Val. Wir sind doch ein Team«, sagte er und wischte sich das Gesicht mit einer Serviette ab. »Willst du vielleicht noch ’ne Cola?«
»Es ist vorbei, Grady. Du bist, was du bist. Egoistisch, unehrlich, respektlos und grausam. Und ich, in meiner Dummheit, dachte wirklich, dass ich dich ändern könnte.«
»Wir kriegen das hin, Val. Ich versprech’s dir.«
Sie wischte sich mit der Hand über die Augen, antwortete aber nicht. Ihr Gesicht war nun ruhig, auch wenn sie immer noch so hastig atmete, als hätte sie Schluckauf.
»Tu mir das nicht an, Val«, sagte er. »Ich liebe dich. Das kannst du doch nicht machen. Willst du wirklich zulassen, dass ein Trottel wie der hier uns auseinanderbringt?«
»Lebwohl, Grady.«
»Wie willst du denn nach Hause kommen?«, sagte er.
»Darüber brauchst du dir keine Gedanken mehr zu machen.«
»Ich lasse dich nicht auf der Straße stehen. Komm schon, steig ein. Langsam, aber sicher machst du mich wütend.«
»Wirklich? Was für eine Tragödie«, sagte sie. »Weißt du, was mein Vater über dich gesagt hat? ›Grady ist kein schlechter Kerl. Er ist einfach nur unfähig, ein guter zu sein.‹«
»Komm zurück. Bitte.«
»Ich wünsche dir ein schönes Leben«, sagte sie. »Auch wenn ich mir beim Gedanken an unsere Küsse am liebsten den Mund mit Waschpaste ausbürsten würde.«
Dann drehte sie sich um und ging, wie die schöne Helena, als diese Attika den Rücken zuwandte. Ein warmer Windstoß trieb ein paar Zeitungsseiten die Promenade entlang und wirbelte sie hinauf in den Himmel. Orangefarbene Sonnenstrahlen drangen durch die Wolken im Westen, während der Horizont sich verdunkelte, auf der anderen Seite des Seawall Boulevard die Wellen am Strand brachen und die Wedel der Palmen trocken im Wind raschelten. Ich konnte das Salz und die Meeresalgen und die winzigen Muscheln riechen, die am Strand vertrockneten, und es roch nach einem Neuanfang. Ich schaute Valerie hinterher, wie sie durch die Autos zum Boulevard ging und die von ihrer Schulter herabhängende Strandtasche bei jedem Schritt auf und ab hüpfte. Grady stand neben mir, schwer atmend, sein Blick ebenso wie der meine auf Valerie fixiert. In seinen Augen allerdings lag die Erkenntnis endgültigen Verlusts, ein Ausdruck, der mich an eine Grundströmung erinnerte, wie sie aus den Tiefen des Meeres aufsteigt, kurz bevor ein Sturm über die Küste hereinbricht.
»Tut mir leid«, sagte ich.
»Kannst von Glück reden, dass wir hier in der Öffentlichkeit sind und ich nicht das mit dir tun kann, was ich gern tun würde. Aber ich sag dir was: Besser, du suchst dir ein tiefes Rattenloch und verkriechst dich«, sagte er.
»Anderen die Schuld zuzuschieben, wird dir jetzt auch nicht weiterhelfen«, sagte ich.
Er wischte sich einen Ketchupfleck von der Wange. »Ich hatte gehofft, dass du so etwas sagen würdest.«
Kapitel 2
Am nächsten Tag besuchten mein Vater und ich die Mittagsmesse. Meine Mutter war zwar als Baptistin erzogen worden, ging aber in keine Kirche mehr. Sie war in fürchterlicher Armut aufgewachsen und von ihrem Vater alleingelassen worden. Mit siebzehn Jahren hatte sie einen sehr viel älteren Mann geheiratet, einen Handlungsreisenden. Ihre Scheidung hielt sie später geheim, als hätte sie damit ihren Wert als Person gemindert und sich als unwürdige Kandidatin für die von ihr so sehr ersehnte soziale Anerkennung erwiesen. Jeden Sonntag bereitete sie uns ein spätes Frühstück, und danach fuhren mein Vater und ich in seinem Firmenwagen zur Kirche. Wir sprachen nur selten während der Fahrt.
Ich habe nie verstanden, warum meine Mutter meinen Vater geheiratet hatte. Sie küssten sich nie, hielten noch nicht mal Händchen, zumindest sah ich das nie. In ihren Augen wohnte eine Einsamkeit, die mich zu der Überzeugung brachte, dass es Gefängnisse in mannigfaltigen Formen und Größen gab.
Während des Gottesdienstes konnte ich die Reste der vergangenen Nacht an der Kleidung meines Vaters riechen; den Biergeruch und den Zigarettenqualm. Noch bevor der Priester den Segen sprach, flüsterte mein Vater mir zu, er hätte Magenprobleme und würde in Costen’s Drugstore auf der anderen Straßenseite auf mich warten. Als ich nach dem Gottesdienst dort ankam, stand er an der Theke, trank Kaffee und unterhielt sich mit dem Ladenbesitzer über das Footballteam der Louisiana State University. »Magst du vielleicht eine Lime Coke?«, fragte mich mein Vater.
»Nein, danke, Sir. Kann ich heute Nachmittag den Wagen haben?«, sagte ich.
»Dürfte ich den Wagen ausleihen.«
»Dürfte ich heute Nachmittag den Wagen ausleihen?«
»Eigentlich wollte ich ja zur Bowlingbahn«, sagte er. »Heute ist da Ligabowling.«
Ich nickte. Mein Vater war kein Bowler und interessierte sich auch nicht dafür. Die Bowlingbahn hatte jedoch eine Klimaanlage und eine Bar.
»Komm doch mit«, sagte er. »Vielleicht kannst du auch ein paar Bahnen bowlen.«
»Ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen.«
Mein Vater war ein gut aussehender Mann, elegant und mit tadellosen Umgangsformen. Selbst wenn er allein war, setzte er sich nie zum Abendessen oder zum Frühstück an den Tisch, ohne dazu ein Sakko anzuziehen. Er hatte seinen besten Freund am 11. November 1918 in den Schützengräben Europas verloren und verabscheute seither nicht nur den Krieg und die landesweite Begeisterung für das Militär, sondern auch die kriegsverherrlichende Rhetorik von Politikern, die andere Männer an die Front schickten, damit diese dort an ihrer statt litten und starben. Aber er trank. Und irgendwie wurden all seine Tugenden von dieser Tatsache überlagert und ausradiert. »Du hast eine neue Freundin?«
»Ich habe noch nicht mal eine alte.«
»Dann bist du gerade dabei, diese Situation zu ändern?«, sagte er.
»Das würde ich gern.«
»Wer ist sie?«
»Ich kenn sie noch nicht so doll.«
»Ich kenne sie noch nicht sonderlich gut.«
»Ja, Sir.«
Ich nahm den Bus nach Nord-Houston. Im Winter zuvor hatte mir ein Freund ein Haus an einem Boulevard gezeigt – ein einstöckiges Gebäude im viktorianischen Stil, im Schatten von Eichenbäumen gelegen und mit breiter Veranda – und gesagt, es sei das Zuhause von Valerie Epstein. An den Namen des Boulevards konnte ich mich nicht mehr erinnern, aber ich wusste noch ungefähr, wo er sich befand. Als ich an der Strippe zog, die dem Busfahrer signalisierte, dass er halten sollte, spürte ich, wie sich mein Magen zusammenschnürte, als würde eine winzige Flamme durch meine Eingeweide nach oben kriechen.
Ich stand in den Abgasen des Busses und starrte auf die Palmen am Straßenrand und die Häuser, in denen einst die reichsten Bürger der Stadt gelebt hatten, bevor sie hinaus nach River Oaks gezogen waren. Ich war tief in Feindesland eingedrungen, und ich wusste, dass mein Bürstenschnitt, meine polierten Schuhe, meine Anzughose und mein gestärktes weißes Hemd in dieser Gegend so wirkten wie Blutstropfen im Haifischbecken.
Ich ging los. Kurz darauf glaubte ich in einer Nachbarstraße das Dröhnen eines Wagens mit frisierter Auspuffanlage zu hören. An der Ecke stand eine farbige Frau hinter einer Bank und wartete auf den Bus. Sie hielt ihre Handtasche fest umklammert und lehnte sich nach vorn, wie über die Reling eines Schiffes, um erst in die eine, dann in die andere Richtung zu schauen. Auf dem Boulevard waren außer ihr keine Farbigen zu sehen. Es waren die Jahre, in denen junge Weiße noch regelmäßig Jagd auf Schwarze machten. Ich versuchte sie anzulächeln, aber sie schaute zur Seite.
Als ich einen weiteren Häuserblock hinter mir gelassen hatte, erkannte ich Valeries Haus. Im Vorgarten standen zwei Virginia-Eichen, von denen Louisiana-Moos herabhing, und auf der Veranda war eine Schaukel zu sehen. An der Seite des Hauses befand sich ein Obst- und Gemüsegarten, hinter dem Gebäude konnte ich einen Geräteschuppen und einen mit einer Schweißausrüstung beladenen Pick-up-Truck ausmachen, der auf einer Rasenfläche unter einem riesigen Pekannussbaum parkte. Hinter mir erklang wieder das tiefe Dröhnen eines Wagens mit frisierter Abgasanlage. Ich drehte mich um und sah einen 1941er Ford mit Doppelauspuff, in die Karosserie eingelassenen Scheinwerfern und einem Motor, der sehr viel kraftvoller klang als ein konventioneller V8. Auch am Aufbau des Wagens hatte man viel gearbeitet: Sämtliches Chrom war entfernt, einige Teile ausgebessert und neu verzinnt und alles mit einer mattgrauen Grundierung angestrichen worden. Ein Blick auf die Insassen genügte, und ich wusste, dass ich gleich ein paar echt harte Typen von der Northside kennenlernen würde; streitlustige Halbstarke, die wir wegen ihrer Pomadenhaare nur Greaser nannten. Oder Ducktails, wegen ihrer an Entenärsche erinnernden Frisuren.
Ihre Markenzeichen? Ein träge starrender Blick; leicht gekrümmte Schultern; bis zur Brust aufgeknöpfte Hemden mit hochgestelltem Kragen, deren Manschetten selbst im Hochsommer stets geschlossen blieben; Drapes genannte Hosen, die oben weit geschnitten waren, sich nach unten aber verengten und von einem dünnen Veloursledergürtel unterhalb des Bauchnabels gehalten wurden; stets ein Esslöffel Pomade in den am Hinterkopf gescheitelten Haaren und Eisenbeschläge unter den spitz zulaufenden Schuhen, mit denen sich im Bedarfsfall auch die Zähne des Gegners eintreten ließen. Auf der Haut zwischen linkem Daumen und Zeigefinger trugen sie das Pachuco-Kreuz tätowiert, und in ihren Augen suchte man vergeblich nach so etwas wie Mitleid oder Gnade. Mir ist klar, dass man heutzutage denken könnte, dass es sich bei diesen Burschen lediglich um ein paar fehlgeleitete Jugendliche handelte, die mit ihrem Kleidungsstil und ihrem Auftreten ihre Ängste kaschieren wollten. Meiner Erfahrung nach war das jedoch nicht der Fall. Ich war damals der Meinung und bin es noch heute, dass die meisten von ihnen selbst dann noch feuern würden, was die Kanonen hergeben, wenn das Deck bereits unter Wasser steht und ihr Untergang besiegelt ist – und dass sie damit dem entsprechen, was George Orwell einst von Leuten sagte, die wahrhaft mutig sind.
Der Ford hielt mit gurgelndem Auspuff an der Bordsteinkante. »Sieht aus, als hättest du dich verlaufen«, sagte der Greaser auf dem Beifahrersitz.
»Das hab ich in der Tat«, antwortete ich.
»Oder du verkaufst Bibeln.«
»Jetzt, wo du’s sagst, Kumpel. Eigentlich such ich nämlich die Kirche der Assembly of God. Ihr habt auch keine Ahnung, wo die hier sein könnte, oder?«
Ich sah an seinen Augen, dass ihm meine nachlässige Ausdrucksweise auffiel. Er war nicht nur intelligenter, als ich gedacht hatte, sondern ohne Zweifel auch gefährlich.
»Spielst du jetzt den Dummen?« Er steckte sich eine Lucky Strike in den Mund, zündete sie aber nicht an. Sein Haar war tintenschwarz, seine Wangen hohl, seine Haut blass. Er kratzte sich am Hals. »Haste Streichhölzer für mich?«
»Ich rauche nicht.«
»Wenn du keine Bibeln verkaufst und auch kein Feuer hast, wozu taugst du dann? Bist du überhaupt für irgendetwas zu gebrauchen, Boy?«
»Wahrscheinlich nicht. Aber wie wär’s, wenn du dir das ›Boy‹ in Zukunft sparst?«, sagte ich. »Eure Kiste finde ich ziemlich stark. Wo habt ihr die Auspufftöpfe her?«
Er nahm die Zigarette aus dem Mund, klemmte sie zwischen Daumen und Zeigefinger ein, drehte sie hin und her und nickte dabei, als würde er gerade zu einer tiefsinnigen Einsicht kommen. »Jetzt weiß ich wieder, wo ich dich gesehen habe. In dieser Auspuffprinzenbar in Downtown. Wie heißt die noch gleich, Pink Elephant?«
»Was sind Auspuffprinzen?«
»Typen wie du. Woher hast du die Gürtelschnalle?«
»Beim Junior-Rodeo gewonnen. Wildpferd- und Bullenreiten.«
»Hast du dafür in den Boxen Schwänze gelutscht?«
Ich wandte den Blick von ihm ab. Die Straße war heiß und strahlte hell. Die Rasenflächen hatten ein sattes Grün, die Luft war feucht, und das grelle Weiß der Häuser trieb einem die Tränen in die Augen. »Ich nehm’s dir nicht übel, dass du so etwas sagst. Auch ich hatte Vorurteile gegenüber Leuten, die der Mutterschoß anders geformt hat.«
»Woher hast du denn den Spruch?«
»Aus der Bibel.«
»Willst du uns damit sagen, dass du schwul bist?«
»Wer weiß?«
»Glaub ich dir sogar. Du hast einen schönen Mund. Vielleicht solltest du dir einen Lippenstift zulegen.«
»Fick dich, Mann«, sagte ich.
Er öffnete langsam die Tür und trat auf den Asphalt. Er war größer, als er im Auto gewirkt hatte. Sein Hemd war aufgeknöpft, der Wind plusterte die Ärmel auf. Sein Bauch war flach, seine Drapes hingen tief auf seinen Hüften. Mit seinen Augen suchte er mein Gesicht ab, als würde er eine Laborratte studieren. »Kannst du das noch einmal sagen?«
Ich hörte, wie hinter mir eine Fliegengittertür mit quietschendem Geräusch aufging und wieder zufiel. Der Greaser hatte seinen Blick von mir abgewandt. Valerie Epstein war die Verandatreppe heruntergestiegen und stand nun unter den Virginia-Eichen in ihrem Garten, wo sie sich zum Schutz vor der Sonne die Hand über die Augen hielt. »Bist du das?«, sagte sie.
Ich wusste nicht, ob sie mich oder den Greaser am Bordstein meinte, und tippte mir mit dem Zeigefinger auf die Brust. »Meinst du mich?«
»Aaron Holland? Das war doch dein Name, richtig?«, sagte sie.
»Ja«, sagte ich und merkte, wie meine Stimme plötzlich dünn wurde.
»Hast du mich gesucht?«, sagte sie.
»Ich wollte nur schauen, ob du gut nach Hause gekommen bist.«
Der Greaser stieg wieder in den Ford und schloss die Tür. Er schaute zu mir hoch, direkt in meine Augen. »Du solltest es mal am einarmigen Banditen versuchen. Scheinst jede Menge Glück zu haben«, sagte er. »Wir sehen uns.«
»Ich freu mich schon drauf. War schön, dich kennenzulernen.«
Der Wagen fuhr davon. Ich schaute Valerie an. Sie trug ein weißes Sommerkleid, bedruckt mit Blumenmotiven.
»Ich dachte schon, jetzt hätte mein Stündlein geschlagen«, sagte ich.
»Warum?«
»Wegen diesen Schlägern.«
»Das waren keine Schläger.«
»Dann eben Schmalzköpfe.«
»Manchmal sind sie etwas übereifrig, wenn es um den Schutz des Viertels geht. Aber das ist schon alles.«
Der Wind drückte ihr das Kleid gegen Hüften, Bauch und Oberschenkel. Ich war so nervös, dass ich meine Arme vor meiner Brust verschränken musste, damit meine Hände nicht mehr zitterten. Ich versuchte mich zu räuspern. »Wie bist du von Galveston nach Hause gekommen?«
»Mit dem Greyhound-Bus. Und du wolltest nur mal nachfragen, ob ich gut angekommen bin?«
»Magst du Minigolf?«
»Minigolf?«
»Das macht richtig Spaß«, sagte ich. »Ich dachte nur, dass du vielleicht ein oder zwei Runden mit mir spielen würdest. Also, falls du nichts anderes vorhast, meine ich.«
»Komm rein. Du siehst aus, als könntest du etwas zu trinken vertragen.«
»Du bittest mich ins Haus?«
»Was habe ich denn gerade gesagt?«
»Du hast gesagt, ich soll mit reinkommen.«
»Also?«
»Ja, ich denke, ich könnte ein Glas kaltes Wasser vertragen. Das mit den Schmalzköpfen ist mir rausgerutscht. Manchmal sage ich Dinge, die ich nicht so meine.«
»Sie werden es überleben. Kommst du?«
Ich hätte den Grand Canyon den ganzen Weg bis nach Texas gezogen, um mit Valerie Epstein an einem Tisch zu sitzen. »Ich hoffe, ich störe dich nicht allzu sehr. Ich hatte schon Gewissensbisse, weil ich dich gestern nicht gesucht habe, aber ich musste erst meinem Vater das Auto zurückbringen.«
»Ich denke, du hast ein gutes Herz.«
»Wie bitte?«
»Du hast schon verstanden.«
Ich hörte die klimpernden Geräusche von Windspielen, den Gesang der Vögel und in der Ferne etwas, das wie eine explodierende Kette von Knallfröschen klang. Und ich wusste, dass ich Valerie Epstein sehr wahrscheinlich für den Rest meines Lebens lieben würde.
Sie führte mich in die Küche, wo sie einen Krug mit Limonade aus dem Eisschrank holte. Die Wände waren weiß und gelb gehalten, sämtliche Oberflächen glänzten. Sie nahm zwei Gläser, warf ein paar Eiswürfel und jeweils einen Minzzweig hinein, füllte sie mit Limonade und stellte sie mit Papierservietten als Untersetzer auf dem Tisch ab. »Das da im Garten ist mein Vater«, sagte sie. »Er baut Pipelines.«
Ein muskulöser Mann mit Latzoverall und nacktem Oberkörper schraubte an dem Pick-up unter dem Pekannussbaum. Seine Haut war von der Sonne gebräunt, die goldenen Haarlöckchen auf seinen Schultern von glitzerndem Schweiß überzogen, sein Profil wie aus Zinn geschnitten.
»Er sieht aus wie Alexander der Große. Ich meine, wie das Bild auf der Münze«, sagte ich.
»Komischer Vergleich.«
»Na ja, Geschichte ist mein Lieblingsfach. Ich lese alles darüber, was ich in die Hände kriege, genauso wie mein Vater. Der ist übrigens Erdölingenieur.«
Ich wartete darauf, dass sie etwas erwiderte, aber sie sagte nichts. Schlagartig wurde mir klar, was ich ihr gerade mitgeteilt hatte: Mein Vater war ein gebildeter Mann, ihr Vater wahrscheinlich nicht. »Nun, ähm, eigentlich wollte ich nur sagen, dass er auch in der Erdölbranche arbeitet.«
»Bist du immer so nervös?«
Wir hatten uns mittlerweile an den Tisch gesetzt, auf der Küchentheke sorgte ein Ventilator für etwas Abkühlung. »Manchmal kommen die Worte einfach falsch aus meinem Mund heraus. Ich wollte dir nur erzählen, wie mein Vater auf den Ölfeldern gelandet ist, aber dann bin ich durcheinandergekommen.«
»Na dann los, erzähl’s mir.«
»Er war als Chemiker in der Zuckerindustrie auf Kuba tätig. Nach einem Vorfall auf einem Fährschiff von New Orleans nach Havanna hat er den Job hingeschmissen und arbeitete von da ab an den Pipelines. Dann erwischte ihn die große Depression, und er konnte nie das werden, was er eigentlich sein wollte, nämlich Schriftsteller.«
»Was ist auf diesem Schiff passiert, dass er deswegen seine Anstellung als Chemiker aufgab?«
»Er war als Soldat im Ersten Weltkrieg. Eines Tages begann die deutsche Artillerie auf den Schützengraben zu feuern, in dem die Truppe meines Vaters lag, und schoss ihre Verteidigungsanlagen regelrecht in Stücke. Nach dem ersten Beschuss kam der Befehlshaber der Deutschen mit einer weißen Flagge aus seinem Graben und forderte den Captain meines Vaters auf, sich zu ergeben. Er sicherte die Versorgung der Verwundeten und die korrekte Behandlung der restlichen Truppe zu. Der Captain meines Vaters lehnte das Angebot jedoch ab. Später flog ein deutscher Doppeldecker über die Gräben und winkte mit den Tragflächen, um anzuzeigen, dass er sich auf friedlicher Mission befand. Er warf Flugblätter über den Linien ab, aber der Captain wollte immer noch nicht aufgeben. Die Deutschen setzten dann auf Eisenbahnwaggons montierte Geschütze ein, und als diese das Feuer eröffneten, töteten sie in dreißig Minuten die Hälfte der Männer in der Einheit meines Vaters.
Zehn Jahre später war mein Vater auf diesem Fährschiff nach Havanna unterwegs und traf an Bord seinen ehemaligen Befehlshaber wieder, den Captain aus dem Schützengraben. Mein Vater bestand darauf, etwas mit dem Mann zu trinken, hauptsächlich, um selbst vergeben und vergessen zu können. Der Mann sprang allerdings noch in derselben Nacht über Bord. Mein Vater hat die Schuld für diese Tragödie stets bei sich selbst gesucht.«
»Das ist eine traurige Geschichte.«
»Die meisten wahren Geschichten sind traurig.«
»Du solltest auch Schriftsteller werden.«
»Warum?«
»Weil ich glaube, dass du ein netter Junge bist.«
»Irgendwie passen diese beiden Aussagen nicht zusammen«, sagte ich.
»Vielleicht sollen sie das auch nicht.« Sie lächelte, und als sie dann Luft holte, veränderte sich das Licht in ihren Augen. »Du musst vorsichtiger sein.«
»Weil ich in die Heights gekommen bin?«
»Ich spreche von Grady und seinen Freunden.«
»Ich glaube, Grady Harrelson ist ein Aufschneider.«
»Grady hat eine dunkle Seite, und diese Seite hat nichts mit Aufschneiderei zu tun. Dasselbe gilt für seine Freunde. Du solltest ihn nicht unterschätzen.«
»Ich habe keine Angst vor ihnen.«
»Vorsicht und Angst sind zwei verschiedene Dinge.«
»Vielleicht stimmen ja ein oder zwei Sachen nicht mit mir, und niemand weiß etwas davon. Vielleicht steht diesen Burschen ja eine große Überraschung bevor, wenn sie mich herausfordern.«
»Erstens glaube ich dir nicht. Zweitens ist es nicht normal, sich mit seinen Makeln zu brüsten.«
»Manchmal glaube ich, in mir würden zwei oder drei verschiedene Menschen leben. Einer von denen hat eine Ballonhupe wie Harpo Marx.«
»Interessant.«
»Meine Mutter meint, ich hätte eine etwas zu lebendige Fantasie.«
Ich sah, wie ihre Aufmerksamkeit schwand.
»Ich muss morgen einen Aufsatz über John Steinbeck abgeben«, sagte sie. »Besser, ich fange langsam damit an.«
»Verstehe.«
»Ich bin froh, dass du vorbeigekommen bist.«
Ich kam mir dumm vor, versuchte aber, mir nichts anmerken zu lassen. Ich konnte ihren Vater bei der Arbeit an seinem Pick-up sehen, wie er mit angespannten Unterarmmuskeln an einem Schraubenschlüssel zog. Ich wollte, dass sie mich ihm vorstellte. Ich wollte über Trucks, Pipelines und Bohreinsätze reden. Ich wollte noch nicht gehen. »Sonntagabend ist der ideale Zeitpunkt für eine Partie Minigolf. Die Sterne stehen am Himmel, eine leichte Brise weht aus dem Süden heran, und gleich nebenan gibt es einen Wassermelonenstand mit Picknicktischen.«
»Siehst du? Du redest wie ein Schriftsteller. Lass uns ein anderes Mal etwas unternehmen.«
»Sicher«, antwortete ich. Ich hatte noch nicht mal meine Limonade ausgetrunken. »Ich finde allein raus. Du solltest besser mit deinem Aufsatz anfangen.«
»Jetzt sei nicht sauer.«
»Bin ich nicht, Miss Valerie. Danke für die Einladung.«
»Du musst mich nicht ›Miss‹ nennen.«
Ich stand vom Tisch auf. »Mein Vater stammt aus Louisiana. Er hält mir dauernd Vorträge über gute Manieren, korrekte Ausdrucksweise und solche Sachen.«
»Das finde ich schön.«
Ich wartete und hoffte, dass sie mich bitten würde, noch zu bleiben.
»Ich bring dich hinaus«, sagte sie.
Wir gingen durch einen dunklen Flur, der nach Holzpolitur roch. An den Kleiderhaken an der Wand hingen eine Arbeitsmütze und eine Herrenregenjacke, ein Pullover der Jugendorganisation 4-H und eine Jeansjacke mit Spitzen an den Ärmelbündchen. Darunter standen Herrengaloschen und weiße Gummistiefel, wie sie ein Teenager tragen würde. Morgenröcke oder Damenhüte, Hausschuhe oder Sonnenschirme, Schals oder Tücher konnte ich allerdings nicht im Flur entdecken.
Zudem war das Wohnzimmer von einer Strenge erfüllt, die ich zuvor nicht bemerkt hatte. Vielleicht hing der Eindruck mit dem Mobiliar zusammen, das aus dem vorigen Jahrhundert stammte, vielleicht auch mit der Radio-Plattenspieler-Kombination, auf der eine Topfpflanze stand, dem leeren Kamin oder der Sitzgarnitur, die so wirkte, als würde nie jemand auf ihr Platz nehmen. Bisher hatte ich gedacht, Valerie Epstein hätte ein perfektes Zuhause. Nun war ich mir nicht mehr so sicher.
»Ist deine Mutter da?«, fragte ich.
»Sie ist im Krieg gestorben.«
»Das tut mir leid.«
»Ihr nicht. Sie tat, was sie für richtig hielt.«
»Wie meinst du das?«
»Als ihre Familie aus Paris floh, war ihr Bruder zurückgeblieben. Meine Mutter ließ sich wieder ins Land schmuggeln und wurde von der Gestapo gefasst. Wir glauben, dass sie nach Dachau deportiert wurde.«
»Wie schrecklich, Valerie.«
»Komm, ich begleite dich noch nach draußen«, sagte sie und hakte sich bei mir unter.
Die Verandaschaukel schwang im Wind leicht vor und zurück, die Bäume rauschten, gelber Staub wurde in den Himmel hinaufgewirbelt. »Kann ich deine Telefonnummer haben?«
»Die steht im Telefonbuch. Du solltest dich lieber beeilen.« Sie schaute zum Himmel hinauf. »Und pass auf, dass du keinen Ärger bekommst. Hörst du? Halt dich von Grady fern, ganz gleich, wie sehr er dich auch provoziert.«
»Mein Vater gibt mir heute Abend das Auto. Wir könnten zum Wassermelonenstand fahren. Wie sieht’s aus? Ich hol dich um acht ab und bring dich eine Stunde später wieder heim.«
»Wie kann man nur so dickköpfig sein?«
»Ich nenne das Überzeugung.«
»Und Punkt neun bin ich wieder zu Hause?«
»Versprochen«, sagte ich.
In den Winkeln ihrer Augen tauchten kleine Fältchen auf.
Es regnete den Großteil der Nacht. Als ich morgens aufwachte, war die Sonne rosafarben, der Himmel blau und die Gehwege von nassen Streifen und Schatten überzogen. Ich mochte die Stichstraße, in der sich unser kleiner Bungalow befand. Alle Häuser in dieser Straße bestanden aus Stein und hatten mit Obstbäumen und Blumen bepflanzte Vorgärten. Die Straße endete vor einer Wand aus Bambus, hinter der sich eine Weide mit ein paar zweihundert Jahre alten Virginia-Eichen befand. Ich setzte mich mit meiner Sandwichtüte auf die Stufen unserer Eingangstür und wartete auf meine Mitfahrgelegenheit zur Schule. Jeden Morgen holte mich mein bester Freund Saber Bledsoe in seinem 1936er Chevy ab. Der Wagen war ein Schrotthaufen auf vier Rädern, an dem Saber unzählige Stunden geschraubt und gewerkelt hatte, um ihn mit Ersatzteilen von der Müllhalde seinen Vorstellungen entsprechend aufzumotzen. Es war allerdings ein qualmendes Wrack geblieben, dessen Gestank und Geknatter man schon aus einem Häuserblock Entfernung wahrnehmen konnte.
Es gab eigentlich nichts, wozu Saber nicht fähig gewesen wäre – ganz besonders, wenn er das Gefühl hatte, seinen Mut unter Beweis stellen zu müssen. Gelegentlich zündete er in der Schule Kanonenschläge in den Rohrleitungen der Toiletten – für gewöhnlich in den Pausen, wenn viele Schüler und Lehrer die WCs benutzten –, sodass im ganzen Gebäude das Wasser aus den Kloschlüsseln spritzte. Oft legte er sich auch mit Mr. Krauser an, dem meistgehassten Lehrer der Schule, vielleicht sogar der gesamten Stadt. So schlich Saber sich einmal ins Lehrerzimmer und stopfte einen mit Formaldehyd getränkten Frosch aus dem Biologieunterricht in den Krautsalat von Mr. Krauser, der sich dann in der Mittagspause auf der Lehrertoilette übergeben musste. Ein anderes Mal legte sich Saber in dem Zimmer über dem Unterrichtsraum von Mr. Krauser mit heruntergelassener Hose auf den Bauch und steckte seinen kleinen Freund durch ein Loch im Fußboden. Wie eine obszöne Glühlampe baumelte sein ganzer Stolz dann von der Decke in Krausers Unterrichtsraum, bis dieser endlich entdeckte, warum seine Schüler grinsten, als würden sie jeden Moment wie pralle Luftballons zerbersten.
Ich war fest entschlossen, dass es ein guter Tag werden würde. Wahrscheinlich hatte niemand die Sache mit meiner Erektion auf dem Parkplatz des Drive-in mitbekommen. Und was die Sache mit Grady Harrelson anging? Nun, dann hatte ich mich eben mit ihm angelegt. Was konnte er schon groß unternehmen? Er hatte seine Chance gehabt. Und die Halbstarken in den Heights? Von denen hatte Valerie gesagt, sie seien nur ein paar Jungs aus der Nachbarschaft.
Ich hatte Valerie Epstein zum Wassermelonenstand ausgeführt und wieder nach Hause gefahren. Anschließend hatten wir auf ihrer Verandaschaukel gesessen, und als dann ein Blitz im Park einschlug, hatte ich sogar ihre Hand gestreichelt. Nichts war geschehen, niemand hatte sich um uns gekümmert.
War es möglich, dass ich in den Heights einen Ort gefunden hatte, an dem meine Probleme mich zufriedenließen? Einen Ort, an dem mein Leben nicht von Angst bestimmt wurde?
Nein.
Kaum saß ich im Auto, merkte ich, dass Saber mächtig aufgeregt war. Er setzte zurück auf die Straße und fuhr Richtung Westheimer Road. Der Ganghebel vibrierte in seiner Hand. Er hatte die T-Shirt-Ärmel bis zu den Achseln hochgeschlagen und schaute mich an. Dann begann sein Kopf wie an einer Feder hängend auf und ab zu wippen, und er setzte sein Saber-Bledsoe-Starren auf, eine mit schielenden Augen und offenem Mund einhergehende Fratze, mit der er seine Fassungslosigkeit über die Dummheit seines Gegenübers zum Ausdruck brachte.
»Warum machst du’s dir eigentlich so schwer, Junge? Meld dich doch lieber gleich bei einem Selbstmordkommando in Korea an«, sagte er.
»Ich versteh kein Wort, Saber.«
»Es heißt, du hättest dich vor einem Drive-in in Galveston mit Grady Harrelson angelegt und wärst danach in den Heights aufgetaucht, um Valerie Epstein durch die Gegend zu kutschieren.«
»Wer hat dir das erzählt?«
»Frag lieber, wer es mir nicht erzählt hat. Außerdem hast du wohl ein paar Greasern gesagt, dass sie sich mal ficken sollen? Einem bestimmten Greaser im Speziellen?«
»Das kannst du unmöglich wissen.«
»Die Schmalzlocke, mit der du dich angelegt hast, heißt Loren Nichols. Vor einiger Zeit hat der Kerl im Prince’s Drive-in jemandem mit einer Luftdruckpistole in die Brust geschossen.«
Saber hatte hellrote Haare, oben als Flattop geschnitten, an den Seiten nach hinten gekämmt. Seine Augen waren grüne Schlitze, sein Blick wirkte stumpf wie das Starren einer Eidechse. Er sprach wie ein Peckerwood, mit der Mundart der verarmten weißen Landbevölkerung, und war von einer nervösen Energie erfüllt, die an eine ständig auf- und zuklappende Tür erinnerte. Er zog sich mit dem Mund eine Zigarette aus seiner Camel-Schachtel.
»Die sind gestern Abend bei mir zu Hause aufgetaucht, Aaron«, sagte er, die Zigarette wippend zwischen seinen Lippen. »Jemand muss denen meinen Namen gesteckt haben.«
»Wer ist bei dir aufgetaucht?«
»Loren und seine drei Greaser-Freunde.«
Ich hatte das Gefühl, meine Magenwand würde aufreißen. »Was wollten sie?«
»Dich.«
»Und was hast du ihnen gesagt?«
»Dass mein alter Herr besoffen ist und einen Baseballschläger hat. Und dass sie deshalb lieber ihre erbärmlichen Ärsche aus meiner Einfahrt hieven. Und rate mal, was dann passiert ist. Bevor ich zu Ende gesprochen hatte, kam mein Alter tatsächlich aus der Garage getorkelt, mit einer großen Rohrzange in der Hand.«
»Lass uns die Sache vergessen, Saber.«
»Vergessen? Nach der zweiten Stunde wird die ganze Schule davon sprechen. Stimmt es wirklich, dass du Grady Harrelson und Valerie Epstein auseinandergebracht hast?«
»Nein.«
»Ist auch egal. Spätestens heute Nachmittag wird diese Story Legendenstatus haben. Und du bist tatsächlich mit ihr ausgegangen, oder?«
»Mehr oder weniger.«
»Wow, das ist ungefähr so, als hättest du Doris Day flachgelegt. Du bist ein verdammter Held, Mann. Hat sie eine Schwester? Ich wäre interessiert, Aaron. Verdammt interessiert sogar.«
Kapitel 3
In der vierten Unterrichtstunde stand für Saber und mich Metallwerken auf dem Plan. Der Lehrer für dieses Fach war Mr. Krauser, der lebende Beweis, dass die Menschheit vom Affen abstammt. Er war im Krieg als Panzerkommandant in Frankreich und Deutschland gewesen und erzählte gern Geschichten darüber, wie er und seine Kameraden zum Spaß mit ihren Shermans französische Bauernhäuser plattgewalzt hatten. Einmal, so die Legende, war einer der Panzer in einen unter dem Haus liegenden Keller eingebrochen, was Krauser zum Schießen fand. Er hatte uns auch erzählt, wie er als Lektion für seine Männer einen älteren deutschen Zivilisten am Kragen gepackt, auf die Straße geschleift und dessen Haus in Beschlag genommen hatte. Vor nicht allzu langer Zeit hatte sich Krauser beim Bowlen in betrunkenem Zustand ein Messer von einem Schüler geliehen und einem anderen Bowler den Schlips abgeschnitten.
Saber war der einzige Schüler an unserer Highschool, der wusste, wie man Krauser Stachelschweinborsten in den Leib trieb und täglich dafür sorgte, dass die Wunden nicht verheilten. Krauser war überzeugt davon, dass Saber derjenige gewesen war, der seinen kleinen Freund durch das Loch in der Decke seines Klassenraums gesteckt hatte. Aber er konnte es nicht beweisen, und so suchte er ständig nach Vorwänden, um sich Saber vorknöpfen zu können. Saber allerdings benahm sich im Metallwerken tadellos, ganz im Gegensatz zu anderen Jungs, die es teilweise bis zum Äußersten trieben.
Unsere Highschool befand sich nur einen Steinwurf entfernt von River Oaks, einem im Schatten grüner Bäume gelegenen Stadtteil mit palastähnlichen Villen. Das Einzugsgebiet der Schule war allerdings riesig und reichte nicht nur bis in die knallharten Arbeiterviertel von Nord-Houston, sondern sogar bis rüber nach Wayside und hoch bis zum Jensen Drive, wo einige der hartgesottensten Kids des Planeten wohnten. Beim Metallwerken waren diese Jungs Naturtalente. Drei von ihnen bedienten die Gießstation, wo sie Modelle im Sand abformten und die Formen mit Aluminium ausgossen – nicht selten Reproduktionen von Schlagringen, die dann für einen Dollar das Stück verkauft wurden, wahlweise mit rundgeschliffenen oder scharfkantig belassenen Konturen. Krauser zog es vor, derartige Dinge nicht zu sehen, ebenso schaute er weg, wenn die Tyrannen der Klasse andere Schüler drangsalierten. Und es war nicht so, dass er aus Angst darüber hinwegsah. Ich glaube, im Grunde seines Wesens war Krauser einer von ihnen. Er liebte es, sich an schmächtige Kids heranzuschleichen, seine Finger in ihre Oberarme zu bohren und Sprüche à la »Kriegst wohl zu Hause nichts zu essen, was?« vom Stapel zu lassen.
Wenn so etwas geschah, fand Saber stets Wege, um sich für die Opfer zu revanchieren und Krauser bloßzustellen. Es kam vor, dass er Sachen sagte wie: »Was soll ich mit diesem Pinsel hier machen, Mr. Krauser? Während Sie für kleine Jungs waren, hat Kyle Firestone dem armen Jimmy McDougal gesagt, er soll die Hände in die Hosentaschen stecken, und ihm dann den Pinsel in den Mund geschoben. Schauen Sie sich doch nur mal diese Sauerei an, alles voll mit Spucke. Wollen Sie den Pinsel haben, oder soll ich ihn auswaschen?«
An diesem Vormittag war alles anders. Anstatt Saber zu beobachten, schaute Mr. Krauser durch die offene Tür zu einem 1941er Ford mit grauer Grundierung, der gerade am Baseballfeld gehalten hatte. Vier junge Männer stiegen aus und strichen sich die Haare zurück. Sie trugen Drapes und spitz zulaufende Schuhe. Sie lehnten sich gegen die Kotflügel und Scheinwerfer des Wagens und zündeten sich Zigaretten an, obwohl sie sich auf Schulgelände befanden. Krauser drehte den Kopf und schaute über die Schulter zu mir. »Komm mal her, Broussard.«
Ich legte mein Halbjahresprojekt zur Seite, einen Zahnradabzieher, den ich gerade an der elektrisch betriebenen Drahtbürste polierte. »Ja, Sir?«
Krauser hatte eine breite Oberlippe, weit auseinanderstehende Augen, einen anmaßend starrenden Blick, lange Koteletten und eine starke Körperbehaarung, die schwarz unter seinen Hemdsärmeln hervorquoll. Seine Gesichtszüge schienen stets sonderbar gedrungen oder gequetscht, als würde er permanent ein unsichtbares Gewicht auf seinem Kopf tragen. Sobald man ihn anblickte, wollte man nur noch wegschauen, hatte aber gleichzeitig Angst, er würde dadurch ahnen, was man für ihn empfand.
»Hab gehört, du hattest ein kleines Abenteuer in den Heights?«
»Ich? Nein.«
»Kennst du diese Brüder da draußen?«
Ich schüttelte den Kopf und bemühte mich um einen neutralen Gesichtsausdruck.
»Mit denen legt man sich besser nicht an«, sagte er.
»Ich will keinen Ärger, Mr. Krauser.«
»Dachte ich mir schon.«
»Wie meinen Sie das, Sir?«
Seine Augen musterten mich von Kopf bis Fuß. »Hast du in letzter Zeit etwas Arbeit in deinen Körper gesteckt?«
»Na ja, ich habe zwei Jobs. Einen im Supermarkt und einen an der Tankstelle.«
»Das ist keine Antwort auf meine Frage, aber egal. Steck dein Hemd in die Hose, und komm mit.«
»Was haben Sie vor?«
»Ich zeig dir jetzt mal, wie man mit solchen Situationen umgeht. Die Kerle glauben, du hättest in ihrem Pussy-Revier gewildert. Dämliche Aktion, Broussard.«
»Woher wissen Sie, dass ich in den Heights war?«
»Hab’s in der ersten Stunde gehört. Glaub mir, ich kenne solche Typen. Es gibt nur einen Weg, um denen beizukommen, mein Sohn. Wenn du einen faulen Zahn im Mund hast, dann musst du ihn rausziehen.«
»Ich will gar nicht, dass Sie etwas wegen der Sache unternehmen, Sir.«
»Hat hier irgendjemand gesagt, dass du eine Wahl hast?«
Ich wusste nicht, was Krauser vorhatte, und traute ihm eigentlich nicht über den Weg. Gerechtigkeit interessierte ihn nicht die Bohne. Ich konnte ihn atmen hören, konnte das Testosteron riechen, das in seine Kleidung eingebügelt schien. Wir gingen zum Baseballfeld hinüber. Als wir dort ankamen, war mir übel, und ich sah kleine Punkte vor meinen Augen herumschwirren.
»Was treibt ihr Brüder hier?«, sagte Krauser.
Der Größte der Gruppe, der Bursche, der mich vor Valeries Haus angesprochen hatte, strich sich mit beiden Händen die Haare zurück, als wären Krauser und ich gar nicht anwesend. Er trug graue Drapes mit einem schwarzen Ledergürtel und ein lilafarbenes Hemd aus Kunstseide mit langen Ärmeln. Er erinnerte mich an Chet Baker, den Jazztrompeter: Er hatte die gleichen hohlen Wangen und dunklen Augen, dazu einen Gesichtsausdruck, der nicht unbedingt aggressiv, sondern eher wie der eines Menschen aussah, der die Unabwendbarkeit des Todes akzeptiert hatte. Eine eigenartige Ausstrahlung für einen Burschen, der aller Wahrscheinlichkeit nach nicht älter als neunzehn war.
»Was mit den Ohren?«, sagte Krauser.
»Gibt’s ’ne Regel dagegen, dass man hier eine raucht?«, sagte der groß gewachsene Greaser.
»Direkt hinter dir steht ein Schild mit dem Hinweis ›Herumlungern verboten‹«, sagte Krauser.
»Da ist doch ’ne Polizeistation auf der anderen Straßenseite, oder? Gehen Sie rüber, und sagen Sie denen, Loren Nichols ist hier. Und dann richten Sie den Herren und Damen aus, dass sie mich mal am Arsch lecken können. Sie können übrigens dasselbe tun.«
»Du bist doch der Typ, der in einem Drive-in auf einen Mann geschossen hat.«
»Mit ’ner Luftdruckpistole. Der Kerl hat meiner Schwester bei einem Picknick der Junior-Highschool unters Kleid gefasst. Aber ich schätze mal, das stand nicht in den Zeitungen, oder?«
Ich hörte die Pausenklingel, und die Schüler strömten aus den Klassenräumen in die Gänge und auf den Schulhof. Bislang hatten mich weder Loren Nichols noch seine Freunde auch nur angeschaut, und ich glaubte fast, die Unterhaltung wäre gleich vorüber, sodass ich mit Saber in die Cafeteria gehen und all die dummen Dinge vergessen könnte, die seit Samstagabend geschehen waren. Vielleicht gäbe es ja sogar die Möglichkeit, mit Loren Nichols Frieden zu schließen. Eins musste ich ihm lassen: Er war ein eindrucksvoller Bursche. Der Moment schien wie ein Zwischenspiel im allgemeinen zeitlichen Ablauf; ein Augenblick, in dem sich die Geschichte sowohl zum Guten als auch zum Schlechten wenden konnte.
Mr. Krauser legte seine Hand auf meine Schulter. Ich hatte das Gefühl, ein Eiszapfen würde auf der Haut meines Brustkorbs hinabgleiten. »Mein junger Freund Aaron hier hat mir erzählt, wie ihr Typen ihn behandelt habt«, sagte er. »Und jetzt taucht ihr hier auf, um ihn noch ein bisschen mehr zu ärgern, nicht wahr? Was meint ihr, sollen wir deswegen unternehmen?«
Loren schaute von Krauser zu mir und stellte den Kopf schräg. »Ich schlage vor, wir kaufen ihm ein Kleidchen. Ist doch wirklich ein süßer Bursche.«
»Die Schüler unserer Schule respektieren die Autorität der Lehrerschaft«, sagte Krauser. »Und deshalb melden sie Kerle wie euch, anstatt sich auf euer Niveau herunterzulassen.«
»Ich habe nichts und niemanden gemeldet. Das ist eine gottverdammte Lüge«, sagte ich. Der Schweiß brannte mir in den Augen, und das Licht der Sonne schien in Millionen kleiner Nadeln zu zersplittern. »Sagen Sie denen, dass es nicht stimmt, Mr. Krauser.«
»Ihr lasst Aaron ab jetzt zufrieden, klar?«, sagte Krauser stattdessen. »Ich will nicht noch einmal hören, dass ihr ihn belästigt. Und von Saber Bledsoe lasst ihr gefälligst auch die Finger.«
»Ist ’ne richtige kleine Hosenscheißer-Farm, in der Sie hier unterrichten.«
»Treib’s nicht zu weit, Boy, sonst reiß ich dir die Eier vom Stamm und wickle sie dir um den Hals«, sagte Krauser.
Loren stellte einen Fuß auf die Stoßstange, kratzte sich an der Innenseite seines Oberschenkels und schaute zur Schule. »Hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ziemlich starke Truppe, die Sie in dem Laden hier versammelt haben. Auf der anderen Straßenseite beginnt River Oaks, nicht wahr? Wird wohl besser sein, wir machen uns wieder auf den Weg in unseren Teil der Stadt.«
»Gute Idee, Boy. Sei auch in Zukunft ein cleverer Bursche, und lass Aaron und Saber zufrieden«, sagte Krauser.
Die Greaser stiegen in den Wagen und fuhren davon. Vom Asphalt hallte das Dröhnen ihrer Doppelauspuffanlage wider. Vor Scham, Übelkeit und Angst zitterten mir die Knie. Krauser legte seine Hand auf meine Schulter und drückte zu. Er massierte sie regelrecht und schraubte seine Finger wie einen Zahnarztbohrer in die Nervenstränge hinein. »Gott sei Dank, mein Kleiner, jetzt bist du sicher. Sabers Freunden helfe ich immer gern. Sag mir Bescheid, wenn ich noch etwas für euch tun kann.«
Er nahm die Hand von meiner Schulter und ließ mich auf dem Rasen stehen wie einen Holzpfeiler. Ich konnte nichts mehr hören, kein einziges Geräusch, nicht mal das Rasseln der Kette an dem Fahnenmast neben dem Baseballfeld.
»Diesen Schwanzlutscher krieg ich dran«, schimpfte Saber auf dem Heimweg. Mit einer Literflasche Jax zwischen den Beinen saß er am Steuer seines Chevy.
»Welchen Schwanzlutscher?«, fragte ich.
»Krauser, wen denn sonst? Ich werde ein paar Gefallen einfordern müssen, aber das wird schon. Ich kenne da nämlich einen Kerl, der ist ein Meister in Sachen Foto-Observierung. Ich wette, Krauser ist ein Sexmonster. Ich werde ihn erwischen, wie er ’ne Politesse durchrammelt oder Schafe vögelt oder so was, und dann mache ich tausend Abzüge und lasse sie von einem Flugzeug über der Schule abwerfen.«
Ich schaute stur geradeaus und sagte kein Wort. Ich spürte immer noch Krausers Finger, wie sie sich in meine Schulter bohrten und nach einer schwachen Stelle suchten.
»Nimm dir das ja nicht so zu Herzen«, sagte Saber. »Oh mein Gott, wie ich diesen Scheißkerl hasse. Du bist ein verdammt aufrichtiger Kerl, Aaron, hörst du? Du hast Krauser einen Lügner genannt! In der ganzen Schule gibt es niemanden, der die Eier dafür hätte. Ich wette, der Kerl macht heute Nacht kein Auge zu. Du hast ihn bloßgestellt, und zwar vor den Greaser-Ärschen! Außerdem bist du ein Musiker, Aaron. Was ist denn Krauser bitte schön? Ein Nichts.«
»Die glauben jetzt aber, dass ich ein Verräter bin.«
»Ach, scheiß auf die Typen. Du bist ein verdammtes Vorbild für Kerle wie mich, Aaron«, sagte Saber. »Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Sache stinkt. Loren Nichols hat in Gatesville gesessen. Typen mit so einer Akte fangen keinen Ärger in diesem Teil der Stadt an, außer sie sind scharf drauf, ein paar Jahre als staatlich geprüfte Baumwollpflücker auf einer Gefängnisfarm abzureißen.«
»Ich bin in sein Revier eingedrungen.«
»Na und? Das machen die Jungs von der Müllabfuhr jeden Tag. Glaub mir, da steckt irgendwas Größeres dahinter. Aber Krauser soll ja aufpassen. Er hat nämlich einen schlafenden Riesen geweckt – die Armee von Bledsoe.«
»Er will dich in die Sache hineinziehen, Sabe.«
»Und das hat er auch geschafft.«
An der nächsten roten Ampelkreuzung legte Saber den Kopf in den Nacken, nahm einen Schluck aus der Flasche und begann mit dem Bier zu gurgeln, während er gleichzeitig den Motor im Leerlauf aufheulen ließ, ohne sich auch nur einen Deut um die ungläubig starrenden Blicke aus den anderen Autos zu kümmern.
Mein Vater hatte ein kleines Büro im hinteren Teil des Hauses, in dem ein Sekretär mit Bücherregal stand. Es war ein Erbstück von seinem Vater; einem Anwalt, den Franklin Roosevelt in Louisiana zum Leiter einer für staatliche Großbauprojekte verantwortlichen Behörde namens Public Works Administration ernannt hatte und zudem einer der wenigen Männer mit der notwendigen Courage, um gegen Huey Long bei dessen Amtsenthebungsverfahren auszusagen. Mein Vater arbeitete seit Jahren an einer Familiengeschichte, bei der er besonders das Leben seines Großvaters beleuchten wollte, der als junger Konföderierten-Leutnant den Shenandoah-Feldzug von Generalmajor »Stonewall« Jackson mitgemacht hatte.
Eine Schreibmaschine benutzte er dazu nie. Stattdessen schrieb er Seite um Seite mit der Hand, manchmal bis spät in die Nacht hinein, und rauchte dabei Zigaretten, deren Reste am nächsten Morgen im Toilettenbecken schwammen. In seinen Regalen standen Kisten voll mit Briefen, die von unterschiedlichen Schlachten berichteten – Manassas und Fredericksburg, Cross Keys und Malvern Hill, Chantilly, Chancellorsville und Gettysburg. Einige stammten aus dem Gefangenenlager für Konföderierte auf Johnson’s Island in Ohio. Die Tragödie meines Vaters betraf fast alle Mitglieder seiner Familie. Ihr Oberhaupt war ein großzügiger und ehrlicher Mann gewesen und aus ebenjenem Grunde verarmt und zu Beginn des Zweiten Weltkriegs als Almosenempfänger gestorben. Seine Familie war überzeugt davon, dass ihre vornehme und von Privilegien bestimmte Welt mit ihm untergegangen war, und so begannen sie zu trinken und tauschten die Gegenwart gegen die Vergangenheit ein, bis ihnen das eigene Leben entglitten war.
Ich ging in das Büro meines Vaters und setzte mich auf einen Stuhl. Er schrieb mit einem dicken, alten Füllfederhalter, aus dem Tinte leckte. Eine glimmende Zigarette lag in einer Mulde seines Aschenbechers, eine Thermoskanne mit Kaffee stand auf dem Schreibtisch, das Fenster war einen Spaltbreit offen, damit der Deckenventilator die Abendluft ins Zimmer sog. Der Himmel war von purpurnen, lilafarbenen und schwarzen Wolken durchzogen, die wie die Abgasfahnen eines Hochofens aussahen. Ich könnte wahrscheinlich eine ganze Menge über die Texte meines Vaters sagen, aber die einprägsamsten Wörter, die er je zu Papier brachte, fanden sich in einem einzelnen Satz auf der ersten Seite seines Manuskripts: »Nie zuvor in der Menschheitsgeschichte haben derart viele gute Männer so ehrenhaft für eine dermaßen schmachvolle Sache gekämpft.«
»Na, wie geht’s, mein Junge?«, sagte er.
Es war ein seltener Moment. Er war gut aufgelegt und roch nicht nach Alkohol. Ich zog mir einen Stuhl an seinen Schreibtisch heran.
»Ich habe ein Problem«, sagte ich.
»So schlimm wird es schon nicht sein, oder?«
»Ich bin mit ein paar Typen aus den Heights aneinandergeraten.«
»Versuch doch bitte, nicht ständig ›Typen‹ zu sagen, Aaron.«
»Das sind aber keine Jungs mehr, Daddy.«