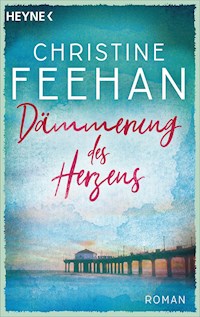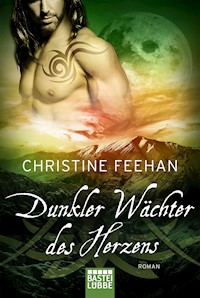
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Karpatianer
- Sprache: Deutsch
Als Vampirjäger den Karpatianer Andor fast töten, bekommt er Hilfe von einer jungen Frau, die er sofort als seine Seelengefährtin erkennt. Doch Lorraine, die gerade ihre Familie verloren hat, ist emotional verschlossen und misstrauisch. Es bedarf mehr als einer telepathischen Verbindung, um sie von der magischen Einheit ihrer Seelen zu überzeugen. Dann erweckt sie auch noch das Interesse eines Meister-Vampirs, und Andor muss gegen einen mächtigen Gegner antreten, um für die Liebe zu kämpfen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumDie Karpatianer IDie Karpatianer IIAndere Karpatianische GefährtenKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20DANKSAGUNGÜber dieses Buch
Als Vampirjäger den Karpatianer Andor fast töten, bekommt er Hilfe von einer jungen Frau, die er sofort als seine Seelengefährtin erkennt. Doch Lorraine, die gerade ihre Familie verloren hat, ist emotional verschlossen und misstrauisch. Es bedarf mehr als einer telepathischen Verbindung, um sie von der magischen Einheit ihrer Seelen zu überzeugen. Dann erweckt sie auch noch das Interesse eines Meister-Vampirs, und Andor muss gegen einen mächtigen Gegner antreten, um für die Liebe zu kämpfen ...
Über die Autorin
Christine Feehan lebt gemeinsam mit ihrem Mann und ihren elf Kindern in Kalifornien. Sie schreibt seit ihrer frühesten Kindheit. Ihre Romane stürmen regelmäßig die amerikanischen Bestsellerlisten, und sie wurde in den USA bereits mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet. Auch in Deutschland erfreut sich die Autorin einer stetig wachsenden Fangemeinde.
CHRISTINE FEEHAN
Dunkler Wächterdes Herzens
Roman
Aus dem amerikanischen Englischvon Anita Nirschl
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2018 by Christine Feehan
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Dark Sentinel«
Originalverlag: Berkley Books
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with The Berkley Publishing Group, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anne Schünemann, Lektorat am Meer
Titelillustration: © Kiuikson/Getty Images; MoiseevVladislav/Getty Images; Nerthuz/Getty Images; Auxins/Getty Images Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-7827-6
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Die Karpatianer I
Die Karpatianer II
Andere Karpatianische Gefährten
Für Martha Nylander,meine Mädelsabend-Komplizin.Wir haben so viele lustige Erinnerungen mit den anderen,hoffentlich werden es noch viele mehr!
Kapitel 1
Andor Katona kam sich wie ein Feigling vor, weil er darüber nachdachte, einfach zu sterben. Er war nie der Überzeugung gewesen, dass es ein edler Akt war, im Freien auf die Morgendämmerung zu warten, damit die Sonne ihn verbrennen konnte. Er – und sehr wenige andere – hatten das immer für einen Akt der Feigheit gehalten. Und doch war er nun hier und dachte darüber nach, ob er sich erlauben sollte zu sterben oder nicht. Die Sonne war noch nicht nah, aber die Wunden, die er sich im Kampf gegen so viele Vampire gleichzeitig zugezogen hatte, hatten ihn geschwächt.
Wegen des Blutverlusts und mehrerer nahezu tödlicher Verletzungen hatte er seinen Körper abgestreift, um zu versuchen, diese Wunden mit seinem Geist zu heilen, und während sein Körper als leere Hülle zurückgeblieben war, hatten menschliche Vampirjäger ihn angegriffen, die ihn nicht als Jäger erkannt hatten. Der Pflock, der nur knapp sein Herz verfehlt hatte, fühlte sich nicht gerade gut an. Sie waren wirklich nicht besonders geschickt bei ihrer selbst ernannten Aufgabe vorgegangen. Sie hatten seine Brust aufgerissen, wodurch sich noch mehr Blut auf das Schlachtfeld ergoss. Er hätte nie gedacht, dass er einmal in einem Land fern der Heimat sterben würde, getötet von einem Trio stümperhafter Menschen, aber der Tod schien wie eine gute Alternative zu einem Leben unablässigen Kämpfens in endloser grauer Leere.
Die drei Männer, Carter, Barnaby und Shorty, steckten ein Stück von ihm entfernt die Köpfe zusammen und warfen ihm ängstliche und hasserfüllte Blicke zu. Sie versuchten, sich einzureden, dass sie es richtig gemacht hatten und er im Sterben lag. Natürlich hatten sie erwartet, dass sein Tod sofort eintreten würde, und nun fragten sie sich, warum dies nicht geschehen war und was sie diesbezüglich unternehmen sollten. Er hätte ihnen sagen können, dass sie einen weiteren Pflock und eine deutlich bessere Pfähltechnik benötigten, um ihn hinzurichten. Musste er wirklich andere darin unterweisen, wie man ihn tötete? Das war lächerlich.
Seufzend versuchte er, die Vor- und Nachteile des Sterbens abzuwägen, um eine rationale Entscheidung zu treffen. Er lebte schon zu lange. Viel zu lange. Er hatte zu oft getötet – so oft, dass nur noch wenig von seiner Seele übrig war. Er hatte ehrenhaft gelebt, aber es musste auch einen Zeitpunkt geben, an dem man ehrenhaft loslassen konnte. Seine Zeit war vorüber. Das wusste er seit gut über einem Jahrhundert. Er hatte die ganze Welt nach seiner Seelengefährtin abgesucht, der Frau, die die andere Hälfte seiner Seele beherbergte, dem Licht seiner Dunkelheit. Sie existierte nicht. So einfach war das. Sie existierte nicht.
Männliche Karpatianer verloren nach zweihundert Jahren alle Emotionen und die Fähigkeit, Farben zu sehen. Manche verloren sie schon früher. Sie mussten von Erinnerungen zehren, und nach so vielen Jahrhunderten verblassten selbst die. Sie behielten ihre Kampffertigkeiten, schärften sie jede Nacht, aber im Lauf der Zeit, in all diesen langen, endlosen Jahren, verblassten selbst die Erinnerungen an Familie und Freunde. Er verbrachte sein Leben meist fern von Menschen und arbeitete nachts, um sie zu schützen.
Vampire waren Karpatianer, die ihre Ehre aufgegeben hatten, um wieder etwas zu fühlen. Man empfand einen Rausch, wenn man tötete, während man sich nährte. Mit Adrenalin versetztes Blut konnte ein starkes Hochgefühl erzeugen. Vampire verzehrten sich danach, und sie terrorisierten ihre Opfer, bevor sie sie töteten. Andor hatte sie auf nahezu jedem Kontinent gejagt. Während die Jahrhunderte kamen und gingen, nahm das verlockende Flüstern, sich zu verwandeln, zu. Ein paar Hundert Jahre lang hatte dieses Flüstern ihn aufrechterhalten, obwohl er wusste, dass es nur ein leeres Versprechen war. Irgendwann hatte ihn sogar das verlassen. Seitdem lebte er in einer grauen Welt aus … nichts.
Er war dem Kloster hoch in den entlegenen Karpaten beigetreten, einem Ort, an dem sich eine Handvoll uralter Jäger vor der Welt verborgen hatten, weil sie sich für zu gefährlich hielten, um zu jagen und zu töten, aber nicht daran glaubten, sich der Dämmerung auszuliefern. Mit jedem Tod durch seine Hand stieg die Gefahr, sich zu verwandeln, und er lebte schon zu lange, wusste zu viel, um ein Vampir zu werden. Nur wenige Jäger würden je in der Lage sein, ihn zu besiegen, und dennoch war er nun hier, beinahe erledigt von einem Trio unfähiger, stümperhafter menschlicher Mörder.
Zusammen mit den anderen Alten hatte er den Schwur geleistet, ehrenhaft auf seine Seelengefährtin zu warten. Natürlich hatte es die Situation nicht verbessert, dass sie sich an einen geheimen Ort zurückgezogen hatten, an dem es keine Hoffnung für sie gab, die eine Frau zu finden, die ihrem Leben Farbe und Emotionen zurückbringen konnte – aber das hatten sie gewusst. Sie hatten die Realität akzeptiert: Ihre Frauen weilten nicht mehr in derselben Welt mit ihnen.
Das Geflüster seiner Möchtegern-Mörder wurde lästig. Wirklich lästig. Ihm schwindelte, was das Denken erschwerte. Auf dem Rücken liegend blickte er hinauf zum Himmel. Sterne leuchteten, aber sie wirkten wie verschwommene Punkte, nichts weiter. Ihr Licht war ein trübes Grau, genau wie der Mond. Dann schaute er hinunter auf das Blut, das eine Pfütze um ihn bildete. Es sickerte aus mehr als einem Dutzend Wunden aus seinem Körper – den Pflock nicht mitgezählt. Das Blut trug einen dunkleren Grauton. Eine hässliche Schweinerei. Wie war er hierhergekommen, so fern seiner Heimat und dem Kloster, in das er sich begeben hatte, um dem Nichts, das ihn umschloss, zu widerstreben?
Hoffnung hatte die Mönche erfasst, und sie waren aufgebrochen, um erneut nach den Frauen zu suchen, die vielleicht ihre Seelen retten konnten. Als sie erkannten, dass die Welt zu verändert, zu riesig war, sie erneut nicht hineinpassten und es nur wenig Hoffnung gab, hatten sie dem Ruf ihres Mönchsbruders geantwortet und waren ihm in die Vereinigten Staaten gefolgt. Die Vampire waren mächtig geworden, und die Karpatianer standen weit zurück, was die Sitten und Gebräuche der neuen Welt betraf. Es war mühsam gewesen, all das Wissen aufzuholen, obwohl es ihm früher immer leichtgefallen war, neuere, modernere Dinge zu erlernen. Das hatte ihn zu diesem Moment geführt – zu der Überlegung, dass seine Zeit vorüber war.
Alles war anders. Er war gezwungen, in unmittelbarer Nähe der Menschen zu leben und zu verbergen, wer und was er war. Die Frauen waren anders. Sie waren nicht länger damit zufrieden, einen Mann zu haben, der für sie sorgte. Er hatte keine Ahnung, wie er mit einer modernen Frau umgehen sollte. Über sein Dahinscheiden zu sinnieren erschien so viel weiser, als zu versuchen, eine Frau der heutigen Zeit zu verstehen.
Das Denken fiel ihm schwer, doch die Nacht war wunderschön. Die drei Männer beratschlagten flüsternd weiter und warfen nervöse Blicke in seine Richtung. Er wollte, dass sie still waren, und überlegte kurz, sie zum Schweigen zu bringen, damit er weiter nachdenken konnte, aber endlich dämmerte es ihnen, dass sie sich vielleicht ein bisschen besser mit Anatomie hätten vertraut machen sollen, bevor sie dieses Metier für sich wählten.
Am Ende zog Carter den Kürzeren. Die anderen schickten ihn herüber, um herauszufinden, was schiefgelaufen war. Er zitterte am ganzen Körper, als er näher kam, eindeutig voller Angst vor dem Mann, den sie zu ermorden versucht hatten. Schweiß strömte aus seinen Poren, und er wischte ihn mit dem Handrücken fort, als er sich über Andor beugte. Er verströmte den Gestank von Fanatismus, sein Gesicht verzerrt zu einer Maske aus Hass und Entschlossenheit. Andor war noch nicht vollends bereit, sich bezüglich seines Todes zu entscheiden. Er hob die Hand, um den Mann mit einem heftigen Luftstoß rückwärtsfliegen zu lassen. In diesem Moment stürmte eine Frau aus der Dunkelheit und griff an.
Der Vollmond warf sein Licht auf den Ort des Kampfes, doch von den Vampiren, die er getötet hatte, war nichts mehr zu sehen, da er sie ordnungsgemäß beseitigt hatte. Er würde so schnell keine Minute Frieden finden, nicht einmal mit einem Pflock, der aus ihm herausragte, und seinem Blut überall, nicht mit seiner vermeintlichen Retterin in Gestalt eines kleinen, wütenden Wirbelwinds, der seine drei Möchtegern-Mörder attackierte. Er würde sie retten müssen. Das bedeutete, weiterzuleben. Es gefiel ihm nicht, dass ihm die Entscheidung abgenommen wurde.
Sie bewegte sich mit unglaublicher Geschwindigkeit, ein Racheengel mit langem, fliegendem Haar und Wanderstiefeln, die knirschend über Steine, Erde und das von Blitzen versengte Gras unter ihren Füßen trommelten. Sie prügelte mit etwas auf Carter ein, das eine Stielkasserolle zu sein schien, dann wirbelte sie wie ein Tornado herum und stürzte sich erneut auf den Mann. Sie tauchte unter seinem Hieb hindurch und blockte ihn mit einem Arm ab – es hörte sich nach einem heftigen Treffer an, als sie ihn mit dem Topf mitten ins Gesicht schlug. Carter taumelte rückwärts und ging zu Boden.
Andor schloss kurz die Augen, weil er glaubte, womöglich eine Illusion zu sehen. Welche Frau würde drei Männer mit einer Stielkasserolle angreifen, wenn die gerade jemanden gepfählt hatten. Erneut seufzte er und dachte daran, wie viel Blut er verlieren würde, wenn er sich aufsetzen und den Pflock herausreißen würde. Das würde ein ordentliches Loch in seiner Brust hinterlassen. Andererseits könnte er ihn auch stecken lassen …
»Beweg dich ja nicht!«, zischte sie, ohne ihn anzusehen, aber sie streckte eine schlanke Hand hinter sich aus, die Handfläche ihm zugewandt, als universelles Zeichen, sich nicht zu bewegen.
Er wurde reglos. Völlig reglos. Wie erstarrt. Seine Lunge fühlte sich wund an, brannte vor Atemlosigkeit. Das war unmöglich. Es konnte nicht sein. Mehr als tausend Jahre. Eine endlose Leere. Seine Augen schmerzten so sehr, dass er sie schließen musste, eine gefährliche Sache, wenn sie ganz sicher angegriffen werden würde.
Die anderen beiden Männer besaßen nicht Carters Mut und hatten sich vorsorglich in sichere Entfernung zurückgezogen, während Carter einen neuen Anlauf startete, die Situation unter Kontrolle zu bringen – in anderen Worten: Er versuchte erneut, Andor zu töten. Seine beiden Begleiter wollten zwar nichts mit dem großen Mann auf dem Boden zu tun haben, aber eine mit einer Stielkasserolle bewaffnete Frau war etwas völlig anderes. Sie hatten sich aufgeteilt und waren in einem Bogen von beiden Seiten an sie herangeschlichen, während sie damit beschäftigt war, Carter mit dem Kochtopf zu verprügeln.
»Was stimmt nicht mit euch Leuten?« Wütend unterstrich sie jedes Wort mit einem weiteren Schlag mit dem Kochtopf. »Seid ihr verrückt? Das ist ein menschliches Wesen, das ihr da umbringen wollt.«
Andor hatte in einer Lache seines eigenen Blutes gelegen und über den Tod nachgedacht, umgeben von einer grauen Welt. Alles war grau gewesen oder in Schattierungen dieser tristen Farbe getaucht. Der Boden. Das Blut. Die Bäume. Der Mond über ihm. Sogar seine drei Möchtegern-Mörder. Er hatte keine echte Emotion empfunden, war distanziert und völlig unberührt von dem gewesen, was mit ihm geschah. Doch seine Welt veränderte sich innerhalb eines einzigen Augenblicks. Seine brennenden Augen, seine Lunge, die sich weigerte, seinen Befehlen zu gehorchen. Er konnte kaum begreifen, was geschah.
Farbe explodierte hinter seinen Augen. Leuchtend. Strahlend. Schrecklich. Obwohl es Nacht war, konnte er das Grün der Bäume und Sträucher sehen, in unterschiedlichen Schattierungen. Sein Blut erschien rot, in einem leuchtenden Scharlachton. Er erkannte Farben an den drei Männern, Blautöne und echtes Schwarz. Der Mond fing die Frau mit seinem Licht ein und erhellte sie mit seinen Strahlen.
Andor stockte der Atem. Ihr Haar hatte die Farbe von Kastanien, Dunkelbraun mit rötlichen und goldenen Reflexen, die die dichte Pracht im Mondschein leuchten ließen. Ihre Augen waren groß und sehr grün, und sie hatte einen Mund, von dem er besessen werden könnte, obwohl er in seiner ganzen, sehr langen Existenz noch nie von irgendetwas besessen gewesen war.
Die lebhaften Farben wirkten in seinem ohnehin geschwächten Zustand äußerst verwirrend. Sein Magen zog sich zusammen. Er fühlte sich schwindelig. Er musste sich aufsetzen. Sie beschützen. Die Farben blitzten durch seinen Verstand, vermischten sich wirbelnd zu lautlosem Chaos. Gleichzeitig strömten Emotionen auf ihn ein, Gefühle, die er nicht schnell genug sortieren konnte, um sie zu begreifen oder zu verarbeiten.
Carter duckte sich zu Boden, als Shorty nach der Frau griff. Sie wirbelte herum und briet dem Mann eins über. »Habt ihr irgendeine Ahnung, wie schwer es für mich ist, zu meditieren, wenn ihr jemanden umbringt?« Sie funkelte Andor über ihre Schulter hinweg an. »Und du. Liegst da und überlegst, ob du genug vom Leben hast oder nicht? Was stimmt nicht mit dir? Man muss das Leben wertschätzen. Nicht wegwerfen.«
Shorty wagte einen weiteren fehlgeleiteten Versuch, sie zu schlagen. Sie traf seine Hand so hart mit dem Kochtopf, dass selbst Andor bei dem Geräusch zusammenzuckte. Aufheulend wich Shorty zurück, um die Frau argwöhnisch zu mustern.
»Ich bin auf der Suche nach persönlicher Erleuchtung, und ihr stört meine Aura der Liebe.« Die Stielkasserolle traf Barnaby heftig genug an der Schulter, dass er schützend die Arme vor den Kopf riss und sich wegdrehte, um einem weiteren Schlag auszuweichen. Er hatte den Fehler gemacht, sich von der anderen Seite an sie heranzuschleichen.
»Ich bin auf einem Pfad der Gewaltlosigkeit, damit mein Leben der Welt ein Beispiel sein kann, wie es wäre, an einem besseren Ort zu leben. Frieden …« Sie schlug den Topf gegen Barnabys Schläfe, als er sie erneut angriff, und trat ihm dann hart genug gegen das Knie, um ihn zu Boden gehen zu lassen. »Liebe.« Sie wandte sich zu Shorty um und kam drohend auf ihn zu. »Einklang mit der Natur.«
Grinsend sah Shorty sie an und schüttelte den Kopf. »Du bist eine Irre.«
»Vielleicht, aber du bist ein Mörder.« Sie wich einem Schlag aus, blockte ihn geschmeidig durch einen Hieb mit dem Kochtopf auf seinen Arm ab und boxte ihn in den Kiefer. Hart.
Andor konnte sehen, wie Shortys Kopf zurückflog. Sie konnte ganz schön zuschlagen, aber er würde etwas unternehmen müssen, bevor das mörderische Pack Ernst machte und seiner Frau etwas antat. Er zwang seinen Körper, sich zu bewegen. Das war nicht leicht mit einem Pflock, der aus seiner Brust ragte, direkt unter seinem Herzen. Als er sich bewegte, trat frisches Blut um das Holz herum hervor. Es tat höllisch weh. Er musste seine Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, abschalten, wenn er sich tatsächlich bewegen wollte.
»Nicht«, zischte sie ihm zu, ein deutlicher Befehl. Verärgert.
In seinem ganzen Leben hatte niemand je einen solchen Ton ihm gegenüber angeschlagen. Er gab die Befehle, nicht eine Frau, und ganz gewiss nicht ein Mensch. Schlimmer noch – eine menschliche Frau.
»Wag es ja nicht, dich zu bewegen. Ich kümmere mich gleich um dich.« Sie wandte den Kopf, um ihn über ihre Schulter hinweg anzusehen, und ihre Augen weiteten sich entsetzt. »Oh. Mein. Gott.« Ihre Stielkasserolle sank herab, und sie drehte sich halb zu ihm um.
Er machte eine Handbewegung in Richtung Shorty, der sich rasch hinter ihr näherte. Shorty stolperte und fiel beinahe vor ihre Füße, was ihre Aufmerksamkeit auf ihn lenkte. Sie zog dem Mann den Kochtopf über den Schädel. Dann wurde sie zu einer kleinen Furie und stürzte sich wieder auf Barnaby.
»Warum tut ihr das einem anderen menschlichen Wesen an?« In ihrer Stimme lag ein kleines Schluchzen, als bereite ihr allein der grausame Anblick des Pflocks in Andors Brust ebenfalls Schmerzen. »Ich soll lernen, ohne Wut zu leben, und ihr foltert und ermordet brutal einen anderen Menschen. Wie könnte ich damit einverstanden sein? Wenn das eine Art Test ist, dann falle ich durch. Ihr sorgt dafür, dass ich durchfalle.« Heftig trat sie Barnaby gegen die Brust. Ihr Vorwärtskick war kräftig und ließ den Angreifer so weit rückwärtsfliegen, dass er gegen einen Baum prallte und zu Boden rutschte.
»Er ist kein Mensch!«, schrie Carter. »Das ist ein Vampir!«
Wie angewurzelt hielt sie inne. »Ihr seid doch alle verrückt. Er ist ein Mensch.« Zum ersten Mal wirkte sie vorsichtiger.
Vielleicht wurde ihr endlich bewusst, dass sie mitten in der Wildnis war, mit drei Fremden, die einen anderen gepfählt hatten. Das konnte Andor nur hoffen.
»So etwas wie Vampire gibt es nicht.«
Die drei Männer kamen unsicher auf die Füße und schwärmten dann aus, um sie zu umzingeln. »Wir haben ihn gesehen. Er hat Blitze herabgerufen. Schau dir die versengten Stellen im Gras an«, sagte Carter.
»Sie haben recht damit, dass es solche Kreaturen wie Vampire gibt«, erklärte Andor ruhig. Es gelang ihm, sich ganz aufzusetzen, dabei stützte er den Pflock mit beiden Händen. Er war schwächer, als er gedacht hatte. Vielleicht würde er aus dieser Sache wirklich nicht lebend rauskommen. Er hatte viel zu viel Blut verloren. »Aber sie irren sich auch. Ich bin kein Vampir. Ich habe die Vampire gejagt. Die Menschen haben nur das Ende des Kampfes gesehen.« Er hatte keine Ahnung, warum er sich die Mühe machte, es zu erklären. In seinem ganzen Leben hatte er noch nie eine Erklärung für sein Handeln abgegeben.
»Hör nicht auf ihn«, sagte Shorty. »Halt dir die Ohren zu. Vampire können dich betören.«
»Mich betören?« Sie klang, als hielte sie Shorty für wahnsinnig. Ihr Blick wanderte zu Andor, und sie erblasste. »Um Gottes willen, leg dich sofort wieder hin.«
Ihre Haut leuchtete wunderschön im Mondlicht. Andor sah ihr in die Augen und griff nach dem dicken Pflock, der ihm aus der Brust ragte. Ihre Augen weiteten sich. Sie schüttelte den Kopf, ließ die Stielkasserolle fallen und lief zu ihm.
»Nein. Zieh den nicht raus.«
Shorty versuchte, sie zu packen, als sie an ihm vorbeirannte. Der Gedanke, dass einer dieser Männer Hand an sie legte, weckte etwas in Andor, von dem er nicht gewusst hatte, dass es in ihm lauerte. Es brach aus ihm heraus, ein Brüllen purer Wut. Tief und bedrohlich wallte es mit der Wucht eines Vulkans aus seinem Innern hervor, um alles in seinem Weg zu vernichten.
»Rührt sie nicht an.« Es war eine Anordnung. Ein Befehl. Nichts weniger.
Alle drei Männer erstarrten. Sie schaffte es an ihnen vorbei und fiel neben ihm auf die Knie, das Gesicht voll Besorgnis, als sie den Pflock berührte.
»Nicht bewegen.« Sie sprang wieder hoch, zog ein Handy aus ihrer Jeans und versuchte fieberhaft, es zum Funktionieren zu bringen. Immer wieder hielt sie den Arm in die Luft, wedelte mit dem Telefon herum und bewegte sich von einer Stelle zur anderen.
»Was machst du da?«
»Ich muss nur einen einzigen Balken kriegen. Nur einen einzigen. Wir sind hier in diesem Tal, und ich bekomme kein Netz, um Hilfe zu rufen.« Sie drängte sich an Shorty vorbei und blieb dann stehen. Wie erstarrt. Sehr langsam drehte sie den Kopf, um den Mann anzusehen. Er bewegte sich nicht. Er stand da, einen Arm ausgestreckt, schaute aber in die andere Richtung. Nicht zu ihr. »Ähm.« Langsam wich sie vor Shorty zurück. »Was stimmt nicht mit dir?« Sie sah die anderen beiden Männer an. Keiner von ihnen blinzelte auch nur. Sie wich noch weiter zurück. »Irgendetwas stimmt nicht mit ihnen.« Sehr langsam drehte sie sich zu Andor um.
Er konnte ihre Angst riechen. Ihr dämmerte, dass kein menschliches Wesen mit einem so großen Pflock wie dem in seiner Brust überleben konnte. Und jetzt konnten sich die Männer, die behauptet hatten, er wäre ein Vampir, nicht mehr bewegen. Sie sahen wie aus Stein gemeißelte Statuen aus. Er überlegte kurz, sie so zurückzulassen, aber das würde in der Menschenwelt Fragen aufwerfen, und das konnte er nicht riskieren. Nicht jetzt, da sich ein richtiger Krieg zwischen Vampiren und Karpatianern zusammenzubrauen schien. Darüber hinaus brauchte er Blut, wenn er diesmal überleben wollte, und die drei konnten es ihm liefern. Jetzt musste er überleben. Es gab keine andere Wahl.
»Ich brauche deine Hilfe«, sagte er leise.
Sie schüttelte den Kopf, machte aber mehrere Schritte auf ihn zu. »Ich komme nicht gut mit Blut klar. Ich muss jemanden anrufen …« Diesmal war ihre Stimme schwach.
»Dazu ist keine Zeit. Wenn du nicht tust, worum ich dich bitte, dann werde ich sterben, und du wirst dein Leben umsonst riskiert haben. Danke übrigens dafür.« Er blieb sehr ruhig, in der Hoffnung, dass sie seinem Beispiel folgen würde.
»Wenn ich sage, dass ich nicht gut mit Blut klarkomme, dann meine ich damit, ich könnte in Ohnmacht fallen.«
»Ich kümmere mich um das Blut. Mach du nur, was ich dir sage, dann stehen wir das hier durch.«
Sie schaute zu den drei zu Statuen erstarrten Männern und wieder zurück zu ihm. Dann fiel ihr Blick auf das sich sammelnde Blut. »Du hast mehr Verletzungen als nur den Pflock.«
»Ich habe es dir schon gesagt: Bevor du gekommen bist, war ich in einen Kampf verwickelt.« Mit den Händen bedeckte er die klaffende Wunde an seinem Bauch, weil er der Frau ansah, dass sie tatsächlich in Ohnmacht fallen könnte. Doch so blieb ihm keine andere Wahl, als sich wieder hinzulegen. Möge die Sonne seine Schwäche verbrennen!
Sie hatte jetzt Angst, das konnte er in ihrem Gesichtsausdruck sehen und in ihrem Geist spüren. Er gab sein Bestes, sie daran zu hindern, seine Gedanken zu lesen. Sie war eindeutig telepathisch veranlagt. Sie wusste, dass er darüber nachgedacht hatte, seinem Leben ein Ende zu setzen, und das wüsste sie nicht, wenn sie nicht seine Gedanken gelesen hätte. Sie aus seinem Geist herauszuhalten kostete Mühe.
»Okay.« Verhalten kam sie auf ihn zu, die Stielkasserolle wie eine Waffe erhoben. »Das war kein Scherz, als ich sagte, dass ich mit Blut nicht gut klarkomme.«
Zum ersten Mal nahm er eine Spur von Scham in ihrem Tonfall wahr. Von Schuldgefühlen. Das gefiel ihm nicht. Sie gefiel ihm verärgert. Sie gefiel ihm kämpfend. Sie gefiel ihm selbstsicher. Dieser Missklang brachte seine Eingeweide dazu, sich zusammenzukrampfen, und weckte in ihm das Bedürfnis, sie an sich zu ziehen und zu trösten. Außerdem wurde es immer schwieriger, den Schmerz in seiner Brust auszublenden. Er wollte den Pflock packen und herausziehen, aber dafür musste sie alles für ihn vorbereiten.
»Du wirst meine Wunden mit frischer Erde füllen müssen. Sie darf nicht verbrannt sein. Wenn versengte Stellen auf dem Boden oder dem Gras zu sehen sind, darfst du sie nicht verwenden.« Er schloss die Augen. Er konnte spüren, wie sich Blutstropfen auf seiner Stirn sammelten und über sein Gesicht liefen. Wenn sie das aus der Nähe sah, könnte sie tatsächlich in Ohnmacht fallen, und dann hatte er niemanden, der ihm half. Es war zu spät, einen Ruf auszusenden.
»Wie heißt du?« Wenn er schon sterben musste, wollte er wenigstens den Namen der Frau wissen, die gekommen war, um ihn zu retten.
»Lorraine. Lorraine Peters.« Er hörte sie tief Luft holen. So nah war sie ihm. »Und du wirst nicht sterben. Wir können das schaffen. Bist du dir mit der Erde sicher?« Sie schaufelte bereits Erdbrocken in ihre Stielkasserolle. »Das ist sehr unhygienisch.«
»Mein Körper reagiert auf das Erdreich. Auf die Erde. Sobald du genug hast, bring sie zu mir.« Er wollte ihr Gesicht sehen, aber er befürchtete, wenn er die Augen öffnete und sie ansah, würde sie das Letzte sein, das er sah. Er würde dieses Bild mit ins nächste Leben nehmen, anstatt die Zeit mit ihr zu genießen, nachdem er so viele Jahrhunderte auf sie gewartet hatte.
Sie zuckte heftig zusammen, und Andor wurde bewusst, dass er abschweifte. Sie könnte einige seiner Gedanken aufgefangen haben.
»Ich dämmere immer wieder weg und habe merkwürdige Träume. Ich glaube, diese Männer haben mir seltsame Gedanken in den Kopf gesetzt.« Das war das Beste, das er tun konnte, und es schien zu funktionieren. Sie atmete wieder. Nicht gleichmäßig, aber dennoch, er hatte sie noch nicht verloren. Er bemühte sich, die Luft weiter in seine Lunge ein- und wieder ausströmen zu lassen.
»Es tut mir leid, dass ich so ein Baby bin, was das Blut angeht.« Sie kniete sich neben ihn. »Ich verstehe nur nicht, wie ich dir eine Hilfe sein kann. Dieser Pflock –« Sie brach ab. In ihrer Stimme lagen Tränen. Kummer.
Sie machte sich keine Sorgen, dass er ein Vampir sein könnte. Sie dachte nicht an die drei Männer, die reglos wie Statuen hinter ihr standen. Sie dachte, dass sie als Mensch völlig versagte, weil sie das Blut nicht ansehen konnte, das um den Pflock herum aus seinem Körper sickerte und aus der Vielzahl von Wunden tropfte, die er nicht heilen konnte.
»Bring die Erde dicht zu mir heran. Ich muss sie mit Speichel mischen.« Er hoffte, dass sie davon so fasziniert sein würde, dass sie das Blut vergaß. Allmählich erfasste ihn ein Gefühl von Dringlichkeit. Er drohte, das Bewusstsein zu verlieren. Zu hoher Blutverlust.
»Ähm …«
»Andor. Mein Name ist Andor Katona.«
»Du hast so viel Blut verloren. Du brauchst eine Transfusion.«
Sie fing immer noch Gedankenfetzen auf, war sich dessen aber nicht bewusst. Er musste vorsichtig sein, aber das war unmöglich, wenn er sich am Leben erhalten wollte. Normalerweise würde er die Erde öffnen, seinen Körper ruhigstellen und versuchen, sich von der Erde heilen zu lassen, aber es stand zu schlimm um ihn. Besorgnis erfasste Andor. Nachdem er jahrhundertelang nach seiner Frau gesucht und sie endlich gefunden hatte, schwand er nun Stück für Stück dahin, oder Liter um Liter durch den Blutverlust.
»Ich kann draufspucken«, bot sie an, mit einem Zögern in der Stimme, als würde sie ihn für einen Wahnsinnigen halten und ihm einfach nur einen Gefallen tun, weil sie sicher war, dass er sterben würde. Allmählich fing er an, das selbst für möglich zu halten.
»Lass mich es tun.« Er wusste nicht, ob ihr Speichel mächtig genug war, um bei der Heilung zu helfen. Seiner enthielt sowohl einen heilenden als auch einen betäubenden Wirkstoff.
Er nahm eine Handvoll Erde, mischte sie mit seinem Speichel und drückte sie auf eine der klaffenden Wunden in seinem Bauch, wo ein Vampir versucht hatte, ihn auszuweiden. Nun, da sie etwas zu tun hatte, außer bei seinem blutüberströmten Anblick in Ohnmacht zu fallen, konzentrierte sie sich darauf, ihm beim Verarzten seiner Wunden zu helfen.
Andor schloss die Augen und versuchte, seine Kräfte zu schonen. Als uralter Jäger hatte er gewaltige Macht und eine eiserne Beherrschung angesammelt. Er hätte nie gedacht, dass drei Menschen – noch dazu keine besonders cleveren – ihn zu Fall bringen könnten.
»Nicht«, befahl sie flüsternd. »Sag mir, was ich als Nächstes tun soll.«
»Ich brauche Blut. Ich habe zu viel verloren. Verteile die Erde um den Pflock herum. Ich kann ihn erst herausziehen, sobald ich eine Transfusion bekommen habe.«
»Ich werde dir mein Blut geben«, sagte sie mit zitternder Stimme. »Aber ich habe Angst, dass ich wirklich ohnmächtig werde. Sag mir einfach, was ich tun soll.«
Er war ausgehungert. Jede Zelle seines Körpers verzehrte sich nach Blut. War es sicher, ihr Blut zu nehmen? Er würde aufhören müssen, bevor er zu viel von ihr nahm, und er wusste nicht, ob er noch diese Art von Beherrschung besaß. Er musste sich auf sie verlassen. Wenn sie schwach war, konnte sie ihm nicht helfen. Andererseits, wenn er einen der Männer aus dem erstarrten Zustand freigab, würde er stärker sein müssen, um ihn unter Kontrolle zu halten.
Er konnte spüren, wie zwei seiner Zähne spitz wurden. Länger. Er atmete tief ein und hielt den Kopf von ihr abgewandt. »Ich kann dir hindurchhelfen, wenn du mich lässt. Ich besitze ebenfalls die telepathische Gabe. Du weißt, dass wir Schutzschilde haben, Barrieren in unserem Geist sozusagen. Vertrau mir genug, um es mich leichter für dich machen zu lassen. Ich habe nicht mehr viel Zeit.«
Es folgte kurzes Schweigen. Er hob die Lider gerade weit genug, um zu sehen, wie sie mit kleinen weißen Zähnen an ihrer vollen Unterlippe nagte. Sie nickte. »Ja. Aber beeil dich. Mir ist schon ein bisschen schwindlig. Ich versuche, nicht hinzusehen, aber das ist fast unmöglich. Und meine Hände sind voller –«
»Ich kümmere mich darum.« Sofort streckte er sich nach ihrem Geist aus. Es hatte keinen Sinn zu warten. Entweder ließ sie ihre Schutzschilde fallen, und er würde überleben, oder sie tat es nicht, und er würde es nicht schaffen.
Er griff nach ihrer Hand, und allein diese Bewegung ließ Schmerz durch ihn hindurchschießen und die Luft mit einem brutalen Stoß aus seiner Lunge entweichen. Ihre Haut war weich, wie Seide. Sein Daumen strich über die Stelle, an der ihr Puls so hektisch pochte. Sie hatte Angst vor ihm. Davor, ihm ihr Blut zu geben. Davor, in Ohnmacht zu fallen und sich zu blamieren. Ihre Phobie vor Blut bewirkte, dass sie sich schwach und töricht fühlte. Sie verabscheute sie und bemühte sich sehr angestrengt, sie zu überwinden.
Er zwang sich, damit aufzuhören, ihre Gedanken zu lesen, und brachte den Rest seiner Kraft auf, um vollständig die Kontrolle über ihren Geist zu übernehmen. Er hatte großes Glück, dass sie ihre Schutzschilde fallen ließ und ihm ihr Vertrauen schenkte, obwohl er es sich noch nicht verdient hatte. Er tauchte nicht tiefer in ihren Geist ein, um herauszufinden, was sie dazu bewog, sondern senkte seine Zähne in ihr Handgelenk.
Ihr Blut sprudelte in seinen Mund wie Perlen feinsten Champagners. Nichts hatte je so erlesen geschmeckt. So perfekt. Er wusste, dass er immer süchtig nach ihrem Geschmack sein würde, sich immer danach verzehren würde. Er kostete jeden Tropfen aus, spürte, wie seine Zellen die Stärkung in sich aufnahmen, verzweifelt das Verlorene ersetzen wollten.
Zum ersten Mal, seit Andor sich erinnern konnte, musste er um seine Disziplin kämpfen. Um Beherrschung. Er wollte nicht aufhören. Er wollte nie wieder aufhören. Er sehnte sich verzweifelt nach Blut. Ihrem Blut. Sehr sanft strich er mit der Zunge über die zwei kleinen Löcher in ihrem Handgelenk und wandte dann den Kopf zu den drei Möchtegern-Mördern um.
Shorty erwachte zum Leben, Zentimeter für Zentimeter. Sein Körper zuckte, dann trat er einen Schritt auf den Karpatianer zu. Entsetzen stand dem Mann ins Gesicht geschrieben. Andor ignorierte es. Er wollte seine Kräfte nicht darauf verschwenden, den Mann zu beruhigen, schließlich hatte er dabei geholfen, Andor einen Pflock in die Brust zu stoßen.
In dem Moment, in dem Shorty ihn erreichte und gehorsam niederkniete, versenkte Andor tief die Zähne in seinen dargebotenen Hals. Das Blut war gut. Nicht durch Alkohol oder Drogen verunreinigt. Er nahm so viel, wie er riskieren konnte, dann schickte er den Mann zurück zu seinem Zeltplatz, nachdem er ihm die Erinnerung gelöscht hatte. Stattdessen pflanzte er ihm Bilder einer Begegnung mit wilden Tieren ein, etwas, das ihm definitiv Angst einflößen und ihm genug Unbehagen bereiten würde, um sein Lager abzubrechen und den Weg nach Hause anzutreten.
Als Nächstes holte er Barnaby dicht zu sich heran und wies ihn an, sich neben ihn zu knien und den Pflock mit beiden Händen zu packen. Andor nahm die restliche Erde, mischte sie mit seinem Speichel, holte tief Luft und befahl dem Menschen, den Pflock herauszuziehen. Nichts in seinem langen Leben hatte ihm je solche Schmerzen bereitet wie dieser Pflock, als er ihm in die Brust gestoßen worden war. Es tat beinahe genauso sehr weh, als er wieder herausgezogen wurde.
Blut quoll hervor, und Andor stopfte die Erde tief in das klaffende Loch. Knirschend biss er die Zähne zusammen, um sich davon abzuhalten, den hilflosen Mann zu schlagen. Noch mehr Blut trat aus der Wunde und sickerte in die Erde. Einen Moment lang konnte er nicht mehr atmen. Oder denken. Er lag einfach nur nach Luft ringend da, sah Lorraines schönes Gesicht an und sagte sich, dass sie alles wert war, was er erduldet hatte, einschließlich dieser Tortur.
Sein Schwur an sie war in seinen Rücken geritzt, auf die alte, primitive Weise eintätowiert, geschrieben mit der von den Mönchen im Kloster gefertigten Tinte. Bei jedem Stich von einer der vielen Nadeln mussten absichtlich Narben auf der Haut hinterlassen werden. Der Schwur in karpatianischer Sprache verlief über seinen ganzen Rücken. Er hatte jedes einzelne Wort ernst gemeint.
Olen wäkeva kuntankért. Olen wäkeva pita belső kulymet. Olen wäkeva – félért ku vigyázak. Hängemért.
Er hatte noch andere Tattoos, aber keines davon bedeutete ihm so viel. Der Kodex, nach dem er lebte, war für immer als Narbe in seinen Rücken graviert. Er war Karpatianer, und es brauchte viel, um eine Narbe zu hinterlassen. Er hatte gelitten, um diese Worte in seine Haut schreiben zu lassen, aber sie mussten dort stehen – für sie. Der Kodex war einfach.
Stark bleiben für unser Volk. Stark bleiben, um den inneren Dämon zurückzuhalten. Stark bleiben für sie. Nur sie.
Diese letzten beiden Worte seines Kodex – seines Schwurs – sagten alles. Jede Wunde, die er im Kampf erlitten hatte, jedes Mal, wenn er einen alten Freund oder Verwandten hatte töten müssen, jede Nacht, in der er sich erhoben und die graue Leere ertragen hatte, war für sie. Jetzt kannte er ihren Namen. Lorraine. Er liebte den Klang dieser Silben. Er liebte, wie sie aussah und wie viel Biss sie hatte. Sie besaß Mut, auch wenn sie ihn mit ein wenig Weisheit mäßigen musste.
Während er Barnabys Blut trank, dachte er an das Kloster und diese langen, endlosen Jahre ohne Hoffnung. Sie hatten die Nächte damit verbracht, an ihren Kampfkünsten zu feilen und dann an ihren Tätowiertechniken zu arbeiten. All jene, die im Kloster gelebt hatten, waren Brüder geworden – obwohl sie gewusst hatten, dass sie die anderen eines Tages vielleicht töten mussten. Der Unterschied lag darin, dass es ein ehrenhafter Tod wäre.
Er schickte Barnaby mit derselben Erinnerung an wilde Tiere, die zu dicht an ihren Zeltplatz herangeschlichen waren, fort und gab den drei Männern ein, dass sie alle in verschiedene Richtungen davongelaufen waren und nun einer nach dem anderen wieder zum Lager zurückkehrten, mit dem Gedanken, es rasch abzubrechen und sich auf den Heimweg zu machen. Sie waren nicht länger darauf aus, Vampire zu jagen und zu töten, und glaubten auch nicht mehr an sie.
Da er ein wenig zu Kräften gekommen war, befahl er Carter – demjenigen, der ihm den Pflock in die Brust gestoßen hatte –, ein Loch in die Erde zu graben. Andor wusste, dass er sich noch nicht aus eigener Kraft bewegen konnte. Er war außerdem zu schwer, als dass Lorraine ihm helfen konnte, aus der Sonne zu kommen. Er musste in die Erde, musste Lorraine ein Zelt direkt über ihm errichten lassen.
Ohne Werkzeug konnte Carter nicht besonders tief graben. Er benutzte Lorraines Stielkasserolle, um direkt neben Andor eine flache Vertiefung zu scharren, damit der Karpatianer sein Gewicht weit genug verlagern konnte, um hineinzurutschen. Die flache Grube war nicht tiefer als dreißig Zentimeter, aber lang und breit genug für seinen Körper, was schon etwas heißen musste. Er war kein kleiner Mann.
Nachdem er Carter gezwungen hatte, ihm zu helfen, trank er von seinem Blut und schickte ihn dann mit derselben Erinnerung wie Barnaby und Shorty seines Weges. Das war das Beste, was er tun konnte. Schon durch diese kleine Bewegung sickerte erneut Blut aus seinen Wunden. Er brauchte Zeit, um sich vom Erdreich regenerieren zu lassen und ausreichend Kraft für seine Heilung zu sammeln. Karpatianer, die so alt waren wie er, besaßen eine unglaubliche Stärke. Er konnte das hier überstehen, er brauchte nur etwas Glück auf seiner Seite und Lorraine.
Er gab ihren Geist frei, und sie sah ihn verwirrt blinzelnd an. Sie kniete immer noch auf dem Boden, nur lag er jetzt etwa dreißig Zentimeter von ihr entfernt in der flachen Grube. Er hätte Barnaby tiefer graben lassen sollen, aber die Zeit konnte er sich nicht leisten. Er versuchte, sie anzulächeln, um sie zu beruhigen, doch schon allein sie anzusehen schmerzte beinahe ebenso sehr wie das Loch in seiner Brust.
An ihr wirkten die Farben sogar noch lebhafter. Ihr Haar schimmerte im Mondlicht, eine wunderschöne Mischung verschiedener Nuancen. Ihre Haut war beinahe durchscheinend, so blass war sie. Er wusste, das kam daher, dass er ihr Blut genommen hatte.
»Fühlst du dich gut?«
Sie blinzelte mehrmals, was seine Aufmerksamkeit auf den Schwung ihrer dichten, langen Wimpern lenkte. »Wo ist der Pflock? Wie hast du ihn rausgekriegt?« Auf Knien rutschte sie dichter zu ihm und stieß ein kleines feminines Keuchen aus, das etwas tief in seinem Innern berührte, als sie das mit Erde gefüllte Loch in seiner Brust sah. Es war kein kleines Loch. Es war auch kein kleiner Pflock gewesen.
»Ich wollte nicht, dass du dich damit befassen musst. Aber ich brauche deine Hilfe. Ich bin schwach. Wirklich schwach.«
Ihr Blick glitt an ihm vorbei, dann drehte sie sich schnell um, eindeutig, um nach den drei Männern zu suchen.
»Sie sind fort. Weggelaufen.«
»Feiglinge. Aber ich bin froh, dass sie weg sind. Trotzdem, mir war es lieber, als ich sie im Auge hatte, denn jetzt muss ich mir Sorgen machen, dass sie zurückkommen könnten, um uns zu töten.«
»Sie sind weggerannt, und ich habe ihnen ein Szenario eingegeben, dank dessen sie sich nicht einmal an uns erinnern werden.«
»Du bist ein außerordentlich starker Telepath«, bemerkte sie. »Und ich kann nicht glauben, dass du immer noch lebst, aber wir müssen Hilfe rufen. Einen Hubschrauber, der dich von hier wegbringt. Ich werde rauf zum Gipfel des Berges wandern müssen, um zu sehen, ob ich dort Handyempfang bekomme.«
Er schüttelte den Kopf. »Hast du ein Zelt in deinem Lager?«
»Natürlich.« Ihre Finger strichen über die Stoppeln auf seinem Gesicht. Sie runzelte leicht die Stirn, während sie an etwas an seinem Kiefer rieb, entschlossen, es zu entfernen. Er war sich sicher, dass es sich um einen Blutfleck handelte. Ihr Blick mied geflissentlich jede andere Stelle seines Körpers, an der Blut aus seinen Wunden ausgetreten war und nasse rote Flecken hinterlassen hatte.
»Wie lange wirst du brauchen, dein Lager abzubrechen und alles hierherzubringen?«
Stirnrunzelnd sah sie ihn an. »Nicht lange. Ich campe oft. Aber ernsthaft, Andor, ich bin nicht gut darin, mich um Verletzte zu kümmern, und du scheinst nicht zu begreifen, wie schlimm es um dich steht. Wir brauchen einen Hubschrauber.«
»Mein Körper spricht auf gewöhnliche Medizin nicht an.«
»Spricht er auf einen Chirurgen an, der Löcher wieder zusammenflickt? Dieser Schnitt in deinem Bauch war entsetzlich. Und dieser Pflock –« Sie brach ab und wurde sogar noch blasser, wenn das überhaupt möglich war.
»Nein, ich habe es dir doch schon gesagt, obwohl du angestrengt versuchst, mich zu vermenschlichen. Ich jage Vampire. Mein Körper ist anders aufgebaut. Ich weiß, du dachtest, ich würde sterben, und hast mir deshalb den Gefallen getan, meine Wunden mit Erde zu behandeln, aber das Erdreich hat wirklich heilende Eigenschaften.« Hol ihn die Sonne, war er erschöpft. »Bitte. Ich bitte dich um deine Hilfe. Hol deine Sachen, und komm wieder her. Sonst werden mich wilde Tiere finden, und ich bin wehrlos.«
Sie betrachtete ihn mit einem kleinen Stirnrunzeln. »An die Tiere habe ich gar nicht gedacht, aber du hast recht. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll.« Sie ließ sich zurück auf die Fersen sinken. »Wenn ich dich hier zurücklasse, um den Berg hinaufzuwandern, könntest du tatsächlich in Gefahr sein. Aber wenn ich bleibe, ernsthaft, Andor, dann könntest du sterben. Du solltest eigentlich schon tot sein.«
Er entwickelte wirklich eine Schwäche für dieses Stirnrunzeln, oder vielleicht war ihm auch nur schwindlig von den Schmerzen. Diese unter Kontrolle zu halten wurde schwierig, trotz der Blutspende. Er verlor immer noch viel zu viel Blut, und im Moment war Blut das Wichtigste für ihn. Er hatte darauf geachtet, die drei Vampirjäger nicht zu sehr zu schwächen, weil er wollte, dass sie aus der Gegend verschwanden.
»Beeil dich einfach und hol deine Campingausrüstung.«
»Der Blutgeruch wird wilde Tiere anlocken. Es gibt Bären und Kojoten in diesen Bergen. Soweit ich weiß, könnte es auch Wölfe geben, aber das halte ich für unwahrscheinlich. Ich kann dich nicht allein lassen.«
»Das musst du. Wir brauchen dein Zelt. Ich darf nicht in der Sonne sein. Nicht einmal für ein paar Minuten. Du musst mich tagsüber mit deinem Zelt und der Erde schützen. Ich werde schlafen und hoffen, dass das Erdreich den Heilungsprozess in Gang setzt.« Es würde ein langer Prozess werden bei dieser Geschwindigkeit.
Er merkte sofort, dass er gewonnen hatte. Ihre Miene wechselte von Sorge und Zögern zu Entschlossenheit. »Es wird ungefähr zwanzig Minuten dauern. Mein Lager ist nicht weit von hier, aber es ist ein kleiner Geländemarsch.« Sie war bereits aufgesprungen, voller Tatendrang, nun, da sie einen Plan hatten.
»Lorraine, danke, dass du keine Fragen stellst oder widersprichst.«
»Was würde das nützen? Ich kann dich nicht zurücklassen, und ich kann von hier unten im Tal aus niemanden erreichen. Du wirst entweder überleben oder sterben, und du bist der stärkste Mann, der mir je begegnet ist, also wette ich darauf, dass du überleben wirst.«
Er hoffte, dass sie recht behielt. Im Moment fühlte er sich nicht sehr stark. Genau genommen wollte er einfach nur die Augen schließen und sich ein Weilchen der Nacht überlassen. Sich einfach nur ein paar Minuten geben, in denen er nicht die Schmerzen ausblenden musste. Es kostete so viel Kraft. Er versuchte, den stetigen Blutverlust zu verlangsamen. Sobald sie mit dem Zelt zurück war und alles aufgestellt hatte, konnte er mehr von ihrem Blut nehmen, aber er brauchte sie fit, nicht schwach.
»Ich werde Wasser brauchen«, erinnerte er sie, als sie sich zum Gehen wandte.
»Ich habe genug dabei, und ein Bach fließt nicht allzu weit von hier. Ich habe ein Wasserfiltersystem.« Sie machte einen Schritt rückwärts, dabei wanderte ihr Blick zum ersten Mal, seit Andor in ihrem Geist gewesen war, über seinen zerschundenen Körper. Sie schluckte heftig und schüttelte erneut den Kopf. »Ich bin bald zurück, halte durch.«
Andor sah ihr nach, als sie verschwand. Sie schien seine Kraft mit sich zu nehmen. Seine Lunge brannte immer noch vor Atemnot, was ihm verriet, dass er seinen Körper bald abschalten musste. Er hatte zu großen Schaden genommen. Sieben Vampire hatte er im Kampf vernichtet. Zwei davon waren kurz davor gewesen, Meistervampire zu werden. Sie hatten lange genug gelebt, dass er ihnen schon einmal begegnet sein sollte, aber er erinnerte sich selten an die Namen oder die Gesichter der Untoten.
Erschöpft schloss er die Augen. Sie würde zurückkommen, obwohl sie den Anblick von Blut verabscheute. Er hatte den Ekel und die aufsteigende Übelkeit in ihren Gedanken gelesen. Ihr Magen hatte rebelliert, und sie musste gegen den Brechreiz ankämpfen. Sie hatte sich wirklich anstrengen müssen, nicht in Ohnmacht zu fallen. Es war ein Beweis für ihren Mut und ihr Durchhaltevermögen, dass sie bei ihm geblieben war, um ihm zu helfen.
Sie war seine Seelengefährtin. Er wusste, dass sie es war, doch er war so schwer verwundet, dass er es nicht wagte, sie aneinanderzubinden. Demnach konnte sie ihn immer noch im Stich lassen, und dann wäre er gefährlicher denn je. Er konnte nur hoffen, dass er sie richtig eingeschätzt hatte und dass sie alles war, wofür er sie hielt. Sie würde zurückkommen. Das musste sie, wenn er auch nur die geringste Chance besaß zu überleben.
Kapitel 2
Lorraine war absolut sicher, dass sie Andor tot vorfinden würde, wenn sie zu ihm zurückkehrte. Niemand konnte so schreckliche Verletzungen überleben. Das ging einfach nicht. Es war unmöglich. Sie kam sich wie ein Feigling vor, weil sie ihn allein zurückgelassen hatte, um seinen Tod nicht mitansehen zu müssen. In ihrem Leben hatte sie weiß Gott schon genug Blut und Tod gesehen. Sie war sicher, wenn sie zurückkehrte, würde es vorbei und er tot sein.
Zitternd, die Hände vors Gesicht geschlagen, stand sie neben ihrem Zelt. Ihr Magen hob sich. Sie musste tief durchatmen, um sich nicht zu übergeben. All das Blut. Sie hatte den Boden nicht angesehen, nur dieses eine Mal, aber da war die Erde unter und um den Mann herum nass und glitschig vor Blut gewesen. Seine Kleider waren so davon befleckt gewesen, dass sie geglaubt hatte, er trage Rot. An jeder Stelle seines Körpers, auf die ihr Blick gefallen war, hatte er Verletzungen. Und dieser Pflock …
Was war los mit der Welt? Waren die Leute wirklich so gemein und grausam, jemandem einen Pflock in die Brust zu rammen? Das Holz hatte den Umfang eines Besenstiels gehabt. Wie konnte jemand so etwas tatsächlich einem Menschen ins Fleisch stoßen? Ihr Magen hob sich erneut, und sie spürte die vertraute Wut in ihrem Bauch rumoren.
Sie hatte keine Ahnung, wohin die drei Männer verschwunden waren, aber sie war wütend auf sich selbst, dass sie keine Fotos von ihnen gemacht hatte, damit sie sie genau beschreiben und die Fotos der Polizei übergeben konnte. Zudem machte sie sich große Sorgen, dass sie zurückkommen könnten, um sie zu töten, weil sie ihre Gesichter gesehen hatte.
Lorraine zwang sich, sich in Bewegung zu setzen und das Lager abzubrechen. Sie war eine erfahrene Camperin, und obwohl sie auf Autopilot lief, war sie schnell. Ihre Campingausrüstung umfasste nur das Nötigste, weil sie alles in einen einzigen Rucksack packen und überallhin mit sich tragen musste. Sie wanderte durch die Berge, auf einer Selbstfindungsreise – zumindest hatte sie das allen erzählt, denen sie begegnet war. In Wirklichkeit, wenn sie absolut ehrlich zu sich war, wusste sie, dass sie davonlief.
All das Blut. Sie presste eine Hand auf ihre Stirn und schaute zum Gipfel des Berges hoch. Dort oben konnte sie wahrscheinlich Hilfe rufen. Doch wenn sie den Berg hochwanderte, würde es wirklich zu spät sein, und Andor würde allein sterben, wahrscheinlich durch die Zähne und Klauen eines wilden Tieres, anstatt einfach nur zu verbluten. Sie hatte dabei geholfen, Dreck in seine Wunden zu schmieren. Man würde sie wahrscheinlich wegen Mordes anklagen, denn wenn ihn seine Verletzungen nicht umbrachten, dann würden es die Bakterien erledigen.
»Verdammt!«, schrie sie laut. Die Nacht trug den Klang ihrer Stimme zur anderen Seite des Tals. »Einfach verdammt noch mal.« Diese Worte flüsterte sie, weil sie wusste, dass sie den Mann nicht allein sterben lassen würde. Das konnte sie nicht.
Den großen Rucksack geschultert machte sie sich auf den Weg zurück zu ihm. Sie war schon ihr ganzes Leben lang telepathisch veranlagt. Als Kind hatte sie geglaubt, jeder könnte hören, was andere dachten. Als sie merkte, dass dem nicht so war, hatte sie nicht anders als die anderen sein wollen und versucht, ihre Fähigkeit abzustellen. Es war ihr nicht gelungen. Dann hatte es eine Zeit gegeben, in der sie ihre Gabe als ein Geschenk angenommen hatte, als etwas, das sie einsetzen konnte, besonders bei ihren Eltern und ihrem Bruder. Diese Phase hatte auch nicht sehr lange angehalten. Wenn doch nur …
Ihr verschwamm die Sicht. Tränen strömten ihr übers Gesicht, als sie zu Andor zurücklief. Sie hatte geglaubt, alle Tränen geweint zu haben, keine einzige mehr übrig zu haben, aber da waren sie wieder. Wenn sie doch nur nicht fort aufs College gegangen wäre. Wenn ihre Eltern sie doch nur gebeten hätten, nach Hause zu kommen und mit ihrem Bruder zu reden. Wenn Theodore sie doch nur selbst angerufen hätte.
Beinahe wäre sie gestolpert, und das ließ sie wütend die nutzlosen Tränen fortwischen. Sie brachten nichts, ganz gleich, was Trauerberater sagten. Tränen verursachten ihr Kopfschmerzen, aber sie konnte ihre Eltern oder ihren Bruder nicht zurückholen. Sie hielten die Zeitungen und die Klatschpresse nicht davon ab, zu berichten oder Fragen zu stellen. Tränen hielten ihre sogenannten Freunde nicht davon ab, sie auszugrenzen.
Zwischen den Bäumen hindurch bahnte sie sich ihren Weg den Hügel hinunter zu der weitläufigen Wiese, wo Andor auf sie wartete. Sie konnte ihn reglos dort liegen sehen, als wäre er tot. Er lag in einer flachen Vertiefung frisch ausgehobener Erde – wie in einem Grab. Oder einem halben Grab. Vorhin, als sie ihren Kochtopf schwingend auf die Gruppe losgegangen war, um auf den Mann, der sich über Andor gebeugt hatte, einzuprügeln, war ihr nicht aufgefallen, dass sie die Erde ausgehoben hatten. Sie hatten eindeutig vorgehabt, ihn zu begraben. Was, wenn sie Andor gezwungen hatten, die Grube auszuheben, und sie deshalb nur etwa dreißig Zentimeter tief war? Sie hatte von dieser Art sadistischen Verhaltens bei Serienkillern gehört.
Ihre Schritte wurden langsamer. Sie wollte nicht zu ihm gehen und feststellen, dass er tot war. Sie hatte schon genug Leute tot aufgefunden, von hellrotem Blut überströmt. Wer hätte gedacht, dass der menschliche Körper so viel Blut besaß? Oder dass es so klebrig sein konnte und überall hinkam? Einen Moment lang blieb sie stehen, um tief durchzuatmen und sich wieder zu fangen.
Lorraine? Die leise Regung war in ihrem Geist. Ihr Name als sanftes Flüstern. Telepathisch miteinander zu sprechen fühlte sich intim an. Das hatte sie nicht gewusst, weil sie nie ein anderes Wesen gekannt hatte, das ebenfalls diese Gabe besaß. Sie hatte nie auch nur daran gedacht, dass sie ihre Stimme oder ihre Gedanken in den Geist eines anderen drängen konnte.
Ich bin hier. Dann lebst du also noch. Sie wusste nicht, ob das eine Erleichterung war oder nicht. Sie zwang ihre Füße, sich wieder in Bewegung zu setzen, zu ihm zu gehen.
Ich lebe. Gerade noch. Ich brauche Wasser. Ich kann dein Blut so bald noch nicht wieder zu mir nehmen, und ich brauche etwas, um mich am Leben zu erhalten, bis du wieder kräftig genug dafür bist.
Ich habe dir etwas Wasser mitgebracht. Sie beschleunigte ihr Tempo und eilte an seine Seite. Rasch streifte sie ihren Rucksack ab und holte ihre Wasserflasche hervor.
Seine Augen waren eindringlich auf ihr Gesicht geheftet. Noch nie hatte sie Augen gesehen, die indigoblau waren, doch das war die einzige Farbe, die seine Augen beschrieb. Eine Mischung aus Mitternachtsblau und einem dunklen Violett. In der Dunkelheit wirkten seine Haare und seine Augen tintenschwarz, bis sie nah genug bei ihm war. Nach nur einem winzigen Zögern hob sie sanft seinen Kopf an und hielt ihm die Wasserflasche an den Mund. Einen Moment lang glaubte sie, er würde nicht trinken, weil etwas über sein Gesicht huschte, das wie Abscheu aussah, aber dann schien er eine Entscheidung zu treffen und trank.
»Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich war –«
Du dachtest, ich wäre tot, und hattest Angst, zu mir zurückzukommen. In seiner Stimme lag eine Spur von Humor, als sie durch ihren Geist strich.
»Na ja …« Das war nicht zu leugnen, nicht wenn er ihre Gedanken lesen konnte. »Ja. Der Gedanke, dich hier draußen mitten in der Wildnis tot vorzufinden –« Sie brach ab.
Es war schwierig, seinen Kopf hochzuhalten und dabei nicht auf seinen mit Blut und Dreck beschmierten Körper hinunterzusehen.
»Ich hätte keine Erde in deine Wunden schmieren sollen. Ich habe ehrlich nicht geglaubt, dass du eine Überlebenschance hast, aber jetzt bist du nach so langer Zeit noch immer bei Bewusstsein, also habe ich mich vielleicht geirrt. Ich sollte versuchen, die Wunden zu säubern.« Bei der Vorstellung drehte sich ihr erneut der Magen um. »Allerdings bin ich nicht gerade geübt in medizinischer Versorgung. Ich klebe anderen Leuten nicht mal Pflaster auf.«
Ich weiß, das hier ist schwierig für dich.
Bei diesen Worten fühlte sie sich klein. Schuldig. Beschämt. Er war derjenige, der litt. Sie benahm sich wie ein Baby. »Sag mir, was ich tun soll. Ich habe keine Schmerzmittel bei mir.« Sie hatte zwar Aspirin, aber Angst, es ihm zu geben. Es war ein Blutverdünner, wenigstens glaubte sie das, und das Letzte, was er brauchte, war, noch mehr Blut zu verlieren.
»Kannst du dein Zelt um mich herum aufstellen? Über mir, sodass ich darin liege? Ist es groß genug?«
Weil Lorraine weite Strecken wanderte und nicht gewusst hatte, welches Wetter sie erwartete, hatte sie ein Allzweckzelt mitgenommen, das größer als ein schlichtes Einmannzelt war. Es war schwerer, und sie konnte mehrere Regentage darin verbringen und sich darin umherbewegen, wenn sie musste.
»Ja. Ich kann es aufstellen.«
»Die Sonne darf mich auf keinen Fall berühren.« Diese Warnung sprach er laut aus.
Sie legte seinen Kopf wieder auf dem Boden ab und trat von ihm zurück, dabei versuchte sie, nicht über die Bedeutung dieser Worte nachzudenken. Viele Menschen reagierten allergisch auf die Sonne. Seine Haut war weder außergewöhnlich blass, noch hatte sie Anzeichen von Vampirzähnen gesehen. Doch allein die Tatsache, dass er immer noch lebte, nachdem er brutal angegriffen und mit so vielen Verletzungen, die eigentlich tödlich sein sollten, zurückgelassen worden war, ließ sie darüber nachdenken, was die drei Männer ihm vorgeworfen hatten.
Ich werde dir nichts tun, Lorraine. Wieder lag sanfte Belustigung in seinem Tonfall.
Ihr Körper zog sich grundlos zusammen, tief in ihrem Innern, eine rein weibliche Reaktion auf den Klang seiner Stimme, die durch ihren Geist fuhr. Es war wirklich intim, und jeder einzelne Ton fühlte sich an, als streichle er wie Samt über ihre Haut.
Sie antwortete ihm nicht. Stattdessen legte sie die Wasserflasche dicht neben seine Hand und machte sich daran, ihr Zelt auszubreiten. Es war leicht zu errichten, robust und ideal für das Campen in den Bergen geeignet. Beinahe sofort sah sie das Problem. Sie konnte es wegen des Zeltbodens nicht über ihm aufbauen. »Ich muss das Zelt ein Stück von dir entfernt aufstellen und dann eine Möglichkeit finden, dich hineinzuschaffen.«
»Du wirst das Zelt über mir errichten und den Zeltboden herausschneiden müssen.«
Ihr Herz stolperte kurz. »Ich kann den Boden nicht herausschneiden. Dann ist mein Zelt ruiniert. Es war nicht billig, und ich habe noch einen weiten Weg vor mir.«
»Ich repariere es dir wieder.«
Sie sagte nicht, dass er bis zum Morgen tot sein würde, weil das unhöflich gewesen wäre. Stattdessen berührte sie ihr Lieblingscampingmesser, um sich zu vergewissern, dass sie es am Gürtel trug, und fuhr damit fort, das Zelt herzurichten. Sie würde den Boden genau um ihn herum herausschneiden. Das wäre das Dümmste, das sie je getan hatte, aber sie tröstete sich mit dem Gedanken, damit den letzten Wunsch eines Sterbenden zu erfüllen.
In kürzester Zeit war das Zelt aufgestellt, mit einem riesigen Loch im Boden um ihn herum. Sie ließ sich neben ihm auf der Erde nieder. »Ich denke, das müsste reichen. Das Zelt ist sehr schwer und dafür gemacht, Wind, Regen und tiefen Temperaturen zu trotzen. Also sollte es auch die Sonne von deiner Haut fernhalten. Leidest du an einer Allergie?« Sie stieß ein stummes Gebet aus, dass er sie anlügen würde, falls dem nicht so war.
Er brachte ein kleines Lächeln zustande, und ihr zersprang beinahe das Herz. Trotz des Bluts und der Wunden gab er sich tapfer. Er kämpfte, um bei Bewusstsein zu bleiben. Sie konnte sehen, dass es ihn Mühe kostete, aber er schien es für sie zu tun. Am liebsten wollte sie ihm sagen, dass er nicht ihretwegen wach bleiben solle, aber sie fürchtete, wenn er sich erlaubte, der Müdigkeit nachzugeben, würde er im Schlaf sterben, und dann würde sie sich dieses enge Zelt mit einer Leiche teilen.
»Du musst noch mehr Erdreich um mich herum ausheben und mich so gut wie möglich damit bedecken.«
Ihr Herzschlag beschleunigte sich, und sie starrte ihn an, dieses Gesicht mit all seinen Kanten. All dieser schroffen männlichen Rohheit. Er war extrem männlich. Er sah aus, als könnte er ziemlich gefährlich sein, selbst wenn er durch die vielen schrecklichen Verletzungen geschwächt war. Aber er bedrohte sie nicht im Geringsten, ganz im Gegenteil. Er sprach sehr sanft mit ihr, und sie spürte, dass er es nicht gewohnt war.
»Ich werde dich nicht lebendig begraben.« Sie legte Entschlossenheit in ihre Stimme, denn sie ahnte, dass er für gewöhnlich seinen Willen durchsetzte. Die drei Männer hatten gesagt, dass er sie mit seiner Stimme betören konnte, und sie glaubte ihnen. Nicht weil sie dachte, dass er ein Vampir war, sondern weil seine Stimme eine so mächtige Waffe war, dass er sie damit in seinen Bann schlagen konnte. Klangfarbe und Tonlage waren so perfekt, dass sie sich fragte, wie wohl sein Gesang klingen mochte. Ganz gewiss würde er keine Schwierigkeiten haben, ein Publikum zu verzaubern oder zu hypnotisieren.
»Du sollst mich nicht lebendig begraben«, konterte er, »nur meinen Körper mit Erdreich bedecken. Ich habe es dir doch gesagt, die Zusammensetzung meines Körpers erlaubt es der Erde, mich zu heilen. Je mehr natürliche Mineralien, desto schneller heile ich. Dieser Boden ist noch unberührt. Die Erde ist besonders reich an Elementen, die ich brauche.«
Er musste Esoteriker sein. Ein durchgeknallter Esoteriker. Keiner ihrer Freunde, die sich für so etwas interessierten, hatte je erwähnt, dass eine Heilkraft darin läge, sich im Erdreich vergraben zu lassen. Wie weit sollte sie gehen, um einem Sterbenden einen letzten Wunsch zu erfüllen?
»Bitte tu das einfach für mich.«
»Ich habe doch schon mein Zelt für dich zerschnitten«, fuhr sie ihn an und schämte sich dann dafür. Sie presste den Handballen an ihre pochende Schläfe. Höllische Kopfschmerzen hatten sie fest im Griff, aber sie konnte sich nicht darüber beklagen, nicht wenn er mit riesigen Löchern im Leib vor ihr lag.
»Tut mir leid, aber du bittest mich, Dinge zu tun, von denen ich glaube, dass sie dir mehr schaden als helfen werden. Ich will nicht für deinen Tod verantwortlich sein, und das wäre ich. Ich habe Dreck in deine offenen Wunden geschmiert. Wenn du in etwas liegst, das einem flachen Grab gleichkommt, und ich es noch tiefer grabe und du stirbst, dann werden die Behörden denken, ich hätte dich auf schrecklich brutale Weise umgebracht.«
»Lorraine.« Sanft sagte er ihren Namen und wartete dann.
Sie zählte ihre Herzschläge. Spürte die Luft, die durch ihre Lunge ein- und ausströmte. Grillen zirpten. Irgendwo heulte ein Kojote. Er blieb stumm, und der Drang, ihn anzusehen, wuchs, bis sie ihn nicht mehr ertragen konnte. Ihr Blick traf seinen, und das Herz sprang ihr beinahe aus der Brust. Diese Augen waren mindestens so hypnotisierend wie seine Stimme.
»Ich werde nicht sterben. Was macht dich so sicher, dass die Behörden glauben könnten, du wärst fähig, jemanden umzubringen? Du trägst nicht die geringste Spur von Bosheit in dir.«
Sie konnte sich nicht mit ihm auseinandersetzen, nicht mit diesem sanften Blick, nicht mit seinen unschuldigen Fragen. Also nahm sie die Stielkasserolle. Der Topf war ein bisschen verbeult vom Verprügeln der Männer, mit denen sie gekämpft hatte. Entschlossen begann sie, um Andor herum zu graben und das lockere Erdreich auf seinen Körper zu häufen. Es hinderte sie daran, ihn ansehen zu müssen.
»Ich habe ein hitziges Temperament.« Das war ein Geständnis. Ein aufrichtiges. »Aber ich arbeite daran. Ich habe mir ein Jahr Auszeit von der Schule genommen, um in den Bergen zu wandern und, so gut ich kann, im Einklang mit der Natur zu leben, um meine schlimmsten Charakterzüge zu besiegen. Besonders mein hitziges Temperament.«
Andor beobachtete jede ihrer Bewegungen. Sie musste nicht einmal von ihrer Aufgabe hochsehen, um das zu wissen, denn sie spürte den Blick seiner indigoblauen Augen auf sich. Es war wie eine körperliche Berührung. Er hatte etwas so Beschwörendes an sich, dass sie ihm nicht widerstehen konnte. Sie wusste, dass seine Verletzungen ihn eigentlich töten sollten – eine einzige davon reichte schon aus, ganz zu schweigen von allen –, aber ein Teil von ihr glaubte daran, dass er nicht sterben würde.