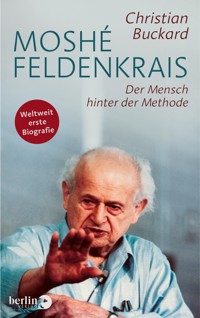19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Weltgeschichte eines Prager Juden Egon Erwin Kisch (1885–1948), Prager Jude, Kommunist und Freund Franz Kafkas und Max Brods, wurde zum Vater der modernen Reportage in deutscher Sprache: Mit einem weinenden und einem lachenden Auge, die brennende Zigarette immer im Mundwinkel, schrieb Kisch über die kleinen Leute in den großen Städten, über das Abenteuer des Alltags und den Alltag in Krieg und Revolution. Das Leben des »rasenden Reporters« aus neuer Perspektive Spannungsreich und mit zahlreichen Fotos illustriert, erzählt Christian Buckard das bewegte Leben des melancholischen »rasenden Reporters«, der in jedem Kaffeehaus der Welt zu Hause schien und doch immer nur von Prag träumte. Zum 75. Todestag des Pioniers der modernen Reportage am 31. März 2023 Stimmen über Egon Erwin Kisch »Ich habe seine Reportagen verschlungen, die meisten auswendig gelernt. Für mich war Egon Erwin Kisch der 'Thomas Mann der Reportage'.« Billy Wilder »Sie sind mit dem Öl des wirklichen Erzählers gesegnet.« Alfred Döblin »Meiner Meinung nach kann man sich mit einem Fünftel Ihres Talents einen Nobelpreis zusammenschmieren, sofern man nichts von Ihrer Gesinnung mitbekommen hat.« Bertolt Brecht
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Für Petra Frisch
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2023
Dieses Werk wurde vermittelt durch Aenne Glienke/Agentur für Autoren und Verlage, www.AenneGlienkeAgentur.de
Abbildungen: Literaturarchiv des Museums der Tschechischen Literatur Prag (Památník Národního Písemnictví)
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: PNP/Památník národního písemnictví (Literaturarchiv)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1. Die Geisterstadt
2. Egonek aus dem Bärenhaus
3. Frühe Abenteuer
4. Eine Jugend in Prag
5. Brechreiz in Berlin
6. Prager Wege zum Ruhm
7. Londoner Streifzüge
8. Kisch lässt eine Bombe platzen
9. Kaffeehaus, vor dem Sturm
10. Weltuntergang
11. Der brave Soldat Kisch
12. Kriegsberichterstatter des Kaisers
13. Weltrevolution in Wien
14. Prager Frühling
15. Kischs Café
16. »Der rasende Reporter«
17. Kisch reist in die Zukunft
18. Kisch goes West
19. In Asien geht die Sonne auf
20. Exil aus Solidarität
21. Australien im Sprung erobert
22. »Ich denke nicht. Stalin denkt für mich«
23. Angst
24. »Mir kann eigentlich nichts passieren«
25. Ein Prager in Mexiko
26. Kommunisten, Zionisten und Indianer
27. Dem Ende entgegen
Epilog
Dank
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1. Die Geisterstadt
»Wir haben die tschechoslowakische Grenze überflogen«, informierte der zweite Pilot der Royal-Air-Force-Maschine seine Passagiere. Es war ein sonniger Märztag im Jahr 1946, und Egon Erwin Kisch konnte weit unten deutlich Felder, Wälder und Straßen erkennen. [1] War dies also der Moment, von dem er im fernen Mexiko seit Jahren geträumt hatte? Nein, noch nicht ganz.
Dieser jahrelang tagtäglich und allnächtlich ersehnte Moment würde erst dann kommen, wenn er endlich wieder zu Hause war. Und zu Hause war er nur in Prag. Nirgendwo sonst. Gleichzeitig wusste Kisch, dass eine Rückkehr in »sein« Prag ja gar nicht möglich war, dass »sein« Prag nicht mehr existierte. Die mörderischen Jahre der deutschen Besatzung hatten aus seiner Heimatstadt, wo der »goldene Egonek« früher kaum einen Schritt gehen konnte, ohne von Freunden, Bekannten oder Fremden herzlich gegrüßt zu werden, eine Geisterstadt gemacht. An seine Prager Freundin Jarmila hatte Kisch im September 1945 geschrieben: »Ich habe Angst davor, wen von meinen Freunden ich in Prag noch sehen werde.« Und: »Danach zu fragen, ob Du weißt, wie meine Brüder endeten, fürchte ich mich geradezu.« [2] »Mehr Angst als Hoffnung« habe er, vertraute Kisch seinem Freund Sinaiberger vor der Rückkehr nach Prag an. [3]
Auf dem Sitz neben Kisch saß Otto Katz. Der alte Freund hatte im Laufe seines geheimnisumwitterten Lebens schon viele Namen getragen. Seit seiner Flucht aus Frankreich nannte er sich »André Simone«. Aber Otto war eigentlich immer noch derselbe elegante junge Mann, als den Kisch ihn vor Jahrzehnten kennengelernt hatte. Mit dem Unterschied, dass er, der in Prag weltberühmte Kisch, sich früher um Otto gekümmert hatte und es nun umgekehrt war. Auch Kischs Frau Gisela, genannt Gisl, die in Wien aufgewachsen war und mit ihm nun in das ihr so fremde Prag reiste, kümmerte sich um ihn. Wie sie es stets tat. Und so würde er nicht alleine sein, wenn jener Moment kommen würde, den er so herbeisehnte und gleichzeitig fürchtete.
»Noch fünfzig Minuten«, sagte Otto Katz. Kisch, der lange geschwiegen hatte, wiederholte leise: »Fünfzig Minuten.« Dann war er wieder stumm. Um drei Minuten später zu sagen: »47 Minuten.« Da mussten sie beide lachen. [4]
Und plötzlich, erinnerte sich Otto Katz später zurück, begann Kisch zu erzählen, »hastig, überstürzt, als fürchtete er, nie wieder Zeit dazu zu haben«. Kisch »sprach wie immer von seinem Leben, vom Leben seiner Zeit, deren Sprachrohr, Sprecher und Porträtist er zeit seines Lebens gewesen war. Er war immer neu und stets derselbe«. [5]
Und dann, endlich, lag sie unter ihnen, genau dort, wo sie immer schon gewesen war, geradeso als hätte sich nichts geändert: die »Stadt und Mutter in Israel« an der Moldau, wie ihre jüdischen Bewohner sie seit Jahrhunderten nannten.
»Prag«, sagte Otto. »Prag, mein Junge«, sagte Kisch. [6]
Mag sein, dass Kisch sich gewünscht hatte, im Augenblick der Heimkehr etwas Zeit für sich alleine zu haben. Und vielleicht verspürte er gleichzeitig Angst, enttäuscht zu werden, dass ihn »seine« Prager vielleicht nicht bereits erwarten, ihn nicht stürmisch begrüßen und feiern würden. Diese Angst, sollte er sie verspürt haben, erwies sich allerdings als unbegründet: Nach der Landung am Prager Flughafen wurden Kisch und seine Begleiter sofort von Freunden, Bekannten und natürlich von jenen umringt, deren ungekrönter König er war – den Reportern. Also schlüpfte Kisch sogleich in die Rolle des »rasenden Reporters« und rief: »Was macht Prag? Stehts noch?« [7] Was die Beliebtheit im Volk angeht, nahm Kisch immer noch eine Sonderstellung ein. Ruth Klinger erinnert sich:
Wenn man sich vergegenwärtigt, was für ein Haß damals in der CSR gegen alles Deutsche herrschte, muß man es besonders hoch einschätzen, dass nirgends eine kritische Äußerung darüber fiel, daß Kisch deutsch dachte und deutsch schrieb, daß es nur Übersetzungen waren, die die Auslagefenster der Buchläden füllten. [8] Außer bei Kisch kommt eine Unterhaltung in deutscher Sprache nirgends in Frage. Der Haß gegen alles, was mit deutsch zusammenhängt, ist abgrundtief. [9]
Dass der deutschsprachige Schriftsteller Kisch ganz offiziell in Prag willkommen geheißen wurde, lag auch an den Machtverhältnissen im Land: In der Koalitionsregierung hatten Kischs Genossen, die aus den Wahlen im Mai 1946 als stärkste Partei hervorgingen, bereits großen Einfluss. Die politische Pluralität wurde allerdings Schritt für Schritt immer mehr zur Fassade in einem Bühnenstück, dessen Regisseur im Kreml saß. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass Edvard Beneš – gegen dessen Mannschaft Kisch früher Fußball gespielt hatte – auch nach den Mai-Wahlen weiterhin Präsident war und Kischs alter Freund Jan Masaryk, der im Volk äußerst populär war, das Amt des Außenministers behalten hatte. Wahrscheinlich ließ sich auch Kisch damals noch von der scheinbaren politischen Pluralität innerhalb der Regierung der nationalen Einheit täuschen. Herz und Kopf waren bei seiner Ankunft ohnehin anderweitig beschäftigt.
»Wir alle«, so schrieb Kisch im April an Hugo Sinaiberger, »wurden hier sehr warm empfangen, die Zeitungen brachten ganzseitige Artikel, und wo immer wir auch auftauchen, gibt es Ovationen.« [10] Im Gespräch mit einem Reporter versuchte Kisch Worte für den bedrückenden Schatten zu finden, der auf seiner Rückkehr nach Prag lag:
Ich habe viele Tote getroffen. Sie stehen vor jedem Haus, sehen aus jedem Fenster. Es sind alte Freunde, Verwandte, Bekannte, die mich anblicken. Sie sind durch den Nazismus gestorben. Es ist ein trauriges Gefühl, auf einen Friedhof zurückzukehren. [11]
Dass Prag ein »Friedhof« geworden sei – dies war offensichtlich nicht das, was der Reporter hören wollte. Wo blieb denn das Positive? Er hakte also nach, wünschte sich von Kisch wohl etwas mehr Begeisterung, wollte den Kommunisten Kisch interviewen, der in ein befreites Land zurückkehrte, das auf dem Wege in die Zukunft, in eine »fortschrittliche« Epoche schien. Und so schwächte Kisch seine düstere Aussage ab, indem er eine leicht spöttische Bemerkung über das »direkt berauschende Tempo« der Stadt machte. [12] Sicher begriff er sehr wohl, dass er als jüdischer Überlebender die verordnete fröhliche Wiederaufbaustimmung im Land stören würde, wenn er zu offen darüber Auskunft gab, wie es in seinem Innern aussah. In seinen Briefen an alte Freunde musste Kisch keine politischen Rücksichten nehmen und deutete das Wechselbad der Emotionen angesichts von frohen Momenten des Wiedersehens und grausamen Nachrichten an:
In Prag trifft sich nun alles, was jahrzehntelang in der Welt zerstreut war, die wenigen, die überlebt haben, oder wenigstens ihre Söhne und Verwandten … Gestern waren wir bei einer Frau Würzburger eingeladen, die mit Elly in Terezin gewohnt hat und auch die Nacht ihres Selbstmordes mit ihr verbrachte. [13] […] Was soll ich Dir schreiben? In Prag leben wohl nur mehr wenige von Deinen Bekannten […]. Leila, die Freundin von Hermann Ungar und später von Camill Hoffmann, der auch im Gas geendet hat, geht jetzt aus Prag nach Amerika. Die schöne Anka Vikova ist als Geisel für Heydrich hingerichtet worden. Von meinen Brüdern sind Paul und Arnold in den Tod geschickt worden. Kaspar, der Arzt, und die zwei Kinder von Arnold leben in London. [14]
Und manchmal überwältigte ihn die Sehnsucht nach den ermordeten Freunden und Verwandten, nach seinem Prag: »Ich fühle mich fast selbst wie einer jener Toten. Und vielleicht bin ich ja nur zurückgekommen, um zu sterben.« [15]
Ein müder Egonek am Grab des Großvaters Jonas Enoch Kisch
Von den nahezu 80 000 durch die Deutschen nach Theresienstadt deportierten tschechischen Juden hatten nur rund 3000 überlebt. [16] Die meisten der 10 000 nun in Prag wohnenden Juden – vor der Besetzung lebten dort rund 55 000 – kamen aus der Slowakei. [17]
Sofort nach seiner Rückkehr »meldete« sich Kisch bei der Prager jüdischen Gemeinde. Seiner Freundin Ruth Klinger erzählte er:
Früher habe ich mich um diesen Prager Sektor wenig gekümmert, aber jetzt habe ich mich ihm vom ersten Tage an zur Verfügung gestellt und bin innerlich in viel stärkerem Maße an jüdischen Problemen interessiert als früher. Mein nächstes, bald in England erscheinendes Buch, heißt: »Über die Ghetti der Welt«. [18]
Egonek spürte wohl, dass man in der jüdischen Gemeinde den ganzen Kisch willkommen hieß und nicht nur den berühmten Kommunisten oder den legendären »rasenden Reporter«.
Eine Woche nach seiner Ankunft in Prag fand im großen Saal des Palais Lucerna, gegenüber dem »Hotel Alcron«, der achte Parteitag der tschechoslowakischen Kommunisten statt. Und Kisch ließ es sich nicht nehmen, die Veranstaltung zu besuchen und der Rede Klement Gottwalds zuzuhören. »Dieser Parteitag«, so teilte er der Parteizeitung Rudé právo mit, sei »der schönste, den ich je auf der Welt gesehen habe«. Für ihn sei dieses Ereignis »Gesang, Musik, Freude über den Sieg.« [19]
Dieses beinahe rührende Bekenntnis enthielt ein fernes Echo des jungen Rebellen Kisch, der 1918 in Wien die »Rote Garde« angeführt hatte, es passte vielleicht auch zu den Parteitagen mexikanischer Genossen. Doch Gottwalds Partei hatte mit diesem jung-fröhlichen Revoluzzergeist des gealterten Herrn Kisch nichts zu tun. Gottwald und Generalsekretär Rudolf Slánský ging es darum, Stalins Kontrolle über die Tschechoslowakei zu gewährleisten. Mit allen Mitteln, die ihnen dazu nötig erschienen, und wohl immer noch in der irrigen Hoffnung, dass Stalin der ČSR zugestehen würde, einen eigenen, vielleicht sogar ein wenig liberaleren Weg zum Sozialismus zu beschreiten. [20] Womöglich waren die Delegierten ja heilfroh, dass Kisch kein öffentliches Amt innehatte. Und Kisch?
Zwar hatte er kurz nach seiner Heimkehr noch vorsichtshalber versichert, er werde sich »mit Vergnügen« am »Aufbau des Staates beteiligen« [21], doch blieb ihm das zu seinem Glück erspart. Denn, so witzelte er, »Ich will mei Ruah habn« [22]. Trotzdem: Man hätte ihn ja zumindest fragen können! Nicht dass er den Wunsch gehabt hätte, in die Redaktion des Parteiblatts Rudé právo einzutreten, die Otto Katz nun leitete. Diese Zeitung, so vertraute Kisch Leo Brod an, sei »ein Beispiel, wie man keine Zeitung machen darf«. Und obwohl er darunter litt, in politischen Dingen nicht um Unterstützung gebeten zu werden, »kehrte er Fremden gegenüber den siegesgewissen Parteigenossen hervor«. [23]
Mit der Aufgabe, Kisch und Katz im Namen der Partei und im Rahmen eines Restaurantbesuchs willkommen zu heißen, hatte man den jungen Genossen Eduard Goldstücker betraut. [24] Wie die beiden Ehrengäste war auch Goldstücker Jude. 1939 war er nach Großbritannien geflohen, hatte dort in Oxford Germanistik studiert und im Anschluss daran für die tschechoslowakische Exilregierung in London gearbeitet. Seine jüdische Herkunft, der lange Aufenthalt im westlichen Ausland und seine Mehrsprachigkeit machten Goldstücker zu dem, was man in der Partei misstrauisch und etwas verächtlich »Globetrotter« oder »Kosmopolit« nannte. Damit nicht genug, schien Goldstücker eine ausgeprägte Schwäche für die deutsche Literatur zu haben. [25] In den Augen der Partei war Goldstücker also der geeignete Mann, um die beiden aus Mexiko heimgekehrten »Globetrotter« anlässlich des Begrüßungsmahls zu betreuen.
Kisch ergriff die Gelegenheit, um zu verkünden, wie glücklich er sei, wieder in »seinem Prag« zu sein. Goldstücker ließ sich von Kischs vordergründiger Fröhlichkeit nicht täuschen: »Ich fühlte, dass er sich isoliert fühlte, ich spürte die Tragödie.« [26]
Einige Monate nach dem Empfang traf Goldstücker das Ehepaar Kisch zufällig abends auf dem Wenzelsplatz: »Kisch rannte auf mich zu, umarmte mich und sagte: ›Mensch, wo bist du die ganze Zeit?‹ Ich antwortete: ›Im Außenministerium.‹ Darauf antwortete er leise: ›Dorthin geht kein anständiger Mensch.‹« [27]
Das war eine Warnung. Eine Warnung, nicht für die Regierung, nicht für den Staat zu arbeiten. Wenn man anständig bleiben wollte. Und obwohl die KP noch nicht die ganze Macht an sich gerissen hatten, ahnte Kisch vielleicht, dass man in Prag derartige Sätze am besten nur noch leise sagte. Oder wollte er sich den Abendspaziergang nicht durch unnötige Diskussionen mit Gisl, der immer noch unbeirrbar linientreuen Genossin (unter Kischs Freunden »der Parteiapparat« genannt) [28], verderben? Recht hatte Kisch auf jeden Fall mit seiner Warnung: Für Menschen wie Goldstücker und auch für den parteilosen Außenminister Jan Masaryk selbst konnte die Tätigkeit in diesem Ministerium, das schließlich nur noch von Direktiven aus Moskau abhängig sein sollte, kein gutes Ende nehmen. [29]
Auf die feierlichen offiziellen Begrüßungen folgte schnell der ernüchternde Alltag. An eine Rückkehr ins jahrhundertealte Stammhaus der Kisch-Familie, das Bärenhaus, war nicht zu denken. Die noch dort wohnenden Witwen seiner Brüder Arnold und Paul waren zerstritten, und so fand Kisch die Atmosphäre im Haus unsagbar deprimierend. [30] Doch anstatt endlich in eine Wohnung ziehen zu können, wurde dem Ehepaar Kisch ein Zimmer im einigermaßen luxuriösen »Hotel Alcron« zugeteilt. Dort lebten sie, wie Gisl dem Freund Hugo Sinaiberger schrieb, »in einem Zimmer, in dem gearbeitet, gekocht, gewaschen, gegessen und ununterbrochen Besuch empfangen« wurde. [31]
Es war nicht nur die Enge des Wohnraums, die für das ältere Ehepaar anstrengend war: Im Nu hatte es sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen, dass Kisch im Alcron wohnte. Und das hatte Folgen. »Im Hotel Alcron in Prag«, berichtete ein Journalist,
ist die Halle voll von Leuten, die um ihn [Kisch] herumstehen und etwas von ihm wollen. Manche wollen ihm nur die Hand schütteln in Erinnerung an irgendeine Nacht, an die er sich wahrscheinlich gar nicht mehr erinnert. Andere haben in der Schlacht von Teruel ihren schweren Schuß bekommen, gerade als sie an der Seite von Kisch vorwärtsstürmten. [32]
Dass der mittlerweile 61-jährige Kisch niemals im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hatte und damals körperlich auch gar nicht mehr in der Lage gewesen wäre – in welche Richtung auch immer – »vorwärtszustürmen«, kümmerte den Kollegen nicht. Seine Schilderung eines permanenten Kisch-Trubels im Hotel ist allerdings mehr als glaubhaft. Und natürlich spielte Kisch dort weiterhin den gut gelaunten Egonek, auch wenn ihn der tägliche Aufruhr um seine Person sehr ermüdet haben muss.
Freunde wie Manfred George trafen bei ihrem Besuch in Prag einen anderen Kisch, nicht den »Clown der Revolution« oder den »rasenden Reporter«, sondern einen alten Mann. Egon Erwin Kisch, so George Ende 1946,
war bedrückt und in sich gekehrt. Politische Argumente vermied er. Man hatte das Gefühl: hier war ein Mann, der das Ende seines Weges erreicht hatte. Er hatte zwar eine neue Welt, ja, diese neue Welt, angestrebt, aber die alte Welt war bei allem Gegensatz zu ihr seine eigentliche Welt gewesen. [33]
Doch wie heimatlos sich Kisch auch fühlen mochte: Auf jeden Fall wollte er in »seiner« Stadt bleiben. Dort, wo alles begonnen hatte. Und wo es für ihn auch enden sollte – in Prag.
2. Egonek aus dem Bärenhaus
Egon Erwin Kisch war als Bürgersohn ein Kind der Belle Époque, die spätestens im von deutschen Truppen zerstörten Leuven, im deutschen Chlorgasnebel der zweiten Flandernschlacht bei Ypern und vor Verdun einen so grausamen wie überflüssigen Tod sterben sollte. Als der Erste Weltkrieg begann, war Kisch bereits 29 Jahre alt. Die prägenden Jahre seines Lebens hat Kisch damit in jener Epoche verbracht, die sein Freund Stefan Zweig im Rückblick als »das goldene Zeitalter der Sicherheit« [34] charakterisierte. Es war jene kurze Atempause zwischen 1884 und 1914, in der West- und Mitteleuropa im Rahmen einer ersten großen Welle der Globalisierung einen gewaltigen Schritt nach vorne machten. »Das neunzehnte Jahrhundert«, so Zweig, »war in seinem liberalistischen Idealismus ehrlich überzeugt, auf dem geraden und unfehlbaren Weg zur ›besten aller Welten‹ zu sein.« [35]
Wirklich »golden« und »schön« waren diese Jahre, wie Barbara Tuchman schreibt, [36] natürlich nur für die Wohlhabenden. Andererseits: Auch wenn die goldenen Lichtstrahlen der Belle Époque lediglich für Sekunden in die Fabriken, Bergwerke und düsteren Proletarierwohnungen zwischen Wien, Prag, Budapest, Paris und London eindrangen, so wurden die Fenster dank der sozialistischen Parteien und Gewerkschaften mit jedem Jahr weiter aufgestoßen. Parallel hierzu ermöglichte der Schriftsteller Émile Zola, den der Reporter Kisch als den besten Journalisten aller Zeiten verehrte, dem Bürgertum einen unverfälschten und von keiner Sentimentalität getrübten »wissenschaftlichen« Blick in die bedrückende Welt der Arbeiterklasse, die Tag für Tag den höchsten Preis für die rasend schnelle Industrialisierung und Globalisierung zahlte.
Zolas Porträt der Bergarbeiter in seinem 1885 veröffentlichten Meisterwerk Germinal befeuerte den Glauben vieler an eine bessere Zukunft, an den Sozialismus. Wobei man im Herrschaftsgebiet der Habsburger eher darauf hoffte, dass sich das Leben für alle verbessern würde, ohne dass die bestehende Ordnung dafür durch leichtsinnige Revolutionen ins Wanken gebracht würde. Spannungen zwischen den beherrschten Völkern und Wien gab es im Reich der Habsburger allerdings zur Genüge. Doch die multikulturelle, vielsprachige »tausendjährige österreichische Monarchie«, so Zweig, »schien auf Dauer gegründet und der Staat selbst der oberste Garant dieser Beständigkeit«. [37]
Auch in der Prager Altstadt, wo die Familie Kisch in der Schwefelgasse 14 (ab 1894 Melantrichgasse) lebte, schien eine von Frieden, Stabilität und Wohlstand besonnte Zukunft sicher, als Egon am 29. April 1885 zur Welt kam. Egonek, wie er von Familie und Freunden liebevoll genannt wurde, war nach dem 1882 geborenen Paul bereits der zweite Sohn von Ernestine und dem so erfolgreichen wie angesehenen Tuchhändler Hermann Kisch. Drei weitere Söhne sollten noch folgen: 1887 Wolfgang, 1890 Arnold und 1894 »Kaspar« Friedrich. Als Kisch 1914 im Feld jeden Abend Tagebuch schrieb, versuchte er die Gemeinsamkeiten zwischen den fünf Kisch-Söhnen in Worte zu fassen:
Wir sind alle fünf von ganz verschiedener Wesensart, aber gemeinsam war uns eine starke Körperlichkeit, nie war einer bettlägerig, alle waren wir tauglich zum Militärdienst, und in uns allen äußerte sich die Gesundheit in übermütigen Bestätigungen, wie Übermaß von Sport, durchbummelte Nächte, Schwimmen verbotener Strecken, Rekord an Mensuren, Tanzwut, abenteuerliche Streifzüge, einen Überschuß an Temperament, das jede Berechnung, jede Überlegung und jede Klugheit verlachte. [38]
Im Bärenhaus ging es dank des wilden Temperaments der Söhne dermaßen laut, turbulent und auch brandgefährlich zu, dass die Wirtschafterin Frau Maschenka noch Jahre später feststellte: »Es war ein richtiges Verhängnis.« [39]
Die Jungs aus dem Bärenhaus, 1912. Von rechts nach links: Friedrich, Egonek, Wolfgang, Arnold und Paul
Immerhin, an Platz mangelte es den jungen Eltern im Haus zu den »Zwei goldenen Bären«, das bereits seit 1866 im Besitz der Familie Kisch war, nicht. [40]
Nicht nur Kleider machen Leute, Orte vermögen dies auch zu tun. Und so hat das prächtige, in der Renaissance erbaute Haus, dessen Portal zwei Bären schmücken, sicher dazu beigetragen, dass die Kisch-Söhne schon früh einen tiefen Stolz auf eine lange Familientradition und eine enge Bindung an ihre Geburtsstadt entwickelten. In den Abenteuern in Prag erzählt Kisch von seiner Großtante Charlotte Steinhardt, die den kleinen Egon stets »Egmont« nannte – aus Liebe zu Goethe, dem sie einmal sogar persönlich begegnet war. Und Kischs »Tante Lotti« war zutiefst überzeugt davon, dass sie Goethes letzte große Liebe geworden wäre, hätte – ausgerechnet! – Ulrike von Levetzow dies nicht vereitelt. [41]
Viel mehr als Goethe interessierte »Egmont« jedoch das Gerücht, dass Heinrich Heine zu seinen Vorfahren zähle. Zu seiner Enttäuschung fand er allerdings später heraus, dass es im Stammbaum der Kischs nur eine entfernte angeheiratete Verwandte Heines gab. Eine ihm unterstellte Ähnlichkeit mit dem jungen Heine konnte also leider nur Zufall sein. [42]
Und dann war da natürlich noch Abraham Kisch, der Sohn des privilegierten Prager Apothekers Jacob Kisch. Abraham hatte als erster Prager Jude Medizin studiert und 1749 an der Universität von Halle den Doktortitel erworben. Er wurde schließlich Freund und Lehrer Moses Mendelssohns in Berlin. Die niederländischen Kischs, so erfuhr Egon im Rahmen seiner Recherchen zu den Abenteuern, hatten sogar noch zwei silberne Rasierbecken in ihrem Besitz, die Mendelssohn seinem einstigen Lehrer geschenkt hatte. [43] Tatsächlich waren gleich zwei seiner Vorfahren mit Moses Mendelssohn befreundet gewesen:
Von der Familie Kuh, der meiner Mutter, finden sich noch manche Angehörige in Büchern verzeichnet. Mein Vater, eifriger Mendelssohnleser, pflegte meiner Mutter in den Briefen des großen Philosophen oder in den biographischen Schriften von M. Kayserling und meines Religionslehrers Dr. Nathan Grün froh die Stellen zu zeigen, wo Moses Mendelssohn gemeinsam von seinen Freunden Kuh und Kisch spricht. [44]
Die Verwandtschaft der Kischs mit einer anderen historischen Persönlichkeit deutete die sechzehnjährige Niederländerin Paula-Louise Kisch halb im Ernst an, als sie 1917 an ihren entfernten Cousin Egon Erwin Kisch schrieb:
Wenn der Traum der Zionisten sich erfüllen würde und wir vielleicht wirklich nochmal ein jüdisches Königreich bekommen sollten, müssten wir Kischs uns jedenfalls zur Stelle melden, denn wir haben doch berechtigte Erbansprüche – meinen Sie nicht auch? Im Geiste sehe ich Sie schon »auf hohem Balkone« wie Sie sich herablassend für die Huldigungen Ihrer Untertanen bedanken, rege Phantasie, nicht wahr? Oder begnügen Sie sich auch mit dem Posten des Reichskanzlers und überlassen die Königswürde einem älteren Familienmitglied? [45]
Paula-Louise bezieht sich hier auf Shaul Ben Kisch, den ersten Herrscher des vereinigten jüdischen Königreiches. Dies ging Egon Erwin allerdings etwas zu weit, weswegen er zwar eine »Hypothese« königlicher Abstammung in den Abenteuern kurz erwähnt, doch sich ansonsten auf die Vermutung beschränkt, dass seine Vorfahren väterlicherseits aus dem böhmischen Dorf »Chiesch« stammen. [46] Gleichwohl mag es ihm gefallen haben, dass Paula-Louise, Tochter des niederländischen Zionisten Hartog Kisch, über einen kommenden jüdischen »König Egon« fantasierte, der aus dem Geschlecht des biblischen Königs Shaul stammt.
»Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen!«, hatte Theodor Herzl dem jüdischen Volk 1902 versichert. [47] In Kischs Augen hingegen war die Vorstellung eines jüdischen Staats in Eretz Israel, im »Land Israel«, nur wenig realistischer als ein Wiedererstehen der sagenumwobenen Stadt Atlantis. Immerhin, jene Sprache, in der die Delegierten der zionistischen Kongresse miteinander kommunizierten, beherrschte »König Egon« bereits, denn Deutsch war die Muttersprache der fünf Kisch-Söhne. Tschechisch erlernten sie wohl nebenbei, durch den täglichen Kontakt mit dem Dienstpersonal. [48]
Waren die Kischs also Deutsche? Durch ihre Sprache und ihr Zugehörigkeitsgefühl zum deutschen Kulturkreis waren sie es. Gleichzeitig waren sie, wie alle Bewohner Prags, ohne jeden Zweifel Österreicher. Ihre ebenso zweifellose jüdische Identität sorgte allerdings dafür, dass sie im Dauerkonflikt der deutschen und tschechischen Prager stets zwischen den Stühlen saßen. Theodor Herzl hat die Situation der böhmischen Juden 1897 so skizziert:
In Prag warf man ihnen vor, daß sie keine Tschechen, in Saaz und Eger, daß sie keine Deutschen seien. Arme Juden, woran sollten sie sich denn halten? Es gab welche, die sich tschechisch zu sein bemühten; da bekamen sie es von den Deutschen. Es gab welche, die deutsch sein wollten, da fielen die Tschechen über sie her – und Deutsche auch. [49]
Oder wie es Joseph Roth formulierte: »Die Juden widerlegten das Sprichwort, das da sagt, der Dritte gewänne, wenn zwei sich stritten. Die Juden waren der Dritte, der immer verlor.« [50]
»Im Jahre 1900«, so schreibt Max Brod, »zählte Prag 415 000 Tschechen, 10 000 nichtjüdische Deutsche, 25 000 Juden, von denen 14 000 sich zur tschechischen, 11 000 zur deutschen Umgangssprache bekannten.« [51] Wenn sich also die meisten Prager Juden der tschechischen Kultur zugehörig fühlten, so waren die Juden unter den deutschsprachigen Pragern in der Mehrheit. Brod fasst die etwas unübersichtliche Situation in Prag so zusammen:
Unter den Juden gab es solche, die sich als Angehörige des deutschen Volkes fühlten und die dafür die gewichtigsten Argumente anzuführen wußten – dann andere, die mit sehr ähnlichen Beweisgründen für den Beweis kämpften, daß sie zur tschechischen Nation gehörten – und schließlich Juden, die sich einfach und ohne Ziererei zum Judentum bekannten. [52]
1921, drei Jahre nach der Gründung der Ersten Tschechoslowakischen Republik, erklärten 53,5 Prozent der Prager Juden, dass sie tschechischer, 25,3 Prozent, dass sie deutscher, und 20,1 Prozent, dass sie jüdischer Nationalität seien. Neun Jahre später hatte sich die Zahl jener Juden, die sich der mittlerweile in der Republik offiziell anerkannten jüdischen Nationalität zugehörig fühlten, noch einmal erhöht. [53]
Der deutsch-tschechische Konflikt verlief mitunter mitten durch die Familien: Als der tschechische Vater von Richard Katz – der später ebenso wie Kisch ein gefeierter Journalist werden sollte – in die deutsche Verbindung »Moldavia« eintrat und sogar Redakteur der deutschnationalen Tageszeitung Bohemia wurde, brach seine Familie mit ihm den Kontakt ab. Es dauerte Jahrzehnte, bis der Vater seine Eltern im Dorf schließlich einmal im Jahr besuchen durfte. Den Enkel Richard haben die tschechischen Großeltern nie kennengelernt. »In meinem Elternhaus«, erinnert sich Richard Katz, »wurde nur Deutsch gesprochen; doch wenn mein Vater aus dem Schlaf sprach, murmelte er in seiner tschechischen Muttersprache.« [54] Für die deutschen Antisemiten war Katz’ Familie allerdings nicht deutsch, sondern jüdisch.
In den Augen der christlichen Prager Tschechen verliefen die Trennungslinien anders: »Deutsche und Juden: das war damals für das tschechische Prag fast identisch«, erinnert sich Kischs Freund Willy Haas, »und beide, Deutsche und Juden waren gleich verhaßt.« [55] Ebenso wie Haas erlebte auch Kisch den »Dezembersturm« des Jahres 1897, als überall in der Prager Altstadt durch tschechische Nationalisten »deutsche und jüdische Läden und Wohnungen erbrochen und ausgeplündert« [56] wurden. Dass des Kaisers Ulanen unter Androhung der Todesstrafe schnell wieder für Ordnung in Prag sorgten, änderte nichts daran, dass die gewalttätige Revolte den 13-jährigen Kisch verstört haben dürfte, als er die Vorgänge hinter einem verdunkelten Fenster des Hauses in der Melantrichgasse verfolgte. [57] Doch auch die Deutschen ließen keine Provokation aus: Jeden Sonntag um zwölf Uhr mittags versammelten sich deutsche Studenten, darunter nicht wenige Juden, vor dem »Deutschen Haus« im Zentrum der Stadt und sangen dort, am Ufer der Moldau, lauthals die inoffizielle deutsche Nationalhymne »Die Wacht am Rhein«. [58]
»Mit der halben Million Tschechen der Stadt«, so erinnerte sich Kisch Jahrzehnte später, »pflog der Deutsche keinen außergeschäftlichen Verkehr.« Die gegenseitig betriebene Apartheid ging dabei mitunter sehr weit:
Niemals zündete er [der Deutsche] sich mit einem Streichholz des Tschechischen Schulengründungs-Vereins seine Zigarre an, ebensowenig ein Tscheche die seinige mit einem Streichholz aus einem Schächtelchen des Deutschen Schulvereins. Kein Deutscher erschien jemals im tschechischen Bürgerklub, kein Tscheche im Deutschen Kasino. Selbst die Instrumentalkonzerte waren einsprachig, einsprachig die Schwimmanstalten, die Parks, die Spielplätze, die meisten Restaurants, Kaffeehäuser und Geschäfte. Korso der Tschechen war die Ferdinandstraße, Korso der Deutschen der »Graben«. [59]
Noch deutlicher wird Richard Katz in seinen Memoiren: »Als ich später Indien bereiste, staunte ich nicht wie andere über den strengen Kastengeist. Ich kannte ihn von Prag her«. [60]
Es waren gerade die jungen deutschsprachigen jüdischen Intellektuellen und Künstler aus Kischs Generation, die sich im zweisprachigen »Café Central« und natürlich im Kaffeehaus »Arco« trafen, in dem auch junge Tschechinnen wie etwa Milena Jesenská verkehrten. [61] Die jungen Idealisten waren ehrlich bemüht, als Juden ganz im Sinn des Philosophen Schmuel Hugo Bergmann Brücken zwischen Prags Völkern und Kulturen zu bauen. Bergmanns Schulfreund Kafka, dessen Vater aus dem tschechisch-jüdischen Proletariat und dessen Mutter aus dem deutsch-jüdischen Bürgertum stammte, lag die Pluralität sozusagen im Blut. Seinem Freund Max Brod – der auch Musikkritiker, Komponist und Pianist war – lag sie im Ohr: Er setzte sich leidenschaftlich für tschechische Musikschaffende ein.
Und Kisch? Ihm lag die Pluralität bereits in den Füßen: Sein Fußballklub, in dem er als linker Außenstürmer brillierte und dessen Mitglieder überwiegend Prager Juden waren, war der einzige deutsche Sportverein, der sich am deutschen Boykott nicht beteiligte und auch gegen tschechische Mannschaften antrat. [62] Was kümmert es den Ball denn schon, wer ihn ins Goal befördert?
Von tschechischer Seite wurden diese Bestrebungen der jungen deutschsprachigen Schriftsteller sehr wohl wahrgenommen. Der sozialdemokratische Literaturkritiker Rudolf Illový veröffentlichte 1913 einen Artikel über die neue Generation deutschsprachiger Künstler, welche »die Kämpfe des tschechischen Volkes und seine kulturellen Bestrebungen unvoreingenommen betrachten und am tschechischen Leben als dessen Beobachter teilnehmen«. [63]
Jahrzehnte später, in seinem Jerusalemer Arbeitszimmer, versuchte Bergmann im Gespräch mit einem jungen Journalisten des Armeesenders Galei Zahal das Prag seiner Kindheit und Jugend noch einmal vor seinem geistigen Auge heraufzubeschwören. Prag, wo er einst Schule und Universität besucht hatte, habe ihn mit den »Ausweispapieren des Geistes« ausgestattet. »Wir verstehen doch erst jetzt«, meinte der alte Philosoph, »wie wichtig Prag für uns gewesen ist, wieviel Bildung wir dort erhalten haben.«
Das Besondere an Prag war, daß es eine Stadt war, in der drei Völker – mehr oder weniger – friedlich zusammengelebt haben. […]Diese drei Kulturen haben sich gegenseitig beeinflußt und dieser »Drillingscharakter«, so möchte ich es ausdrücken, hat seinen Stempel allem aufgedrückt, was ich und die anderen in Prag geborenen – soweit sie noch leben – bis zum heutigen Tag denken. [64]
Bergmann fügte hinzu, auch etwas von jenem Pluralismus, der in seinem Freund Franz Kafka lebendig war, sei das Produkt jener Stadt gewesen, in der dieser aufgewachsen war. Und der Charakter Prags und seiner Bewohner habe sich auch in der Art und Weise ausgedrückt, wie die drei Kulturen im Alltag miteinander rangen.
Kisch und Mutter vor dem Bärenhaus, 1932
Diese Spannungen machten Prag in Kischs Augen zu einer »Stadt, in der ewig der Kriegslärm tobt, alles zerstört, Schulkinder erfaßt und Greise verbittert«, doch die »gerade deshalb so staunenswert eigenartig ist, so verstiegen schön, daß sie jeder lieben muß, jeder, dem sie ihren Zauber erschlossen«. [65] Die Liebe der jüdischen Prager drückte sich auch darin aus, dass sie Prag »die Stadt und Mutter in Israel« nannten. [66]
Als sich das deutsch-tschechische Verhältnis in Prag während der letzten Jahre der Republik allmählich zu bessern begann, als endlich »die Chinesische Mauer durchbrochen« [67] wurde, war es bereits zu spät. Die Drei-Völker-Stadt Prag hatte keine Zukunft mehr.
3. Frühe Abenteuer
In zwei Büchern hat Egon Erwin Kisch ausführlich über Kindheit und Jugend in seiner Heimatstadt berichtet: Die Abenteuer in Prag und Marktplatz der Sensationen. Diese Memoiren wurden in einem Abstand von rund zwanzig Jahren verfasst und unterscheiden sich sowohl in ihrer Entstehung als auch ihrer historischen Verlässlichkeit. Im Fall des Mitte der Dreißigerjahre begonnenen und 1943 publizierten Buchs Marktplatz der Sensationen hat man es noch mit dem Werk eines Journalisten und schon mit dem eines Schriftstellers zu tun, der mit einer gewissen Geringschätzung auf die meisten seiner früheren Texte zurückblickt und unbedingt ein Werk schaffen möchte, das seinen Ansprüchen an »gute Literatur« entspricht. [68] Er wollte einfach gute, spannende Geschichten erzählen, ohne sich durch Fakten unnötig beirren zu lassen. Außerdem war es Kisch in Mexiko, wo er das Buch vollendete, kaum möglich, über das ferne Zeitalter seiner Prager Jugend Recherchen in Bibliotheken und Archiven anzustellen. Und so waren Erinnerungen und Fantasie die Hauptquellen, aus denen er beim Schreiben schöpfen konnte.
Die autobiografischen Kapitel in den 1920 veröffentlichten Abenteuern in Prag hat Kisch hingegen noch unter den kritischen Augen all jener jungen Menschen publiziert, die in derselben Zeit und am selben Ort wie er selbst aufgewachsen waren. Also musste er besonders bei jenen Dingen, die Teil der kollektiven Biografie seiner Generation waren, besondere Authentizität wahren. Und dies natürlich auch deswegen, weil gerade die Freude des »Genauso war es!« und »Das kenne ich auch!« die Glaubwürdigkeit und damit den Erfolg des Buchs bei den Lesern bestimmen sollte. Und diese Glaubwürdigkeit erreichte Kisch mit den Abenteuern in Prag in hohem Maße. Die Leser fanden sich in Kischs persönlichen Erinnerungen und Prager Skizzen wieder: »Es ist alles da«, jubelt Felix Weltsch in seiner Besprechung des Buchs, »alles ist hier aufbewahrt und liebevoll verzeichnet.« [69]
Die Abenteuer in Prag sind unverkennbar die Kindheits- und Jugenderinnerungen eines Recherche-erprobten Journalisten. Eines Journalisten allerdings, der sich bei aller Faktentreue und Offenheit trotzdem eine gewisse Zurückhaltung auferlegen musste, da »die alte Kisch« bei Erscheinen des Buchs noch sehr lebendig war und – bei all ihrer grenzenlosen Liebe zu Egonek – auf den guten Ruf der Familie allergrößten Wert legte.
Die ersten Schuljahre verbrachte der kleine Egonek ganz in der Nähe des Bärenhauses, im Servitenkloster zu St. Michael in der Schwefelgasse Nummer 17. Hätte es in unmittelbarer Nähe des Hauses eine jüdische Schule gegeben, die es mit dem Bildungsstandard des Servitenklosters hätte aufnehmen können, dann hätte Ernestine Kisch sicher eine jüdische Schule vorgezogen. Doch da es ihr einzig und allein um Egoneks Wohl ging, wählte sie das in der Nachbarschaft gelegene Servitenkloster.
Von dort ging es für Egonek im Alter von zehn Jahren in jene Schule, die seit Generationen sowohl für deutschsprachige Juden als auch für deutschsprachige Christen aus dem Bürgertum ein Fixstern am Prager Schulhimmel war: die 1766 Ecke Graben/Herrengasse erbaute Piaristenschule, in der die »Väter der frommen Schulen« [70] die Bürgersöhne in ihrer privaten »Normalschule« auf Gymnasium und Realschule vorbereiteten.
Der erste Schultag blieb für Kisch auf traumatische Art unvergesslich: Der kleine Egonek trat nicht nur in eine bereits seit drei Jahren bestehende Klasse ein, er kam an diesem Tag zudem unverschuldet zu spät zum Unterricht. Alle Schüler starrten ihn an. Und plötzlich
rutschte mir der Strumpf hinunter. Ob das die Argusaugen meiner lieben Mitschüler von selbst bemerkten oder ob ich durch einen Versuch, die nackte Wade wieder mit dem Strumpfe zu bedecken, das Signal zum Huronengebrüll gab, ist nicht wichtig. Wichtig ist eben nur das Huronengebrüll. Ich hörte es damals, ich hörte es durch mein ganzes Leben, und ich fürchte es wiederzuhören, bis ich in die versammelte Hölle komme, als Neuer, um drei Viertel neun. […]Vielleicht bilde ich mir das nur ein: Aber seit jenem Tage, da ich zu spät gekommen war, leide ich an einem Minderwertigkeitskomplex. Seit jenem Tage ist mein Leben darauf gerichtet, den schlechten Eindruck von damals zu verwischen. […]Und immer von neuem verfluche ich die drei Viertelstunden, um die ich zu spät kam und die ich nicht einholen kann. [71]
Von Anfang an war Egonek klar, dass er nicht wirklich dazugehörte: Er trug keinen feinen blauen Matrosenanzug, wohnte nicht im richtigen Viertel. Und wenn er sich auch vorbildlich in der ersten Reihe an Prügeleien mit den Schülern tschechischer Schulen beteiligte, »gesellschaftsfähiger« wurde er dadurch nicht. [72] Im Gegenteil.
Überhaupt scheint Kischs Besuch der Piaristenschule nicht von Erfolg gekrönt gewesen zu sein, weswegen der Vater entschied, dass sein Zweitgeborener das Realgymnasium besuchen sollte, die »Nikolander«, in der Nikolandergasse 3. Mit dieser Entscheidung war bereits klar, dass Egon – im Gegensatz zu seinen Brüdern – der Besuch einer Universität und die Erlangung eines Doktorgrades versagt sein würde. Er hätte allenfalls an der Technischen Hochschule studieren können. [73] Einerseits befreite ihn diese Einschränkung von dem Erwartungsdruck seitens der Mutter, unter dem etwa sein älterer Bruder Paul noch in späteren Jahren leiden sollte, [74] andererseits war auch der Besuch des »Nikolander« für Egonek kein Spaziergang. Dort tobte, glaubt man Kisch, zwischen Schülern und Lehrern ein »Siebenjähriger Krieg«. [75]
Krieg hin oder her: Über seine Zeit im schulischen Schützengraben schrieb Kisch einen seiner schönsten Texte, die »Ode an die Nikolander«. Und da er den Text »1915, im Felde« verfasste, geriet er ihm hier und da unwillkürlich zum »Kaddisch« für all jene Schüler und Lehrer, die mittlerweile nicht mehr lebten: »Liebe ich sie doch alle noch heute, die Todfeinde aus den Knabenjahren, die ich schon liebte, als ich sie befehdete.« [76] Da Kisch Schüler wie Lehrer in seinen wehmütig-komischen Vignetten stets beim Namen nannte, entstand so ein weiterer Text des Prager Chronisten Kisch, dessen Kinder- und Jugenderinnerungen immer auch die seiner Generation sind.
Eine Ausnahmeerscheinung unter den Lehrkräften des »Nikolander« war der Rabbiner Dr. Nathan Grün. Er übernahm an höheren Prager Schulen den Religionsunterricht für jüdische Schüler und war als ein Gelehrter bekannt, der sowohl Bücher verfasste als auch in verschiedenen Bildungseinrichtungen und Vereinen Vorträge zu jüdischen Themen hielt. In manchen dieser Vorträge tauchten auch Vorfahren Egon Erwin Kischs auf, wie etwa dessen Ahne Rabbi Judah Löw, der nach der Legende im 16. Jahrhundert den »Golem« erschaffen und die Prager Juden des Gettos so vor Angriffen der Judenhasser geschützt haben soll. [77] Für die schulische Unterweisung undisziplinierter Heranwachsender war der Rabbiner Grün allerdings weniger geeignet.
Dazu kam, dass die Mehrheit seiner Schüler, wie sich Hugo Bergmann erinnert, ihn als Vertreter einer archaischen Religion betrachtete. Sie verspotteten, ja verachteten ihn. Der Rabbiner repräsentierte für alle, die nur noch auf dem Papier, doch kaum noch im Alltag Juden waren, das ferne Judentum ihrer Vorfahren. [78] Seine Mischung aus Zerstreutheit und Originalität führte schließlich dazu, dass ausgewählte Anekdoten über ihn noch jahrzehntelang an jenen Kaffeehaustischen die Runde machen sollten, an denen seine ehemaligen Schüler in der Emigration zusammentrafen. Dabei erwies sich, dass der große Schauspieler Ernst Deutsch als »Nathan Grün« nicht weniger beeindruckend als in der Titelrolle von Nathan dem Weisen war. [79]
Ein guter Schüler sei Egonek nicht gewesen, erzählte Ernestine Kisch einem Reporter Jahrzehnte später. Wenn er in einem Fach schlecht gestanden habe, habe er wohl gewusst, wie er sich »herausreißt«, doch dafür seien seine Leistungen dann wieder in einem anderen Fach abgefallen. Immer wieder wurde Mutter Kisch wegen Egonek in die Lehrersprechstunde bestellt. [80] Und wenn sie sich Sorgen machte, weil sich der Junge noch spät abends herumtrieb, statt brav nach Hause zu kommen, öffnete sie das Fenster und rief den Prostituierten, die auf der Straße auf Kunden warteten, laut zu: »Habt ihr vielleicht meinen Egonek gesehen?!« [81]
Das Bärenhaus
Jene Bildungserlebnisse, die tatsächlich einen nachhaltigen Einfluss auf Kisch haben sollten, lagen außerhalb des Bildungskanons des Realgymnasiums. Denn was gab es für Egonek in Prag nicht alles zu entdecken! Stundenlang durchstreifte er alleine oder mit Freunden die verwinkelte und düster-geheimnisvolle Altstadt: »War es der Trieb, der zu Erstbesteigungen veranlasst, war es Entdeckersehnsucht, war es Hintertreppenromantik wörtlichen Sinnes oder der Wunsch, tiefer in die Geheimnisse einzudringen, die sich ganz bestimmt hinter den gedunkelten Fassaden der Häuser verbergen?« [82]
Egonek lernte schon als Piaristenschüler das Labyrinth der halbdunklen Gassen der Josefstadt, des früheren Gettos, kennen. Nachdem 1867 die rechtliche Gleichstellung der Juden in Österreich-Ungarn erfolgt war, waren nun nur noch rund 30 Prozent der Bewohner der Josefstadt Juden. [83] Die schrittweise, beinahe vollständige Zerstörung des Gettos, die sogenannte Assanierung, wurde nach mehrjähriger Planung Ende des 19. Jahrhunderts langsam in Angriff genommen. [84] Das einstige Ghetto war in Kischs Kindertagen mehr denn je das Armenviertel der Stadt, wo nun zahlreiche Bordelle, Beisl und Kaschemmen zu finden waren. [85]
Seit dem 13. Jahrhundert war die über Prags Grenzen hinaus berühmte Altneu-Synagoge, die »Altneuschul«, wo Kischs Vorfahre Judah Löw gewirkt hatte, das Herz des jüdischen Viertels. 1885 hatte Theodor Herzl die Synagoge besucht. Inspiriert von diesem Erlebnis, gab er seinem 1902 veröffentlichten utopischen Roman den Titel Altneuland. [86] Das Buch erschien in hebräischer Übersetzung unter dem Titel Tel-Aviv, und somit ist die heimliche Hauptstadt Israels die wohl erste Stadt der Welt, die nach einem Roman benannt wurde.
In seinen Abenteuern hat Kisch die Liste der von ihm eingeschlagenen verschlungenen Pfade durch Gassen, Hinterhöfe, Hausdurchgänge und über Schleichwege detailliert notiert. Auf fast manische Art und Weise versuchte er die Karte seines Prags festzuhalten, sich gegen den Strom der Zeit zu stemmen. Geradeso, als wolle er das Bild seines Prags für die Zukunft festhalten, bevor es endgültig vergessen würde. Egoneks Streifzüge waren eine frühe Äußerung seiner lebenslangen unersättlichen Neugierde, die ihm der stärkste Treibstoff bei der Arbeit war.
Nicht weniger wichtig als Egoneks räumliche Entdeckungsreisen waren für seine spätere Karriere die kleinen täglichen Fluchten in die Literatur. Denn die Tagträumerei, das Fantasieren – das er in vieler Hinsicht auch als Reporter einsetzen sollte –, will schon früh gelernt sein. So verschlang Egonek die Lederstrumpf-Erzählungen von James Fenimore Cooper, die Wildwestromane des deutschen Auswanderers Friedrich Gerstäcker, die damals erfolgreichen Abenteuergeschichten der Autorin Sophie Wörishoffer und natürlich die Reiseerzählungen Karl Mays. [87] Letzterer hatte es dem kleinen Prager besonders angetan.
Während der Unterrichtsstunden hatten wir einen der Fehsenfeldschen May Bände unter der Bank aufgeschlagen, die Zehn-Uhr-Pause opferten wir der Fortsetzung der Lektüre, und der Weg von der Schule nach Hause wurde im Schnellschritt zurückgelegt, weil man daheim in dem Buche weiterlesen konnte. [88]
In Kischs Liste seiner Jugendautoren fehlt der Name Sir Arthur Conan Doyle. Doch kann dies nichts anderes als ein Versehen sein. Und falls nicht: Spätestens für den schon in Prag sehr umtriebigen Hobby-Kriminalisten Kisch gehörten Doyles Detektivgeschichten ebenso zur Pflichtlektüre, wie es Sigmund Freuds Fälle für angehende Psychoanalytiker sind. Und ebenso wie Sherlock Holmes brauchte der Reporter Kisch beides: Fantasie und logische Kombinationsgabe. Diese beiden Eigenschaften würden die Eckpfeiler seiner ganz eigenen Theorie von der »logischen Phantasie« des Reporters werden. [89]
Karl May und seine Romane haben Egonek nie wieder losgelassen. Bis in Kischs Alterswerk hinein wird der kleine Sachse immer wieder auftauchen, wie eine Hommage an Egoneks Prager Kindheit und an die Kraft der Fantasie. Von den vor allem in Mays frühen Kolportageromanen antisemitisch gezeichneten jüdischen Protagonisten [90] wusste der Schüler Kisch womöglich nichts. Und es gibt durchaus Anhaltspunkte dafür, dass der alte Karl May – jesusgläubiger Pazifist und selbst ernannter »Edelmensch« – gegenüber Juden und Judentum mitunter einen freundlichen Respekt empfand. [91]
Jedenfalls war es für den jungen Bücherwurm Egonek fraglos ein besonderer Tag, als Karl May im Oktober 1898 in Prag eintraf. Der Schriftsteller war in die Stadt gekommen, um einen Rechtsstreit mit seinem tschechischen Verleger beizulegen. [92]
Wir verschlangen alles, was wir hierüber in der »Bohemia« finden konnten, mit wahrem Heißhunger. Denn, wenn es auch mit der kritiklosen Bewunderung längst vorbei war – das Interesse für den Autor unserer Jugend war noch nicht erstorben. Wir wollten diesen einmal von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir ließen im Hotel de Saxe, in dem er logierte, nachfragen, ob wir mit ihm sprechen dürften. [93]
Sie durften. Und Kisch, als Wortführer der Schüler, erhielt den »dritten Band Old Surehand« geschenkt. »Auf die erste Seite«, erinnert sich Kisch Jahre später, schrieb Karl May »einen Spruch und setzte seinen Namen darunter. Der Spruch ist wirklich überaus schön. Er stammt von – Goethe«. [94] Tatsächlich handelte es sich um den ersten oder zweiten Old Surehand-Band, und der Spruch war ein wohl tatsächlich von May selbst fabriziertes Gedicht.
Das Leben ist ein Kampf,
der Tod ist der Sieg.
Ich lebe, um zu kämpfen,
und ich sterbe, um zu siegen. [95]
Doch die eigentliche Pointe ist eine andere: Unter Karl Mays Eintrag hatte Hermann Kisch – wohl nicht ohne Stolz – vermerkt: »Prag, am 17. Oktober 1898«. [96]
Hermann Kisch stand zwar tagaus, tagein in den Geschäftsräumen von »S. Kisch & Bruder«, doch seine Leidenschaft war nicht der Tuchhandel, sondern – die Literatur. Er war Mitglied der im Winter 1871 anlässlich von Grillparzers 80. Geburtstag ins Leben gerufenen »Concordia«, einem »Verein deutscher Schriftsteller und Künstler in Böhmen«. [97] Dabei war Vater Kisch nicht nur Gründungsmitglied des honorigen Vereins, unter dem Pseudonym »Hugo Kühlborn« schrieb er auch eigene Gedichte. Der stille und bescheidene Mann beschränkte sich allerdings darauf, seine Dichtkunst im Kreis von Freunden und Familie vorzutragen. [98]
Freude dürfte dem Vater auch bereitet haben, dass es der »Concordia« gelang, illustre Gäste als Vortragsredner zu gewinnen. Darunter Felix Dahn, Fritz Mauthner, Karl Emil Franzos, Ludwig Anzengruber, Rudolf Virchow und Gottfried Kinkel. [99] So geschah es, dass Schriftsteller und Journalisten im Bärenhaus bald ein und aus gingen. Mit Gustav Meyrink, der später mit dem Roman Der Golem berühmt werden sollte, und Alfred Klaar, dem Literatur- und Kunstkritiker der Bohemia, der als Schriftführer und Vereinsobmann fungierte, war Hermann Kisch eng befreundet. [100] Klaar war es auch, der vor sozialistischen Arbeitern in der Provinz Vorträge hielt, was für einen bürgerlichen Liberalen damals ungewöhnlich war. [101] Diese Hinwendung zur sozialen Frage lag durchaus in der Tradition des Vereins, der notleidende Dichter und Künstler mit Stipendien unterstützte und sogar einen Pensionsverein für Journalisten gegründet hatte. Ein Teil dieses Geldes, so darf man annehmen, kam auch von Egoneks Vater.
Ein weiteres Betätigungsfeld Hermann Kischs war der »Nächstenliebeverein zur Unterstützung verschämter isr. Hausarmen«. Zu »verschämt« durften die Empfänger allerdings nicht sein, denn die Namen der Beglückten nebst Zweck der Spende wurden als »Danksagung« im Prager Tagblatt veröffentlicht. [102] Es entspricht jüdischer Tradition, dass der Spender dem Empfänger dankbar sein darf, hat dieser ihm doch Gelegenheit gegeben, das Gebot der Mildtätigkeit zu erfüllen. Insofern geschah es nur halb im Scherz, als der bekannte »Sprechsteller« Anton Kuh seine Emigration nach Amerika mit den Worten ankündigte: »Schnorrer kann man überall brauchen!« [103]
Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Hermann Kisch – ebenso wie sein Bruder Samuel – nicht nur für jüdische Bedürftige eingesetzt, sondern mit seinen Söhnen zumindest an den hohen Feiertagen die Synagoge besucht hat. Diese Gottesdienstbesuche, der Religionsunterricht und natürlich die Tatsache, dass Egonek in einer vom Judentum geprägten Umgebung aufwuchs, dürften der Grund dafür sein, dass Kisch später zumindest eine Art familiärer Vertrautheit mit jüdischen Bräuchen und der hebräischen Sprache zeigte.
Eines seiner frühen Kindheitserlebnisse waren jene Festtage, an denen den »Gläubigen im Allgemeinen und den Knaben im Besonderen« in der Altneu-Synagoge eine alte Fahne, eine »zerschlissene fünfzackige Standarte«, und ein Hemd gezeigt wurden. Den Anwesenden wurde dann erklärt, dass Fahne und Hemd einst »einem gewissen Molcho« gehört hatten, »der in Italien mit seinem Freund Reubeni eine jüdische Revolution machte, ein Königreich der Juden ausrufen wollte und auf dem Scheiterhaufen heroisch starb«. Für den kleinen Egonek waren Molchos Fahne und Hemd das »Beweisstück für das Vorhandensein einer Welt von Abenteuern«. [104] Aber hat er damals bereits begriffen, dass dieser legendäre David Reubeni ein früher Zionist war?
Was Kisch mit zunehmendem Alter auf jeden Fall bewusst war: Irgendwo draußen – fern des Bärenhauses, fern Prags – lauert die Gefahr durch Menschen, die Juden hassen. Juden töten. Sobald Egonek lesen konnte, war er Zeitungsschlagzeilen, die etwa von mörderischen Pogromen in Polen oder Russland kündeten, zwangsläufig immer wieder ausgesetzt. So war es Egonek irgendwann unmöglich, zu ignorieren, dass es offensichtlich Menschen gab, die ihn ganz einfach deswegen hassten, weil er existierte.
Und dann, im Frühling des Jahres 1899, kochte der jahrhundertealte Judenhass in Böhmen wieder hoch. In seinen Memoiren Marktplatz der Sensationen erzählt Kisch, dass seine Empörung über diesen Judenhass zum auslösenden Moment seiner frühen Leidenschaft für den Journalismus wurde.
Im Wald beim Dorf Polna war die Leiche eines Mädchens aufgefunden worden, Dorfbewohner rotteten sich zusammen und schrien, niemand anderer als die Juden hätten das Mädchen ermordet und man müsse alle Juden erschlagen. Um dieser Forderung wenigstens einigermaßen zu entsprechen, nahm der Gendarm irgendeinen Juden aus der Gegend fest, und gegen diesen, Leopold Hilsner mit Namen, wurde das Verfahren wegen »Ritualmords« eingeleitet. [105]
Ein bemerkenswerter Unterschied zu früheren Ritualmord-Beschuldigungen bestand darin, dass man sich jetzt nicht mehr die Mühe machte, eine ursächliche Verbindung zwischen der jüdischen Religion und »Ritualmorden« zu unterstellen, sondern dass die Tatsache, als Jude geboren worden zu sein, jetzt schon genügte, um des Mordes verdächtigt und angeklagt zu werden. [106] Und so war, vor allem unter dem Einfluss deutscher Antisemiten, der Vorwurf des Ritualmords »säkularisiert« worden: Nun half auch die Taufe keinem Juden mehr, jetzt war seine bloße Existenz bereits ein Verbrechen. Der Hilsner-Prozess fand zu einer Zeit statt, da Frankreich noch immer in Antisemiten einerseits und Dreyfus-Verteidiger andererseits gespalten war.
Im Januar 1898 hatte Zola zur Verteidigung des zu Unrecht inhaftierten Dreyfus sein J’accuse! veröffentlicht und danach Frankreich verlassen müssen, um dem Gefängnis zu entgehen. [107] »Die Rolle«, erinnert sich Kisch, »die Zola im Fall Dreyfus übernommen, übernahm im Fall Hilsner der Professor Masaryk. Ja, dessen Rolle war vielleicht noch undankbarer. Keine Zeitung stand Masaryk bei, und er führte diesen Kampf allein.« [108] Also sah Egonek, der nun von christlichen Kindern als »Hilsner« beschimpft wurde [109], den Zeitpunkt gekommen, dem Schriftsteller und Philosophen Tomáš Garrigue Masaryk beizustehen: »Das war die Zeit, in der mir, umso mehr als ich einen Kinderdruckkasten besaß, die Idee kam, eine Zeitung zur Aufklärung der Massen herauszugeben.« [110]
Auch falls es diese Zeitung nie gegeben hat und sie nur eine Erfindung des älteren Kisch beim Verfassen des Marktplatzes der Sensationen war: Der Memoirenschreiber wollte klarmachen, dass seine Erfahrungen als Jude, als Außenseiter, entscheidend und prägend für ihn waren.
Eigentlich hätte es der Realgymnasiast Kisch bei der Fabrikation unveröffentlichter Schriften belassen müssen, denn Schülern war es streng verboten, Texte zu publizieren: »Mitarbeit an Zeitungen oder Zeitschriften beziehungsweise Einsendungen, auch wenn sie keine Veröffentlichung zur Folge haben«, wurden laut der Disziplinarordnung der Mittelschulen »auf das rigoroseste, gegebenenfalls mit Relegierung bestraft«.[111] Ein solches Verbot kam für Egonek fast einer direkten Aufforderung gleich. Und Angst vor dem »Karzer« hatte er schon mal gar nicht. So ließ er in der Vorweihnachtszeit des Jahres 1899 über einen Kunden seines Vaters dem Redakteur eines »vielgelesenen Wochenblatts« einige Gedichte zukommen. Unterzeichnet waren sie – wegen der »Disziplinarordnung« – mit »E. Kisch«. Da der Redakteur den Autor nicht kannte, legte er Hand an und veröffentlichte die Gedichte unter dem Namen »Erwin Kisch«. »Weiß Gott, wie er darauf kam, ich hatte niemals Erwin geheißen«, wunderte sich Kisch noch Jahrzehnte später. [112]
Jedenfalls, der Augenblick der Wahrheit nahte, nachdem der Lehrer Garzaroni – von den Schülern nicht ohne Grund »Karzeroni« genannt – Egonek gerade eine Fünf verpasst hatte. Wie beiläufig fragte er: »Ich habe in der letzten Zeit Gedichte von einem Kisch gelesen. Sind das etwa Sie?«
Weiß er? Ich bin blaß. Ich zittere. In einer Sekunde muß sich mein Schicksal entscheiden. »Nein«, antworte ich. Ganz zu verleugnen vermag ich meine Literatur aber nicht und füge hinzu: »Die Gedichte sind von meinem Bruder.« [113]
»Ihr Bruder scheint ja den Grips für die ganze Familie abbekommen zu haben«, sagte der Lehrer. Die Klasse lachte, Egonek lachte mit – und durfte auf dem »Nikolander« bleiben. [114]
So wurde »Egon Erwin Kisch« geboren.
4. Eine Jugend in Prag
Am 19. Januar 1901 verstarb Hermann Kisch, und schon wenige Monate darauf folgte ihm sein Bruder Samuel. [115] Kurz danach schloss »S. Kisch & Bruder« für immer seine Türen. Ernestine war immerhin finanziell abgesichert: Seit Jahren verfügte die Familie durch die Vermietung von Wohnungen, Ladenräumen und sogar eines »Eiskellers« im Bärenhaus über zusätzliche Einkünfte. [116]
Vielleicht hatte der Tod des Vaters Egoneks familiäres Verantwortungsbewusstsein geweckt, vielleicht hatte er sich während der Prüfungen einiger Hilfsmittel bedient, jedenfalls schaffte er entgegen allen Befürchtungen der Mutter den Schulabschluss. Welchen Beruf er ergreifen würde, das war Egonek bereits klar – Journalist! [117]
Wie alle anderen Schüler seiner Klasse wollte sich auch Egonek auf die Abituriententanzstunde vorbereiten. Wie er das anzustellen hatte, besagte eine »Bauernregel der Prager Gesellschaft« [118]: Als Bürgersohn ging man in das Lokal »Klamovka«, im gleichnamigen Prager Stadtteil, wo man sich mit einem Mädchen im Tanz erproben konnte, um es später draußen im Park näher kennenzulernen. Für Egonek und die anderen Bürgersöhne bedeutete dies, dass sie – wohl meist zum ersten Mal in ihrem Leben – engen Kontakt zu tschechischsprachigen Arbeiterinnen und Angestellten bekamen. Zuerst stieß sich ein Bürgersohn die Schuhspitzen und danach unverbindlich die Hörner ab. [119] Poetischer formuliert: »Die Schulter zuckt, das Auge schließt sich, die Sohle liebkost das Parkett, Musik und Lust und Weib ergießt sich mit dir in den Garten, Duft umfließt dich, und Strauch ist Kuß, und Nacht ist Bett.« [120]
Auf diese Weise lernte Egonek schnell, dass der Weg das Ziel ist. Im »Klamovka« entdeckte Egonek »höchste Moral in gegenseitigem Vertrauen, Lieben und Erfüllen, wie man es nur im manuellen Proletariat findet«. [121] Diese Erkenntnis blieb Kisch erhalten: Warum sich mit unnahbaren Bürgertöchtern abmühen, wenn man woanders auf gleichgesinnte, unkomplizierte Mädchen treffen konnte? Mädchen, die ohnehin wussten, dass sie für eine Ehe mit den Bürgersöhnen nie infrage kommen würden?
Während von den Töchtern des Mittelstands erwartet wurde, dass sie »unberührt« in die Ehe gehen würden, waren von Erwartungshaltungen unbelastete sexuelle Beziehungen zu den »niederen Klassen« oder Bordellbesuche für die Bürgersöhne der gesellschaftlich akzeptierte Weg, Erfahrungen auf diesem Gebiet zu sammeln. [122] Dass Kisch diese Art bürgerlicher Erfahrungsbereicherung auf Kosten der sozial benachteiligten Mädchen später stark idealisierte, bedeutet allerdings nicht, dass er es nicht genauso naiv empfunden hätte. »Wir lernten«, so Kisch in den Abenteuern, dass
die erste Liebe nicht dazu da sein muß, sich in ödem Ballgespräch, raffiniertem Kokettieren, Fächerspiel, Stammbuchversen und Kotillonbändern zu erschöpfen, daß es auch eine Liebe gibt, die keine Spielerei, keine Berechnung und keine Abwägung der Konsequenzen kennt, eine junge Liebe, die glücklich machen kann und unglücklich für ein Leben. [123]
Auch Kischs Freund Max Brod sah das so: Es sei kein Zufall gewesen, dass Egonek und er »jene Vergnügungen vorzogen, die sich nicht im Rahmen der gesicherten Prager Bürgerlichkeit abspielten, der wir doch eigentlich angehörten« [124]. Sondern dass
wir lieber zum Dienstmädchenball im »Apollo« auf dem Fügnerplatz gingen als zum »Kommerziellen«, daß wir, wie man es damals zu nennen pflegte, »sozial eine Stufe hinabstiegen« und uns besonders gern in jenen übel berüchtigten Lokalen herumtrieben, die Paul Leppin besungen hat, die in Kischs ›Prager Gassen und Nächten‹ […] ihren düsteren Glanz verbreiten. [125]
Und Brod erkannte natürlich auch, dass beim »Hinabsteigen« durchaus ein gewisser »literarischer Snobismus« eine Rolle spielte, wenn auch vermischt mit einer »echten Liebe zu allem Volkhaften, Ursprünglichem, Naiven«. [126]
Im Oktober 1903 fasste Egonek dann einen erstaunlichen Entschluss: Obwohl er doch eigentlich Journalist werden wollte, immatrikulierte er sich an der »Kaiserlich-Königlichen Deutschen Technischen Hochschule in Prag. [127] Wollte er der Mutter zuliebe zumindest versuchen, den krisenfesten Beruf eines Bauingenieurs zu erlernen? Oder wollte Egonek es einfach seinem zwei Jahre älteren Bruder Paul gleichtun, der in der Studentenverbindung »Saxonia« Mensuren ausfocht und nebenbei studierte?
Immerhin: Im Gegensatz zu fast allen anderen Burschenschaften Österreich-Ungarns und Deutschlands hatten sich die Prager Verbindungen geweigert, den antisemitischen »Waidhofener Beschluss« anzuerkennen, der Juden grundsätzlich die Satisfaktionsfähigkeit versagte. [128] Erstaunlich ist es trotzdem, dass sich Paul Kisch für derartige Deutschtümelei – die ja immer auch antitschechisch [129] war – begeistern konnte. Pauls Freunde und Klassenkameraden Kafka und Bergmann hatten bereits als Gymnasiasten bei einem gemeinsamen Umtrunk mit Kooperationsstudenten erlebt, was passieren konnte, wenn man sich weigerte, gleich allen anderen Anwesenden aufzuspringen und »Lieb Vaterland, magst ruhig sein!« zu schmettern: Sie wurden von den »Burschen« aufgefordert, die sangesfreudige Gemeinschaft zu verlassen. Kafka, schon als Gymnasiast ein begeisterter Sozialist, und sein Freund Bergmann, der ebenso begeisterte Zionist, [130] waren damit gegen jede Deutschtümelei – auch wenn sie liberal daherkam – gründlich geimpft.
Egonek wählte einen Mittelweg: Er wurde »Ehrenbursch« der »Saxonia«, [131] stand also immerhin mit einem Fuß innerhalb der Verbindung. Auch wenn er kein ordentliches Mitglied war und Paul gegenüber gern über die Couleur-Studenten lästerte [132], so schaffte es Kisch auf eigene Faust, sich einen Namen als Fechtkünstler zu machen. Im Oktober 1903 gründete er mit anderen Kommilitonen einen Fechtzirkel. Den Unterricht übernahmen erfahrene Lehrer der Landesfechtschule. [133]
In den Abenteuern schreibt er:
Der Schreiber dieser Zeilen hat unter anderem im Ausschank eines jüdischen Branntweinhändlers in der Zigeunergasse gegen den Obmann des völkisch-antisemitischen Lese- und Redevereines »Germania«, in der Garage eines deutschen Hotels auf der Unteren Neustadt gegen einen Herrn, der heute im tschechisch-nationalen Leben der Republik eine Rolle spielt, und gegen einen zionistischen Arzt aus Czernowitz in einem verfallenen Klostertrakt gefochten. [134]
Und selbst noch Jahre nach seinem zwei Semester dauernden akademischen Intermezzo, von denen er das zweite als »außerordentlicher« Universitätsstudent der Literatur widmete [135], als Kisch längst als Reporter etabliert war, zeigte er noch stets eine Neigung zum Duellieren. So fand im Sommer 1912 ein Duell mit dem Kollegen und »Saxonen« Richard Katz statt. [136] Der Prager Korrespondent der Wiener zionistischen Jüdischen Volksstimme berichtete genüsslich über den »Zweikampf der beiden deutschen Recken«. Diese »sollen durch nahezu fünf Stunden einander mit den Säbeln gekitzelt haben und dann unverletzt, aber versöhnt mit gestärktem deutschen Volksbewußtsein geschieden sein«. [137]
Es wäre allerdings leichtfertig, von der Neigung zum Duellieren automatisch auf eine konservative, nationalistische Gesinnung der Duellanten zu schließen: So fanden allein zwischen 1898 und 1904 in Frankreich vierzig Duelle zwischen Dreyfus’ Verteidigern und seinen antisemitischen Gegnern statt. Der Sozialist Ferdinand Lassalle starb mit nur 39 Jahren nach einem Pistolenduell, und selbst der französische Pazifist Jean Jaurès war stets bereit, im Namen der Ehre zum Säbel zu greifen. [138] Kischs Vorliebe für das Duell entsprach sowohl dem Zeitgeist als auch seinem Temperament. Und er hatte fraglos auch das Bedürfnis, seine Geschlechtsgenossen zu beeindrucken. Dabei hatte er ja eigentlich ausgiebig Gelegenheit, sich bei den Spielen seiner Fußballmannschaft »DCB Sturm Prag« in Szene zu setzen.
Kischs Freund Joseph Roth hat es 1938, zu fortgeschrittener Stunde in einem Pariser Café, auf den wesentlichen Punkt gebracht: »Ich war immer, wo ich auch war, und was für Klamotten ich auch trug, ein österreichischer Offizier.« [139] Er bewahrte sich seine Liebe für den kaiserlichen Offiziersrock und die von ihm symbolisierten Ideale. Und auch Kisch konnte sich wohl nicht ganz dem Zauber der Offiziersuniform entziehen, wenn auch seine Entscheidung, ab Oktober 1904 den »einjährig-freiwilligen« Militärdienst zu absolvieren, vor allem praktische Gründe hatte: Wieso sich drei Jahre lang als gemeiner Soldat schinden lassen, wenn man das Recht hat, nur ein einziges Jahr Militärdienst zu absolvieren und fortan Reserveoffizier zu sein?
Auch im Frieden hatte dies durchaus gewisse Vorteile: Geriet man mit dem Gesetz aneinander, konnte man aufgrund seines Status oft auf eine unverdiente Milde des Richters hoffen. Wurde man allerdings beim Verrichten körperlicher Arbeit ertappt, konnte man vor einem »Ehrenrath« landen und seines Titels verlustig gehen. [140]
Während seines einjährigen Militärdienstes schaffte es Kisch angeblich, 147 Tage in der Arrestzelle zu verbringen. [141] Für den Bürgersohn Egonek wurden die Tage und Nächte hinter Gittern zu einer ganz besonderen Art »Universität«. Viel von seiner später gezeigten erstaunlichen Fähigkeit, sich ungeachtet seiner bürgerlichen Herkunft wie ein Fisch im trüben Wasser der Prager und Berliner Unterwelt zu bewegen, hat hier seinen Anfang genommen.
Meine Mitgefangenen erklärten einander verschiedenartige Praktiken beim Gebrauch des Dietrichs, sie unterhielten sich über Leben und Treiben in den Spelunken, über ein Zuhälterkonsortium und den Handel mit Jungfrauenschaft und über die Möglichkeit von Fluchtversuchen aus Inquisitionsspital und Garnisonsgericht. Das war eine andere Welt als die, in der ich bisher gelebt, da gab’s manches zu lernen, manches zu verlernen. Ich, der ich nicht einmal mit einem meiner Brüder aus der gleichen Kaffeetasse getrunken hätte, trank jetzt aus der Schnapsflasche, die reihum ging. Ich sog an dem gemeinsamen Zigarrenstummel. Ich ließ mich tätowieren, um zu beweisen, daß ich mich weder fürchte noch ekle vor der rostigen Nadel und dem schmutzigen Lappen, mit dem das ausströmende Blut und die einströmende Farbe auf der durchlöcherten Haut verrieben wurden. [142]
Die Geschichte seiner ersten Tätowierung nimmt im Werk Egon Erwin Kischs eine besondere Stellung ein. Wie kaum in einer anderen seiner Geschichten geht hier die Freude am Fantasieren mit ihm durch. Dabei scheint es dem Erzähler völlig egal zu sein, dass er seine unbändige Lust an der Pointe unübersehbar auf die Spitze treibt. Tatsache ist: Kisch trug auf seinem Rücken eine amateurhaft ausgeführte Tätowierung: das Bild eines Mannes, dessen Zunge Richtung Steißbein zeigt. Nun mag dies tatsächlich jene Tätowierung sein, die der »Einjährige« Kisch während seines Arrests erhielt. Doch ließ sich, wie Kisch behauptet, in dieser stümperhaften Tätowierung in der Tat sein damaliger Oberst erkennen?
Falls die Geschichte bis hierhin tatsächlich stimmt, hätte dies ja bereits als Pointe ausgereicht. Doch Kisch dreht das Rad seiner Geschichte weiter:»In der Nacht schwoll das Gemälde – es war mit Stiefelwichse eingestochen – dergestalt an, dass ich mich zur Marodenvisite melden musste.« [143] Und was der Leser bereits ahnt, das geschah dann angeblich auch: Der Arzt erkannte sofort, wen die Tätowierung darstellen sollte, und erstattete Anzeige gegen Kisch. Seinen Beteuerungen, er hätte nicht geahnt, was oder wen die Tätowierung zeigt, schenkte natürlich niemand Glauben.
Mit einigem gutem Willen könnte man diese Wendung der Geschichte als Schlusspointe akzeptieren. Doch Kisch konnte der Versuchung nicht widerstehen, noch eine stärkere Pointe draufzusetzen: Der porträtierte Oberst sei vom Anblick der Tätowierung so geschockt gewesen, dass er einen Schlaganfall erlitt und verstarb! Sollte Kisch, wie er es mitunter gerne tat, auch diese Geschichte zunächst im Kaffeehaus »ausprobiert« haben, dürfte er gemerkt haben, dass seine Zuhörer irgendwann auf die Glaubwürdigkeit pfiffen, zu groß war ihr Spaß dabei.