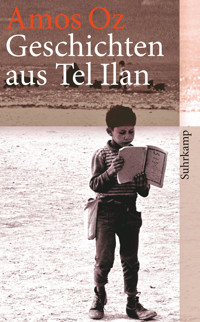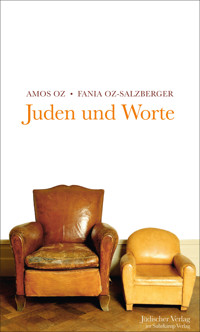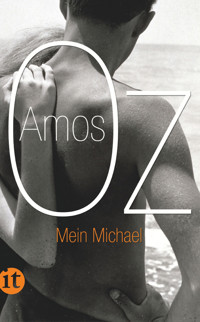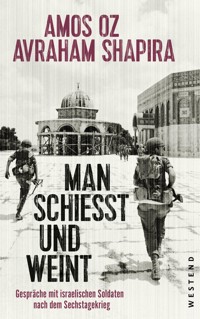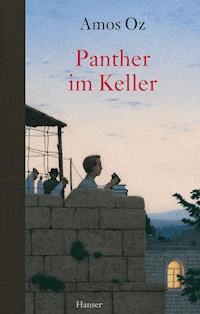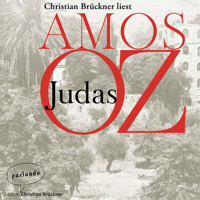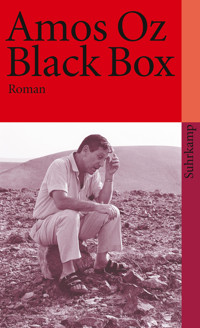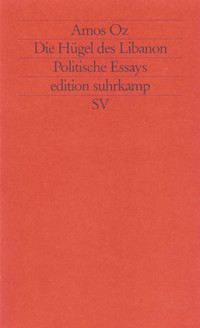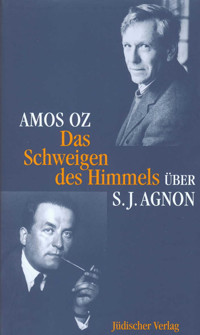17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit den jüdischen Einwanderungswellen nach Palästina und verstärkt durch die Gründung des Staates Israel im Jahre 1948 ist es zwischen der jüdischen Bevölkerung und deren arabischen Nachbarn zu heftigen Auseinandersetzungen, die in Kriege mündeten, gekommen. Diese Entwicklung prägte und prägt nicht nur die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse des Landes, sondern auch das Verhalten der einzelnen Menschen. Amos Oz ist der erzählende Chronist der realen, geistigen und emotionalen Verhältnisse Israels. Sein Roman Ein anderer Ort zeichnet mit der kleinen Welt des Kibbuz einen Mikrokosmos dieses Landes.
Der Kibbuz liegt an der nördlichen Grenze Israels. Auf den ersten Blick erscheint er, zu Beginn der sechziger Jahre, als ein kleines Paradies auf Erden. Doch wird er zweifach bedroht: von außen, da auf den Bergen über dem Ort feindliche Stellungen lauern. Von innen: Hinter der harmonischen Außenseite tun sich Spannungen auf, verstricken sich die Menschen in verquere Liebesverhältnisse, werden ideologische Differenzen ausgetragen. Amos Oz zeigt in seinem humorvollen, vielstimmigen Roman, der moralische Wertungen vermeidet und auch dem Klatsch die ihm im Kibbuz gebührende Rolle einräumt, die eruptive Gewalt der Leidenschaften und der weltanschaulichen Gegensätze – und die Art und Weise, wie sie, vielleicht, versöhnt werden können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Amos OzEin anderer Ort
Roman
Aus dem Hebräischen von Ruth Achlama
Suhrkamp
Titel der Originalausgabe: Makom acher
eBook Suhrkamp Verlag 2025
Der vorliegende Text folgt der 6. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 3448
© Amos Oz 1966
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin, 2001
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
eISBN 978-3-518-78502-7
www.suhrkamp.de
Dem Andenken meiner Mutter Fanya
Meint nicht, Mezudat Ram sei ein Tropfen, der das große Meer widerspiegeln will. Seine Einwohner sind nicht von hier. Höchstens möchte es Abbild eines Seereiches sein, das an einem anderen Ort besteht, weit von hie.
Inhalt
1. Teil: Gegenüber den Fischern
1. Ein perfektes und herzerfreuendes Dorf
2. Ein hervorragender Mann
3. Stella Maris
4. Bronka hört vereinzelte Schüsse
5. Eine Frau sein
6.
Eine andere Traurigkeit
7. Ein schlechter Traum
8. Vor langen Zeiten
9. Altes Weh
10. Vielleicht an einem anderen Ort
11. Tiere und Pflanzen
12. Die segensreiche Routine
13. Eine derbe Hand
14. Auf drei Wegen
15. Blendung
16. Dunkle Triebe
17. Frau
18. Haß
19. Am Schabbat
20. Zwei Frauen
21. Heimtücke
22. Der Klöppel der Weltglocke
23. Wenn es Gerechtigkeit gibt
24. Gedichte lesen
25. Mehr von der segensreichen Routine
26. Einfache Leute, Fischer
2. Teil: Inbal – Glockenklöppel
1. Eine negative Gestalt
2. Eine der Unseren bist du
3. Ein Wintermensch
4. Glockenklang und ein Anflug von Wehmut
5. Ein goldener Dolch
6. Ein flüchtiger Gast
7. Herbert Segal erweist sich als ebenbürtiger Gegner
8. Eine positive Seite
9. Siegfrieds Geheimnisse: Ein dürrer Baum
10. Wir fahren, sei bereit
11. Dumpf, dumpf in der Nacht
12. Meines Bruders Hüter?
Letztes Bild
Erster Teil: Gegenüber den Fischern
1. Kapitel: Ein perfektes und herzerfreuendes Dorf
Vor euch liegt der Kibbuz Mezudat Ram.
Die Gebäude sind streng symmetrisch am Ende des grünen Tals angeordnet. Die dichtgekrausten Zierbäume brechen den strengen Grundriß nicht auf, zeichnen die Linien nur weicher und verleihen ihnen Gewicht.
Die Häuser sind weiß. Die meisten haben schmucke rote Dächer – leuchtend rote, nicht weinrote. Diese vorherrschende Farbe hat etwas Trotziges gegenüber den östlichen Bergen, an deren Fuß der Kibbuz liegt. Die Gebirgskette riegelt den Horizont im Osten rundum ab. Schroff und zerklüftet sind die Berge, von wilden Schluchten durchschnitten, nackte Felsmassen, deren Schatten dunkel in ihre Falten fallen und im Sonnenlauf langsam abwärts gleiten, als wollten die Berge in ihrer Öde sich mit dem melancholischen Schattenspiel zerstreuen.
Am Saum der Hänge, den unteren Felsabsätzen entlang, verläuft die Grenze zwischen dem Land des Staates und den Ländern seiner Feinde. Diese Grenze, auf Landkarten unübersehbar mit einer dicken grünen Linie markiert, ist im Gelände für das Auge unerkennbar, da sie nicht der natürlichen Trennlinie zwischen dem frischen Grün des Tals und der dürren Ödnis der Berge folgt. Das israelische Gebiet erstreckt sich ja, wie gesagt, über die Talsohle hinaus auf die unteren Hangstufen des kahlen Felsmassivs. Dadurch entsteht eine krasse Diskrepanz zwischen Augenschein und Wissen oder – genauer gesagt – zwischen den geologischen und den geopolitischen Gegebenheiten. Der Kibbuz selbst – sein Name bedeutet Hohe Feste – liegt rund drei Kilometer von der Staatsgrenze entfernt. Präziser können wir die Entfernung nicht angeben, ohne die blutigen Meinungsverschiedenheiten der beiden verfeindeten Staaten über den wahren Grenzverlauf zu erörtern.
Die Landschaft ist also reich an Gegensätzen – solchen zwischen Augenschein und tatsächlichen Gegebenheiten und solchen zwischen Teilbereichen des Augenscheins. So müssen wir notgedrungen erneut das Wort »Trotz« bemühen, denn das von geometrisch angelegten, kultivierten Feldern bedeckte Tal ist dem wilden, einsamen Bergzug gegenüber ja feindselig eingestellt. Auch die architektonische Symmetrie Mezudat Rams wirkt trotzig gegenüber dem Naturchaos, das grimmig und verschlossen von oben auf den Kibbuz herabblickt.
Der Gegensatz zwischen den Landschaftsteilen dient dem örtlichen Poeten von Mezudat Ram naturgemäß als Grundmotiv, gewinnt gelegentlich sogar Symbolwert, wie wir feststellen werden, wenn wir uns mit Ruven Charischs Lyrik befassen. Vorerst jedoch wollen wir dem Dichter seinen Lieblingskontrast entlehnen und ihn auf Dinge ausdehnen, die er selbst nicht in Verse kleidet.
Nehmen wir zum Beispiel den krassen Gegensatz zwischen dem äußeren Erscheinungsbild unseres Dorfes und dem eines Dorfes des Typus, der im Herzen des Großstädters wehmütige Sehnsucht weckt. Sind eure Augen an das Bild alter Dörfer gewöhnt, deren verwinkelte Dächer in vielerlei nördlichen Formen emporragen; verbindet ihr das Wort »Dorf« mit hochgetürmten, pferdegezogenen Heuwagen, in deren Flanken die Forken stecken; sehnt ihr euch nach einer Ansammlung engstehender Hütten, in deren Mitte sich düster ein verwitterter Kirchturm erhebt; halten eure Augen Ausschau nach fröhlichen Bauern in bunten Trachten und breitkrempigen Hüten, nach malerischen Taubenschlägen, einer munter auf dem Misthaufen pickenden Hühnerschar, freilaufenden Rudeln magerer, bösartiger Dorfhunde, mehr noch – erwartet ihr am Dorfrand dichte Waldungen, gewundene Feldwege, umzäunte Weiden, offene Wasserläufe, in denen sich niedrige Wolken spiegeln, sucht ihr eingemummte Wanderer, die einer schützenden Herberge bedürfen – ja seht ihr darin das Wesen der Dörflichkeit, dann wird unser Dorf euch mit seiner krassen Abweichung von diesem Bild wohl verblüffen, einer Diskrepanz, die uns zwingt, hier erneut den »Trotz« heranzuziehen. Denn unser Dorf ist in optimistischem Geist errichtet.
Die Häuser der Einwohner sind eins wie das andere, getreu der Weltanschauung des Kibbuz, die in keinem Dorf der Welt ihresgleichen hat. Ruven Charischs wohlbekannte Zeilen vermitteln die Quintessenz dieses Gedankens:
Entgegen einer verderblichen Flut von falschem Glanz, Entgegen Sodoms Satzung und Totentanz, Entgegen einer wahnsinnigen Welt, die Übel verficht, Entgegen trunkenem Wüten und Schreckensgericht – Entzünden wir mit unserm Herzblut hier ein
Fünkchen Licht.
Die Häuser sind, wie gesagt, von heller Färbung. Sie sind in gleichmäßigen Abständen voneinander aufgereiht. Die Fenster gehen allesamt nach Nordwesten, weil die Baumeister die klimatischen Bedingungen berücksichtigen wollten. Hier gibt es kein über Generationen planlos gewachsenes Häusergewirr, auch keine Gebäudegevierte, die verborgene Höfe umschließen, denn der Kibbuz kennt keinen Familienbesitz. Und gewiß existieren keine getrennten Viertel für verschiedene Handwerkszweige. Weder sind am Dorfrand Armenbehausungen angesiedelt, noch ist die Ortsmitte Kaufleuten und Honoratioren vorbehalten. Klare Linien und saubere Formen sowie die schnurgerade Ausrichtung der Betonwege und Rasenstücke sind Ausflüsse einer festgefügten Weltanschauung. Eben das meinten wir mit unserer Behauptung, daß unser Dorf in optimistischem Geist erbaut sei.
Wer daraus den seichten Schluß ziehen sollte, unser Dorf sei steril und daher weder hübsch noch malerisch, bezeugt damit nur seine Voreingenommenheit. Zu Recht werden wir sein Urteil mit einem Achselzucken abtun und uns von seinem fragwürdigen Geschmack distanzieren. Denn der Kibbuz ist nicht dazu da, die sentimentalen Erwartungen der Großstädter zu erfüllen. Unser Dorf ist sehr wohl hübsch und malerisch, aber seine Schönheit ist von männlich vitalem Charakter, und das Pittoreske birgt hier eine Botschaft. So.
Die Straße, die unseren Kibbuz mit der Landstraße verbindet, ist schmal und holperig, dabei aber pfeilgerade. Wenn ihr uns besucht, müßt ihr bei dem weiß-grünen Wegweiser von der Hauptstraße abbiegen, wegen der Schlaglöcher das Tempo verlangsamen und kurz vor dem Kibbuztor einen hübschen kleinen Hügel hinauffahren. (Man halte diesen grünen Hügel mit seinen bestellten Böden nicht etwa für einen Bergfinger, der wütend zur Talmitte ausgestreckt und dann abgetrennt worden wäre, denn er hat nichts mit den drohenden Bergen gemein.) Halten wir hier einen Moment inne, um uns die herrlich bunte Postkartenlandschaft einzuprägen. Von der Anhöhe können wir erneut den Kibbuz betrachten. Nun, der Anblick ist nicht gerade überwältigend, erfreut aber zweifellos das Auge: breite Eisentore, ein Zaun mit V-förmigem Stacheldrahtaufsatz und ganz vorn – der Maschinenschuppen. Landwirtschaftsgeräte sind stehend und liegend mit einer Lässigkeit in der Gegend verstreut, die Schaffensfreude signalisiert. Die Stallungen für Rinder, Schafe und Geflügel sind nach modernsten Erkenntnissen erbaut. Asphaltierte Wege zweigen nach hier und dort ab, und dichte Zypressenalleen unterstreichen den Grundriß der Anlage. Ein Stück weiter steht der Speisesaal, umgeben von gepflegten Blumenrabatten, ein ausgesprochen moderner Bau, dessen leichte Linienführung seine Größe überspielt. Ihr werdet euch gleich davon überzeugen können, daß sein Inneres dem Äußeren nicht nachsteht. Es strahlt feine, schlichte Eleganz aus.
Hinter dem Speisesaal teilt sich die Ortschaft in zwei Wohnbereiche, hüben die Alteingesessenen, drüben die jungen Leute. Die Wohnhäuser baden in einer Fülle kühlen Grüns, überschattet von ausladenden Zierbäumen, umrahmt von frischem Rasen und dekorativen Blumenrabatten in allen Farben. Das sanfte Wiegen und Rauschen der Kiefernnadeln erfüllt dort ständig die Luft. Der hohe Getreidespeicher am Südende und das hohe Kulturhaus am Nordende durchbrechen die niedrige Einheitlichkeit und verleihen der Siedlung eine Höhendimension. Vielleicht vermögen sie in gewissem Maß den fehlenden Dorfkirchturm zu ersetzen, der für euch doch zum typischen Dorfbild gehört, ob ihr es nun wahrhaben wollt oder nicht.
Am Ostende, am weitesten von unserem Aussichtspunkt entfernt, hat das Barackenviertel seinen Platz. Es dient der Unterbringung von Praktikantengruppen, Freiwilligen beim Arbeitseinsatz und Militäreinheiten – all jenen, die zu uns kommen, um für eine gewisse Zeit mit anzupacken. Diese Baracken verleihen dem Ganzen einen pionierhaften Anstrich, den Charakter einer bedrohten Grenzsiedlung, jederzeit bereit, der Gefahr beherzt ins Auge zu sehen. Verstärkt wird dieser Eindruck durch den Zaun mit Stacheldrahtaufsatz, der den Kibbuz von allen Seiten umgibt. Wir verharren einen Augenblick an diesem Punkt und erwarten eure gebührende Bewunderung.
Nun wollen wir die Augen heben und die blühenden Felder rings um die Ortschaft betrachten. Das Herz wird einem weit. Leuchtend grüne Futterpflanzen, schattige Obstgärten, sonnengoldene Getreidefelder, tropisch üppig anmutende Bananenplantagen, Weinberge, die sich bis zur Felsgrenze den Hang hinaufziehen, die Reben nicht wild wuchernd, sondern sorgfältig in schnurgeraden Reihen an Stäbe gebunden. Erfreulicherweise unternimmt der Rebgarten einen bescheidenen Vorstoß in die Bergregion. Davon zeugen die leicht aufwärts gekrümmten Reihenenden, die an ein lässig gebeugtes Knie erinnern. Wir wollen jetzt kein weiteres Gedicht von Ruven Charisch rezitieren, verhehlen jedoch nicht unseren bescheidenen Stolz über den scharfen Gegensatz zwischen kultivierter Ebene und dräuendem Berg, fruchtbarem Tal und feindlichem Gebirge, unverbrüchlichem Optimismus und dem, was sich jeder Ordnung entzieht und mit satanisch hochmütiger Fratze von droben auf unser gutes Werk herabblickt.
Knipst jetzt bitte die letzten Fotos. Die Zeit drängt. Wir kehren zum Bus zurück und fahren das letzte Stück Weg zwischen grünen Feldern.
Ach, der Jordan? Den haben wir doch bereits überquert. Ja. Diese flache Brücke. An dieser Stelle ist der Fluß zu dieser Jahreszeit äußerst schmal. Die Füße könnt ihr auf der Rückfahrt hineintauchen, nach dem Rundgang mit Führer durch den Kibbuz. Wir befinden uns auf dem letzten Streckenstück, durchfahren das Tor. Gleich könnt ihr die müden Lebensgeister mit kühlem Wasser erfrischen. Ja, die Luft ist – wie üblich in dieser Gegend – feuchtheiß. Trösten wir uns mit der bekannt herzlichen Gastfreundschaft der Kibbuzbewohner. Willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen.
2. Kapitel: Ein hervorragender Mann
Logischerweise müßte Ruven Charisch Touristen abgrundtief hassen. Ein Tourist hat sein Leben zerrüttet. Das ist einige Jahre her. Noga war zehn und Gai drei, als Eva Mann und Kinder verlassen hat, um einen Touristen zu heiraten, einen Verwandten, ihren Cousin Isaak Hamburger, der drei Sommerwochen bei uns hier in Kibbuz Mezudat Ram zu Gast weilte. Es war eine häßliche Geschichte, sagen wir. Dunkle Triebe krochen aus Höhlen hervor, um zu sengen und zu brennen. Jetzt wohnt Eva mit ihrem neuen Mann in Deutschland. Dort, in München, führen sie einen Nachtklub, gemeinsam mit einem anderen werten Juden namens Sacharja Siegfried Berger, einem cleveren, gewieften Junggesellen. Man möge uns verzeihen, daß wir kaum dazu fähig sind, über dieses Ereignis und seine Beteiligten ohne moralische Entrüstung zu reden.
In der Tat, logischerweise müßte Ruven Charisch Touristen zutiefst hassen. Allein schon ihr Vorhandensein erinnert ihn an sein Unglück. Zu unserer Verblüffung hat Ruven sich jedoch gerade die Touristenbetreuung in unserem Kibbuz zur ständigen Aufgabe gemacht. Zwei-, dreimal pro Woche opfert er einen Teil seiner Freizeit für diesen Zweck. Wir sind es schon gewohnt, seine große, asketische Gestalt an der Spitze eines bunten Touristenschwarms durch den Kibbuz wandern zu sehen. Mit seiner freundlich warmen Stimme legt er den Besuchern die Grundzüge der Kibbuzidee dar. Weder läßt er sich zu Allgemeinplätzen hinreißen, noch übergeht er abstrakte Grundsätze, und niemals würde er die exotischen Erwartungen seiner Zuhörer bedienen. Seine entschiedene Geradlinigkeit duldet keine Kompromisse und keine Ausflüchte. In seiner Jugend war er von glühendem Eifer erfüllt. Im Lauf der Jahre hat dieser einem bedachteren Streben Platz gemacht, das keinerlei Hochmut kennt, dafür aber strenge Askese, wie es sie reiner nicht gibt. Dieser Mann hat Schmerz kennengelernt, hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt zu verbessern, und weiß um die Wechselfälle des Lebens, die sich nicht in einfache Formeln pressen lassen.
Es ist löblich, wenn ein leiderprobter Mensch danach strebt, die Gesellschaft zu verbessern und Leiden aus der Welt zu schaffen. Gewiß gibt es Leidgeprüfte, die in ihrem Unglück die Welt hassen, sie tagtäglich mit glühenden Flüchen versengen wollen. Aufgrund unserer Weltanschauung lehnen wir Haß und Fluch ab. Nur ein seelisch verkrümmter Mensch wird das Dunkel dem Licht vorziehen. Und es ist doch sonnenklar, daß seelische Verkrümmung das krasse Gegenteil von Geradlinigkeit ist, ein Gegensatz wie der zwischen Tag und Nacht.
Anfangs wunderte uns Ruven Charischs Entschluß, Touristen zu betreuen. Er mutete seltsam an, widersprach der elementaren Logik. Klatschmäuler versuchten, die geheimen Gedankengänge dahinter zu entschlüsseln, sagten zum Beispiel, manchmal wolle der Mensch sich an die schlechten Dinge erinnern, in seelischen Wunden stochern. Jemand meinte, es gebe Wege, um ein Schuldgefühl zu bemänteln. Ja man hörte sogar die extreme Erklärung, von der wir uns allerdings energisch distanzieren, wonach der Mann eine junge Touristin verführen wolle, um seine Schmach mit Gleichem zu vergelten. Und man redete noch einiges mehr.
Wer Klatsch nicht schätzt, beweist damit nur, wie wenig er unser Kibbuzleben kennt. Klatsch und Tratsch – oh reißt jetzt nicht entsetzt die Augen auf – erfüllen hier eine äußerst wichtige Aufgabe und helfen auf ihre Weise, die Welt zu verbessern. Um diese These zu untermauern, möchten wir, mit Verlaub, Ruven Charisch selbst zitieren: Das Geheimnis liegt in der Selbstläuterung. Das Geheimnis liegt darin, daß wir einander Tag und Nacht gnadenlos und unbarmherzig richten. Hier ist jeder Mensch Richter und Gerichteter, es gibt keine Schwäche, die lange dem Auge des Gesetzes verborgen bliebe. Es gibt keine verschwiegenen Ecken. Jeden Tag, jede Minute deines Lebens wirst du gerichtet. Deshalb muß jeder hier wohl oder übel gegen seine eigene Natur ankämpfen. Sich läutern. Wir schleifen einander ab, wie der Bach die Kiesel glattschleift. Bekämpfen unsere Natur. Denn was ist die Natur anderes als blinder, egoistischer Instinkt ohne Entscheidungsfreiheit? Und die Entscheidungsfreiheit ist, laut Ruven Charisch, schließlich das, was den Menschen vom Tier unterscheidet.
Ruven hat vom Richten gesprochen. »Klatsch« ist nur ein anderes Wort dafür. Kraft des Klatsches beherrschen wir unsere Triebe, unterjochen wir unsere Natur, werden wir ein klein wenig besser. Die Macht des Klatsches ist bei uns deshalb so groß, weil unser Leben offenliegt wie ein sonnenüberfluteter Hof. In unserer Mitte lebt eine Witwe namens Fruma Rominow, die den Klatsch besonders pflegt. Ihre Urteile sind streng, entspringen aber einem glühenden Herzen. Wenn einige unter uns ihre scharfe Zunge fürchten, müssen sie notgedrungen ihre Schwächen besiegen. Wir wiederum richten auch die Witwe, werfen ihr übermäßige Verbitterung vor und bezweifeln gar ihre Treue zur Kibbuzidee. Deshalb muß Fruma Rominow ihren Trieb unterdrücken und allzu boshafte Sprüche unterlassen. Dies wäre eine Illustration für das Gleichnis von Bach und Bachkiesel. Der Klatsch zählt zu den schlechten Eigenschaften. Bei uns wird jedoch auch dieses Laster in den Dienst der Weltverbesserung gestellt.
Nachdem Eva ihren Cousin Isaak Hamburger geheiratet hatte, zog sie mit ihrem neuen Mann nach München und unterstützte ihn im Vergnügungsgewerbe. Nachrichten, die uns auf Umwegen von dort erreichen, künden von ungeahnten Fähigkeiten, die sie nun entwickle. Dank ihres guten Geschmacks habe sie dem Kabarett von Berger und Hamburger eine außergewöhnliche Note verliehen, erklärt unser zuverlässiger Informant, dessen Identität wir alsbald preisgeben werden. Die Gäste strömten nur so in dieses Etablissement, um ein rares Vergnügen zu erleben, das die Fantasie reize. Aus Gründen der Moral werden wir nicht ins Detail gehen.
Eva hatte seit jeher Talent fürs Praktische, eine sprudelnde Energie und eine überbordende Phantasie, die sich unablässig künstlerisch artikulieren wollte. Derlei Eigenschaften, in einer treuen Gattin vereint, sind ein prickelnder Genuß für den klugen Ehemann. Außerdem war Eva Hamburger selbst als erwachsene Frau mit zerbrechlicher, gazellenhafter Schönheit gesegnet.
Vor langer Zeit schrieb Eva Ruvens frühe Verse mit ihrer schrägen Handschrift ins reine. In einem besonderen Album bewahrte sie die Ausschnitte aus den Presseorganen der Kibbuzbewegung auf, die seine ersten Gedichte abdruckten, und schmückte die Seiten mit feinen Bleistiftzeichnungen. Warme Heiterkeit lag über ihrem ganzen Tun. Trotz ihrer Untreue können wir nicht vergessen, mit wieviel Freude und Geschmack sie die Treffen des kleinen Kreises von Liebhabern klassischer Musik in unserem Kibbuz leitete. Bis der Teufel in sie fuhr.
Ruven Charisch ertrug den Schlag mit bewundernswerter Selbstbeherrschung. Nie hätten wir gedacht, daß diese strikte, verbissene Schicksalsergebenheit in ihm stecke, die er bei seinem Unglück zeigte. Keinen einzigen Tag vernachlässigte er seine Arbeit als Klassenlehrer einer der mittleren Klassen unserer Volksschule. Seine unterdrückte Verzweiflung enthielt keine Spur von Bösartigkeit oder Haß. Die Trauer erhöhte spürbar seine Sensibilität. Hier im Kibbuz Mezudat Ram umgibt ihn eine Aura allgemeiner Sympathie. Seine mutterlosen Kinder betreut Ruven Charisch mit unauffälliger Hingabe. Seht nur, wie er gegen Abend im Kibbuz spazierengeht, ein blaues Hemd zur verwaschenen Khakihose am Leib, Noga und Gai zur Rechten und zur Linken, den Kopf gesenkt und emsig bedacht, kein Wort seiner Kinder zu überhören, selbst wenn deren Geplapper keinen rechten Sinn ergibt. Die Augen des Mädchens sind groß und leuchtend grün wie die ihres Vaters; der Junge hat die warmen, dunklen Augen seiner Mutter geerbt. Beiden Kindern ist ein lebhaftes Empfindungsvermögen eigen. Ruven achtet sorgfältig darauf, ihnen in allem nahezusein, ohne rücksichtslos in ihr Innerstes einzudringen. Er ist ihnen gestrenger Vater und liebevolle Mutter zugleich. Aus Liebe zu seinen Kindern hat Ruven Charisch angefangen, Kinderreime zu schreiben. Seine Gedichte sind nicht die eines albernden Erwachsenen, sondern die eines greisen Kindes. Sie enthalten keine lauten Späße, sehr wohl aber feinen Humor und innige Musikalität. Der Verlag der Kibbuzbewegung hat gut daran getan, einen Band mit Kinderliedern unseres Lokaldichters Ruven Charisch in ansprechender Aufmachung herauszubringen. Dem Band sind Zeichnungen von Eva aus früheren Zeiten beigegeben, vor der Sintflut. Zwar sind sie seinerzeit nicht zur Illustration von Kinderreimen entstanden und decken sich nicht mit deren Inhalt, aber es besteht die reinste Harmonie zwischen Bildern und Versen. Auch das ist ein Rätsel, das sich mit elementarer Logik nicht lösen läßt. Natürlich kann man den Einklang damit erklären, daß Eva und Ruven doch trotz allem im Grunde, dem Wesen nach – und so weiter und so fort. Vielleicht gibt es eine andere Erklärung. Oder auch gar keine.
Jedenfalls verfaßt Ruven seine Gedichte nicht in der Absicht, die Kinder mit Clownerien zu unterhalten. Wie seine Erwachsenengedichte wollen sie die Welt auf poetische Weise interpretieren, in schlichten Worten und Bildern, die ins Herz dringen.
Jetzt werden wir ein kleines Geheimnis verraten. Merkwürdigerweise ist eine indirekte Verbindung zwischen Ruven Charisch und seiner geschiedenen Frau, zwischen Eva Hamburger und ihren betrogenen Kindern erhalten geblieben. Isaak Hamburgers Partner steht in Briefkontakt mit einem unserer Genossen, dem Kraftfahrer Esra Berger, und gelegentlich fügt Eva Hamburger in ihrer schrägen Handschrift ein paar Zeilen am Rand hinzu, wie etwa:
Jetzt ist es vier Uhr morgens, und wir sind von einer sehr langen Fahrt durch die Wälder zurück. Die Landschaft hier ist ganz anders als im Jordantal. Auch die Gerüche ähneln sich nicht. Ist die Hitze bei euch sehr drückend? Hier ist es kühl, ein bißchen modrig. Das kommt vom Nordostwind, der gegen Morgen weht. Könnte man zum Beispiel mal ein Deckchen herschicken, das meine Tochter gestickt hat? Bitte. Eva.
Der Klatsch behauptet steif und fest, diese flüchtigen Zeilen seien von warmem Gefühl beseelt. Wir meinen, sie ließen verschiedene Lesarten zu, von Warmherzigkeit bis Unberührtheit. Manche sagen gar, eines Tages würde Eva in den Schoß ihrer Familie und ihres Kibbuz zurückkehren, wofür es schon deutliche Anzeichen gebe. Von Fruma Rominow indes haben wir einmal gehört, es sei sehr, sehr gut, wenn Eva niemals wiederkäme. Früher meinten wir, Fruma sage dies aus Boshaftigkeit. Aber jetzt, nach erneuter Überlegung, sind wir uns dieses Urteils nicht mehr sicher.
Ruven Charisch hat, wie gesagt, seine Kinder nun doppelt lieb. Er ist ihnen Vater und Mutter zugleich. Wenn du sein Zimmer betrittst, siehst du ihn oft mit Holz und Nägeln hantieren, um seinem Sohn Gai etwa einen kleinen Traktor zu basteln, oder damit beschäftigt, für Noga ein hübsches Stickmuster auf ein Stück Stoff vorzuzeichnen.
Auch seinen ideologischen Eifer hat er verdoppelt. Seine wichtigen Gedichte – diejenigen, die nicht für Kinder gedacht sind – beschreiben häufig den Gegensatz zwischen Bergen und besiedeltem Land. Dürften sie auch gewissen strengen Kriterien kaum standhalten, zeugen sie doch vom Glauben an die Fähigkeit des Menschen, sein Schicksal zu bestimmen, und sind nicht einfach Programmsätze in Versform. Wenn wir uns diesen Gedichten vorurteilsfrei nähern, können wir Traurigkeit, Hoffnung und Menschenliebe darin finden. Wer diese Werte belächelt, verrät seine eigene Wertlosigkeit.
Der trübe Fluß schäumt dem Gestern entgegen: Wird der Mensch seine schwachen Schultern regen, Wagen, eine Handvoll Feuer der Sonne zu entwenden Und das Werk trotz versengter Finger lächelnd beenden?
Hat er Kraft im Herzen, den Damm aufzuschichten, Ströme zu brechen, Flüssen Gesetz zu errichten? Wird er heil aus fremder Unterdrückung auferstehen, Wenn er ausgeht, sein Leben mit grünem Anstrich zu versehen?
Seine Lehrtätigkeit verrichtet Ruven Charisch mit ganzer Kraft und einer Offenheit, die die Herzen der Kinder erobert. Auch seine hingebungsvolle Touristenbetreuung ist letztendlich – wenn wir einmal das Geschnüffel der Klatschmäuler beiseite lassen – nichts anderes als intensiver Ausdruck seines Dienstes an der Idee.
Die genau abgewogene Poesie seiner Sätze, seine gewinnende Stimme, das feine Pathos ohne jeden falschen Ton – all das macht uns Ruven Charisch lieb und teuer. Er ist einer der hervorragenden Menschen in unserer Mitte, ein Mann des Geistes und der Erde, dem der Schmerz zusätzlichen Scharfsinn verliehen hat. Gewiß, er hat auch etwas Naives an sich. Nicht die Naivität der Toren, sondern eine absichtliche Naivität von prinzipieller Bedeutung. Mögen kleingläubige Müßiggänger sich über ihn mokieren – wir mokieren uns über sie. Sollen sie ihn nach Herzenslust mit ihrer verdorrten Seele bespötteln. Der Spott, der ihn trifft, fällt auf den Spötter zurück, entlarvt seine Hohlheit und läßt ihn letztendlich einsam und allein in seiner Häme suhlen. Sogar der Tod – über den Ruven heute, nach der Verabschiedung der Touristen, sonderbarerweise viel nachsinnt – wird sie bitterer treffen als ihn, denn sie gehen öd und leer in den Tod, während er seinen Fingerabdruck in der Welt hinterlassen hat.
Wenn nur die Einsamkeit nicht wäre.
Die Einsamkeit quält. Allabendlich nach seiner Rückkehr aus Bronka Bergers Zimmer steht Ruven, jünglingshaft rank und schlank, allein in seinem Zimmer und starrt mißmutig vor sich hin. Sein Zimmer ist leer und still. Bett, Schrank, ein grüner Tisch, ein Stapel Schulhefte, eine gelbe Glühbirne, Gais Spielzeugkiste, blaustichige Bilder aus Evas Hinterlassenschaft, erstarrte Öde. Der Mann zieht sich langsam aus. Brüht Tee auf. Ißt zwei, drei Kekse. Sie schmecken trocken. Wenn die Müdigkeit ihn nicht überwältigt, schält er ein Stück Obst und kaut, ohne den Geschmack wahrzunehmen. Er wäscht das Gesicht. Rubbelt es mit einem rauhen Handtuch, das er wieder nicht in den Schmutzwäschesack gesteckt hat. Geht ins Bett. Hohle Stille. Eine Wandlampe, die nicht richtig festgemacht ist und ihm eines Nachts noch, der Schwerkraft gehorchend, auf den Kopf fallen wird. Die Zeitung. Die letzte Seite. Eine Beilage über Verkehrsfragen. Liebe Bürger. Die Geräusche der Nacht stehlen sich ins Zimmer. Welcher Wochentag ist morgen? Er löscht das Licht. Eine Mücke. Er schaltet das Licht wieder an. Die Mücke ist weg. Er schaltet das Licht aus. Morgen ist Dienstag. Eine Mücke. Endlich feuchter, unruhiger Schlaf. Oft kommen reißerische Träume. Selbst ein lauterer Mensch mit festen Wertvorstellungen ist nicht Herr seiner Alpträume.
Wir haben Ruven Charisch nun in den höchsten Tönen gelobt. Jetzt sollten wir auch seine Fehler erwähnen. Andernfalls würden wir unser Recht auf ein Urteil, ja unsere Pflicht zum Urteilen verletzen, die bekanntlich das Geheimnis dieses Ortes ist. Taktgefühl und Zuneigung gegenüber Ruven Charisch mahnen uns jedoch zur Zurückhaltung. Deshalb werden wir eine bestimmte Affäre nur andeutungsweise mit wenigen Worten streifen.
Ein Mann im vollen Saft und in den besten Jahren kann nicht auf lange Dauer ohne Frau auskommen. Ruven Charisch ist in vielem außergewöhnlich, nicht jedoch in diesem Punkt.
Schon lange hatte eine platonische Freundschaft zwischen Ruven Charisch und einer Kinderpflegerin namens Bronka Berger bestanden, die wie Ruven im Erziehungssystem des Kibbuz tätig ist. Bronka zählt ebenfalls zu den alteingesessenen Mitgliedern, ist in der Stadt Kowel an der polnisch-russischen Grenze geboren und mit ihren fünfundvierzig Jahren etwas jünger als Ruven. Wüßten wir nicht um ihren guten Charakter, würden wir sie als ausgesprochen häßlich bezeichnen. Lobend seien jedoch ihre Feinfühligkeit und ihre regen geistigen Interessen erwähnt. Wie schade, daß die Freundschaft der beiden Pädagogen nicht lauter geblieben ist. Etwa zehn Monate nach der Sintflut – das heißt nach Evas skandalöser Abreise – berichtete uns der Klatsch, daß Bronka Berger den Weg in Ruven Charischs Bett gefunden habe. Dies betrachten wir als eine verwerfliche Handlung, von der wir uns hier aus moralischen Gründen ausdrücklich distanzieren, weil Bronka Berger verheiratet ist, und zwar mit dem Lastwagenfahrer unseres Kibbuz, Esra Berger, einem Bruder des bekannten Dr. Nechemja Berger aus Jerusalem. Außerdem ist Ruven Charischs Geliebte Mutter zweier Söhne. Der ältere, bereits verheiratet, sieht Vaterfreuden entgegen, der jüngere ist in Nogas Alter. So viel zu Ruven Charischs Schande.
Unversehens haben wir nun die Namen der drei Gebrüder Berger eingeführt. Wir hätten sie gebührender vorstellen sollen. Aber da es nun einmal so geschehen ist, betrachten wir die Vorstellung als erfolgt. Siegfried Sacharja Berger, der jüngste Bruder, führt mit den Eheleuten Hamburger das bewußte Kabarett in München. Esra Berger, um die fünfzig, ist der Vater von Tomer und Oren Geva und betrogener Ehemann einer untreuen Frau. Dr. Nechemja Berger, der älteste und bekannteste der drei, genießt als Gelehrter bescheidene Berühmtheit und lebt in Jerusalem. Wenn unser Gedächtnis uns nicht trügt, beschäftigt er sich mit der Geschichte des jüdischen Sozialismus und hat bereits etliche Aufsätze über dieses Thema veröffentlicht. Eines Tages wird er seine verstreuten Studien sammeln und in einem Buch zusammenfassen, das die gesamte Geschichte des jüdischen Sozialismus behandeln wird – von den biblischen Propheten, die die Welt zu verbessern suchten, bis zur Gründung der Kibbuzim im wiedererstandenen Land Israel.
Die drei Brüder haben also unterschiedliche Wege eingeschlagen und sich dabei weit voneinander und von ihren Vorfahren entfernt. Ja, alle drei mußten viel Kummer und Leid erfahren. Die Frommen, die im Glauben an himmlische Gerechtigkeit ihr Los willig annahmen, wollten uns lehren, daß auch Leiden das gnädige Walten der Vorsehung belegten, denn ohne Leid gebe es ja kein Glück, keine Erlösung und keine Freude. Aber wir, die die Verbesserung der Welt anstreben, sind nicht schicksalsergeben. Wir möchten die Welt von allem Leid befreien und sie mit Liebe und Brüderlichkeit erfüllen.
3. Kapitel: Stella Maris
Ruven Charisch jagt nicht kaltem Feuerwerk nach. Wen ein eisiger Finger berührte, der wärme seine Seele durch Tun.
Um sechs Uhr morgens wacht er auf, wäscht sich, zieht sich an, nimmt seine Tasche und geht in den Speisesaal. Viele unserer Genossen beginnen den Tag mit säuerlicher, verschlafener Miene. Ruven beginnt ihn mit freundlichem Gesicht. Während er eine Tomate aufschneidet und ein Radieschen würfelt, steht ihm der Sinn nach leichter Unterhaltung unter Freunden. Gutgelaunt plaudert er, redet etwa mit Nina Goldring über die Gründung eines Bezirksorchesters, fragt Jizchak Friedrich, den Schatzmeister, nach den Traubenpreisen oder klärt mit Fruma Rominow, an welchem Abend man den Erziehungsausschuß einberufen könnte. Am Montag ist Mendel Morag weg. Er fährt nach Haifa, um eine Ladung Holz für die Tischlerei abzuholen, und bleibt gewiß über Nacht bei seiner Schwester. Vielleicht Donnerstag. Mundek Sohar wird nichts dagegen haben. Also Donnerstag. Übrigens, wie geht es Zitron? Ich weiß, man wird ihn heute nachmittag im Krankenhaus besuchen. Ich würde sehr gern mitfahren, aber gestern hat sich eine skandinavische Touristengruppe telefonisch für genau die Zeit angemeldet. Hör mal, Grischa, der Friseur kommt heute oder morgen. Oder möchtest du dir etwa eine Künstlermähne wachsen lassen? – Ich kann weiche Tomaten nicht ausstehen. Grischa, sei so gut und schau mal auf dem Tisch hinter dir nach. Liegt dort vielleicht eine feste Tomate?
Um halb acht ist er in der Schule und wartet auf das Klingelzeichen. Heute werde ich euch die Hefte zurückgeben. Einige Arbeiten habe ich mit Vergnügen gelesen. Andererseits sind einige von euch kaum fähig, ein Komma richtig zu setzen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes unerträglich. Jetzt wollen wir versuchen, das Leitmotiv in David Schimonis Gedicht Denkmal herauszuarbeiten. Was wollte Schimoni sagen? Aufopferung. Ja. Aber was bedeutet Aufopferung? Das ist die Frage.
Um zwölf Uhr ist der Unterricht zu Ende. Ein hastiges Mittagessen. Die Touristen kommen um halb zwei. Mein Name ist Ruven. Ruven Charisch. Herzlich willkommen im Kibbuz Mezudat Ram. Ja, wir können ganz offen miteinander reden.
Um Viertel nach zwei sind die Touristen wieder abgezogen. Ohne die seltsamen Worte des alten niederländischen Obersten wäre mir ihr Besuch gar nicht in Erinnerung geblieben. Als dieser Goj mir aber unter großkotzigem Pochen auf seine militärische Erfahrung sagte, der Berg würde irgendwann abrutschen und auf uns prasseln, ist mir keine passende Antwort eingefallen. Kein denkwürdiger Satz, den er seinen Kindern und Enkeln würde erzählen können. Welch dünkelhafte Selbstüberheblichkeit: »als Fachmann«. Ich hätte ihm so antworten sollen: Der Berg wird nicht auf uns niederstürzen, weil Ihre Fachregeln nur an anderen Orten gelten. Wir leben nach einer anderen Schwerkraft, mein Herr. Und was den Tod angeht – natürlich müssen letztendlich alle sterben, aber manche Menschen sind schon im Leben tot. Ein feiner, aber entscheidender Unterschied, mein Herr.
Wie schade, daß Ruven Charisch nicht schlagfertig ist, sondern immer erst später eine passende Antwort findet. Lobend sei aber sein Fleiß erwähnt. Kaum hatte er die Touristen verabschiedet, kehrte er in sein leeres Zimmer zurück, zog sich aus, nahm eine belebende Dusche, schlüpfte in saubere Sachen und machte sich ans Korrigieren. Diese Arbeit verrichtet er nicht lässig nebenbei. Sein Rotstift fährt unbeirrbar über die kindlichen Zeilen, ertappt Schreibfehler, füllt die Ränder mit Anmerkungen (streng, aber auch behutsam, um die junge Seele nicht zu entmutigen). Ruven ist sich nicht zu schade, sich ernsthaft auf die Ansichten seiner Schüler einzulassen. Gerade weil sie noch zart sind, elf oder zwölf Jahre alt, darf man sie nicht autoritär mit fertigen Antworten überfahren. Das Recht, Fehler zu begehen, ist kein Monopol der Erwachsenen, lautet Ruven Charischs Wahlspruch. Niemals macht er einen roten Strich ohne ausführliche Erklärung daneben. Die Arbeit wird also keineswegs mechanisch verrichtet.
Seine Gedanken sind klar wie immer, seine leuchtend grünen Augen nicht minder. Da ist zum Beispiel dieser faszinierende Unterschied zwischen den Aufsätzen der Sprößlinge deutschstämmiger Genossen und denen der kleinen Russen. Das wäre eingehender Überlegung wert. Die ersteren achten auf harmonischen Satzbau und geordnete Darstellung. Die letzteren bersten vor Einfallsreichtum. Die ersteren neigen oft zu einem etwas trockenen Stil. Die letzteren – zu völligem Chaos.
Das sind natürlich grobe Verallgemeinerungen. Wir dürfen daraus keinesfalls zweifelhafte Begriffe wie »russische Seele« ableiten, im Stil Herzl Goldrings, der hier für den Ziergartenbereich zuständig ist. Nein. Schließlich sind diese wie jene Kinder hierzulande geboren. Kleine Kinder werden dir nicht wie Lehm in des Töpfers Hand übergeben. Der wahre Künstler sieht in einem Steinblock die darin verborgene Form, tut dem Material keine Gewalt an, sondern befreit die eingeschlossene Gestalt. Erziehung ist keine Alchemie, sondern subtile Chemie, Gestaltung des Vorhandenen, nicht Schöpfung aus dem Nichts. Wer die Erbanlagen außer acht läßt, wird sich eine Beule holen. Schlimmer noch ist jedoch derjenige, der das Erbgut als das Ein und Alles betrachtet. Er gelangt leicht zu nihilistischen Schlüssen. Jener niederländische Offizier wollte wissen, ob mir nicht der Sinn nach Abenteuern stünde. Gibt es auf der Welt denn ein größeres Abenteuer als das des Pädagogen? Ja sogar das eines einfachen Vaters? Aber er sagte, er habe keine Kinder. Deshalb redete er so vom Tod. Ein verdorrter Baum.
Diese Gedanken sind als Rohfassung für das gedacht, was er heute Abend Bronka sagen wird.
Zwischen halb drei und drei Uhr nachmittags macht Esra Berger seinen Lastwagen startklar für eine lange Tour. Zweimal täglich, um sechs Uhr morgens und um drei Uhr nachmittags, fährt er mit rund zehn Tonnen Traubenkisten nach Tel Aviv. Es sind jetzt die ersten Tage der Frühtraubenlese. Seit Beginn der Erntesaison hat Esra eine doppelte Arbeitslast auf sich genommen, von sechs Uhr morgens bis gegen Mitternacht.
In allen Winkeln der Welt lädt der Mensch sich doppelte Arbeit auf, wenn er Geld braucht. Bei uns liegen die Dinge natürlich anders. Die Frage, warum Esra Berger freiwillig für zwei arbeitet, läßt sich nicht mit materiellen Dingen beantworten. Vertrauen wir unserem Bündnispartner in dieser Geschichte, dem Klatsch, so entspringt Esras Übereifer dem, was zwischen ihm und seiner Frau oder – genauer gesagt – zwischen seiner Frau und dem Dichter und Pädagogen Ruven Charisch vorgeht. Diese Erklärung, die wir von Fruma Rominow gehört haben, ist wohlbegründet, wenn auch naturgemäß etwas vereinfachend formuliert.
Wie dem auch sei, Esra Bergers kräftiger Körper erträgt die Dauerbelastung mit Leichtigkeit. Er ist stämmig und behaart, hat leichten Bauchansatz und massige Glieder. Muskulöse Schultern tragen ohne Vermittlung durch einen Hals den schütteren dunklen Kopf. Das grobschlächtige, gedrungene Gesicht wird zur einen Hälfte von einer grauen Schirmmütze verdeckt, die andere Hälfte guckt mit verschwommenem Blick in die Welt. Dieses Äußere wirkt weder abstoßend noch anziehend. Auffallend ist der Ring, ein dicker Goldring, den Esra am linken kleinen Finger trägt. Schmuckstücke dieser Art sind bei Lastwagenfahrern gang und gäbe, nach unserem Geschmack jedoch unpassend für einen Fahrer, der einem Kibbuz angehört.
Esra Berger gehört nicht zu den großen Denkern in unserem Kibbuz. Er zählt zu den bescheidenen, geradlinigen Menschen der Tat. Daraus ist nun nicht vorschnell zu schließen, der Kibbuz sei einfach in zwei Gruppen unterteilt. Nein. Esra Berger selbst würde solchen Unsinn zurückweisen. Er ist kein Jüngling mehr – sein jüngerer Sohn hat ihn an Größe bereits eingeholt – und noch immer pflegt er seine geistigen Neigungen. Zwar ist er nicht sehr belesen, auch nicht wirklich vertraut mit den Schriften der Väter der Kibbuzbewegung, aber er liebt die Bibel und studiert sie in seiner Freizeit, am Schabbat. Außerdem liest er die Aufsätze seines gelehrten Bruders, auch wenn er wenig damit anzufangen weiß. Daß er sich nicht rege an den anstehenden Debatten beteiligt, wollen wir ihm nicht vorschnell ankreiden. Seine Ansichten, die er seit frühester Jugend klar und bestimmt vertritt, lassen ihn ein unbeschwertes Leben führen. Auch das ist eine Art Vollkommenheit, um die so manche Spötter ihn insgeheim beneiden.
Besonders reizvoll ist Esras Redeweise. Er würzt seine Sätze gern mit Bibelversen und Sprichwörtern, so daß man nie recht weiß, wann er es ernst meint und wann er nur so tut. Er ist ein verschlossener Mensch. Gespielter Ernst trennt ihn von uns. Wir wundern uns über ihn, weil er witzelt, ohne zu lächeln, und weil er in unpassenden Momenten grinst.
Einen Mann wie Esra Berger wirft die Untreue einer Frau nicht um. Gutmütigkeit, mäßige Vorstellungskraft, Kontrolle über die Gefühle – all das bewahrt ihn vermutlich vor Eifersucht. Gewiß, die Sache schmerzt ihn. Aber er hat den Schmerz im Griff. Fruma meint, er sei aus Schwerfälligkeit beherrscht. Wir finden, diese Zurückhaltung hat etwas Nobles an sich, wenn wir das Noble mit Mäßigung und Selbstbeherrschung verbinden.
Zuerst vertaut er ein dickes Seil unten an der Seitenwand des Wagens, wickelt es mit geübter Hand ein paarmal um eine Halterung. Dann tritt er drei Schritte zurück, holt weit aus, wirft die Seilrolle in einer kräftigen Bewegung über die Ladung und geht auf die andere Seite, wo das Seilende auf ihn wartet. Er packt es und zerrt unter Einsatz seines ganzen Körpergewichts daran, bis die Holzwände geknechtet ächzen. Danach zurrt er das gespannte Seil um einen weiteren Eisenhalter und wiederholt die ganze Prozedur noch zweimal, bis die Lasterwände dreifach fest miteinander vertäut sind. Zum Schluß spuckt Esra in die großen Hände, reibt sie aneinander, spuckt in jäher Wut auf den Boden, steckt sich eine Zigarette zwischen die Lippen und zündet sie mit einem goldschimmernden Feuerzeug an, das ihm sein Bruder geschenkt hat (sein Bruder Sacharja Siegfried in München, nicht sein Bruder Nechemja in Jerusalem). Nach ein paar lässigen Zügen setzt der Fahrer einen Fuß auf das Trittbrett des Lasters und benutzt sein Knie als Unterlage zum Ausfüllen der Lieferscheine.
Was jetzt? Jetzt ab in die Küche, um Kaffee und Brot zu holen. Bis nach Mitternacht wird Esra Berger auf Tour sein. Bei uns geht der Spruch: Esra ohne Kaffee ist wie der Leyland ohne Sprit. Eine abgedroschene Phrase zwar, aber zweifellos richtig. Nina Goldring, die Wirtschafterin, füllt ihm heißen Kaffee in die gelbe Thermoskanne, während Esra sich auf seinen dicken Gummisohlen von hinten an sie schleicht, ihr die Hand auf die Schulter legt und mit tiefer Stimme sagt: »Dein Kaffee geht einem wie Balsam in die Haut, Nina.«
Nina Goldring erschrickt vor der harten Hand und dem harten Ton. Ein Tropfen des heißen, schwarzen Naß spritzt ihr auf den Arm. Sie stößt einen lauten Schreckensschrei aus.
»Ich hab dich erschreckt«, stellt Esra fest, er fragt nicht.
»Du ... bist irgendwie merkwürdig aufgetreten, Esra. Aber nicht das wollte ich dir sagen. Ich wollte dir was Wichtiges sagen. Wegen deines Verhaltens hab ich’s vergessen. Ja, jetzt fällt’s mir ein: Daß du dieser Tage sehr schlecht aussiehst. Das wollte ich dir schon längst mal sagen. Mit solch roten Augen fährst du nachts. Für Autofahrer ist fehlender Schlaf sehr gefährlich und gerade ein Mensch wie du, der ...«
»Ein Mensch wie ich, Nina, schläft nicht am Steuer ein. Nie. Wie es heißt, mit Hilfe dessen, der dem Müden Kraft verleiht. Entweder denke ich über etwas Bestimmtes nach, oder ich trinke deinen Kaffee, oder ich rauche, und der Laster saust heimwärts wie ein Pferd, das den Stall riecht. Das letzte Stück Weg schaff ich auch mit geschlossenen Augen.«
»Merk dir, was ich gesagt habe, Esra. Ich sage, es ist gefährlich und auch ...«
»Wie steht geschrieben? Der Einfältigen Hüter ist der Ewige. Es gibt so einen Psalmvers wirklich. Danach bin ich in jedem Fall gut raus: Wenn ich einfältig bin, wird mir nichts passieren. Passiert mir was, ist das ein schlagender Beweis, daß ich nicht einfältig war. Dann kann man meinen Namen mit auf Ramigolskis Grabstein einmeißeln – du weißt, daß wir Freunde gewesen sind –, und Charismann kann ein Klagelied auf uns dichten und von den Geliebten und den Holden und so weiter singen, wie es weiland von Saul und Jonatan geheißen hat. Was nun? Immer geht meine Uhr nach, ist es schon drei?«
»Drei Uhr«, sagt Nina Goldring, »sogar fünf Minuten nach drei. Da, riech mal den Kaffee. Stark, ha? Verlaß dich nicht zu sehr auf diese Sprüche. Beschwörungen und Verheißungen helfen nichts. Sei vorsichtig.«
»Du bist eine gute Frau, Nina. Es ist sehr schön, an seinen Nächsten zu denken, wie es heißt, aber um mich braucht man sich keine Sorgen zu machen.«
»Muß man, aber sicher. Der Mensch kann nicht leben, wenn keine Seele sich um ihn sorgt.«
Noch beim Aussprechen bedauert die gute Nina ihre Worte. Vielleicht waren sie nicht taktvoll. In seinem Fall könnte man sie sonstwie auslegen.
Esra Berger legt die Thermosflasche, die Butterbrote und die Hartkäseschnitze auf den freien Nebensitz, steckt den Kopf zum Wagenfenster hinaus und manövriert seinen hoch beladenen Lastwagen rückwärts aus der Haltebucht, um der Straße zuzustreben. Eine gute Frau, diese Nina. Nur, sie ist klein und dick wie eine Gans. Ein Festschmaus für Herzl Goldring. Es herrscht doch Ordnung auf der Welt, nach Aussage der Philosophen, es hat seine Logik, daß Klugheit nicht mit Gutherzigkeit einhergeht und Gutherzigkeit und Schönheit nie zusammen auftreten. Sonst wäre ja der eine rundum vollkommen, die Krone der Schöpfung, wie es heißt, und der andere wäre vollends ein armes Schwein. Deshalb ist es vorbestimmt, daß eine schöne Frau sittenlos sei. Die dort zum Beispiel wird mal eine sehr schöne Frau. Aber es gibt auch eine Kehrseite. Daß sie nämlich die Tochter des Dichters ist. – Ja, junge Dame, was kann ich für Sie tun?
Noga Charisch ist ein Mädchen von sechzehn Jahren, hoch aufgeschossen wie ein Junge, die Figur eher knabenhaft als weiblich. Lange, schlanke Beine, schmale Hüften und kindliche Schenkel, über die ein weites Männerhemd fällt. Dickes weiches Haar wallt ihr über die Schultern bis zur Taille hinab. Ihr Körperbau ist eckig, spitz, und gerade deswegen hat jedes der kaum angedeuteten Zeichen von Weiblichkeit etwas eminent Wildes an sich. Ihr auffallend kleines Gesicht verliert sich in den schweren Haarkaskaden. Matt schwarz ist Noga Charischs Haar. Stirn und Wangen umschließt es weich schimmernd, wie der Schattenkranz um eine Kerzenflamme. Ihre Brauen sind fein wie auf alten Madonnenbildern. Nur sind die Augen derart groß, daß sie diese Harmonie stören, groß und mit einem verschwiegenen grünen Blitzen darin: Ruven Charischs Augen in Evas schönem Gesicht. Esra Berger sieht sie von oben aus seinem Kabinenfenster und wiegt den Kopf, als sei ihm eben eine geheime Wahrheit offenbart worden. Einen Moment später wendet er den Blick zur Windschutzscheibe und knurrt ungeduldig: »Nun?«
»Nach Tel Aviv, Esra?«
»Nach Tel Aviv«, antwortet der Fahrer, noch immer, ohne sie anzublicken.
»Kommst du spät zurück?«
»Warum?«
»Würdest du mir einen Gefallen tun?«
Esra stützt die Ellbogen aufs Steuerrad. Senkt das Kinn auf die Schulter. Wirft dem Mädchen einen müden, leicht belustigten Blick zu, der keine Sympathie enthält. Ein warmes, schmeichelndes Lächeln öffnet Noga Charischs schmale Lippen. Sie ist nicht sicher, ob Esra ihre Frage wirklich verstanden hat. Deshalb hüpft sie aufs Trittbrett, drückt ihren Körper an die glühendheiße Blechtür und lächelt dem Mann keck ins Gesicht.
»Tust du mir einen Gefallen?«
»Erlaubt ist, was gefällt. Was willst du eigentlich?«
»Kauf mir in Tel Aviv Stickgarn, sei so gut. Ein Knäuel in Türkis.«
»Was ist Türkis?«
So hatte Esra nicht fragen wollen, aber diesmal war er mit dem Reden schneller als mit dem Denken. Wieder wendet er den Blick ab, um sie nicht anzusehen, wie ein dummer Junge, peinlich geradezu.
»Ein Farbton. Türkis ist eine hübsche Farbe zwischen Blau und Grün. Ich erklär dir, wo du’s kaufen kannst. Dort ist bis acht Uhr abends auf. Nimm diesen Faden als Muster. Das ist Türkis.«
Nogas Füße sind in Bewegung. Sie wippen auf dem Trittbrett, einem inneren Rhythmus folgend, ohne sich von der Stelle zu bewegen, wie in verhaltenem Tanz. Esra spürt geradezu ihren Körper, der sich außen an die Kabinentür preßt. Wie oft habe ich dieses Mädchen schon gesehen. Aber was ist jetzt? Noga legt sein Schweigen als Ablehnung aus. Versucht, durch inständiges Bitten seine Zustimmung zu erwirken: »Esra, sei lieb.«
Ihre Stimme geht in Flüstern über. Da Esra Berger Vater zweier Söhne ist, die beide älter als diese Kleine sind, erlaubt er sich, ihr die schwere Hand auf den Kopf zu legen und ihr übers Haar zu streichen. Im allgemeinen mag er keine Mädchen, die sich wie kleine Frauen aufführen. Diesmal verspürt er eine Art Zuneigung. Er nimmt die Hand von ihrem Haar, faßt ihr kleines Kinn mit Daumen und Zeigefinger und verkündet gespielt feierlich: »Geht in Ordnung, junge Dame, so geschehe es, Amen. Türkis also.«
Das Mädchen wiederum legt ihm zwei gebräunte Finger auf die behaarte, schwitzende Hand und erklärt: »Du bist süß.«
Wegen des Altersunterschieds und ihres kindlich bettelnden Tons wollen wir ihr diesen Ausspruch verzeihen. Aber Esra Bergers Verhalten können wir diesmal nicht verstehen: Gab es denn irgendeinen Grund, das Bremspedal so plötzlieh loszulassen, daß Noga nur dank ihrer großen Gelenkigkeit noch rechtzeitig von dem anfahrenden Laster springen konnte? Welche Ursache existiert für diese merkwürdige Eile? Schon braust er in einer Staubwolke davon. Gute Fahrt. Vergiß bitte nicht das türkisfarbene Garn. Sicher wird er es nicht vergessen. Geduckt und gedrungen sitzt er in seiner Fahrerkabine, stützt sich aufs Lenkrad und denkt an Frauen. Erst an das Mädchen. Dann an Eva. An Bronka. Zum Schluß ist er wieder bei Noga angelangt. So ein zierliches Kinn, kleine Türkisa, dein Vater würde wahnsinnig, wenn.
Der Kibbuz brütet halb ohnmächtig in der Sonne. Die glutheißen Strahlen prallen auf den Betonpfad, daß der nackte Fuß sich versengt und vom Weg auf den Rasen springt. Es ist ein sanfter Sprung, Schritt eines verhaltenen Tanzes. Winzige Schweißtropfen perlen auf der gebräunten Stirn. Noga summt wort- und tonlos eine zarte Weise vor sich hin, die ihre Augen umflort: Der Granatapfelbaum, er duftete so / vom Toten Meer bis Jericho ...
Im Schatten des knorrigen Johannisbrotbaums hält sie inne, legt versonnen die Hand an die Rinde, beschattet die Augen und blickt auf das Bergmassiv. Feiner Dunst schwebt über den Bergen und mildert deren dräuende Schwere. Die feuchte Hitze bringt den Dunstschleier hervor. Dort schmoren die Felsen lautlos, regungslos. Nur in den gewundenen Schluchten halten sich abgerissene Schattenstreifen, als wollten die Berge sich mit fremdartigem Spiel vergnügen.
Am Rasensaum rotiert tickend ein Sprinkler. Noga rennt aus Spaß zwischen den Wasserstrahlen hindurch. Vielleicht wegen ihres zerbrechlichen Körperbaus, des verkniffenen kleinen Mundes oder des matten Haars weckt der Anblick dieses Mädchens selbst im Übermut noch Trauer. Beklemmende Wehmut überkommt dich, wenn du, wie wir nun, verstohlen dieses große, schlanke Mädchen mit dem schweren Haar beobachtest, das sich allein auf dem abfallenden Rasenstück tummelt. Sie ist jetzt die einzige auf der weiten leeren Fläche, von glutheißer Luft umflirrt. Hin und zurück springt sie, reizt mit ihren langen Beinen die Wasserstrahlen. Ziellos spielt sie, ohne ein Lächeln, in düsterer Konzentration. Verschwommene Geräusche erfüllen die Luft. Wollte man sie zu isolieren suchen, könnte man das Tuckern eines fernen Traktors, das Muhen einer Kuh, Frauengezänk und das Plätschern fallenden Wassers unterscheiden. Aber die Geräusche verschmelzen zu einer dumpfen Kulisse. Und das Mädchen scheint jetzt völlig in sich selbst versunken.
Ich will nicht, daß er seine Späßchen mit mir treibt. Ich wollte von ihm beachtet werden. Wieso wußte er nicht, was Türkis ist? Türkis ist eine Farbe zwischen Blau und Grün. Ein bißchen grell, aber ganz was Besonderes. Immer redet er in Sprüchen statt was Normales. Ich sage ihm, er soll mir einen Gefallen tun, und er sagt, erlaubt ist, was gefällt. Ich bin gar nicht sicher, daß er was damit meint. Er muß einfach was sagen, und so sagt er was, um nichts zu sagen. Ich hatte gedacht, er würde nur mit mir in Sprichwörtern reden, aber nein, er ist ein Mensch, der mit allen Sprüche klopft. So geschehe es, Amen. Das ist was aus der Tora. Aber er hat es nicht ganz im Ernst gesagt. Auch meinen Kopf hat er nicht ganz im Ernst gestreichelt. Wie unabsichtlich ist er mir übers Haar gefahren. Dabei hat er’s mit Absicht getan. Frauen irren nicht in diesen Dingen. Er hat was an sich, das mir nun gerade gefällt. Immer scheint er nach außen eines zu sagen und im Innern was anderes. Übrigens war das Garn, um das ich ihn gebeten habe, keineswegs bloß ein Vorwand, um ihn aufzuhalten. Ich brauche es wirklich dringend. Aber ich dachte, vielleicht kommen wir dabei miteinander ins Gespräch. Er ist nicht groß und sieht nicht besonders gut aus, der Mann von Vaters Bronka, aber er ist sehr stark. Das sieht man. Stärker als Vater. Ich häng einen bestimmten Gedanken an ihn. Gut, daß Herzl Goldring mich nicht auf seinem feuchten Rasen herumlaufen sieht. Er schreit nicht, wedelt nur mit der Hand, daß man abhauen soll, aber wie haßerfüllt er jeden fixiert. Schon vier Uhr. Zeit, zu Vater reinzugehen. Manchmal möchte ich sehr krank sein, so daß Vater mich Tag und Nacht pflegen müßte, und manchmal stelle ich mir vor, daß Vater sehr krank ist und ich ihn Tag und Nacht pflege, und dann würde ich weinen, bis alle wüßten, daß ich ihn viel mehr liebe. Trauer kann einem das Herz brechen. Aber ein gebrochenes Herz ist nur ein übertragener Ausdruck. So was gibt’s nicht. Wie heiß es jetzt ist.
Noga geht zu ihrem Vater. Auf nackten Zehenspitzen schleicht sie federnd ins Haus und linst vom Vorraum wie ein Spion in sein Zimmer. Ruven Charisch schaut nicht in ihre Richtung. Ruven Charisch blickt auf seine Uhr, räumt die Hefte vom Tisch in seine Tasche und wiegt den Kopf, als diskutiere er mit sich selbst. Sein Vogelgesicht zeigt sich dem Mädchen in spitzem Profil. Er hat sie noch nicht bemerkt. Mit der schwebenden Leichtigkeit eines verängstigten Tieres springt sie ihn von hinten an, hängt sich ihm an den Hals und küßt ihm den Nacken. Er fährt erschrocken herum und packt die Schultern der Angreiferin mit bleichen Fingern. »Du Katze«, murmelt er, »wann wirst du endlich aufhören, dich wie ein Dieb in dieses Haus zu stehlen. Das ist eine häßliche Angewohnheit, Noga, das meine ich ernst.«
»Du hast dich erschrocken«, sagt das Mädchen in warmem Ton, als Feststellung, nicht als Frage.
»Ich bin nicht erschocken. Nur ...«
»Leicht. Was hast du gemacht? Ein Gedicht geschrieben? Hab ich die Muse verscheucht? Keine Sorge, Vater, die kommt wieder.«
»Wer, eh ...«
»Die Muse, schwupp – ich hab sie an den Zöpfen gepackt. (Eine flinke, bezaubernde Handbewegung, ein Bogenschlagen in der Luft, die Finger schließen sich um eine imaginäre Beute.) Haben Musen Zöpfe, Vater?«
»Meine Stella«, sagt Ruven Charisch und küßt seine Tochter oben auf die Stirn, knapp unter dem Haaransatz, »meine Liebe.«
Noga löst sich aus dem Griff ihres Vaters und wiegt die Hüften, wie gewohnt, wie in einem inneren Tanz. »Habe ich dir schon von der Aufführung erzählt? Nein? Die Klasse bereitet eine Aufführung zu Schawuot, zum Wochenfest vor. In sechzehn Tagen. Eine Folge von Tänzen verbunden mit einer szenischen Lesung. Ich tanze den Rebstock, eine der sieben Arten, der traditionellen Früchte des Landes, weißt du. Symbolische Bewegungen. Und ...«
»Stella«, wiederholt der Vater und streckt die Hand aus, um ihr übers Haar zu streichen. Die Kleine bemerkt die Geste und schlüpft schulterzuckend weg. Schon setzt sie den Wasserkessel auf.
Stella. Diesen Namen hat Eva früher häufig benutzt. Es ist kein beliebiger Kosename. Evas verstorbene Mutter hieß Stella. Als Noga geboren wurde, wollte Eva sie nach der seligen Großmutter Stella nennen. Ruven hielt dagegen, er sei nicht ins Land Israel gekommen, um seinen Kindern Diasporanamen zu geben, ganz zu schweigen von solchen mit christlicher Prägung. Wie von selbst tauchte der Name Kochava auf, als hebräische Form des großmütterlichen Namens. Dagegen sträubte sich Evas musikalisches Empfinden, denn der Name Kochava Charisch strotze ja vor rauhen Gutturalen. Evas Ablehnung war definitiv, wie in allem, was die sanfte Beharrlichkeit dieser zerbrechlichen, schwarzäugigen Frau weckte, deren Lippen so schmal wie eine gespannte Saite waren. Daraufhin stimmte Ruven dem Namen Noga zu, einer Kompromißlösung, die sowohl Evas sensibles Gehör als auch Ruvens klare Grundsätze berücksichtigte. Noga ist der Name eines Sterns, der Venus, Noga erinnert an den Namen der seligen Großmutter Stella.
Großmutter Stella Hamburger war in einem noblen Kölner Vorort gestorben, wenige Monate nach dem Tod ihres Ehemanns, des Bankiers Richard Hamburger (Evas Vater, Isaaks Onkel), zwei Jahre, nachdem ihre einzige Tochter Eva sich den Pionieren angeschlossen hatte und ohne elterlichen Segen nach Erez Israel gegangen war, wo sie ebenfalls ohne Segen einen einfachen Mann geheiratet hatte, der zwar in Deutschland geboren, aber nur der Sohn eines simplen Schächters aus einem entlegenen podolischen Städtchen war.
Dank eines gnädigen Schicksals war Großmutter Stella noch am Ausgang der schönen Zeiten gestorben und hatte nicht lange genug gelebt, um in einem Konzentrationslager umzukommen. Eine Verfügung war eingetroffen, die ihr die Witwenrente von der Kölner Kleinhandelsbank strich. Die Schmach darüber raffte Großmutter Stella hinweg. In Noga Charisch lebt nun auf Umwegen ihr Name und Andenken fort. Wir können nicht frommen Blicks behaupten, das Mädchen schlüge Großmutter Stella nach. Richard Hamburgers Enkelin läuft die meisten Stunden des Tages barfuß herum wie eine einfache Bauerntochter. Andererseits könnte Noga von Eva die nach außen sich zart gebende zähe Willensstärke geerbt haben, die Eva wiederum von Großmutter Stella hatte.
In frohen Stunden nannte Eva ihre Tochter liebevoll Stella, gelegentlich sogar Stella Maris. Dieser Zusatz läßt sich nicht erklären. Fruma Rominow vermutet darin einen Hinweis auf Evas Vorliebe, Seelandschaften in Kohle zu zeichnen: ein einsames weißes Segelboot am dunstigen Horizont, leichtes Wellengekräusel, stille Wasserläufe zwischen dichtgrünen Gestaden, alles in etwas altmodischem, leicht süßlichem Stil. Einige dieser Zeichnungen wurden in Ruven Charischs Kinderreimbuch abgedruckt. Doch wir sind abgeschweift, hatten nur eine seelische Erklärung für den Namen Stella Maris Vorschlagen wollen.
Das Wasser im Kessel kocht. Noga bereitet Kaffee für ihren Vater, Tee mit Milch für sich, duftenden Kakao für ihren kleinen Bruder Gai. Wir wollen nicht sagen, sie tue das alles geistesabwesend, aber ihre Augen scheinen den Fingern nicht recht zu folgen. Ihre großen Augen sind jetzt halb geschlossen, als blickten sie nach innen, in die Kopfhöhle hinein. Ich meine, er hat sich extra bemüht, mich nicht anzugucken. Warum und wieso macht dieser Gedanke solche Freude.
Ruven sitzt am Couchtisch, stützt sich mit den Händen auf ihn. Er betrachtet seine Tochter. Ist nicht froh. Sie ist ein kleines Mädchen und doch wieder nicht. Bisher hat sie noch kein einziges Wort über Bronka gesagt. Eigentlich wäre es an mir, vernünftig darüber zu reden. Wenn sie mir zuvorkommt und eines Tages fragt, eine Frage stellt, was soll ich ihr dann antworten. Was soll ich ihr sagen, wenn sie zum Beispiel heute damit anfängt. Jetzt. In diesem Moment. Was tu ich nur.
Gai Charisch kommt herein, ohne zu grüßen. Ruven rügt ihn. Der Junge erklärt: »Okay. Guten Abend. Aber ich will keinen Kakao.«
Sofort legt er sich, wie gewohnt, auf den Teppich und beginnt umstandslos und ohne Überleitung von etwas zu erzählen, was ihn beunruhigt. Im wesentlichen sagt er Folgendes: »Heute Mittag, nach der Heimatkundestunde, hat Bronka uns was über die Araber erklärt. Was für Vorstellungen die hat! Wie ein kleines Mädchen. Sie würden ohne böse Absicht auf die Juden schießen, oder so was. Und daß sie uns überhaupt nicht hassen, sondern einfach arm dran seien und bloß ihr Sekretariat in Damaskus sie zum Kämpfen zwinge. Und wir sollten sie auch keinesfalls hassen, weil sie Arbeiter und Bauern wie wir seien. Also, wen sollen wir dann wohl hassen, ha? Und auch, daß sie bald mit uns Frieden schließen werden. So’n Quatsch. Nach meiner Meinung ist es sehr unpädagogisch, Drittkläßlern unrichtige Sachen zu erzählen. Tatsache ist, daß wir auf die hier schießen und nicht auf die in Damaskus. Und dann ziehen sie den Schwanz ein und sind ruhig. Stimmt’s, Vater, daß es bei uns Ruhe gibt, wenn die keine Syrer mehr haben?«
»Was hast du für ein dreckiges Gesicht«, sagt Noga, »ab ans Waschbecken. Ich wasch dich.«
»Ruhe. Merkst du nicht, daß ich mit Vater rede?«
»Du wirst jetzt mit mir reden und tun, was ich dir sage«, verlangt Noga in scharfem Ton.
»Wenn Männer reden, Noga, sollen Frauen sich nicht einmischen.«
An dem von Noga gedeckten Tisch, vor den dampfenden Tassen, beim Obstschälen und Keksemampfen, versucht Ruven, seinem Sohn etwas über Völkerfreundschaft beizubringen. Seine Worte sind schlicht und zu Herzen gehend. Seine gütige Stimme verstärkt seine Worte. Vielleicht gelingt es ihm kraft seiner väterlichen Autorität, die Lehren seiner Kollegin Bronka Berger zu untermauern. Wir wünschen ihm guten Erfolg.
Gai Charisch ist hübsch, aber auf andere Weise als seine Schwester. Türkisa ist ein dunkler, Gai ein heller Typ. Die blonde Tolle fällt ihm locker in die hohe Stirn, die Kleidung wird von einem breiten Militärkoppel an den schmalen Körper gezurrt, die Gesichtszüge sind markant und spitz wie die seines Vaters, aber die Augen schimmern dunkel und warm. Welch schönes Bild – Vater und Sohn gemeinsam am Schreibtisch sitzend. Während Noga den Tisch abräumt und das Geschirr spült, dabei bewußt wie eine überlastete Hausfrau seufzt, kleben die Männer Briefmarken ein. Das Album ist nach Themen geordnet: Sportmarken, Blumenmarken, Weltraummotive, Tiere und zu unserem Leidwesen auch Kriegsmotive. Spielerisch vermittelt Ruven seinem Sohn ein Gefühl für Disziplin und Ordnung. Unterdessen hat Noga ihre Pflichten beendet und eine kleine Blockflöte zur Hand genommen. Ihre Finger tanzen über die Löcher und spielen Melodien so zart und lang wie diese Finger selbst. Sie ist tief in den alten Sessel versunken, die Knie bis ans Kinn hochgezogen, der Rücken rund, die Wimpern gesenkt, der Kopf voll lebhafter Phantasien. Frühmorgens vor Sonnenaufgang zum Fischteich hinuntergehen, dort barfuß umherschlendern und gucken. In den alten Stall schleichen, in dessen dicken Mauern es immer noch nach modrigem Heu riecht, obwohl schon seit Jahren keine Pferde mehr drinstehen. Im Stall schreien. Dem Echo lauschen. Hinausgehen. Lieder in den Wind singen. Nicht schlafen während einer winterlichen Sturmnacht, wenn der Regen weint und die Donner ihn verlachen. Mit dem Schiff fahren. An einem fernen Ort Frau sein.
Einmal im Herbst, so um dieselbe Tageszeit wie jetzt, bin ich hier in Vaters Dusche gegangen. Ich zog meine stinkenden Arbeitsklamotten aus (damals melkte ich im Schafstall), drehte den Hahn auf, aber es kam kein Wasser. Also mußte ich zur Gemeinschaftsdusche. Aber ich wollte die verdreckten Sachen nicht wieder anziehen. Im Badezimmerschrank fand ich so ein dünnes blaues Hauskleid, das hinten geknöpft wird. Von Mutter. War irgendwie hängengeblieben. Ich bin reingeschlüpft, hab mir Handtuch, Seife und Haarklammern geschnappt und bin zur Gemeinschaftsdusche gegangen. Hab dort geduscht. Und bin nach Hause gegangen. Plötzlich kam mir auf dem Weg Esra Berger entgegen. Auch damals hat er den Kopf abgewandt und mich nicht angesehen. Aber bevor er das Gesicht wandte, hat er mich angeguckt. Nicht mein Gesicht. Wenn Rami nicht so wäre, würde ich’s ihm erzählen. Ich erzähle Rami nie so was. Er würde einen falschen Eindruck von mir kriegen. Er würde es dieser Hexe Fruma weitertratschen. Einmal hat er mir erzählt, seine Mutter habe ihm gesagt, ich sei meiner Mutter ähnlich, weil der Apfel nicht weit vom Stamm falle. Erst dachte ich, ich sollte hingehen und Fruma eine runterhauen. Aber bei weiterem Nachdenken habe ich eingesehen: Wenn ich mich aufrege, ist das ein Zeichen, daß es eine Beleidigung war, und es ist doch gar keine Beleidigung.
Später, wenn leichter Westwind die Wipfel der Zierbäume fächelt und den sonnversengten Ort ein wenig mit seinem Luftzug versöhnt, geht Familie Charisch in den Garten, auf den Rasen in der Mitte. Das ist die Stunde, in der Ruven Charisch sich der Zeitungslektüre widmet. Gai begießt eifrig das Rosenbeet. Noga, den Rücken zum Vater, stickt wunderbar fein. Wenn sie plötzlich den Kopf wendete und eine Frage stellte, was könnte Ruven ihr antworten. Sie hat die langen Beine untergeschlagen. Das Haar fällt ihr über die linke Schulter bis auf die Brust. Ihre schönen Finger fliegen nur so über den Stoff. Ein sanftes, ruhiges Bild bietet sich derzeit unseren Augen. Verwahren wir es im Herzen. Kommt Gutes, ist es ein Zeichen, daß die Liebe stärker ist als der Haß. Kommt Schlechtes, können wir dieses friedliche Bild aus der Erinnerung zurückrufen, Trost daraus schöpfen und das boshaft schleichende Gift abdämmen. Vieles ist möglich. Noga Charisch hat einen mädchenhaften Körper und das Gebaren einer Frau. Eine erregende Kombination. Ein gieriges, versteinertes, ödes Auge steht im Begriff, seinen bösen Blick auf unser zauberhaftes Reh zu richten. Es gibt ein Schauermärchen von einem kleinen Mädchen, das einen Korb durch den großen Wald trug. Sogar Gai ist schon reif genug, um dieses deutsche Ammenmärchen verächtlich abzutun. Und Ruven Charisch würde euch sagen, wer Grimms Märchen aufmerksam lese, werde begreifen, wieso dort ein Volk von Mördern und Werwölfen herangewachsen sei. Womit er recht hat. Aber wir blicken jetzt auf Türkisa, auf die zarte Stella Maris, und unser Herz fliegt ihr zu.
4. Kapitel: Bronka hört vereinzelte Schüsse
Dies Tal, in dem der Jordan singt, Der Arbeit mächtig Tosen klingt, Ist der Vision und Schönheit Flamm, Ist grünes Feuer gegen öden Felsenkamm.
Diese Zeilen aus einem berühmten Gedicht von Ruven Charisch kennt jedes Kind. Sie sind längst anmutig vertont worden und werden viel gesungen. Auf Kongressen der Kibbuzbewegung und bei Versammlungen der Pionierjugend haben wir es oft erlebt, daß man ein oder zwei Zeilen als Tagungsmotto ausgewählt hatte, die Lettern zuweilen aus Zypressenzweigen geflochten oder sogar als Feuerschrift: Der Vision und Schönheit Flamm oder Grünes Feuer gegen öden Felsenkamm.