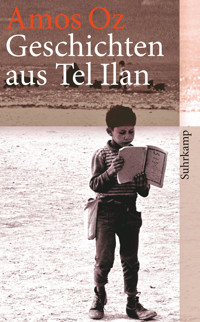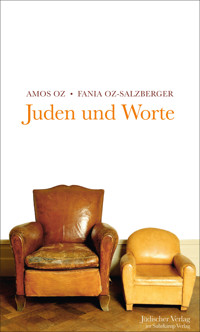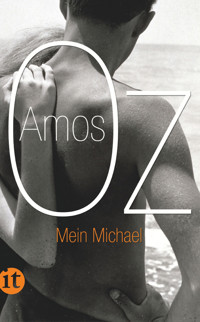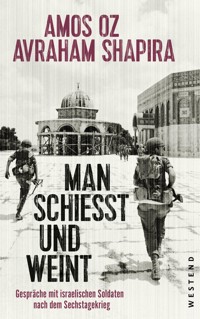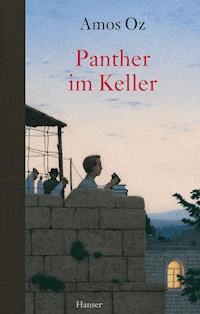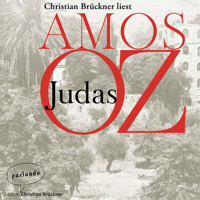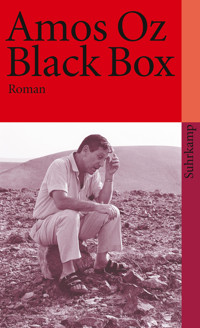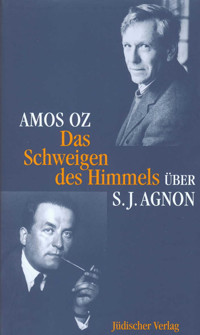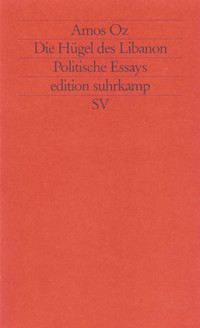
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der vorliegende Band versammelt die wichtigsten, aufschlußreichsten und politisch relevantesten Essays von Amos Oz von 1967 bis zur Gegenwart. In ihm sind die Grundannahmen und politischen Schlußfolgerungen des brillant formulierenden Essayisten Amos Oz nachzulesen, die sich seit den ersten kriegerischen Auseinandersetzungen des Staates Israel mit den arabischen Nationen bis zum schwierigen Friedensprozeß zu einer geschlossenen Rundschau verdichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
es 1876
edition suhrkamp
Neue Folge Band 976
eBook Suhrkamp Verlag 2025
Der vorliegende Text folgt der 2. Auflage der Ausgabe der edition suhrkamp 1876
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin, 1995 Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung nach dem Konzept von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-78503-4
www.suhrkamp.de
Inhalt
Vorwort
Die Bedeutung der Heimat
Hebräische Melodien
Eine Belagerung in der Belagerung
Die Macht und der Zweck
Mohammad, Gideon und die Duschen
Über die Abstufungen des Bösen
Der Ursprung von Autorität
Amalek-Woche
Der Graben existiert
Zwischen Mensch und Mitmensch
Die starken Nerven der Gottheit und der Humor der Deutschen
Sie sind wirklich nach Gottes Ebenbild geschaffen
Zwischen Wort und Bild
Die Moral und das Joch der Schuld
Ein neues Herz
Von Visionen und Visionären
Der Staat Israel oder das Land Israel
Macht Frieden, nicht Liebe
Der Kern der Angst
Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche
Die Hisbollah mit einem Käppchen
Die Minenfelder des Herzens räumen
Drucknachweise
Vorwort
Diese Sammlung enthält Essays, Artikel und Reden, die in einem Zeitraum von mehr als 25 Jahren entstanden sind. Eine Reihe von ihnen sind das Ergebnis von Bestürzung, Scham oder Wut, und zum größten Teil sind sie nicht in ruhiger Verfassung geschrieben worden.
Dieses Buch beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Als Erzähler kann ich meines Erachtens womöglich leichter als andere mit der Gegebenheit und Gültigkeit zweier einander ausschließender Selbstverständnisse leben, die die Ursachen und Folgen dieser Tragödie ausmachen. Ginge es hier nicht um Tod und Leiden, hätte ich vielleicht sogar gewisse komische Züge an der spiegelbildlichen Beziehung zwischen Fanatikern und selbstgerechten Predigern auf beiden Seiten gefunden. Meiner Meinung nach brauchen Israelis und Palästinenser jedoch nicht die widersprüchlichen Versionen ihrer jeweiligen Vergangenheit miteinander zu versöhnen, um zukünftig in Frieden Seite an Seite zu leben. Es ist nicht nötig festzustellen, wessen Fehler und wessen Blindheit der Grund für die Tragödie war. Wir brauchen einen Ausweg aus diesem Schlamassel.
Israelis und Palästinenser werden vielleicht auf immer über den Verlauf und die Bedeutung ihrer gemeinsamen Vergangenheit streiten. Dennoch könnten sie davon profitieren, ihren gewöhnlich starren Vorstellungen von der Normalität der früheren und gegenwärtigen Position ihres Gegenübers einen Schuß Relativismus hinzuzufügen.
Seit 1967 hat sich eine Reihe von Israelis für eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen, die auf eine Teilung des Landes hinausläuft und sich im großen und ganzen nach demographischen Grenzen ausrichtet. Dieser Plan ließ sich viele Jahre lang Israelis und auch Arabern nur schwer plausibel machen. Die Israelis waren zum größten Teil der Meinung, der Krieg, den wir 1967 geführt haben, sei ein gerechter Verteidigungskrieg gewesen und das in diesem Krieg eroberte Land der Vorväter dürfe den Arabern nicht zurückgegeben werden, die sich mit nichts als der Auslöschung des Staates Israel zufriedengeben würden. Die Araber wiederum, einschließlich der Palästinenser, behaupteten bis vor einigen Jahren, die Schaffung, ja die Existenz des Staates Israel als solche sei eine gegen sie gerichtete Aggression und Israel müsse man daher nicht nur aus den 1967 eroberten Gebieten hinauswerfen, sondern Israel solle überhaupt verschwinden.
Auf beiden Seiten war man zum größten Teil nicht in der Lage, einen moralischen Unterschied zwischen dem Recht auf die West-Bank und dem Recht auf Galiläa vorzunehmen.
Die Vorstellung eines territorialen Kompromisses auf der Grundlage beidseitiger Anerkennung konnte sich erst verbreiten, nachdem beide Seiten einige schmerzhafte Schläge der harten Realität hatten hinnehmen müssen: die arabische Niederlage im Jahre 1967, die israelische Beinahe-Niederlage 1973, der bilaterale Frieden-für-Land-Vertrag zwischen Israel und Ägypten 1978, das Fiasko im Libanon von 1983, der palästinensische Intifada-Aufstand seit 1987, der Golf-Krieg 1991, der israelische Regierungswechsel von 1992, die Osloer Vereinbarungen im Jahre 1993 und kürzlich die in Gaza und Jericho stattfindende Realisierung der Anfangsphase des ersten jemals von Israelis und Palästinensern unterzeichneten Abkommens. Jedes einzelne dieser Ereignisse muß man als Schritt auf dem langen Weg zu einem quälenden Erkenntniswandel auf beiden Seiten betrachten; jeder Schritt führte zu der Einsicht, die Existenz oder die Erwartungen des anderen lediglich zu ignorieren werde den anderen nicht dazu bringen fortzugehen.
Zum jetzigen Zeitpunkt, im Juli 1994, während ich dies Vorwort schreibe, genießt fast die Hälfte der Palästinenser, die zwischen Juni 1967 und Mai 1994 unter israelischer Militärverwaltung gelebt haben, also die Einwohner von Gaza und des Bezirks Jericho, eine PLO-Verwaltung. Eine PLO-Polizeimacht und israelische Truppen patrouillieren gemeinsam entlang den neuen Grenzen und sorgen für relative Ruhe auf beiden Seiten. Ein bescheidenes Maß an Koordination, ja selbst Kooperation beginnt sich zwischen den früheren Todfeinden zu entwickeln. Die Palästinenser besitzen bislang nirgends volle Souveränität, und sie haben nicht die Gelegenheit gehabt, ihre eigene Regierung zu wählen. Sollte aber die jetzige Phase der Vereinbarung von beiden Seiten mit Ehrlichkeit und Klugheit realisiert werden, so könnte sich »Gaza und Jericho zuerst« in einigen Jahren zu einem Palästinenserstaat entwickeln, der den größten Teil der von Israel 1967 besetzten Gebiete umfaßt.
Araber, Israelis und ausländische Beobachter haben diesen Konflikt sehr lange mißverstanden und ihn für einen ethnischen Zusammenstoß zweier Gemeinschaften innerhalb einer Gesellschaft gehalten, für einen religiösen Krieg oder für einen Kampf um Entkolonisierung, kurz gesagt: für eine Art von Bürgerkrieg. Jetzt endlich fangen beide Seiten an, den Konflikt als das zu begreifen, was er tatsächlich ist – eine internationale Auseinandersetzung, ein Zusammenstoß zweier Nationen, die jeweils dasselbe Stück Land für sich beanspruchen. Es handelt sich, mit einem Wort, um eine Auseinandersetzung um Land, die allerdings von historischen Traumata und verletzten Gefühlen auf beiden Seiten geprägt ist.
Ein Konflikt um Land läßt sich durch einen Kompromiß lösen, der wahrscheinlich niemanden glücklich macht, aber zumindest jeden so weit bringt, daß das Töten und Getötetwerden aufhört. Ich habe seit 1967 die Meinung vertreten, daß »wenn ein Recht auf ein anderes stößt, ein über dem Recht stehender Wert gelten muß, und dieser Wert ist das Leben selbst«.
Zwischen den Konfliktparteien muß jedoch noch sehr viel ausgehandelt werden: Sicherheit, Grenzen, Jerusalem, Siedlungsgebiete, Wasser, Wirtschaftsbeziehungen und umfassende regionale Friedensvereinbarungen, um nur die wichtigsten zu nennen. Die Hauptvoraussetzung für diese harten Verhandlungen ist allerdings jetzt von beiden Seiten akzeptiert: Wir sind übereingekommen, daß die israelischpalästinensische Frage nicht mehr eine »Entweder-oder«-Angelegenheit ist und daß sich beide nationalen Ansprüche nicht mehr von vorneherein ausschließen.
Einige der Essays dieses Buchs befassen sich mit den demoralisierenden Auswirkungen langandauernder Konflikte, auch wenn sie um eine gerechte Sache geführt werden. Winston Churchill hatte mit seiner Ansicht, der Kampf um England habe seinem Volk »seine größte Stunde« beschert, vielleicht recht, vielleicht auch nicht. Aber der Kampf um England dauerte vergleichsweise kurz. Ein Konflikt, der sich über Jahrzehnte dahinzieht, wird nahezu zwangsläufig zu einem Kreislauf von Schlägen und Gegenschlägen, von Mißtrauen und Rachsucht, mit demoralisierenden Folgen für nahezu alle Beteiligten.
Die folgenden Essays haben sich weder aus einer »nachzionistischen« Schuld noch aus reumütigen Gefühlen gegenüber dem palästinensischen Volk ergeben. Ich bin nach wie vor der Ansicht, daß Israel die einzige Heimat der Israelis ist und daß Israel in Zukunft bereit sein sollte, Juden aufzunehmen, die Israelis werden wollen, und solche, die aufgrund von Antisemitismus zur Auswanderung nach Israel gezwungen sind. Gleichzeitig betrachte ich Palästina als legitime und rechtmäßige Heimat der Palästinenser. Da Israelis und Palästinenser, so wie es aussieht, keine gemeinsame Heimat haben können, muß sie unter ihnen aufgeteilt werden.
Und schließlich ist dieses Buch von einem Israeli geschrieben, der für sein Land gekämpft hat und der es liebt, der auch in dunklen Zeiten zu diesem Land gestanden hat, als er es nicht leiden konnte. Ich war nie der Meinung »Ob richtig oder falsch – Ich muß für mein Land eintreten«. Ich habe oft das Gefühl gehabt, daß mein Land nur dann überleben und gedeihen wird, wenn es das Richtige tut.
Arad, Juli 1994
Die Bedeutung der Heimat
Beginnen will ich mit einigen Dingen, die mir als selbstverständlich erscheinen. Ich werde überkommene Vorstellungen von Identität und Identifikation neu fassen, denn es hat in letzter Zeit ein mächtiges Erdbeben gegeben, das Worte und Bedeutungen mit sich gerissen hat: »Judentum«, »Zionismus«, »Heimat«, »nationales Recht«, »Friede« – diese Worte haben eine neue Dimension gewonnen, und man mißt ihnen Bedeutungen bei, an die wir nicht im Traum gedacht hätten. Und wer heute aufsteht und darüber spricht, läuft Gefahr, daß man ihn auf dem Marktplatz steinigt, ihm jüdischen Selbsthaß, Staatsverrat oder Entehrung des Gedächtnisses der Gefallenen vorwirft; denn sogar deren Ruhe ist gestört, so daß man sie als Munition in unseren internen Auseinandersetzungen verwenden kann.
Ich bin Jude und Zionist. Wenn ich meine Identität definiere, beziehe ich mich nicht auf die Religion, da ich außerhalb der Religion stehe. Ich bin es nicht gewohnt, mich auf verbale Kompromisse einzulassen wie »der Geist unserer jüdischen Vergangenheit« oder »die Werte jüdischer Tradition«, denn die Werte und die Tradition entstammen gleichermaßen direkt jenen Glaubenssätzen, an die ich nicht glauben kann; ich bin auch außerstande, die jüdischen Werte und die jüdische Tradition von ihren Quellen zu trennen, und das sind Gebot, Offenbarung und Glaube. Worte wie »Mission«, »Bestimmung« und »Auserwähltsein« machen mich, wenn sie mit dem Adjektiv »jüdisch« versehen sind, mehr als wütend. In meinem Sprachgebrauch ist ein Jude jemand, der sich selbst als Juden betrachtet oder gezwungenermaßen Jude ist. Ein Jude ist jemand, der es akzeptiert, Jude zu sein. Wenn er es öffentlich eingesteht, ist er aus freien Stücken Jude. Wenn er es nur sich selbst gegenüber anerkennt, ist er ein Jude durch den Zwang der Verhältnisse. Lehnt er jegliche Beziehung zum jüdischen Volk ab, dann ist er, zumindest meiner Ansicht nach, kein Jude, obwohl das religiöse Gesetz ihn als solchen definiert. Meiner Meinung nach ist ein Jude jemand, der sich entscheidet, das Schicksal anderer Juden zu teilen, oder dazu verurteilt ist.
Des weiteren: Jude zu sein bedeutet, sich geistig auf die jüdische Vergangenheit zu beziehen, ob diese Beziehung nun in Stolz oder Zurückweisung oder beiden zusammen, ob sie in kultureller und sprachlicher oder in emotionaler Teilhabe besteht.
Des weiteren: Jude zu sein bedeutet, sich auf die jüdische Gegenwart zu beziehen, sei es durch Handeln oder Nicht-Handeln; es bedeutet Stolz und aktive Teilnahme an den Leistungen der Juden als Juden, und es bedeutet, für das Unrecht, das Juden als Juden verübt haben, Verantwortung zu übernehmen (Verantwortung – nicht Schuld!).
Und schließlich: Jude zu sein bedeutet zu spüren, daß dann, wenn ein Jude verfolgt wird, weil er ein Jude ist – du gemeint bist.
Zionist sein
Wer an die Macht von Wörtern glaubt, muß sie sorgfältig verwenden. Das Wort »Holocaust« gebrauche ich nicht, wenn ich mich auf die Ermordung der europäischen Juden beziehe. »Holocaust« verfälscht das Wesen dessen, was geschehen ist. Ein Holocaust ist ein Naturereignis, ein Ausbruch von Kräften, die sich der Kontrolle der Menschen entziehen. Die Ermordung der europäischen Juden durch die deutschen Nazis war kein Holocaust. Und es war auch keine schreckliche, aber beiläufige Episode. Die Ermordung der europäischen Juden war das letzte, konsequente und fürchterliche Resultat des Status der Juden innerhalb der westlichen Zivilisation; die konsequente und schreckliche Vollendung einer sehr langen Geschichte: der Jude fällt in der westlichen Zivilisation nicht unter die geläufige Definition einer »nationalen Minderheit«, einer »religiösen Minderheit« oder eines »sozio-ökonomischen Problems«. Er ist seit Generationen ein Symbol. Wie der Kirchturm und das Kreuz, wie der Teufel und wie der Messias ist der Jude Teil der Infrastruktur des westlichen Denkens. Selbst wenn sich alle Juden den Völkern Europas assimiliert hätten, wäre der Jude dort immer noch gegenwärtig. Jemand hätte ihn entdecken müssen. Er war, so könnte man sagen, dazu verurteilt, als Archetyp im Keller des westlichen Bewußtseins zu existieren, zu glänzen und abzustoßen, zu leiden und zu betrügen, es war sein Schicksal, ein Genie zu sein, und es war sein Schicksal, ein Scheusal zu sein. Ein Jude in der Diaspora zu sein bedeutet daher diese eine Fürchterlichkeit: Auschwitz gilt dir. Es gilt dir, weil du ein Symbol bist. Das Symbol des zu Recht verfolgten Vampirs bzw. das Symbol des zu Unrecht ewig verfolgten Opfers – aber du bist immer und überall kein Individuum, sondern ein Stück dieses Symbols.
Ich bin Zionist, weil ich als Symbolstück im Bewußtsein anderer weder existieren will noch kann. Nicht als das Symbol des gerissenen, schlauen Vampirs und auch nicht als das Symbol des bemitleidenswerten Opfers, das Wiedergutmachung und Versöhnung verdient. Es gibt für mich daher keinen anderen Ort auf dieser Welt als das Land der Juden. Diese Tatsache befreit mich nicht von meiner Verantwortung als Jude, aber sie rettet mich vor dem Alptraum, Tag und Nacht ein Symbol im Denken fremder Menschen zu sein.
Ich sprach vom Land der Juden. Das Land der Juden hätte nur hier Wirklichkeit werden und bleiben können. Nicht in Uganda, nicht im Ararat-Hochland und nicht in Birobidschan. Weil hier das Land ist, auf das die Juden immer geschaut, nach dem sie sich immer gesehnt haben. Weil es keinen anderen Teil der Welt gibt, wohin die Juden in Massen gekommen wären, um dort ein jüdisches Land aufzubauen. Und an dieser Stelle nehme ich in aller Deutlichkeit eine schwerwiegende, rücksichtslose Unterscheidung vor zwischen den internen Motiven für die Rückkehr nach Zion und ihrer Rechtfertigung gegenüber anderen. Sehnsucht ist ein Motiv, aber keine Rechtfertigung. Unsere Rechtfertigung hinsichtlich der arabischen Bewohner des Landes kann sich nicht auf unsere uralten Sehnsüchte berufen. Wir besitzen keine andere Rechtfertigung als das Recht eines Ertrinkenden, der nach dem einzig erreichbaren Balken greift. (Eins will ich hier vorwegnehmen: Es besteht ein abgrundtiefer Unterschied zwischen einem Ertrinkenden, der nach einem Balken greift und sich Platz verschafft, indem er die anderen, die dort bereits sitzen, zur Seite schiebt, und einem Ertrinkenden, der die dort bereits Sitzenden ins Meer stößt. Da liegt der Unterschied, ob man Jaffa und Nazareth jüdisch macht oder Ramalla und Nablus.)
Worte wie »das versprochene Land« oder »die versprochenen Grenzen« kann ich nicht verwenden, weil ich nicht an ihn glaube, der dieses Versprechen gegeben hat. Glücklich sind jene, die das können: Ihr Zionismus ist einfach und offenkundig. Der meine ist hart und kompliziert. Ich kann auch nichts mit jenen Scheinheiligen anfangen, die sich schnell auf das Versprechen und den Urheber des Versprechens berufen, sobald ihr Zionismus mit Schwierigkeiten und inneren Widersprüchen konfrontiert wird. Ich bin Zionist in allen Punkten, die die Errettung der Juden betreffen, aber ich bin kein Zionist, wenn es um die »Errettung des Heiligen Landes« geht. Wir sind hierher gekommen, um als freie Menschen zu leben, und nicht, um das Land zu befreien, das unter der Entweihung durch ein fremdes Joch stöhnt, Jerusalem oder Galiläa oder Samaria oder Gilead oder Aram bis zum Euphrat. Ich bin nicht geboren, um Trompeten zu blasen oder ein Erbe zu befreien, das von Fremden entehrt worden ist.
Warum also dieser Ort unter allen anderen? Weil hier und nur hier der Ort ist, wohin die Juden kommen und ihre Unabhängigkeit aufbauen konnten. Weil die Erlangung der politischen Unabhängigkeit der Juden in keinem anderen Gebiet möglich gewesen wäre. Denn hier konzentrierten sich ihre Sehnsüchte.
Um die Wahrheit zu sagen, diese Sehnsüchte waren auf organische Weise mit dem Glauben an das Versprechen und den Urheber des Versprechens, an den Erlöser und Messias verbunden. Und der Glaube bildete, ebenso wie das gemeinsame Schicksal, die überdauernde Einheit des jüdischen Volkes. Andererseits hat nicht der Messias diesen Staat errichtet, sondern eine national-politische Bewegung mit einer säkularen, modernen Ideologie. Daher weist das Prinzipiengebäude des Zionismus eines Menschen ohne religiösen Glauben notwendigerweise Risse auf. Ich habe nicht die Absicht, diese Risse mit Phrasen und Sprüchen zu übertünchen oder zu kitten. Ich stelle mich ihnen, ich gestehe sie ein und akzeptiere sie; und ich sage: Hier stehe ich. Im gesellschaftlichen Leben und in der Liebe, im Angesicht des Todes und in der Gegenwart anderer ist ein nicht-religiöser Mensch zu einer widersprüchlichen Existenz verurteilt. Und das gilt für die Ideologie und den Zionismus gleichermaßen.
Daraus folgt, daß mein Zionismus kein »Ganzes« darstellt. Ich habe beispielsweise an Mischehen oder Glaubensübertritten, falls sie glücken, nichts auszusetzen. Nur solchen Juden, die aus freien Stücken Juden sind oder dazu verurteilt sind, Juden zu sein, gilt meine jüdische Verantwortung und meine jüdische Verbundenheit. Für sie und nur für sie stellt der Staat Israel eine Möglichkeit in der Gegenwart dar.
Ich betrachte mich nicht als einen Juden lediglich aufgrund der »Rasse« oder weil ich ein »Hebräer« bin, da ich im Lande Kanaan geboren wurde. Ich habe mich entschieden Jude zu sein. Als Jude möchte und kann ich nirgendwoanders leben als in einem jüdischen Staat. Der jüdische Staat konnte nur im Lande Israel Wirklichkeit werden. So weit reicht mein Zionismus.
Die Konfrontation mit der jüdischen Vergangenheit
Ich lebe hier nicht, um die alten Zeiten mit neuem Leben zu füllen oder den Ruhm der Vergangenheit zu erneuern. Ich lebe hier, weil ich den Willen habe, als freier Jude zu leben.
Ich gebe zu, daß dieses Land zum größten Teil aufgrund einer religiösen Erfahrung gewachsen und verwirklicht worden ist. Selbst seine Gründer, die sich außerhalb der Sphäre der Religion begaben und dagegen revoltierten, waren von der Kraft einer religiösen Erfahrung getrieben, die sich als Formulierung einer national-säkularen Ideologie verkleidete. »Den Ruhm der Vergangenheit erneuern«, »die alten Zeiten mit neuem Leben erfüllen«, »das Land erretten« – diese geläufigen Redeweisen sind und waren Zeugnisse für die mächtigen Strömungen unter der Oberfläche der säkularen zionistischen Vorstellungen. Tatsächlich findet sich häufig ein Stück bewußter oder unbewußter Selbsttäuschung in diesen Wendungen, die absichtlich von ihrem religiösen Zusammenhang losgelöst werden, um eine wesentlich national-säkulare Ideologie zu schmücken und zu verschönern. Dieser falsche Zungenschlag wird besonders störend, wenn der Staat Israel mit messianischen Attributen versehen wird und man uns weismachen will, daß die Ankunft des Messias in jeder jüdischen Ziege, jedem jüdischen Hektar Boden und jedem jüdischen Gewehr sichtbar ist. Brenner hat dazu einiges zu sagen gehabt.
Aber die Existenz des Staates Israel, die sich hier entfaltet und Form angenommen hat, hat ein eigenes Bild hervorgebracht: Im Mittelpunkt steht nicht die Befreiung des überkommenen Erbes und auch nicht die Befreiung und Wiedererrichtung des Judaismus, sondern die Befreiung der Juden. Das neue Israel ist keine Wiedererrichtung des Königreichs Davids oder Salomos oder des Zweiten Tempels. Andererseits kann man es nicht als eine Art von amerikanischem oder australischem Einwanderungsland auf dem Boden Kanaans betrachten. Der neue Staat Israel ist nicht durch eine Nabelschnur mit der jüdischen Religion und Geschichte verbunden, aber auch nicht vollständig davon getrennt. Es ist eine merkwürdige und faszinierende Situation des »Sich in Bezug Setzens«. Bibel und Mischna, Gebete und Pijut, Halacha und Agada beherrschen den Staat Israel nicht, aber sie sind darin gegenwärtig und formen indirekt das tagtägliche und das geistige Leben.
»Sich in Bezug setzen« bedeutet weder ununterbrochene Kontinuität noch Neubeginn. »Sich in Bezug setzen« bedeutet ständige Beziehung zur jüdischen Vergangenheit. Die hebräische Sprache, das Gesetz und die Rechtspflege, die Gebräuche, die Kinderlieder, die Literatur – all dies verweist unablässig auf das Erbe der jüdischen Kultur. Das ist keine Neuinterpretation einer alten Kultur, wie die Schüler von Ahad Ha’am es wollen, und auch kein Sprung in Vergangenheit, um an die uralten vorjüdischen Zeiten anzuschließen, wie die Schule von Berdyczewski [Bin Gorin] behauptet. Es ist eine indirekte, gewundene, dialektische Bezugnahme, beladen mit Konflikten und Spannungen, voller Aufbegehren und gefühlsmäßiger Nostalgie und reich an Widersprüchen und Gegensätzen.
Ich gehöre zu jenen, die glauben, daß diese Konflikte und Spannungen, diese Gegensätze und Widersprüche nicht zu geistiger Armut und Schalheit führen. Im Gegenteil: Sie sind eine Ader kulturellen Reichtums, eine fruchtbare Quelle geistiger Dynamik. Als nichtgläubiger Jude bin ich begeistert vom aufregenden Reichtum, der im Knäuel unseres Daseins hier verborgen liegt, im Lande der Juden, die sich zum Judaismus in Bezug setzen.
Die Stellungnahme zu Palästina
»Einem Volk ohne Land ein Land ohne Volk« – diese Formel machte ihren Vertretern einen leichten, einfachen und selbstverständlichen Zionismus möglich. Aber ihr Weg ist nicht der meine. Mein Zionismus ist hart und kompliziert.
Anscheinend brachte die verzaubernde Idee, »die alten Zeiten zu erneuern«, den Zionismus zu seiner tiefverwurzelten Neigung, ein Land ohne Bewohner vor sich zu sehen: Jeder Wunsch nach Wiederbelebung und Erneuerung beinhaltet die Absicht einer symmetrischen Zusammenfügung von Vergangenheit und Gegenwart. Wie wäre es den Vertretern der These von der Rückkehr nach Zion entgegengekommen, wenn sie das Land von den römischen Legionen oder den Kanaanitern und Philistern genommen hätten. Und in ein vollkommen leeres Land zu kommen wäre noch angenehmer gewesen. Von hier ist es nur ein kleiner Schritt zu jener selbstverschuldeten Blindheit, die darin besteht, die Existenz der arabischen Bevölkerung des Landes zu leugnen bzw. sie selbst und ihre Bedeutung mit der zweifelhaften Begründung abzuqualifizieren, sie »habe hier keine wertvollen Kulturleistungen geschaffen« – als ob uns das erlauben würde, von ihrer Existenz keine Notiz zu nehmen. (Zu gegebener Zeit sollte Naomi Shemer diese Haltung ausdrücken, als sie Ost-Jerusalem folgendermaßen beschrieb: »...der Marktplatz ist leer / und niemand geht hinunter zum Toten Meer / über Jericho«1, was natürlich bedeutete: Der Marktplatz ist leer von Juden, und kein Jude geht hinunter zum Toten Meer über Jericho. Eine bemerkenswerte Enthüllung einer bemerkenswert typischen Einstellung.)
Als ich ein Kind war, lehrten mich einige meiner Lehrer folgendes: Nachdem unser Tempel zerstört war und wir aus diesem Land vertrieben worden waren, beerbten Fremde unser Land und entehrten es. Die in der Wüste geborenen Araber ließen das Land brach liegen, überließen die Hügelterrassen ihrem Ruin und zerstörten mit ihren Herden die schönen Wälder. Als unsere ersten Pioniere ins Land kamen, um es wiederaufzubauen und von seiner Verwüstung zu erretten, fanden sie ein aufgegebenes, ödes Land vor. Nun ja, einige rückständige, unzivilisierte Nomaden zogen darin herum.
Unter den ersten, die hier ankamen, waren einige der Meinung, daß von Rechts wegen die Araber in die Wüste zurückkehren und das Land seinen Eigentümern zurückgeben sollten, und falls nicht – »Stehe auf und tritt dein Erbe an« – wie jene, die »Kanaan im Sturm nahmen«: »Eine Weise von Blut und Feuer... Erklettere den Berg, zermalme die Ebene, alles, was du siehst – beerbe es... und erobere das Land mit der Kraft deines Arms«, und so weiter (Tschernichowski: »Ich habe eine Weise«). Die ersten Siedler hielten allerdings zum größten Teil dem jüdischen Erbe und den Prinzipien Tolstojs die Treue und suchten daher den Weg des Friedens und der Güte, denn »die Beduinen sind Merschen wie wir«(!). So brachten wir Licht in die Dunkelheit der Zelte von Kedar. Wir haben Straßen gebaut und Gebäude errichtet, wir haben geheilt und verbessert, und wir haben die Bewohner des Landes an den Wohltaten des Überflusses und der Zivilisation teilnehmen lassen. Aber sie, blutdürstig und undankbar, wie sie nun einmal sind, haben nur zu bereitwillig dem aufstachelnden Rat von Fremden Gehör geschenkt, und sie waren neidisch auf unseren Besitz und unseren Fleiß, sie waren begierig auf unsere Häuser und auf unsere Frauen. Daher haben wir ihre Angriffe abgewehrt. Wiederum haben wir die Hand ausgestreckt, und wieder hat man sie verweigert, und so geht der Krieg zwischen dem gepflügten Land und dem wüsten Land, zwischen den Söhnen des Lichts und den Söhnen der Finsternis bis auf den heutigen Tag weiter. (Man muß darauf hinweisen, daß diese vereinfachte Sicht zwar nicht allgemein vorherrschte, aber doch bei den Zionisten gang und gäbe war. Unter den besten Köpfen innerhalb und außerhalb der Arbeiterbewegung gab es viele, von A.D. Gordon bis Buber und Sharett, von Brenner bis Ben-Gurion und Yaari, die eine weitaus reifere und vielseitige Sicht der Situation hatten.)
Hinzu kommt, daß in unserer Haltung gegenüber der arabischen Bevölkerung von Anfang an zwei extreme, entgegengesetzte Denkrichtungen übereinstimmten: Der nationalistische Revisionismus und der »Kanaanismus« (der übrigens auf dem Boden des Revisionismus entstanden war) waren einer Meinung. Viele Jahre vor dem erstaunlichen, ironischen Zusammentreffen von Uri Zvi Grinberg und Aharon Amir im »Komitee für die Integrität des Landes Israel« stimmten die Kanaaniten und die Nationalisten darin überein, die Araber seien die direkte Reinkarnation der Amoriter, Ammoniten, Aramiten und was nicht noch. Die Romantiker und die Gegenromantiker wollten gleichermaßen die Gegenwart im Lichte der Bibel darstellen. (Die Schlußfolgerungen waren allerdings entgegengesetzt: Die Revisionisten träumten von einem heiligen Krieg gegen die Stämme Kanaans, also von einer direkten Fortführung der Kriege Joshuas, Davids und Jannais und von der »Vergeltung für das Blut deiner Knechte, das vergossen ist«. Die Kanaaniten wiederum träumten von einer Rückkehr, um in die semitisch-kanaanitische Ethnie aufgenommen zu werden, wo wir vor Tausenden von Jahren durch einen »Gebetsriemen-Judaismus« getrennt worden waren.)
Am allerbedauerlichsten allerdings für die Vertreter dieses romantischen Bildes, das die glaubenstreuen und die apostatischen Juden jeweils auf ihre Weise so liebevoll hegten, war der Umstand, daß die Menschen, die ins zeitgenössische Zion zurückkehrten, keine kanaanitischen Stämme vorfanden und somit weder von diesen aufgenommen werden noch die uralten Blutfehden mit ihnen zu Ende führen konnten. Die Menschen, die nach Zion zurückkehrten, fanden sich mit einer arabischen Bevölkerung konfrontiert, die sich nicht symmetrisch ins Bild von der »Erneuerung der alten Zeiten« einfügen ließ, da sie nicht identisch war mit jenen, die uns aus unserem Land vertrieben und uns unseres Erbes beraubt hatten. Wegen tausend Nichtigkeiten, aber auch wegen der ersten Anzeichen eines legitimen Nationalbewußtseins war die arabische Bevölkerung nicht willens, uns die traditionelle herzliche orientalische Gastfreundschaft entgegenzubringen, und sie breitete nicht die Arme aus, um die heimkehrenden Söhne zu umarmen. Daher all die Verwirrung und all die Wut.
Dort war also das Volk, das nach Zion zurückkehrte, und es sah sich dem Volk des Gebiets gegenüber; es war verwirrt und weigerte sich, das andere Volk wahrzunehmen, war anmaßend und überschwenglich, galoppierte auf Patrouillenpferden und zupfte die Briten am Ärmel, um sich Gehör zu verschaffen, vergrub sich in Erinnerungen an Josua, Esra und Nehemia, beschäftigte sich mit exotischen, orientalischen Gebräuchen, zeigte das Bewußtsein eines missionarisch-zivilisatorischen Auftrags, war sich da und dort auch auf unbestimmte Weise einer tragischen Seite bewußt, war aber in jedem Fall fremd und anders.
Gerechtigkeit gegen Gerechtigkeit
Ich habe versucht, mittels einiger Übertreibungen zum einen die Ansicht zu skizzieren, welche die Auseinandersetzung als eine Art Wildwestfilm versteht, in dem die zivilisierten Guten die blutrünstigen Eingeborenen bekämpfen, zum anderen die romantischen Vorstellungen, die den Disput mit der Aura einer uralten Heldensage versehen wollen. Für mich ist die Konfrontation zwischen dem nach Zion zurückkehrenden Volk und den arabischen Bewohnern des Landes keine Art Western oder Sage, sondern eine Art Tragödie. Eine Tragödie ist kein Konflikt zwischen »Licht« und »Dunkel«, zwischen Gerechtigkeit und Verbrechen. Es ist ein Zusammenstoß von vollkommener Gerechtigkeit mit vollkommener Gerechtigkeit, wenngleich man die beiden Kontrahenten nicht als symmetrisch zueinander verstehen sollte. Und wie in allen Tragödien gibt es keine Hoffnung auf eine jubilierende Versöhnung auf der Grundlage einer klugen Kompromißformel. Die Alternative besteht hier zwischen einem Blutbad und einem traurigen, enttäuschenden Kompromiß, in dem man die Situation eher aufgrund zwingender Notwendigkeiten als dem plötzlich erreichten gegenseiten Verstehen akzeptieren wird.
Natürlich ist die Auseinandersetzung nicht symmetrisch (wie J. Harcavy in seinem Aufsatz Israel’s Position in the Israeli-Arab Dispute2 deutlich herausgearbeitet hat). Zwischen den unablässigen, enthusiastischen Versuchen des Zionismus, einen Dialog mit den einheimischen und ausländischen Arabern zu führen, und der bitteren, hartnäckigen Feindschaft, die die Araber, mit all ihren unterschiedlichen Herrschaftsformen, uns umgekehrt in den letzten Jahrzehnten entgegengebracht haben, besteht keine Symmetrie. Die Annahme jedoch, die Auseinandersetzung beruhe auf einem Mißverständnis, stellt einen großen Fehler und eine grobe Vereinfachung dar. Sie beruht vielmehr auf vollständigem Verständnis: Wir kehrten zurück und boten den Arabern guten Willen, gute nachbarschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit an, aber nicht das war es, was sie von uns wollten. Sie wollten, daß wir die Errichtung des jüdischen Staates im Lande Israel einstellten, und das ist ein Zugeständnis, das wir nicht machen konnten und niemals werden machen können. Es ist ein Zeichen äußerster Naivität zu glauben, daß allein die Streitsüchtigkeit gegenüber fremden Elementen und die Rückständigkeit ihrer reaktionären Herrschaftsformen die Araber daran hinderte, die positiven Seiten des Zionismus zu erkennen und uns sofort in brüderlicher Liebe um den Hals zu fallen.
Die Araber haben den Zionismus nicht bekämpft, weil sie ihn nicht verstanden haben, sondern weil sie ihn nur zu gut verstanden haben. Und darin liegt die Tragödie: Das gegenseitige Verständnis ist gegeben. Wir wollen als eine Nation, als ein jüdischer Staat existieren. Sie wollen diesen Staat nicht. Das läßt sich nicht mit leeren Worten übertünchen. Hochherzige Güte vom Brit-Schalom-Zuschnitt wird ebenso wenig helfen wie die politische Akrobatik der Semitischen Aktion; und die arabische Taktik, etwa die Behauptung, man gebe sich zufrieden, falls man den Flüchtlingen ihre Rechte zubillige, wird auch nichts helfen. Jede Suche nach einem Ausweg muß klar das volle Ausmaß der Auseinandersetzung erkennen: ein tragischer Konflikt von tragischer Stärke.
Wir sind hier – weil wir nirgendwo sonst als eine Nation, als ein jüdischer Staat existieren können. Die Araber sind hier – weil Palästina die Heimat der Palästinenser ist, so wie der Irak die Heimat der Iraker und die Niederlande die Heimat der Niederländer ist. Welche kulturellen Leistungen die Palästinenser hier geschaffen haben und in welchem Maße sie ein Nationalbewußtsein entwickelt haben, hat für ihr Recht auf Heimat keinerlei Bedeutung. Und man braucht ja wohl nicht zu erwähnen, daß der Palästinenser Gottes Versprechen gegenüber Abraham, den Sehnsüchten eines Jehuda Halevi und eines Bialik oder der von jenem britischen Adeligen, Lord Balfour, abgegebenen Erklärung keine Hochachtung zollt.
Häufig wird davon geredet, man solle die palästinensischen Menschen ins reiche Kuwait oder in den fruchtbaren Irak abschieben, aber das ist ebenso unsinnig wie die Idee, wir selbst sollten massenweise in die »jüdische« Stadt Brooklyn auswandern. Der Palästinenser hat schließlich das Recht, sich als Palästinenser zu betrachten, und nicht als Iraker oder Kuwaiter. Die Tatsache, daß nur eine Minderheit von Palästinensern dies offenbar so sieht, kann das nationale Recht auf Selbstbestimmung für die, sagen wir, nächste Generation nicht präjudizieren. Wir sollten uns in Erinnerung rufen – bei allen Einschränkungen, die dieser Vergleich erfordert -, daß eine Minderheit bewußter Zionisten – mit voller Berechtigung! – das Recht für sich beansprucht hat, hier einen jüdischen Staat zu errichten, zum Wohle der Mehrheit des jüdischen Volkes ohne zionistisches Bewußtsein und für das jüdische Volk als Ganzes.
Dies ist unser Land; es ist ihr Land. Recht prallt mit Recht zusammen. »Ein freies Volk in unserem eigenen Land zu sein« ist ein Recht, das universelle oder gar keine Gültigkeit hat.
Der Streit zwischen Israel und den arabischen Nachbar-