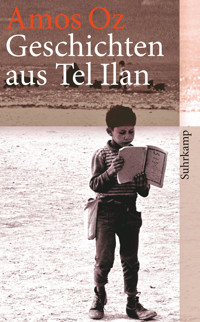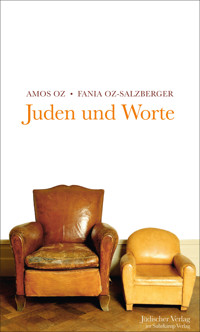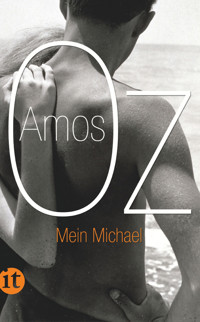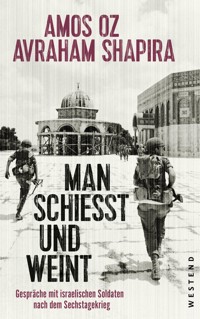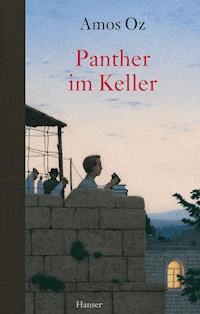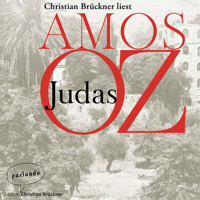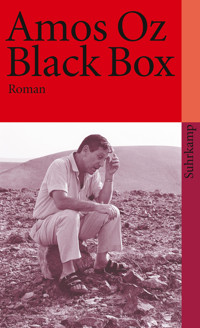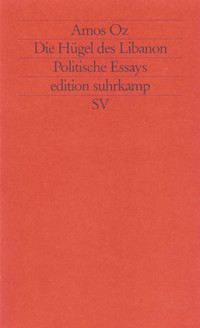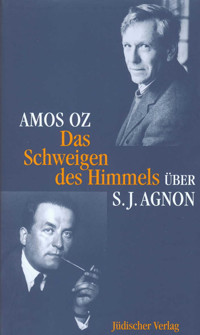6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tel Aviv, ein stickiger Sommerabend: Ein bekannter Schriftsteller ist zu einer Lesung eingeladen. Was werden seine Leser, was wird sein Publikum ihn fragen? Das Übliche? Warum schreiben Sie? Sind Ihre Bücher autobiographisch? Was wollten Sie uns mit Ihrem letzten Roman sagen? Was wird er antworten? Das Übliche? Oder wird er sich den Erwartungen widersetzen? Amos Oz erzählt in seinem neuen Roman von einem bekannten Schriftsteller an einem stickigen Sommerabend in Tel Aviv, von der Liebesnacht danach, von den Menschen, die ihm begegnen, bis die Geschichten, die sie alle haben oder haben könnten, sich entfalten und miteinander verknüpfen, bis das, was sich ereignet, und das, was sich hätte ereignen können, ununterscheidbar werden. Verse auf Leben und Tod ist die unkonventionelle Antwort des großen Erzählers Amos Oz auf die Frage nach dem subversiven Wechselspiel von Leben und Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Amos Oz
Verse auf Leben und Tod
Titel der Originalausgabe Charuse ha-chajim we-ha-mawet
eBook Suhrkamp Verlag 2025
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4084
© Amos Oz 2007
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin, 2008
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Göllner, Michels, Zegarzewski
Umschlagfoto: © Basso Cannarsa/opale.photo/laif
eISBN 978-3-518-78499-0
www.suhrkamp.de
Inhalt
Dies sind die wichtigsten Fragen
Die Personen
Dies sind die wichtigsten Fragen: Warum schreiben Sie? Warum gerade in dieser Weise? Wollen Sie Ihre Leser verändern, und wenn ja – in welchem Sinne? Welchen Zweck verfolgen Ihre Geschichten? Streichen und verbessern Sie ständig, oder schreiben Sie alles auf einmal aus einer Eingebung heraus? Wie ist das, wenn man ein berühmter Schriftsteller ist, und welche Auswirkungen hat es auf die Familie? Warum beschreiben Sie fast immer nur die negativen Seiten? Was halten Sie von anderen Schriftstellern, wer hat Sie beeinflußt, und wen mögen Sie überhaupt nicht? Und nebenbei, wie verstehen Sie sich selbst? Was sagen Sie zu den Angriffen auf sich, wie fühlt man sich dabei? Haben solche Angriffe Auswirkungen auf Ihr Schreiben? Schreiben Sie mit dem Bleistift oder mit dem Computer? Und wieviel verdienen Sie ungefähr mit jedem Buch? Stammt das Material für Ihre Geschichten aus Ihrer Phantasie oder aus dem wirklichen Leben? Was denkt Ihre Ex-Ehefrau über die weiblichen Protagonisten in Ihren Büchern? Und warum haben Sie Ihre erste Frau verlassen und auch die zweite? Gibt es feste Stunden zum Schreiben, oder schreiben Sie nur, wenn Sie in der entsprechenden Stimmung sind? Sind Sie ein engagierter Schriftsteller, und wenn ja, wofür? Sind Ihre Geschichten autobiographisch oder erfunden? Und das wichtigste, als Künstler, wie kommt es, daß Ihr Privatleben alles andere als aufregend ist? Könnte man nicht sagen, es ist ein ziemlich normales Leben? Oder gibt es Dinge, von denen niemand etwas weiß? Und wie kommt es, daß ein Schriftsteller, ein Künstler, sein Leben lang als Steuerberater arbeitet? Was, das machen Sie nur, um Ihren Lebensunterhalt zu verdienen? Und tötet Ihr Beruf nicht die Inspiration? Und gibt es ein Geheimnis in Ihrem Leben? Vielleicht sind Sie ja bereit, uns heute abend wenigstens ein paar Hinweise in dieser Richtung zu geben? Und vielleicht erklären Sie uns bitte, ganz kurz und in eigenen Worten, was Sie mit Ihrem letzten Buch sagen wollten?
Auf diese Fragen gibt es spitzfindige Antworten und ausweichende. Einfache und direkte gibt es nicht.
Deshalb sitzt der Schriftsteller in einem kleinen Café, vielleicht drei, vier Straßen von dem nach Schunja Schor benannten Kulturzentrum entfernt, in dem der literarische Abend stattfinden soll. Das Café, mit seiner niedrigen Decke, erscheint ihm dunkel und stickig, folglich gerade recht. Hier versucht er, sich auf diese Fragen vorzubereiten (schon immer ist er eine halbe Stunde oder vierzig Minuten vorher an Ort und Stelle, und immer muß er dann irgendwie die Zeit rumbringen). Vergeblich wischt die müde Kellnerin, in einem kurzen Rock, die Brust hochgeschnürt, mit einem Lappen seinen Tisch ab, die Resopalfläche wird klebrig bleiben, auch nach dem Wischen. Vielleicht war der Lappen nicht sauber?
Der Schriftsteller mustert die Beine der Kellnerin, volle, schöne Beine, nur die Knöchel sind etwas zu dick. Dann betrachtet er ihr Gesicht, ein hübsches Gesicht, heiter, strahlend, die Augenbrauen berühren einander, und ihre Haare hält ein roter Gummi zusammen. Sie verströmt den Geruch von Schweiß und Seife, den Geruch einer müden Frau. Der Sliprand ist unter ihrem Rock erkennbar. Er konzentriert sich auf diese Umrisse: Eine leichte Asymmetrie an der linken Hüfte fasziniert ihn. Sie bemerkt den über ihre Beine, ihre Oberschenkel und ihre Hüften streichenden Blick und schnaubt abweisend: »Das reicht jetzt, oder?«
Ganz höflich wendet der Schriftsteller daher die Augen ab, er bestellt ein Rührei und Salat mit einem Brötchen sowie eine Tasse Kaffee, er nimmt eine Zigarette aus der Packung und hält sie unangezündet zwischen den Fingern der linken Hand, in die er seinen Kopf stützt: ein hoch vergeistigter Ausdruck, der die Kellnerin nicht beeindruckt, weil sie sich auf ihren flachen Absätzen umgedreht hat und hinter dem Raumteiler verschwunden ist.
Während er auf das Rührei wartet, malt sich der Schriftsteller die erste Liebe dieser Kellnerin aus (er beschließt, daß sie Riki heißt): Als sie gerade sechzehn war, verliebte sie sich in den Ersatztorwart von Bnei-Jehuda, Charlie, der an einem Regentag in seinem Lancia vor dem Schönheitssalon auftauchte, in dem sie arbeitete, und sie zu einem Dreitage-Trip in ein Hotel nach Eilat entführte (sein Onkel war Miteigentümer dieses Hotels). In Eilat kaufte Charlie ihr ein ganz besonderes Abendkleid, ein Kleid wie das jener griechischen Sängerin, mit Silberpailletten und allem, aber nach zwei Wochen trennte er sich von ihr und fuhr wieder zu jenem Hotel, um sich zu amüsieren, diesmal mit der zweiten Strandkönigin. Und vielleicht träumt Riki acht Jahre und vier Männer später immer noch davon, daß er eines Tages zu ihr zurückkommen würde: Es gab solche schrecklichen, gefährlichen Momente, in denen er sich sehr über sie zu ärgern schien, so als ob er gleich zu toben anfinge, und sie erschrak dann zu Tode, und plötzlich, auf einmal, schlug seine Stimmung um, er verzieh ihr und freute sich wie über ein Kind, umarmte sie, nannte sie Gogog, küßte ihren Hals, kitzelte sie leicht mit seinem warmen Atem, öffnete mit der Nasenspitze zärtlich ihre Lippen, wodurch ein warmes, honigsüßes Kribbeln ihren Körper überlief, und übergangslos warf er sie hoch in die Luft, wie ein Kissen, bis sie »Mama« schrie, aber immer fing er sie im allerletzten Moment auf und umarmte sie, so daß sie nicht auf den Boden stürzte. Seine Zungenspitze kitzelte sie ganz leicht und sehr lange hinter jedem Ohr, und auch in jedem Ohr, und auch im Nacken, an der Stelle, an der die feinsten Härchen wachsen, bis sie wie Honig zerfloß. Nie hatte Charlie sie geschlagen, und nie hatte er sie beleidigt. Er war der erste, der ihr das enge Tanzen beigebracht hatte, er hatte ihr beigebracht, Bikinis zu tragen und in der Sonne nackt auf dem Bauch zu liegen und die Augen zu schließen und sich alle möglichen unanständigen Sachen vorzustellen, und er war der erste, der ihr beigebracht hatte, lange Ohrringe mit einem grünen Stein zu tragen, die ihr Gesicht und ihren Hals erst richtig zur Geltung brachten.
Aber danach mußte er den Lancia zurückgeben, und sie gipsten auch seine angebrochene Hand ein, und wieder fuhr er nach Eilat, aber mit einem anderen Mädchen, Lucy, die bei der Wahl zur Strandkönigin nur knapp gescheitert war, und vor der Fahrt sagte er: »Schau, Gogog, es tut mir wirklich schrecklich leid, aber versuche trotzdem, mich zu verstehen, Lucy gab es eigentlich schon vor dir, alles in allem haben Lucy und ich uns nie wirklich getrennt, wir hatten nur etwas Streit, und irgendwie haben wir für eine Weile nichts mehr miteinander zu tun gehabt, aber jetzt sind wir wieder zusammen, und Lucy läßt dir ausrichten, daß sie wirklich nicht sauer auf dich ist, no hard feelings, du wirst sehen, Gogog, du wirst mit einem gewissen Abstand unsere Affäre ruhiger betrachten, und bestimmt findest du einen anderen, der besser zu dir paßt als ich, denn, ehrlich gesagt, du hast einen verdient, der besser ist als ich, du hast den besten verdient, den es gibt. Und am wichtigsten ist doch, daß ich und du, Gogog, eine gute Zeit miteinander hatten, nicht wahr?«
Das griechische Paillettenkleid schenkte Riki einer Cousine, und den Bikini stopfte sie ganz hinten in die Schublade mit dem Nähzeug, und später vergaß sie ihn dort: Männer können nicht anders, das ist ihre Natur, so sind sie einfach, schlimm, sicher, aber eigentlich sind die Frauen, ihrer Meinung nach, auch nicht besser, deshalb nimmt das mit der Liebe so oder so fast immer ein schlechtes Ende.
Charlie spielt schon lange nicht mehr Fußball bei Bnei-Jehuda. Er hat eine Familie, drei Kinder und eine Firma in Holon, die Sonnenboiler herstellt, und man sagt, sie stelle sogar Sonnenboiler in größeren Mengen für die besetzten Gebiete und für Zypern her. Und jene Lucy? Die mit den schlanken Beinen? Wäre interessant, zu wissen, was aus ihr geworden ist. Hat Charlie auch sie nach Gebrauch weggeworfen? Wenn ich nur ihre Adresse hätte oder ihre Telefonnummer oder mutig genug wäre, nach ihr zu suchen. Damit wir zusammen Kaffee trinken. Damit wir miteinander reden. Vielleicht hätten wir sogar Freundinnen werden können. Seltsam, daß er mir überhaupt nichts mehr bedeutet, sie aber doch ein wenig. An ihn denke ich schon nicht mehr, noch nicht mal mit Verachtung, aber an sie denke ich manchmal: Denn vielleicht ist sie ein bißchen wie ich geworden? Was, auch sie hat er im Bett Gogog genannt? Er hat gelacht und die Nasenspitze zwischen ihren Lippen hin- und herbewegt? Ganz langsam hat er ihr sehr zart, zusammen mit ihr, mit ihrer Hand, gezeigt, was das überhaupt ist, ihr Körper? Wenn es mir gelingen würde, sie zu finden, könnten wir vielleicht darüber sprechen und ganz langsam Freundinnen werden.
Zwischen einer Frau und einem Mann ist Freundschaft unmöglich: Wenn es zwischen ihnen funkt, dann kann es keine Freundschaft mehr geben. Aber zwischen Frauen, besonders zwischen zwei Frauen, die leidvolle Erfahrungen mit Männern hinter sich haben, und vielleicht besonders zwischen zwei Frauen, die beide unter demselben Mann gelitten haben – vielleicht würde es mir wirklich guttun, diese Lucy eines Tages zu finden?
Am Nebentisch sitzen zwei Herren, die offensichtlich Zeit haben, beide ungefähr fünfzig. Derjenige, der den Ton angibt, ist breitschultrig, energisch und vollkommen kahl, er sieht aus, als stamme er aus einem Gangsterfilm und spiele dort den für die Drecksarbeit Zuständigen. Der Begleiter macht einen verlebten, schäbigen Eindruck, ein Großmaul, sein Gesichtsausdruck deutet an, daß er bereit ist, bedingungslos jeden zu loben oder zu bemitleiden, je nachdem, was gerade benötigt wird. Der Schriftsteller steckt eine Zigarette an und stellt sich vor, dieser Typ sei ein kleiner Makler oder Vertreter für Haartrockner. Den Anführer nennt der Schriftsteller für sich Herrn Leon, und vielleicht könnte der unterwürfige Herrn Schlomo Chugi heißen. Die beiden unterhalten sich gerade über Erfolg im allgemeinen.
Der Mann fürs Grobe sagt: »Und außerdem, bis man endlich etwas erreicht im Leben, ist das Leben auch schon zu Ende.«
Der Sekundant sagt: »Du hast hundertprozentig recht, ich werde mich hüten, dir zu widersprechen, aber was soll’s? Komm, du mußt doch zugeben, daß ein Leben, das nur aus Essen und Trinken besteht, nicht alles sein kann. Der Mensch braucht auf jeden Fall eine gewisse Geistigkeit, eine besondere Seele, wie es im Judentum heißt, oder?«
»Du«, konstatiert der Chef kühl und sogar leicht angewidert, »du redest mal wieder Unsinn. Was heißt hier Unsinn? Schwachsinn pur. Du solltest ein lebensnahes Beispiel bringen, wenn du etwas erklären willst.«
»Gut, das ist möglich, warum nicht, nimm zum Beispiel Chasam von der Firma Isratex, Ovadja Chasam, du erinnerst dich an ihn, der, der vor zwei Jahren eine halbe Million im Lotto gewonnen hat, er hat sich anschließend scheiden lassen, ist von einer zur anderen geflattert, hat eine neue Wohnung bezogen, hat Geld angelegt, hat jedem Geld ohne Sicherheiten geliehen, ist bei uns in die Partei eingetreten und wollte sich zum Ortsvorsteher wählen lassen, er hat wie ein König gelebt. Wie ein Lord. Und dann hat er Leberkrebs bekommen und wurde in kritischem Zustand ins Ichilow-Krankenhaus eingeliefert.«
Herr Leon zieht eine Grimasse, als wäre er gelangweilt, und sagt: »Klar, Ovadja Chasam, ich war auf der Hochzeit seines Sohns. Zufällig kenne ich den Fall sehr gut. Ovadja Chasam hat das Geld mit vollen Händen ausgegeben, für mildtätige Zwecke, zum eigenen Vergnügen, er ist jeden Tag in einem blauen Buick in der Stadt rumgefahren, mit russischen Blondinen, und die ganze Zeit hat er nach allen Arten von Geldgebern gesucht, Unternehmern, Bürgschaften, Geldquellen, Teilhaber. Der Ärmste. Aber was? Für unser Thema spielt er keine Rolle: Er ist kein Beispiel für dich. Krebs, mein Freund, bekommt man nicht wegen schlechter Angewohnheiten. Krebs, das haben die Wissenschaftler schon festgestellt, bekommt man von Schmutz oder von Streß.«
Der Schriftsteller läßt fast das halbe Rührei auf dem Teller. Er trinkt zwei, drei Schluck Kaffee, der nach angebrannten Zwiebeln und verbrannter Butter riecht. Er schaut schnell auf seine Uhr. Er begleicht seine Rechnung bei Riki, dankt ihr mit einem Lächeln für das Wechselgeld, das er für sie unter der Untertasse versteckt. Diesmal will er sie nicht mustern, doch als sie von ihm weggeht, läßt er einen langen Abschiedsblick über ihren Rücken und ihre Schenkel gleiten: Die Kontur ihres Slips zeichnet sich unter dem Rock links etwas höher ab als rechts. Von dem Anblick kann er sich nur schwer losreißen. Endlich steht er auf, geht zur Tür, dreht sich dann aber um und steigt die zwei Treppen zur fensterlosen Toilette hinunter: eine ausgebrannte Birne, abblätternder Verputz und der Geruch nach altem Urin in der Dunkelheit erinnern ihn daran, daß er auf seine Lesung und die Fragen des Publikums nicht vorbereitet ist.
Als er von der Toilette zurückkommt, bemerkt er, daß Herr Leon und Schlomo Chugi ihre Stühle näher zusammengerückt haben und sich jetzt Schulter an Schulter über ein Notizbuch oder ein Album beugen. Der, der das Sagen hat, fährt langsam mit dem Daumen die Zeile entlang, während er zugleich eindringlich flüstert, den Kopf schüttelt, immer wieder, als sei ein für allemal die Angelegenheit erledigt, mit allem Nachdruck, kommt nicht in Frage, ausgeschlossen, während sein gehorsamer Partner unaufhörlich nickt.
Als er auf die Straße hinaustritt, zündet sich der Schriftsteller eine weitere Zigarette an. Es ist zwanzig nach neun. Ein warmer Abend, schwül, über den Straßen und Höfen hängt unbeweglich eine Luft voller Ruß und dem Geruch nach verbranntem Benzin. In den Augen des Schriftstellers ist es schrecklich, an einem so stickigen Abend wie diesem in kritischem Zustand im Ichilow-Krankenhaus liegen zu müssen, von Injektionsnadeln zerstochen, angeschlossen an Schläuche, zwischen verschwitzten Laken, mit dem asthmatischen Fauchen der Beatmungsgeräte. Der Schriftsteller stellt sich Ovadja Chasam vor. Bevor die Krankheit ausbrach, war er äußerst aktiv, rastlos, immer auf dem Sprung, ein Mann mit einem schweren Körper, aber flinken, fast tänzerischen Bewegungen, der in seinem blauen Buick durch die Straßen der Stadt fuhr, umgeben von Assistenten, Bekannten, Beratern, jungen Frauen, Investoren, Mittelsmännern, Spekulanten, von Menschen, die vor Ideen und Unternehmungslust nur so sprühten, von Schnorrern aller Art und von allen möglichen Strippenziehern. Er klopfte jedem auf die Schulter, umarmte alle, Männer wie Frauen, drückte sie an seine breite Brust, stieß seinem Gesprächspartner den Ellenbogen in die Seite, schwor hoch und heilig, war tief erstaunt, brach in lautes Lachen aus, kritisierte, riß Witze, sagte, das überrascht mich echt, schrie, das kannst du wirklich vergessen, zitierte Abschnitte aus der Tora, und zuweilen schien ihn eine Welle von Gefühlen zu überschwemmen, dann fing er an, ohne Vorwarnung Männer und Frauen gleichermaßen mit vielen Küssen und leidenschaftlichem Streicheln zu überschütten, fast auf die Knie zu fallen, plötzlich zu weinen, verschämt zu kichern und dann wieder zu küssen, zu umarmen, zu weinen, sich tief zu verneigen, zu schwören, den anderen nie im Leben zu vergessen, und dabei rannte er schon weiter, schwer atmend, lächelnd, zum Abschied mit offener, breiter Hand winkend, an deren einem Finger immer die Schlüssel des Buick baumelten.
Unter dem Fenster des Sterbezimmers, in dem Ovadja Chasam liegt, heulen die ganze Nacht lang die Sirenen der Krankenwagen, quietschen die Bremsen, dringt aus einem Radio in der Taxizentrale neben dem Krankenhaus das Johlen von Reklamespots. Jeder Atemzug saugt einen trüben, schimmeligen Brei in die Lungen, einen schweren Geruch nach Urin, nach Beruhigungsmitteln, nach Essensresten, nach Schweiß, nach Desinfektionsmitteln, nach Chlor und Medikamenten und schmutzigen Verbänden und den Gestank von Kot, Rote-Rüben-Salat und Lysol.
Vergeblich sind alle Fenster des alten Kulturzentrums aufgerissen, das jetzt »Kulturzentrum zu Ehren von Schunja Schor und der sieben Toten vom Steinbruch« heißt: Die Klimaanlage funktioniert nicht, und die Luft ist dick und stickig. Das Publikum ist schweißüberströmt. Bekannte treffen sich und bleiben in den Gängen stehen. Andere sitzen schon auf den harten Stühlen, die jungen Leute hinten, weit weg vom Podium, die Altgedienten haben sich in den vorderen Reihen niedergelassen, die Kleidung klebt am Körper, und der Geruch des Nachbarn hängt in der trüben Luft.
Einstweilen unterhält man sich, über die Abendnachrichten, über das Unglück in Akko, über das, was von der Kabinettssitzung durchgesickert ist, über die Aufdeckung von Korruptionsfällen, über die Lage im allgemeinen, über die kaputte Klimaanlage, über die Hitze. Die drei müden Ventilatoren drehen sich ohne Wirkung über dem Publikum, man merkt fast nichts davon: Es ist sehr heiß. Kleine Insekten krabbeln ständig unter die Hemdkragen, als befände man sich im tropischen Afrika. Die Luft steht vor so viel Schweiß und Deodorants, daß man sie mit dem Messer schneiden könnte.
Draußen, drei, vier Straßen entfernt, heult die Sirene eines Krankenwagens oder eines Feuerwehrautos auf, schwillt ab und heult wieder auf, das unheilverkündende Heulen läßt langsam nach, aber nicht weil es sich immer weiter entfernt, sondern als sei es kraftlos geworden. Danach jault draußen auf der Straße die Alarmanlage eines geparkten Autos, als ängstige es sich, in der Dunkelheit allein gelassen zu werden. Wird der Schriftsteller heute abend etwas Neues von sich erzählen? Kann er erklären, wie wir in diese Lage geraten sind oder was wir tun müssen, um sie zu ändern? Ahnt er etwas, von dem wir noch nichts wissen?
Manche haben das Buch dabei, dem dieser Abend hier im Kulturzentrum gewidmet ist, und einstweilen benutzen sie es – oder eine Ausgabe der Zeitung Davar – als Fächer. Es gibt bereits eine kleine Verspätung, vom Schriftsteller ist noch immer nichts zu sehen. Das Programm sieht eine Begrüßung vor, den Vortrag eines Literaturexperten, die Lesung kurzer Passagen aus dem neuen Buch, eine Ansprache des Schriftstellers, Fragen und Antworten, ein Schlußwort. Der Eintritt ist frei, und der eine oder andere ist auf den Schriftsteller neugierig.