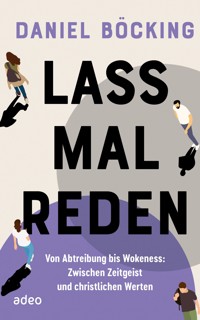11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Gott findet BILD-Journalisten!
Fast jeder Mensch ist auf der Suche nach dem Sinn. Dabei tragen viele Millionen Deutsche den Kern aller Antworten auf die großen Fragen längst in sich: Sie sind gläubig – aber die meisten von ihnen nur nebenher, so ein bisschen. Wie viele lassen sich wirklich mit Herz und Verstand auf den Glauben an Gott ein?
Daniel Böcking hat es gewagt, sich frei zu Jesus zu bekennen und Veränderungen zuzulassen. So hat er den Sinn gefunden in allem, was er tut, und auch seine von Gott gegebene Aufgabe. Dieser Schritt hat sein Leben komplett umgekrempelt. Er führte von einem Alltag zwischen Partys und Job-Stress zu einem Leben allein nach Gottes Wort. Er brachte neue Verpflichtungen und Aufgaben mit sich, auch viele Fragen, mitunter Konflikte und Konfrontation. Daniel Böcking beschreibt seine Umkehr zu Gott als »einen Sechser im Lotto« und will mit seiner Geschichte auch andere ermutigen, diesen Hauptgewinn anzunehmen.
- - Wie ein BILD-Journalist eine Vollbremsung in seinem hektischen Alltag hingelegt hat, um zu Jesus umzukehren
- - Ein glücklicher Vollzeit-Christ erzählt von seiner Glaubensfreude und von den radikalen Veränderungen in seinem Leben
- - Eine neue, offensive und kraftvolle Stimme – ehrlich, glaubwürdig und überraschend
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Daniel Böcking
Ein bisschen
Glauben
gibt es nicht
Wie Gott
mein Leben
umkrempelt
Gütersloher Verlagshaus
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Copyright © 2016 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-19039-2V001
www.gtvh.de
Inhalt
Vorwort oder: Guter Gott!
Dieser Morgen danach ...
Ein blasser, leiser Gott
(K)ein moralischer Kompass
Böse Augen
Das Leid der anderen
Gebete in der Katastrophe
Das Ende der Belanglosigkeit
Das Wunder in der Wüste
An der Grenze zum Glauben
Auf Schatzsuche
Kirchen-Hopping
Eine Gute Nachricht per Mail
Schwein oder Schaf?
Schatz, wir müssen reden!
Mit allemann am Ballermann!
Die Umkehr
Und nun?
Rumms! Gott da!
Gottvertrauen lernen
Eine neue Lebensaufgabe
Geschwister auf der ganzen Welt
Veränderungen durch Gott
Eine Umarmung aus dem Inneren
Wahre Liebe
Radikal gläubig
Glaube meets ISIS
Wer hat mir vor den Kopf gehauen?
Ein Christ bei BILD?
»Macht die Nackten weg!«
Ein ganz besonderer Gottesdienst
Männer über Frauen – oder ...?
Kann denn Schwulsein Sünde sein?
Erlösung, Gnade, Freiheit
Eine neue Realität
Nächstenliebe
Gute Taten, hässliche Worte
Neue Worte in einem neuen Leben
Naiv und blauäugig
Glauben lernen
Nachwort
Anhang: Die Gebote aus dem Neuen Testament – eine unvollständige Liste
Danksagung: Gott sei Dank!
Vorwort oder: Guter Gott!
Danke! Danke, dass du mein Leben auf den Kopf gestellt hast. Danke, dass du mir eine Glaubensfreude geschenkt hast, die mich rätseln lässt, wie ich 36 Jahre lang ohne diese innere Ruhe, diese Zuversicht und diese Wegweisung gut schlafen konnte. Danke für die Vollbremsung auf meinem Lebensweg und den anschließenden U-Turn zu dir. Und danke, dass ich heute ein Buch darüber schreiben darf. Herr, es gibt so viel, wofür ich dir dankbar bin, und es ist schön, dass ich auf den folgenden Seiten anderen Menschen davon erzählen darf, wie es dazu gekommen ist: wie aus mir – einem, der wie Millionen anderer Menschen in Deutschland zwar irgendwie an irgendetwas glaubte, aber eher so nebenher – ein glücklicher Vollzeit-Christ geworden ist.
Lange habe ich mich gefragt, was wohl angemessene, einleitende Worte sein könnten. Schreckt ein Dank-Gebet zu Beginn einen skeptischen Leser ab? Ist es vielleicht sogar lästerlich, eine Einleitung als Gebet zu tarnen? Wirkt das zu hymnenhaft und nimmt mir jede Glaubwürdigkeit? Ich habe zu dir, Gott, gebetet, um herauszuhören, wie ich starten könnte. Ja, ich belästige dich inzwischen auch mit solchen Kleinigkeiten – so präsent bist du in meinem Alltag geworden. Und so schreibe ich die ersten Worte gleichzeitig an dich und an den Leser. Eigentlich ein chaotischer Mischmasch aus Gebet und Buch-Einleitung. Aber ein Mischmasch, zu dem du mich geführt hast und der vielleicht zeigt, wie wunderbar, bunt und vielfältig mein Leben dank deiner Nähe geworden ist. Wie allgegenwärtig du für mich bist.
Wann immer ich mit Menschen rede, versuche ich auch, meine Leitung zu dir offen zu halten. Wann immer ich zu dir bete, versuche ich, die Auswirkungen auf meinen Alltag zu hören und zu beherzigen. Du existierst nicht nur in einer abgetrennten Welt: hier das Gebet und der Glaube, dort das wirkliche Leben. Nein. Ein Leben mit dir, ein Leben in der Nachfolge Jesu, ist eine krasse, radikale Entscheidung, weil du dich immer und überall einmischst. Weil du nicht einfach einen heiligen Zuckerguss über den Alltag gießt, sondern fordernd bist. Nichts passiert mehr ohne dich.
Einen Schlüsselmoment vor dieser Umkehr zu dir erlebte ich bei einem kleinen Lotto-Gedankenspiel. Als ich mal wieder über das Leben sinnierte, fragte ich mich selbst:
Was würde ich tun, wenn ich einen Sechser im Lotto hätte?
Die Antwort: Vermutlich erstmal richtig feiern! Und nach der Spontan-Euphorie würde ich voller Vorfreude losplanen: Was kann ich jetzt machen, wovon ich bislang nur geträumt habe? Mit wem teile ich was? Dieser Gewinn (zwei, drei Millionen Euro sollten’s schon sein) würde meine Lebensplanung auf den Kopf stellen. Und zwar so richtig ...
Als ich diese Analogie auf mein Verhältnis zu dir, Gott, anwendete, fiel bei mir der Groschen: Wegen eines Lotto-Gewinns wäre ich glücklich und begeistert bereit, mein Leben umzukrempeln. Für dich tat ich das bis dahin nicht. Dabei sind deine Geschenke viel, viel größer: Vergebung, Erlösung, innere Ruhe und Sinn. Von ewigem Leben ganz zu schweigen. Das alles kann ich mir mit Geld nicht kaufen. Zum Glück bekomme ich es von dir geschenkt.
Vor fünf Jahren habe ich angefangen, mich auf die Suche nach diesem Geschenk zu begeben. Vor zwei Jahren habe ich es dann wirklich angenommen. Davor? Hatte ich – wie so viele andere Menschen auch – eine Art Individual-Glauben. Auf mich persönlich zugeschnitten, so, dass er bloß nicht zu sehr in mein Leben eingriff. Und wenn doch, dann mit klaren Regeln, die ich mir selbst ausgedacht hatte. Evangelisch getauft, als Kind hin und wieder ein Abendgebet gesprochen. Nebenher so ein bisschen gläubig. Kirche vielleicht mal am Heiligabend. Mein Glaubensbekenntnis passte auf einen Bierdeckel: »Gott ist Liebe«. Jesus fand ich auch sympathisch. Aber ob er nun dein Sohn ist oder einfach ein netter Typ, der viele gute Sachen gesagt hat, war für mich kaum relevant.
Das hat sich radikal geändert. Ich bin zu dir, Gott, umgekehrt. Und wie das Wort Umkehr schon sagt: Für mich – damals 36 Jahre alt, BILD-Journalist, ehrgeizig, partywütig – war es eine 180-Grad-Kehre mit sehr konkreten Veränderungen: im Job (kann man auch ganz ohne Ellbogen seinen Weg gehen?), in der Freizeit (wie viele durchfeierte Nächte in der Woche tun mir wirklich gut?), in der Familie (»Gehst du jetzt etwa in eine Sekte?« »Nein! Ich bin Christ!«).
Zwischen dem ersten Impuls »Hey, irgendetwas Wichtiges in deinem Leben hast du bislang vernachlässigt« und dem großen Schritt »Ab heute will ich mein Leben ganz und gar in deine Hand geben« lagen stolze dreieinhalb Jahre. Ganz offensichtlich bin ich nicht der schnellste, wenn es um lebensverändernde Entscheidungen geht. Eher so Typ Bausparer. Außerdem ging es mir bis dato ja auch ohne diese Kehrtwende ganz gut. Neben Job, Familie, Freunden und bierseligen Nächten war kaum Platz, alles in meinem Leben zu überprüfen, zu hinterfragen oder gar zu ändern. Keiner machte mir Druck. Du hattest es wohl nicht eilig mit mir. Oder warst geduldig. Oder ich war zu beschäftigt (und zu blöd), dir zuzuhören. Als ich endlich damit anfing und mich auf den Weg machte, erlebte ich es wie ein Wunder.
Lieber Gott, du weißt, wie unsicher ich noch in vielen Situationen bin. Wie eingeschüchtert, bei jeder Gelegenheit, die der Alltag mir bietet, über dich und den Glauben an dich zu sprechen. Immer gibt es Menschen, die früher zum Glauben gefunden haben als ich, die die Bibel öfter gelesen haben und sich komischerweise problemlos Kapitel- und Versnummern merken können, die historische Fakten tiefer recherchiert haben. Viele sind treu in ihrem Glauben geblieben und haben sich bewährt, obwohl sie schlimmste Schicksalsschläge erlitten haben. Verfolgung, Folter – aber auch schwere Krankheiten, Unfälle, Katastrophen. Ich hingegen führe ein fast zu schönes Leben: in einem gut bezahlten, aufregenden Job als stellvertretender Chefredakteur bei BILD.de, mit einer Eigentumswohnung in Berlin, einer Pacht-Datsche in Brandenburg, tollen Freunden, drei fantastischen Kindern und einer wundervollen Frau (für die ich dir nie genug werde danken können). Ich hätte also viele Gründe, ein dankbarer Vorzeige-Christ zu sein. Dankbar bin ich (inzwischen aber für andere Geschenke von dir), Vorzeige-Christ noch immer nicht, obwohl ich es redlich versuche. Immer wieder knallen Anspruch an mich selbst im Glauben und Wirklichkeit im Alltag aufeinander. Immer wieder stolpere ich, falle hin, baue Mist – und erfahre bei dir Vergebung. In fast jedem Gebet stelle ich Fragen, auf die ich noch keine Antwort weiß. Der Weg ist noch weit.
Ich bin also sicherlich nicht angetreten, um Lehren oder Ratschläge zu erteilen. Ich möchte einfach in demütiger Dankbarkeit erzählen, wie du in mein Leben eingegriffen und es verändert hast – gerettet hast. Denn zumindest zwei Dinge habe ich begriffen:
1. Du willst nicht, dass wir lauwarm im Glauben sind.
Es gibt so viele Menschen, die sich Christen nennen, die sich selbst als gläubig bezeichnen. Aus irgendeinem Grund sind sie aber nicht bereit, den logischen nächsten Schritt zu machen: sich wirklich RICHTIG auf den Glauben an dich einzulassen. Sich frei zu Jesus zu bekennen und die Veränderungen zuzulassen.
Vielleicht tun sie das nicht, weil es in Mode ist, einen persönlichen Einzel-Glauben zu leben (»Ich glaube an Gott. Aber nicht so wie die Kirche«). Vielleicht tun sie das nicht, weil sie sich nie wirklich damit beschäftigt haben und die gute Botschaft gar nicht kennen. Vielleicht tun sie das nicht, weil das Gefühl herrscht, die »Hardcore-Christen« seien irgendwie komisch und lebten fern der Realität.
Ich kann das alles nachvollziehen – denn mir ging es ja bis vor wenigen Jahren genauso. Trotzdem bin ich diesen Schritt gegangen und spaziere seitdem auf einem wundervollen Weg. Ich brauche keine esoterischen Ratgeber, mir geht es innerlich besser als je zuvor, ich habe den Sinn gefunden in allem, was ich tue. Viel wichtiger aber noch: Ich habe meine von dir gegebene Aufgabe gefunden. Ich höre dir endlich zu. Denn das ist das Schöne an diesem Weg: Dein Wort (ob im Gebet oder in der Bibel) lässt mich an keiner Gabelung allein. Es gibt Rat, hilft bei Entscheidungen. Und es ist gut. Andere Christen begleiten mich. Der Weg ist nicht übermäßig kompliziert, aber mitunter anstrengend, weil neu. Er bedeutete auch für mich Abschied nehmen von liebgewonnenen Gewohnheiten. Er bringt Verpflichtungen mit sich.
Und damit bin ich beim zweiten Punkt, den ich begriffen habe:
2. Du willst, dass Christen von ihrer Glaubensfreude und ihrem Gottvertrauen berichten, dass sie sich offen und laut zu dir bekennen, damit viele Menschen die wundervolle Botschaft hören und deine Einladung annehmen. Das klingt erst einmal ganz simpel und fluffig, ist aber eine wirklich neue Aufgabe, die zu Konfrontationen führen kann. Natürlich wird man von Freunden komisch angeguckt, wenn man an einem gemütlichen Grillabend nach einem Plausch über die Bundesliga-Tabelle und den letzten Politiker-Irrsinn ein Gespräch über Jesus anfängt. Doch dieses offene Bekenntnis zu dir ist gerade in Zeiten wie diesen wichtiger denn je.
Mir fiel es anfangs schwer, laut und sogar öffentlich für dich und meinen Glauben an dich einzustehen. Aus Angst vor Ablehnung oder Spott oder – im besten Fall – einem mitleidigen Lächeln. Doch das änderte sich von einem Moment auf den anderen, als ich, gemütlich vor dem Fernseher sitzend, in einer Nachrichtensendung das x-te Beispiel für das unfassbare Morden von ISIS im Namen ihres angeblichen Glaubens sah.
In diesem Augenblick war es vorbei mit meinem leisen Vor-Mich-Hin-Glauben.
Ich weiß nicht mehr, ob es eine Verbrennung, eine Erschießung oder eine Enthauptung war. Mir platzte jedenfalls der Kragen: Ich wollte nicht länger still sein und hinnehmen, dass es diesen (jeder kann hier sein eigenes Schimpfwort einsetzen) gelingt, den Glauben in den Dreck zu ziehen. Dabei ging es mir nicht darum, wer zu dem richtigen Gott betet. Sondern darum, dass mein Glaube an Jesus Christus mich zu Liebe, Barmherzigkeit, Vergebung anleitet. Zu innerer Freiheit, Ruhe, Frieden. Und dass diese fanatischen Glaubensschänder es fast geschafft haben, dich, Gott, in etwas Abschreckendes in den Augen vieler Menschen zu verwandeln. Du bist gläubig? Dann bist du gewiss so ein Extremist! Im besten Fall stock-konservativ, verbissen, intolerant – im schlimmsten Fall ein Terrorist ... Nein. Ich bin Christ. Und das bedeutet auch, dass die Zeit des Rumsitzens und Zusehens vorbei sein muss. Jeder Christ sollte in dem verursachten Leid so viele Aufträge zur Hilfe und zur Nächstenliebe sehen, dass es spätestens jetzt an der Zeit ist, sich zu diesen wahren Verpflichtungen des Glaubens an dich, guter Gott, zu bekennen und zu handeln. Davon, dass man als Christ sogar bereit sein sollte zur Vergebung für die Terroristen – davon will ich noch gar nicht reden.
Herr, ich habe dich oft gefragt, ob dieses Buch in deinem Sinne ist. Ob es nur meine Eitelkeit befriedigt (jeder Journalist möchte doch gern ein Buch schreiben ...), ob ich mich selbst damit viel zu wichtig nehme, ob ich mich selbst damit zu angreifbar mache oder meine Karriere riskiere, weil ich mich in eine Schublade stecke. Ob ich mich blamiere, weil andere ja viel theologischer an das Thema herangehen können. Du hast mich so weit geführt, dass ich nun wirklich zu schreiben beginne.
Ich kann nicht von oben herab predigen, weil ich selbst täglich lerne und viele Fehler mache. Ich kann keine verbindlichen Antworten auf große Fragen geben, weil die allein von dir kommen können. Aber ich kann meine Geschichte erzählen, die ganz von selbst zu Antworten von dir führte. Sie beginnt an einem Punkt, den viele Menschen von sich selbst kennen: Ich glaubte irgendwie so ein bisschen – nicht mit Volldampf, nicht mit tiefem Vertrauen, nicht mit Haut und Haaren. Ich glaubte noch nicht so richtig. Und dann wurde Schritt für Schritt alles anders und besser.
Dieser Morgen danach ...
Noch heute glüht mein Gesicht rot vor Scham, wenn ich an diese Nacht im Frühling 1996 denke: Es war unsere Abi-Party. Die erste von drei Feten (ein Wort, das leider ausstirbt, damals aber noch angesagt war). Es war die Zeit zwischen den letzten Prüfungen und der offiziellen Zeugnisverleihung unseres Gymnasiums in Siegen. Und wir hatten beschlossen, dass drei Feste genau die richtige Anzahl sind für das, was wir geleistet hatten.
Auf der Wiese einer großen Waldlichtung hatten wir ein Party-Zelt aufgebaut – nicht so groß wie auf dem Oktoberfest, aber größer als ein typisches Armee-Zelt – insgesamt mit Platz für um die 100 Leute. Die Wiese hatte ein leichtes Gefälle, in der Senke plätscherte ein Bach. Es gab einen Grill- und einen Bolzplatz. Hier wurde aber weder gegrillt noch gebolzt – sondern vor allem getrunken, geflirtet, geplaudert. Aus den mächtigen, gemieteten Boxen dröhnte der bei uns damals übliche wirre, aber lustige Mix: »Killing in the Name« von Rage against the Machine, »Coco Jamboo« von Mr. President. Dann schrammelte Greenday »Basket Case«, um nahtlos ins fast sphärische »Insomnia« von Faithless überzugehen. Wenn alle besoffen genug waren, durfte üblicherweise irgendwann Blümchen ran mit »Herz an Herz«, und man stolperte und torkelte euphorisch zuckend durcheinander. Ich war besoffen genug. Eigentlich schon zu sehr. Ich war bereits über Herz an Herz hinaus. Eher auf dem Weg Richtung Faust auf Faust und später Brett vorm Kopf. Das wusste ich da aber noch nicht.
Ich selbst fühlte mich einfach nur in bester Partylaune. Einige Wochen zuvor war zwar meine Beziehung in die Brüche gegangen. Aber das war kein Drama. Hatte eh nicht länger als drei, vier Monate gehalten. Sie war es, die die Notbremse gezogen hatte – aber ich war durchaus einverstanden, wenn nicht sogar dankbar gewesen. Inzwischen hatte sie sich einen Neuen angelacht. Einen entfernten Kumpel von mir. So jemanden, den man schon lange kennt, aber sich noch nie intensiv mit ihm unterhalten hatte. Die Beiden waren auch auf der Abi-Party, obwohl er ein Jahr älter als ich und sie einen Jahrgang unter mir war. Sie schmusten und turtelten auf einer Bierbank im Party-Zelt.
Draußen war es längst dunkel. Ich stand am Rand der Tanzfläche, die gerade mal wieder leer war, weil alle – mich eingeschlossen – auf den nächsten Gassenhauer warteten. In der Tanzpause beobachtete ich das frisch verliebte Pärchen und nickte ihnen während einer Knutsch-Unterbrechung zu, sie grüßten zurück. Alles friedlich und vergnügt. Alle inklusive mir gut drauf. Doch dann taten die Beiden etwas, das für mein bierseliges Empfinden schier unglaublich war: Sie schmusten einfach weiter! Was für eine Provokation! Drei, wenn nicht sogar vier Monate lang war ich der Herzbube im Leben dieser Dame da gegenüber von mir gewesen. Und plötzlich war ich es nicht einmal mehr wert, dass sie ihren Kuss für mehr als einen Atemzug unterbricht, aufsteht und mich herzlich begrüßt? Und er erst! Zumindest hätte er die Größe haben können, zu mir zu kommen und mich wenn schon nicht um Erlaubnis, dann doch zumindest um Verzeihung oder Verständnis zu bitten. Schließlich knabberte er an MEINER Ex-Freundin. Aber nichts von alledem geschah.
Ich tat also das, was ich in diesem Moment für die einzig ritterliche Möglichkeit hielt: Ich überquerte mit großen, entschlossenen Schritten die staubige Tanzfläche, brachte mich direkt vor ihnen in Position, wog etwa eine Zehntel Sekunde lang ab, ob es hier noch Gesprächsbereitschaft gab oder ob gehandelt werden musste. Und dann handelte ich.
Dies ist der Moment, in dem mein Gesicht auch heute noch, 19 Jahre später, allein bei der Erinnerung daran rot aufleuchtet. Denn der männlich-heroische Akt spontaner Entschlossenheit, den ich nach mindestens zehn Bier zustande brachte, war: Ich trat ihm vor das Schienbein. Und zwar mit der Pike und Karacho! Ha! Damit hatte er nicht gerechnet! Damit war die Sache für mich geklärt.
Für ihn nicht.
Er stand auf. Groß, zäh, ganz ordentlich Muskeln. Schubste mich auf die Tanzfläche. Und so stolperte ich rückwärts ins Rampenlicht und damit in die Aufmerksamkeit aller umher stehenden Mitschüler und Freunde. Meine halbe Jahrgangsstufe konnte nun gut beobachten, was als nächstes passierte. Nur ich konnte kaum noch etwas sehen, da ich einen Augenblick später auf dem Boden lag und Staub meinen Blick vernebelte. Wow! Den Schlag hatte ich nicht kommen sehen. Aber fühlen konnte ich ihn und die folgenden ganz gut. Der neue Freund meiner Ex verdrosch mich nach Strich und Faden. Man könnte auch sagen: Er versohlte mir den Hintern. Denn ich war zu träge, zu betrunken, zu überrascht, um mich auch nur ansatzweise zu wehren. Es war eine ordentliche Tracht Prügel. Und schon beim Verkloppt-Werden kam mir der Gedanke: »Okay, Daniel, nüchtern betrachtet muss man analysieren: Das hast du irgendwie verdient!« Niederlage auf ganzer Linie. Aber die Linie war noch nicht am Ende. Sie zog sich weiter durch diese denkwürdige Nacht.
Nachdem ich mich bereits weder bei meinem Angriff noch bei der späteren Verteidigung besonders profiliert hatte, rollten mir nun die Tränen über das Gesicht. Ich werde schnell sentimental, wenn ich zuviel getrunken habe. Aber in diesem Fall war es einfach nur Rumheulen. Eine Heul-Attacke vor all meinen Kumpels, von denen einige inzwischen meinen Peiniger von mir gezerrt und somit den sehr einseitigen Kampf beendet hatten. So lag ich nun im Dreck der Tanzfläche: voller Staub, vermöbelt, mich windend und heulend. Und trotzdem der Voll-Idiot, der kein Mitleid verdient hatte, weil er grundlos den Streit vom Zaun gebrochen hatte. Gibt es aus so einer Situation noch einen Ausweg? Nein! Da war ich mir damals ganz sicher. Nicht nur diese Situation erschien mir ausweglos. Eigentlich alles. Wirklich alles. Das ganze Leben.
Nur konsequent also, dass ich mich wieder aufrappelte, halb humpelnd, halb torkelnd gen Zeltausgang schlingerte und verkündete: »Ich gehe jetzt raus und bringe mich um.« Nett von den Party-Gästen, dass ich mich zumindest nicht an schallendes Gelächter in meinem Rücken erinnere, als ich das Zelt und sie hinter mir ließ und durch die Dunkelheit den kleinen Bach in der Nähe ansteuerte.
Irgendwer muss gehört haben, wie ich eine Bierflasche auf dem Weg dorthin an einem Stein zerschlug. Zumindest kam eine aufgeregte Menschentraube gelaufen, als ich gerade überlegte, wie ich mir mit den Scherben wohl am besten die Pulsadern aufschneiden könnte und ob ich wirklich sterben oder allen nur einen großen Schrecken einjagen wollte, damit sie vielleicht die kleine Peinlichkeit von vorhin schnell wieder vergessen und Mitleid mit mir haben. Es war Dominik, ein Freund aus Pfadfinderzeiten, der mich schließlich davon überzeugte, dass die Idee nicht ganz so ausgefeilt war und es am besten wäre, wenn mich jetzt jemand nach Hause fährt. Wirklich? JA! Aber ...! LOS!
Die gute Nachricht: Ich hörte auf ihn und schlimmer wurde es nicht. Die schlechte: Ich wurde am nächsten Morgen wach und war nüchtern.
Mittlerweile weiß ich, dass sich viele Menschen meinem Urteil anschließen: Es gibt wenig Schlimmeres, als mit einem Brummschädel aufzuwachen und zu wissen, dass man in der Nacht davor wirklich spektakulären Mist gebaut hat. Dieses zähe Grübeln über die Details, wenn die Erinnerungen ganz langsam ins Bewusstsein tropfen. Erst süß und klebrig wie Sirup, waberig und unscharf – aber plötzlich ätzend und schmerzhaft wie Säure, in dem Moment, in dem einem klar wird: Das ist nicht nur ein Bild in deinem Kopf, das ist wirklich passiert. Das tut fast körperlich weh.
Schienbein ... Da war was. Achja. Prügel. Geheult? Ja, wirklich! Dieser Schüttelfrost, der einen durchfährt, wenn man die innere Frage an sich selbst »Das hab ich nicht wirklich auch noch gemacht?« mit »Oh, doch!« beantworten muss. Damals gab es zum Glück noch kaum Handys. Ich musste also nicht auch noch checken, ob ich bestürzte oder hämische Nachrichten erhalten hatte oder morgens um drei Uhr noch irgendwen warum auch immer angerufen hatte, noch, ob ein Freund auf Facebook zig Fotos geteilt hatte, auf denen ich markiert war. Solch übles Erwachen kam erst Jahre später. Trotzdem ging es mir elend.
Zum Glück hatten wir keinen Unterricht mehr. So stellte sich die Frage nicht, ob ich meinen über 100 Mitschülern schon am nächsten Tag wieder unter die Augen treten konnte. Ich wagte mich sogar auf Abi-Party Nummer 2 – allerdings fuhr ich selbst mit dem Auto hin, bot mich als Chauffeur für alle an und verhinderte so, dass ich mich wieder in eine Laune trinken konnte, in der ich meinte, ein Schienbeintritt sei ein vernünftiges Argument.
Kurzum: keine bleibenden Schäden. Die gab es fast nie. Und ich habe noch oft und viel Mist gebaut.
Von dieser Nacht im Siegener Wald kann ich mittlerweile recht entspannt erzählen, weil es keine echten Opfer gab, meinen Stolz und meine Würde und ein schmerzendes Schienbein auf der Gegenseite mal ausgenommen. Außerdem liegt es so lange zurück, dass man es heute getrost im Ordner »peinliche Jugendsünden« ablegen kann. Mir bleiben die Momente dennoch vermutlich ein Leben lang im Gedächtnis. Besonders das lausige Gefühl danach, denn das hatte ich noch sehr, sehr oft – egal, ob noch ein Kater hinzukam oder ich komplett nüchtern und als Herr meiner Sinne daneben gegriffen hatte. Unzählige Male hatte ich schon vorher und habe ich auch später das Falsche getan, mal mit voller Absicht, mal nicht. Wieder und wieder gab es solche Momente, über die ich kurz darauf den Kopf geschüttelt habe und mir eingestehen musste: »Daniel, da hast du riesengroße Scheiße gebaut!«
Mal war es ein verletzendes Wort, das ich wenig später bereute. Mal war es eine hitzige Diskussion, bei der ich zu spät merkte, dass wir längst nicht mehr über die Sache sprachen, sondern eigentlich nur darauf aus waren, uns gegenseitig schlimmstmöglich zu beleidigen. Hier mal als Jugendlicher eine Kleinigkeit aus dem Supermarkt mitgehen lassen, da mal eine Beziehung beendet, weil ich eigentlich längst eine neue hatte, zum Glück ebenfalls schon viele, viele Jahre her und verjährt ...
Das lässt sich im Rückspiegel alles verhältnismäßig leicht aufschreiben. Schließlich bin ich nicht wirklich kriminell geworden. Die meisten meiner Fehltritte sind nicht außergewöhnlich oder verheerend gewesen. Aber so larifari waren sie dann auch nicht. Nein, viele waren schlimm! Freundschaften sind auf der Strecke geblieben, Vertrauen ist kaputt gegangen – alles, weil ich oft das Falsche gemacht habe – aus Wut, Jähzorn, gekränkter Eitelkeit, Faulheit, notgeilem Übermut, Egoismus oder aus Ignoranz.
Aber es gab noch einen weiteren Grund, warum ich immer wieder mit mir selbst haderte nach solchen – nennen wir sie mal – Patzern: Ich glaube, so lange ich denken kann, an Gott. Was er genau war, was er wollte, was er mit mir vorhatte – so in die Einzelheiten war ich nie eingetaucht. Aber ich glaubte daran, dass es etwas Göttliches gab. Egal ob in Form eines Geistes, eines Hauchs, als unser Gewissen oder als alter Mann mit Bart. Es gab da einen Gott – und der konnte nicht zufrieden mit mir sein. Das war mir klar. Und wenn er es nicht war, konnte ich es auch nicht sein.
Ein blasser, leiser Gott
Im Laufe der Jahre begab ich mich also auf einen Weg. Ich will nicht sagen, dass es ein Holzweg war. Denn schließlich und endlich hat er mich dann ja doch zu Gott geführt. Aber es war mitunter ein völlig bekloppter Weg. Es gab Zeiten, da war Gott für mich kaum mehr als eine zusätzliche Belastung. Er wurde zu einer Moral-Keule, zu einer Art strafendem Gewissen. Schlechtes Gewissen als Buße. Gott war mir fremd, aber da. Bedrohlich. Im Hintergrund. Ich kannte die Bibel, wie man sie eben nach Religionsunterricht und Konfirmandenunterricht kennt. Aber ich kannte sie nicht wirklich. Gott auch nicht. Und Jesus erst recht nicht. Ich gab dem Kennenlernen keine echte Chance.
Glaube und Religion waren mir nie sympathisch oder einladend genug, um mich wirklich intensiv damit zu beschäftigen.
Dieses zwiespältige Verhältnis fing schon früh an. Beispiel Religionsunterricht: Den fand ich zwar stets recht kurzweilig – aber mehr auch nicht. In der Grundschule haben wir in diesen Stunden viel gemalt. Ich erinnere mich noch an meinen Petrus aus Wachsmalstiften, der mit ausgebreiteten Armen am Himmelstor stand und die zwei Türblätter offen hielt. Das einzige, was ich aber mit dieser Erinnerung verbinde, ist die Kritik meiner Lehrerin: Ich hatte die Arme nicht ganz naturgemäß abgebildet. Der linke Arm war deutlich kürzer als der rechte, okay, maximal halb so lang wie sein Pendant. Falsch! Arme sind zumindest ungefähr gleichlang. Setzen!
Mit acht Jahren ging ich zu den katholischen Pfadfindern. Ich habe die Gruppenstunden geliebt. Wir waren eine eingeschworene Gemeinschaft. Es wurde gesungen, getobt, Verstecken gespielt, die Schokokuss-Wurfmaschine ausprobiert. Ich mochte meine schlammfarbene Kluft mit dem orangen Halstuch und dem ledernen Knoten. So sehr, dass ich sie auch noch in der Schule anziehen wollte.
Die Zeltlager waren die Höhepunkte – und die Nachtwanderungen mit Gespensterspielen in den Wäldern, die Feuer vor den Zelten, das Baden im See und die übermüdete, verdreckte, restlos glückliche Heimkehr am Ende eines solchen Wochenendes wurden zu kunterbunten, wundervollen Erinnerungsbildern aus meiner Kindheit. Bis heute summt in meinem Kopf »Laudato Si« los, sobald ich irgendwo ein Lagerfeuer erblicke.
Oft besuchten meine Pfadfinderfreunde und ich die Gottesdienste. Die Kirche war ja gleich neben dem Pfadfinderheim und es gehörte einfach dazu. Doch wenn es zum katholischen Abendmahl, der Eucharistiefeier, kam, musste ich in meiner Bank sitzen bleiben, während meine katholischen Kumpels nach vorne gehen konnten. Ich war schließlich evangelisch. Später wurden sie Messdiener – mir blieb auch diese damals durchaus erstrebenswerte Karriere versagt. Im Pfadfinderheim waren wir alle gleich. In der Kirche nebenan war ich der Außenseiter.
Wenn ich an diese Pfadfinderzeit zurückdenke, kommen mir Szenen von praller Freundschaft in den Sinn, von Miteinander, Freude und Ausgelassenheit. In den Gruppenstunden waren wir alle zusammen kleine, glückliche Christen. Doch in der Kirche wurden wir nach Konfessionen getrennt. Gott kam mir dadurch nicht näher. Bei mir blieb viel mehr kleben: Pfadfinderheim hui, Gottesdienst pfui – oder zumindest gähn. Dass die Gruppenstunden unser eigentlicher Gottesdienst waren, in dem wir ja auch Gemeinschaft erlebten (nicht erzwungen), Gott lobten (in fröhlichen Gitarren-Liedern) und stets einander halfen, so wie es das Pfadfinder-Versprechen verlangte – Mensch, das wäre mal eine Erkenntnis gewesen! Aber davon war ich noch weit entfernt.