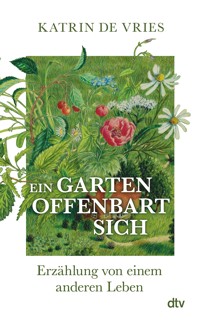
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Garten als Lehrmeister Als Katrin de Vries nach Jahren in der Großstadt zurück in ihre Heimat zieht, in ein Backsteinhaus in Ostfriesland, zu dem auch ein großer Garten gehört, ist sie noch überzeugt: Rasen gehört gemäht, Unkraut gejätet und morsche Bäume sollten gefällt werden. Doch nach und nach ändert sich ihre Vorstellung von Naturschönheit, ja von Natur überhaupt, und sie wagt sie einen neuen Ansatz: Statt den Garten nach herrschenden Vorstellungen zu gestalten, lässt sie den Bäumen, Gräsern, Büschen und Blumen vor ihrer Haustür freien Lauf. Und während es um sie herum wächst, wimmelt und sprießt, beobachtet sie und lernt – und muss dabei unweigerlich an ihre Großeltern denken, für die der Garten noch eine ganz andere Bedeutung hatte. - Gefühlvolles Nature Writing: Was können wir von der Natur vor unserer Haustür lernen? - Faszinierende Familiengeschichte: Einblicke in die traditionelle Lebensweise ostfriesischer Landarbeiter - Für Leserinnen und Leser von Robin Lane Fox, Jan Haft und Ewald Frie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Katrin de Vries ist im Rheiderland aufgewachsen, im westlichen Ostfriesland. Noch bis in die 1960er-Jahre haben ihre Großeltern hier als Landarbeiter sehr einfach gelebt, den Küchenofen mit Briketts geheizt, Regenwasser in einer Zisterne aufgefangen, selber geschlachtet und kaum Elektrizität genutzt. In ihrem Garten bauten sie Gemüse zur Selbstversorgung an: Kartoffeln, Kohl, Bohnen. Ihr Verhältnis zur Natur war geprägt von harter Arbeit. Jahrzehnte später entschließt sich Katrin de Vries, ihren eigenen Garten weder wie ihre Großeltern noch nach den mittlerweile herrschenden modernen Vorstellungen zu gestalten. Stattdessen wählt sie einen anderen Weg: Sie greift nur noch wenig ein, lässt den Garten sich entfalten, schaut zu, wie er sich verändert, und lernt eine neue Art natürlicher Schönheit kennen. Nach und nach verändert sich durch den Umgang mit den Pflanzen auch ihr Selbstverständnis, und sie wird mehr und mehr Teil eines lebendigen Ganzen.
Katrin de Vries
Ein Garten offenbart sich
Ein Blick
Früh am Morgen geht eine greise, dunkel gekleidete Frau zu ihrem Acker hinter dem Haus. Es ist der Kartoffelacker. Dicht an dicht, grün, in Reih und Glied wachsen hier die Kartoffeln. Die alte Frau blickt zurück. Ihr Mann, ihr Sohn und ihre Schwiegertochter sind im Haus. Niemand ist draußen. Also kann auch niemand sie sehen. Denn das Haus hat zum Acker hin kein Fenster.
Die alte Frau bückt sich zu den Pflanzen hinab. Mit den Händen schabt sie ein wenig Erde weg. Dann bohrt sie die Finger in den lockeren Boden hinein. Sie tastet nach den Knollen. Sind sie schon groß genug?
Frühestens in zwei Wochen wird ihr Sohn die Forke in den Boden stoßen, um zwei, drei Stämme herauszuheben. Dann wird es die ersten Frühkartoffeln zu essen geben. Aber vierzehn Tage, das sind für die Greisin noch viele, noch zu viele Tage.
Fast zwölf Monate lang hat die Familie von der Kartoffelernte des Vorjahres gegessen. Im Herbst war die Ernte im Kriechkeller, den man nur über eine kleine Luke im Flur erreichen kann, eingelagert worden. Es ist ein Berg an Kartoffeln gewesen. Mittlerweile sind sie fast alle gegessen. Im Frühjahr ist ein Teil als Saatkartoffeln zurück in die Erde gegangen. Der kleine Rest, der noch daliegt, ist in den letzten Wochen zunehmend verschrumpelt. Die Knollen haben immer mehr und immer längere Triebe gebildet. Sie suchen Licht, Erde und Wärme. Sie wollen überleben, indem sie sich vermehren. Ihre allerletzte Kraft geben die vorjährigen Kartoffeln in diese Austriebe. Doch auch diese alten Kartoffeln werden noch als Nahrung gebraucht. So lange, bis die Knollen der diesjährigen Stauden groß genug sein werden.
Die alte Frau blickt zum Haus. Weiterhin ist niemand zu sehen. Ihre Familie will nicht, dass die Kartoffeln zu früh, zu klein geerntet werden. Sie sind kostbar. Sie sind die Grundlage fast jeder Mahlzeit. Also müssen sie möglichst groß werden, bevor sie jemand aus der Erde holt. Alles andere wäre Verschwendung.
Aber die alte Frau ist schon so alt. Es gab nicht viele Genüsse in ihrem Leben. Sie weiß genau, wie die ersten Kartoffeln schmecken. Ihr ganzes Leben lang, über achtzig Jahre lang, hat sie im Juni diese ersten Kartoffeln gegessen. Deren Schale ist ein dünnes Häutchen. Die Knollen brauchen nur abgespült zu werden. Sie werden schnell gar. So zart sind sie. Fast ein wenig süßlich schmecken sie. Darüber geschmolzene Butter und ein wenig Salz. Und immer bleiben ein paar Kartoffeln übrig, die sie am Abend kalt isst. Die sie zuerst in die weiche Butter drückt, dann in das Salztöpfchen tupft und dann in den Mund schiebt.
Behutsam graben die Fingerspitzen der alten Frau weiter in den Boden hinein. Sie erfühlen die Knollen. Eine neben der anderen. Einige sind groß genug, entscheidet sie. In der Erde umschließt ihre Hand eine erste größere Kartoffel. Nur diese darf sie nehmen, denn nur diese lässt sich leicht von der Wurzelsprosse lösen, mit der sie noch an der Mutterkartoffel hängt. Die kleinen müssen weiterhin mit der Setzkartoffel verbunden bleiben. Diese ist noch nicht verrottet, und die kleinen Kartoffeln sind weiterhin auf die Verbindung mit ihr angewiesen, um zu wachsen. An sie darf jetzt nicht gerührt werden, damit das empfindliche Gebilde der Triebe nicht beschädigt wird.
Die alte Frau holt die erste der gelben Knollen ans Licht. Sie ist so warm wie die Erde, aus der sie kommt. Die alte Frau dreht sie ein wenig in der Hand und wischt so die verbliebene Erde ab. Sie hebt ihre Kittelschürze an und legt die Kartoffel hinein. Und dann wühlt und tastet sie weiter an den Pflanzen entlang. Bis sie genug für eine Mahlzeit zusammenhat.
Wie immer werden die anderen nicht erfreut sein und ein wenig schimpfen. Das wird nichts ändern. Sie steht auf. In ihrer Kittelschürze liegen die ersten Kartoffeln dieses Jahres. Sie lächelt. Sie geht zurück zum Haus. Um zwölf Uhr wird es Mittagessen geben.
Diese Greisin war meine Urgroßmutter.
Was wird geschehen
Mehr als ein halbes Jahrhundert später gehe ich mit unseren beiden Söhnen durch den Garten. Die zwei sind erwachsen und wohnen mittlerweile am anderen Ende Deutschlands. Aber der Garten, durch den wir laufen, war und ist der Garten ihrer Kindheit. Der Jüngere rupft ein paar Blätter von einem Weißdorn ab und steckt sie sich in den Mund. »Gut fürs Herz«, meint er lachend.
Wir bleiben vor dem ältesten unserer Apfelbäume stehen, einem Boskop. Er war schon lange vor uns hier und dürfte um die neunzig Jahre alt sein.
In anderthalb Metern Höhe klafft ein großes Loch in seinem Stamm. Vom Boden her ist die Rinde handbreit aufgeplatzt und endet in ebendiesem Loch. Die Kinder kennen diesen Baum und seine Höhlung von klein auf. Früher habe ich dort immer ein Osterei versteckt. Jahr auf Jahr haben wir seine Äpfel im Schuppen eingelagert und bis ins Frühjahr hinein gegessen.
Unser jüngerer Sohn arbeitet viel im Wald und auf dem Acker. Das ist seinen Händen anzusehen. Sie sind groß und kräftig. Mit diesen großen, kräftigen Händen fährt er sacht über die wulstige Rinde. Er greift in das Loch hinein, holt eine Handvoll Erde heraus und riecht daran.
»Dazu wird der ganze Baum werden«, sagt er und hält mir die schwarze krümelige Erde hin, um sie dann in meine Hände rieseln zu lassen. »Unser alter Boskop wird langsam, ganz langsam absterben, er wird sein Leben weiter abgeben, wird sich wandeln und immer schwächer werden. Ab und an wird ein morscher Ast abbrechen. Pilze und kleine Tiere werden den Stamm von innen her zersetzen. Dieser Baum hier ist in seinem Altwerden einer der ganz besonderen kleinen Lebensräume, die wir im Garten haben. Selten gewordene Insekten können in ihm ihre Eier ablegen. Das macht ihn wertvoll.«
Ich blicke auf die Erde in meinen Händen. Sie duftet würzig wie Waldboden.
»In diesem bisschen Humus«, spricht er weiter, »lebt es. Er enthält eine Fülle von Bakterien, Mikroben, Pilzen. Sie alle zehren vom toten Holz und bilden diese seltene Substanz, wie sie sich so nur in hohl gewordenen Bäumen findet. Heutzutage lässt man alternden, kranken Bäumen nicht mehr die Möglichkeit, langsam abzusterben. Überall, im Wald oder im Garten, werden sie gefällt, wenn sie nicht mehr ganz gesund wirken oder irgendwie im Wege stehen. Dabei sind sie etwas Besonderes. Sie sind zu etwas Rarem geworden. Im Winter werde ich einige Zweige abnehmen und ein anderes Bäumchen, eine Unterlage, damit veredeln. Diese alte Boskopsorte sollte erhalten bleiben.«
Heute, noch einmal zehn Jahre später, ist dieser Schößling zu einem gedrungenen, nicht sehr hohen, aber weit ausladenden Apfelbaum herangewachsen. Er trägt große Früchte, die lange gelagert werden können.
Und der alte Apfelbaum? Er streckt weiterhin seine Zweige aus. Er ist wunderschön. Noch immer steht er im Frühling, insektenumsummt, in Blüte. Aber seine Äpfel bleiben klein. Für große Früchte hat er nicht mehr genügend Kraft. Einige Äste sind im Sturm abgebrochen. Andere sind dicht mit Flechten überwachsen. Sein Inneres wurde in den Jahren weiter zersetzt. Der Baumstamm ist mittlerweile nach oben und unten hohl. Nur noch eine äußere Schicht ist fest. Dort sind gleich hinter der Rinde die Bahnen, durch die der Baum weiterhin Nährstoffe und Wasser transportiert. Sein Innerstes hat sich aufgelöst. Sichtbare und für unser Auge unsichtbare Wesen, Tiere, Pflanzen und Pilze, haben das harte Kernholz verzehrt. Sie haben sich dabei vermehrt und fortgepflanzt. Für sie war und ist diese Höhle ihr Ursprungs- und Lebensraum.
Neige ich den Kopf hinein, kann ich durch das Loch des alten Boskops nach unten blicken. Am Fuße seines Stammes hat sich ein wenig Rinde gelöst. Durch einen kleinen Spalt dringt Licht herein.
Vielleicht wird ein Sturm bald weitere morsche Äste abbrechen.
Vielleicht sogar den ganzen Stamm mit Wurzeln aus der Erde hebeln.
Oder was wird geschehen?
Die Zukünftigen
Ich bin im Rheiderland, dem westlichen Teil Ostfrieslands, geboren und aufgewachsen. Das Rheiderland liegt am Dollart, einem Meerbusen der Nordsee. Dieses Meer und das Ringen mit ihm haben den schmalen Landstrich in den letzten Jahrhunderten geprägt. Das Rheiderland war für lange Zeiten ein sehr feuchtes Gebiet mit Seen, Mooren und Sümpfen. In Büchern kann man lesen, welch vielfältige Pflanzen- und Tierwelt es hier noch vor hundert Jahren gegeben hat. Um Acker- und Weideland zu gewinnen, hat man die Sümpfe und Moore entwässert, den Torf abgestochen, Gräben gezogen, Bäume gefällt und Siele gebaut.
An der Küste kam es über Jahrhunderte hinweg immer wieder zu schweren Sturmfluten. Erst mit dem Deichbau im späten Mittelalter entstand ein erster Schutz vor dem Meer. Die Fluten hatten nun mit dem Deich einen Widerstand, an dessen Außenböschung, der flacher ansteigenden Seeseite, die Wellen ausrollten, sodass sich die Wassermassen nicht mehr weit ins Land ergießen konnten. Das Wasser führte Schlamm und Schlick mit sich, die sich vor dem Deich ablagerten. Diese Erde hatte einen hohen Gehalt an Senkstoffen, Pflanzen, die sich ehemals auf dem Meeresboden abgelagert hatten, aber auch Reste tierischer Schlickbewohner. Die äußerst fruchtbare Marsch begann sich zu bilden.
Durch Eindeichung dem Meer abgerungene Landstriche wurden Polder genannt. Da diese Böden so nährstoffreich waren, baute man, nachdem ein Polder entstanden war, einen weiteren Deich zum Dollart hin. Der neue Deich hielt nun ebenfalls die Wassermassen auf, wieder lagerte sich fruchtbarer Boden davor ab, und ein nächster Polder entstand. Diese Eindeichungen begannen um 1600 und dauern bis heute an. So hat der Mensch einen breiten Gürtel aus fruchtbaren Polderböden am Ufer des Dollarts entstehen lassen, die zum besten Ackerland in Deutschland gehören.
Steht man heute auf dem jüngsten Deich, so hat man ungefähr hundert Meter Vorland vor sich, mit Gras bewachsen und von Gräben durchzogen. Bei Sturmflut überschwemmt das Wasser diese Salzwiesen und reicht dann je nach Stärke bis an den Deich heran. Aber der ist hoch, noch besteht keine Gefahr eines Durchbruchs.
Am Ufer wächst Schilf oder Gras, dahinter beginnt das Wattenmeer. Da hier die Gezeiten herrschen, kommt das Wasser alle paar Stunden bis an das Ufer heran und zieht sich dann wieder zurück. Bei Ebbe liegt der graue Schlickboden, das Watt, frei. Es ist fast so, als gäbe es keine klare Abgrenzung zwischen Festland und Meer. Als seien die Übergänge fließend zwischen Land und Wasser.
Vor einigen Jahren wurden die Naturschutzbestimmungen am Dollart verschärft. Am Fuße des Deiches, zur Meerseite hin, ist ein hüfthoher Drahtzaun gezogen worden. Kein Mensch darf jetzt mehr auf das Vorland oder gar zum Ufer. Dabei sind in den letzten Jahrzehnten, seit wir hier wohnen, ohnehin kaum noch Menschen dort spazieren gegangen. Diese wenigen dürfen nun auch nicht mehr dahin. Es ist eine Art von Naturschutz, die nicht den Menschen dazu bringen soll, pfleglich mit der Natur umzugehen, sondern die meint, ihn ganz aus der Natur verbannen zu müssen. Der Zaun ist dabei mehr als ein bloßer Zaun, er ist ein Zeichen: Mensch und Natur sind getrennt und sollen getrennt bleiben. Auf der anderen Seite des Deiches, dort, wo die wenigen Menschen wohnen, fällt der Dollart immer mehr aus deren Bewusstsein heraus. War die Nordsee viele Jahrhunderte bestimmend für das Leben hier, ob durch ihre Flutgefahren, ob durch die Fischerei, so spielt sie im Leben der Menschen mittlerweile fast keine Rolle mehr. Weder braucht man sie, noch fürchtet man ihre Wassermassen.
Das Rheiderland ist heute eine für deutsche Verhältnisse dünn besiedelte Kulturlandschaft. Die industrielle Landwirtschaft und die Massentierhaltung nutzen nahezu alle freien Flächen, sodass sich kaum mehr naturnahe Räume finden lassen und die ehemalige Vielfalt an Pflanzen und Tieren verschwunden ist.
Was geblieben ist, was sich seit Jahrtausenden nicht gewandelt hat, das ist der Himmel. Das Rheiderland ist für mich vor allem eine Landschaft des Himmels. Den Boden unter ihm haben die Menschen immer wieder durch Kultivierung verändert, aber der Himmel ist noch genauso groß und weit wie ehedem.
Manchmal ist er nur grau, manchmal auch tagelang nur grau, häufig aber reißt er auf, zeigt dunkle Regenwolken vor blauer Tiefe, schiebt langsam weiße, von der Sonne beschienene Schönwetterwolken vor sich her oder überlässt es Winden und Stürmen, ein sich rasend schnell veränderndes Bild zu zeichnen. So ist die flache Landschaft darunter die Bühne, über der sich dieser gewaltige Himmel in dauernd sich verändernden Gestaltungen erhebt. Immer wieder türmt er mächtige Wolkengebilde auf, die dem Landstrich Weite und Tiefe, ja fast Unendlichkeit zu geben vermögen.
Mitte der 1990er-Jahre lebten mein Mann und ich mit unseren zwei kleinen Söhnen in Berlin, als ich von einem Haus in dieser Poldergegend erfuhr. Es war ein großes rotes Backsteinhaus aus dem Jahre 1893. Seit zwei Jahren schon stand es leer. Und so, ohne Pflege, war es recht heruntergekommen, die Heizung kaputt, die Dielen morsch. Auch von außen sah man dem Gebäude an, dass es auf eine fast unheimliche Weise ohne Leben war.
Und dann war da noch die Größe des Grundstücks, ein halbes Fußballfeld, dreitausend Quadratmeter Fläche. Wer wollte sich um einen dermaßen großen Garten kümmern? Das bedeute unweigerlich sehr viel Arbeit, so die allgemeine Meinung. Nicht zuletzt deshalb war das Haus schwer verkäuflich gewesen. Dass diese Größe ein Privileg bedeuten könnte, ahnte ich damals noch nicht.
Gegen alle Vernunft, aber mit dem Gefühl, die Entscheidung sei richtig, erwarben wir dieses alte Haus. 1996 sind wir hierhergezogen.
Etwas ratlos stapfte ich damals durch den Garten, der nun also unser Garten war. An der Ostseite stand – und steht noch immer – eine mächtige alte Rotbuche. Wahrscheinlich ist sie wie der Boskop auf der Südseite, nachdem das Haus fertiggestellt worden war, in die Erde gekommen. Auch ein knorriger Pflaumenbaum und eine hochstämmige, weit ausladende Süßkirsche waren wohl nicht viel jünger als ein Jahrhundert. An der Nordseite stand eine Reihe hoher alter Pappeln und Ahorne. Wie eine Ahnenreihe muteten mich diese eindrucksvoll gegenwärtigen Bäume an.
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Flüchtlingsfamilien im Haus untergebracht gewesen. Jede Familie hatte ein Zimmer zugeteilt bekommen. Ein Mann, der als Junge mit seiner Mutter und seiner Tante in einem der Räume gewohnt hatte, stand eines Tages am Straßenrand und meinte, als wir ins Gespräch kamen: »Die Rotbuche und der Apfelbaum und die Pflaume sind immer noch da. Ich kann mich genau erinnern. Das ist noch genauso wie damals.«
Ich ging die Blumenbeete am Südrand des Hauses entlang. Sie waren verwildert. Eine einzige stark verholzte Rose blühte vor sich hin. Ganz licht war der untere Teil der Pflanze geworden. »Das ist eine alte Sorte, also eine, die noch wirklich duftet«, erklärte mir unser damaliger Nachbar. Eine einzelne alte Pfingstrose trug im Frühling schwere rote Blüten. Aber ansonsten war nichts dergleichen zu finden, keine Stauden oder andere mehrjährige Blumen.
Nicht nur das Haus, sondern sogar die Welt des vom Menschen Angepflanzten schien älter als wir.
Und zwischen Haus und Grundstücksrand: Rasen. Nun, so etwas Ähnliches wie Rasen. Es war nicht das, was ein gepflegter Rasen genannt wird. An schattigen Stellen hatte sich Moos ausgebreitet. Und überall Gänseblümchen. Dazu Löwenzahn, Margeriten und Butterblumen. Wir mähten diese Grünfläche alle paar Tage. So wie alle hier alle paar Tage mähten. Meine Vorstellungen von unserem zukünftigen Garten waren nur vage, aber doch irgendwie anders. Wie nun genau, das wusste ich nicht.
Aufs Geratewohl begannen wir zu pflanzen. Zuerst legten wir eine lange Hecke an. Die Büsche, aus denen sie bestand, waren die, die es in der nächsten Gärtnerei zu kaufen gab. Vieles fügte sich dem Zufall. Im Dorf fragte uns jemand, ob wir den Wurzelstock einer Mirabelle, den er, warum auch immer, ausgegraben hatte, haben wollten. Jahre später erklärten mir die Söhne, dass unsere Mirabelle eigentlich eine Kirschpflaume sei. Aber wir belassen es bis heute bei der anfänglichen Benennung. Unser Nachbar hatte ein Walnussbäumchen, das wild hochgekommen war und sich noch umsetzen ließ. Jemand anderes wollte eine kleine Pflaume loswerden. Ein anderer eine Kastanie. Eine alte Frau brachte mir auf dem Fahrrad einige Herbstastern.
Heute weiß ich, wie wahllos wir vorgingen. Uns war nicht gegenwärtig, was unsere Entscheidungen für die Zukunft bedeuteten. Wir dachten nicht daran, verschiedene Obstbäume und Beerenbüsche anzupflanzen, um dann während des Sommers und des Herbstes unterschiedliche Früchte zu unterschiedlichen Zeiten ernten zu können. Wir pflanzten zwar eine Birne, die mit anderen halb vertrockneten Bäumchen vor einem Großmarkt zum Verkauf stand, aber keine Esskastanie, keinen Pfirsich, keine Haselnuss, keine Kornelkirschen, keine Himbeeren. Wir waren uns nicht bewusst, welche Bedeutung unserem Tun für die kommenden Jahre zuwuchs. Wir waren hierfür blind.
Jeder unserer Söhne bekam ein junges Kaninchen. Sie bauten ihnen ein Gehege aus Latten und Draht. Und mit einem Eifer, wie er so nur bei Kindern zu finden ist, übernahmen sie die Fürsorge für diese Tiere.
»Mein Kaninchen heißt Liebe Mira«, entschied unser jüngerer Sohn.
»Aber das ist kein richtiger Name!«, versuchte ich zu erklären. »Liebe gehört nicht dazu. Mira ist genug. So wie dein Freund Johann heißt und nicht Lieber Johann. Mira ist gut, aber Liebe Mira hört sich komisch an.«
»Das ist mir egal. Mein Kaninchen heißt Liebe Mira!«
Und dabei blieb es. Später, wenn das Tier gestorben sein würde, sollte er unter den Büschen ein kleines Grab ausheben und darauf ein Holzkreuz mit der Aufschrift »Liebe Mira« stellen.
Jeden Tag sammelten die Kinder Löwenzahn. Und immer waren sie auf der Suche nach besonders großen Exemplaren. Bald hatten sie herausgefunden, was den Kaninchen sonst noch schmeckte: Sie rupften Giersch, Spitzwegerich und Wiesenkerbel. Im Herbst liefen sie hinüber auf den Acker des Bauern und zogen eine Zuckerrübe aus dem Boden.
Im Winter war Liebe Mira zu einem Kaninchenbock gebracht worden. Im Frühling polsterte sie mit den feinen Haaren ihres Fells ein Nest. Eines Morgens lag ein Wurf nackter Jungtiere darin. Aber dann wurde es in einer der folgenden Nächte noch einmal sehr kalt, eines der Jungen war nicht im Nest geblieben. Tot lag es in der Frühe da. Zum ersten Mal erfuhren unsere Kinder die Willkür der Natur, deren Gleichgültigkeit gegenüber dem einzelnen Lebendigen.
In einem Teil des Gartens legten wir Gemüsebeete an, damit gehörten wir zu den ganz wenigen im Dorf, die noch ihr eigenes Gemüse zogen. Einmal blieb eine Frau stehen und sah mich Bohnen ernten.
»So etwas«, meinte sie, »haben wir nicht mehr nötig. Wenn ich Bohnen will, gehe ich und kaufe welche.«
Die Kinder wurden größer und übernahmen immer mehr Arbeiten im Garten. Den Jüngeren faszinierten vor allem die Bäume. Er buddelte wild aufgeschlagene, zwei- oder dreijährige Bäumchen aus und pflanzte sie an einer anderen, günstigeren Stelle, an der mehr Licht und Platz war, wieder ein. Einmal war er der Meinung, er müsse unbedingt eine Kastanie verpflanzen. Er hatte sie selbst Jahre vorher als kniehohen Schößling an ihre jetzige Stelle gesetzt. Dort war sie sehr schnell gewachsen und mittlerweile mehr als mannshoch. Aber er hatte sich in den Kopf gesetzt, diesem Baum erneut einen anderen Standort zu geben.
»Sie steht jetzt zu sehr im Schatten der Mirabelle«, erklärte er uns. In den Herbstferien begann er, das Wurzelwerk freizulegen. Mit Spaten und Schaufel grub er rundum eine Menge Erde weg. Ein Gärtner, der auf dem Nachbargrundstück zugange war, beobachtete ihn und wollte schließlich wissen, was er da mache.
»Die Kastanie muss hier heraus, die bekommt nicht genug Licht.«
»Aber Junge, so schaffst du das nie, dazu brauchst du einen kleinen Bagger.«
»Nein, ich schaffe das auch so«, sagte er und grub weiter.
Fast eine Woche benötigte er, um die Wurzeln freizulegen. Einen weiteren Tag, um das Loch zu graben, in das die Kastanie nun hineinsollte. Als er fertig war, rief er seinen Vater und bat ihn, ihm dabei zu helfen, den Baum samt Wurzeln auf die Schubkarre zu hieven. Dabei zerbrach der Wurzelstock in zwei Hälften. Nun galt es, zwei Kastanien neu zu pflanzen. Also wurde ein weiteres Loch gegraben. Beide Stücke trieben im Frühling mächtig aus, und beide wuchsen in den nächsten Jahren zu stattlichen Bäumen heran. An der alten Stelle waren noch Wurzelreste im Boden geblieben, genug, um neue Triebe hinauf ans Licht zu schicken.
Zehn Jahre später sind die beiden umgepflanzten Kastanien dann von unserem Sohn in zwei Metern Höhe gekappt worden. Eine kleine Esskastanie und eine chinesische Korkeiche hätten sonst zu sehr in ihrem Schatten gestanden. Die größeren Äste wurden zu Brennholz. An den Schnittstellen trieben die Kastanien erneut aus.
Während seiner Schulzeit behielt unser jüngerer Sohn seine Vorliebe für Bäume für sich. Unter seinen Altersgenossen hätte er sich damit, wie er befürchtete, lächerlich gemacht. Erst ein Zufall, später im Leben spricht man gerne von Schicksal, hat für ihn innerlich den Weg frei gemacht, seine Liebe zu den Bäumen offen zu zeigen und einen Beruf zu wählen, in dem diese Zuneigung wichtig, ja unersetzlich ist.
Er war es dann auch, der sich zusammen mit seinem großen Bruder in den letzten Jahren darum gekümmert hat, unseren Garten umzugestalten. Dies hieß vor allem, meinem Mann und mir langsam, beharrlich und behutsam beizubringen, wie wir unser Tun verändern könnten. Allmählich begann sich in uns ein anderes Verständnis vom Boden, vom Anpflanzen, vom Fortpflanzen, vom Wuchern und vom Licht zu entwickeln.
Einmal, ich ging mit ihm durch unseren Garten, zeigte und erklärte er mir einiges.
»Das Wichtigste ist das Hinschauen. Gehe immer wieder durch den Garten und beobachte nur. Betrachte. Sieh hin. Sieh genau hin. Das ist das Allerwichtigste.« Und er sagte: »Du bist Teil eines Lebendigen Ganzen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.«
Und so habe ich in den letzten Jahren geschaut und getan und sinniert und wieder geschaut und getan und sinniert.
Und so habe ich langsam sehen gelernt.
Die früheren Alten
Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, so erscheint esmir manchmal, als hätte ich in den jetzt etwas über sechzig Jahren, die ich mich auf dieser Erde bewege, einen Wandel erlebt, der einen weit größeren Zeitraum umfasst. Ich meine damit nicht nur die zunehmende Dominanz aller auf Strom angewiesenen Geräte und Medien. Es ist eine ungeheure Veränderung aller Lebensbereiche. Sie erstreckt sich vom Intimen, dem unmittelbar auf den Leib Bezogenen, wie etwa dem Toilettengang, bis hin zu der schier unendlichen Fülle an Wissen, welches wir, völlig losgelöst von jedem praktischen Tun, als Information zur Kenntnis nehmen können.
Noch Anfang der 1960er-Jahre, als ich im Rheiderland aufwuchs, waren hier fast alle Menschen arm. Wohlhabend, ja reich waren nur die Großbauern auf ihren riesigen Ländereien, den fruchtbaren Poldern. Sie hießen deshalb auch Polderfürsten. Viele Menschen arbeiteten ihr ganzes Leben lang als Knechte und Mägde bei diesen Großgrundbesitzern. Später wurden sie Landarbeiter genannt, was an ihrer Ausbeutung nichts änderte. Einige kleine Bauern gab es ebenfalls, sie besaßen ein paar Kühe und ein Stück Weideland oder einen kleinen Acker für Getreide und Gemüse. Die ärmsten von ihnen hatten zum Bestellen ihrer Felder und zum Transport ihrer Habseligkeiten kein Pferd, sondern lediglich einen großen Hund. Der wurde vor einen Karren gespannt, um damit etwas von A nach B zu bringen. »Köterburen«, Hundebauern, nannte man sie.
Mit so einem Hundekarren transportierten auch manche Fischersfrauen den Fang ihrer Männer: Stint, Aal, Butt und den sogenannten Granat, kleine Garnelen. War viel Fisch gefangen worden, konnte ein Teil davon in die umliegenden Dörfer und in die nächsten Kleinstädte verkauft werden. Bis zu fünfzig Kilometer wurden hierfür, hin und zurück, zu Fuß zurückgelegt.
Andere Dörfler lebten vom Handwerk. Sie waren Tischler, Zimmerer, Bäcker, Schmied, Schuster, Müller, Maler, Schlachter, Frisör, Schneider oder hatten einen Laden. Es gab einen Zahnarzt, eine Polizeistation mit einem einzigen Polizisten, ein Armenhaus und eine Hebamme. Alle Geburten waren Hausgeburten. Noch wurde keine Frau zur Entbindung ins Krankenhaus gebracht.
In meinen Kinderjahren war die Hebamme schon alt. Sie wusste immer, wie gerade die Tide war, also der Stand von Ebbe oder Flut. »De Kinner komen mit Water«, sagte sie. Die Kinder kommen mit der Flut. Ging das Wasser zurück, so brach die Hebamme, rief man nach ihr, nicht sogleich auf, selbst wenn die Wehen bereits eingesetzt hatten. »Is noch Tied«, sagte sie dann, »dat Water mutt erst komen, dann kummt ok dat Kind.«
Kinder wurden sehr viele geboren. In den Landarbeiterfamilien waren fünf oder sechs Kinder nicht selten. Und so gab es im lang gezogenen Straßendorf auch einige Schulen. In diesen Volksschulen mit nur ein oder zwei Räumen wurden mehrere Jahrgänge gemeinsam unterrichtet. Jedes Dorfkind, gleichgültig wie klug, besuchte bis zur achten Klasse eine dieser Schulen. Und dann war Schluss.
Noch in den 1950er-Jahren legten die Menschen hier die meisten Strecken zu Fuß zurück. Ein Auto stellte die große Ausnahme dar. Auch ein Moped war noch etwas Besonderes. Selbst ein Fahrrad besaßen nicht alle. Meine Großeltern hatten beide eines, und diese Räder wurden sehr gepflegt, denn sie waren teure Anschaffungen gewesen, die lange halten mussten. Einige Landstraßen waren noch aus Steinen gesetzt und deshalb mit dem Rad schwer zu befahren.
Meine Großeltern haben mir oft erzählt, wie meine Urgroßmutter bis ins hohe Alter zu einem reichen Bauern zum Melken gegangen ist. Sie war die schnellste Melkerin weit und breit, weshalb der Großbauer sie auch als alte Frau noch möglichst lange halten wollte. Jeden Tag, sommers wie winters, im Frühling und im Herbst, ging sie um fünf Uhr in der Früh los, lief kilometerweit über die Äcker und überquerte die Schloote, die Entwässerungsgräben, um zum Gehöft zu gelangen. Der Weg querfeldein war kürzer als der über die Straßen. Bei Sturm und Wind, bei Regen, Frost, Hagel oder Schnee, im warmen Frühling wie auch im heißen Sommer ging sie diese Strecke. Denn für das Melken gab es ein bisschen Geld. Nach getaner Arbeit legte sie dieselbe Strecke zurück, um am Nachmittag erneut zum Melken aufzubrechen.
Wann Ebbe und Flut war, wussten in meiner Kindheit alle, die hier an der Küste lebten. Es war von lebensnotwendiger Bedeutung für die Fischer und die Männer, die beim Küstenschutz in der Landgewinnung arbeiteten. Und der Stand der Tide war wichtig für die Einschätzung des Wetters. Sturm mit auflaufendem Wasser, also Hochwasser, war bedrohlicher als Sturm bei ablaufendem Wasser. Ein wolkenverhangener Himmel bedeutete bei Flut viel eher Regen. Bei ablaufendem Wasser zogen die Regenwolken mit dem Wasser weg.
Einige Dörfler hatten einen kleinen Gemischtwarenladen, in dem es alles zu kaufen gab: Messer, Teetassen, Eimer, Schnüre, Butter, Mehl, es waren die Güter des täglichen Bedarfs.
Fünf Wirtshäuser lagen an der einzigen, etwas größeren Straße nah beieinander. Kamen die Männer von der harten und langen Arbeit zurück, kehrten viele dort ein. Manche betranken sich regelmäßig.
Auch mein Großvater war Landarbeiter, meine Großeltern und meine Urgroßeltern bewohnten gemeinsam eines der kleinen Häuser an der Straße. Hinter dem Haus lag der Garten. In diesem Garten bauten sie Kartoffeln, Bohnen und Kohl zur Selbstversorgung an.
Wenn wir älter werden und dann schließlich alt sind, drängen unweigerlich die Erinnerungen an die Kinderjahre in unser Bewusstsein. Wir blicken zurück auf unser Leben und das, was Schicksal genannt wird, zeichnet sich deutlicher ab. In was für eine Familie wurde man hineingeboren, welche Menschen gab es um einen herum, lernte man die Welt in einer ländlichen Umgebung, in einer Kleinstadt oder in einer Großstadt kennen. Und wie hat sich das alles auf den Lebensweg ausgewirkt, welche Einflüsse gab es noch. Wo scheint das Leben vorgezeichnet, wo waren die Brüche, die Umwege, die Hindernisse, und wie sehen die geglückten und missglückten Phasen im Rückblick aus.
Je mehr ich in den letzten Jahren in unserem Garten gearbeitet habe, desto deutlicher trat mir der Garten meiner Großeltern und was er für sie bedeutete vor Augen. Ihr Garten, das war ein rechteckiges Stück Acker hinter dem Haus. Schwerer schwarzer Kleiboden, der im Herbst mit dem Spaten umgegraben wurde. Ein Schloot, ein Graben, begrenzte das Grundstück zum Acker des Großbauern. Im Herbst wurde das Schilf mit dem Spaten aus dem Schloot gestochen. An den Seiten rechts und links verliefen schmale Gräben zu den Nachbarn. Nach vorne, zur Straße hin, standen auf einer Art Wiese drei Apfelbäume und ein Pflaumenbaum. Dazu zwei Johannisbeersträucher und ein Stachelbeerstrauch. Das war alles. Es gab keine Hecke, keine Blumenstauden, keine Kräuter außer ein wenig Petersilie. Es war ein karges Grundstück, so wie alle hier. Aber in den 1960er-Jahren war es das, was ich kannte. So war Garten.
Ich wusste damals nicht, dass man dieses Leben später arm nennen würde, seine Umstände waren mir selbstverständlich. Auch meine Großeltern begriffen sich nicht als arm. Sie wussten zwar, dass sie sehr wenig hatten. Aber so lebte fast jeder im Dorf. Es war alles da. Es war voller Leben. Jeder kannte jeden. Diese Welt erschien mir als Kind sehr groß. Später, als ich mehr von ihr verstand, wurde sie mir eng, sehr eng.
Die Polderfürsten wohnten außerhalb des Dorfes auf ihren herrschaftlichen Höfen. Die hatten viel. Alle wussten, alle sahen das. Aber auch dieser Reichtum war eine Selbstverständlichkeit.
Im Herbst wurden die Kartoffeln im Keller eingelagert, die Briketts im nun leeren Schweinestall gestapelt. Denn das ein halbes Jahr lang gemästete Tier war zuvor geschlachtet worden. Alles vom Schwein wurde verarbeitet: das Blut zu Blutwurst, die Vorderpfoten und der Schwanz kochten in den nächsten Tagen in der Erbsensuppe, die Speckseiten, die Hinterpfoten, die beiden Schinken und verschiedene Würste hingen zum Trocknen an der Decke. Das restliche Fleisch wurde gebraten und als künftiges Sonntagsessen in Weckgläser eingemacht. Erst im Frühjahr würde wieder ein Ferkel gekauft werden: Bis dahin aber würden die Briketts verbraucht und Platz für das junge Tier vorhanden sein.
Für die Briketts und die Kohlen sparte man das ganze Jahr über. Beides war sehr teuer im Verhältnis zu dem, was die Menschen an Geld zur Verfügung hatten. Meine Großmutter legte, wenn ein paar Mark übrig waren, diese oben in den Küchenschrank. Und hatte sie schon im Sommer die nötige Summe zusammen, so konnte das Heizmaterial bereits im Juli oder August gekauft werden, denn dann war es etwas billiger. Es verhielt sich genauso wie heute, wer wenig Geld hat, muss für Lebensnotwendiges im Verhältnis mehr ausgeben.
»Tuffels sünd in’t Keller, Briketts sünd in’t Stall, de Winter kann komen«, sagten meine Großeltern dann. Nach zwei Weltkriegen bedeutete dies keinen Wohlstand, aber zumindest die Abwesenheit von bedrängendem Mangel. Und das alles ist kaum mehr als eine Handvoll Jahrzehnte her. Außer den Erinnerungen ist davon fast nichts geblieben. Aber es ist die Kultur, der ich entstamme und an die ich mich in vielen Einzelheiten erinnere.
Wenn ich an die heutigen Kinder denke, so kann ich mir vorstellen, dass deren Leben in sechs Jahrzehnten von unserem mindestens so weit entfernt sein wird wie das meiner Großeltern von der jetzigen Gegenwart.
Im Sommer gab es drei bis vier Mal in der Woche Bohnen mit Speck. Die Bohnen reiften unterschiedlich schnell, also wurden sie nach und nach geerntet, zum sofortigen Essen oder um sie haltbar zu machen. Ich half immer mit, als Mädchen liebte ich es, mitzutun – das zu tun, was die Frauen taten. Ich war also mit auf dem Acker, um die Bohnen zu pflücken, und half mit, sie anschließend weiterzuverarbeiten.
Zwei bis drei Eimer Bohnen wurden geschnippelt. Dazu kam die »Schnippelmöhlen« auf den Küchentisch, ein einfaches Küchengerät mit einer Handkurbel und einem runden Schneideblatt. Die geschnippelten Bohnen wurden auf dem Küchentisch mit grobem Salz vermischt und anschließend in einen hohen Steinguttopf, den Flintpott, gepresst und so konserviert. Alles geschah mit bloßen Händen, und diese nahmen dabei den Geruch der Bohnen an, rochen nach dem Fruchtwasser, das bei ihrem Zerkleinern ausgetreten war. Einzig frische Bohnen, gerade geerntete und sofort verarbeitete Bohnen, können so riechen. Beschreiben lässt sich dergleichen nicht. Nie wieder habe ich einen ähnlichen Duft gerochen.
Die Schnippelmöhlen meiner Großmutter besitze ich noch heute. Sie zählt zu den ganz wenigen Dingen, die aus jener Welt in meinen Alltag überdauert haben. Wenn wir in unserem heutigen Garten eine reiche Ernte haben, mache ich noch immer zwei Eimer Bohnen auf diese Weise haltbar.
Einen weiteren Teil ihrer Bohnen kochte meine Großmutter in Weckgläser ein, ein anderer wurde getrocknet. Dieses Trocknen ist eine sehr alte Konservierungsmethode, dazu brauchte es weder Flintpott noch Weckgläser noch irgendein Gerät. Eine Nadel und eine dünne Schnur reichten aus. Alle Frauen hatten damals ein solches Bohnenband. Dieses Band aus Baumwolle benutzten sie ausschließlich zum Aufreihen der Bohnen. Eine Länge von anderthalb Metern wurde abgeschnitten, durch eine große Nadel gezogen und an einem Ende zu einer kleinen Schlaufe gebunden. Jede Bohne wurde mit der Nadel durchstochen und das Band durch die Schote gezogen. Bohne reihte sich an Bohne, so lange, bis das Band voll und am anderen Ende ebenfalls eine Schlaufe zu binden war.
An diesen Schlaufen wurden die recht schweren Bänder, ungefähr ein Dutzend, über dem Küchenofen aufgehängt. Da der Ofen jeden Tag angeheizt werden musste, konnten die Bohnen unter der niedrigen Decke schnell trocknen, ohne zu faulen. Sie verloren ihre grüne Farbe und wurden im Laufe der Wochen immer leichter und härter. Sollten sie im Winter gegessen werden, so holte meine Großmutter ein Band von der Decke. Sie streifte die Bohnen herunter und weichte sie





























