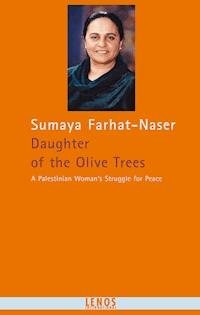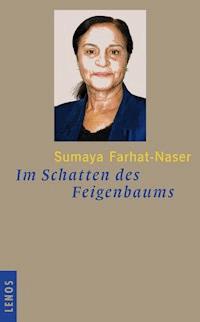16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lenos Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Arabische Welten
- Sprache: Deutsch
Geboren im Jahr der israelischen Staatsgründung, die aufgrund der Vertreibungen als Nakba (Katastrophe) ins kollektive Gedächtnis der Palästinenser eingegangen ist, wuchs Sumaya Farhat-Naser im Westjordanland auf, das seit nunmehr fünfzig Jahren von Israel besetzt gehalten wird. In Friedensinitiativen und Frauengruppen sowie in Seminaren mit Jugendlichen setzt sie sich seit Jahrzehnten für Dialog und Gewaltverzicht bei der Lösung des Nahostkonflikts ein. In mittlerweile vier Büchern und auf zahlreichen Vortragsreisen hat Sumaya Farhat-Naser von ihrer Arbeit und vom Alltag unter Besatzung berichtet. Dieser Band zeichnet anhand einer Auswahl ihrer Texte den Lebensweg der vielfach ausgezeichneten Friedensvermittlerin von 1948 bis in die Gegenwart nach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
www.lenos.ch
Sumaya Farhat-Naser
Ein Leben für den Frieden
Lesebuch aus Palästina
Mit einem Essay von Ernest Goldberger
Die Autorin
Sumaya Farhat-Naser, geboren 1948 in Birseit bei Ramallah, studierte Biologie, Geographie und Erziehungswissenschaft an der Universität Hamburg. Promotion in Angewandter Botanik. Ab 1982 Dozentin für Botanik und Ökologie an der Universität Birseit. Mitbegründerin und Mitglied zahlreicher Organisationen, u. a. von Women Waging Peace an der Harvard-Universität und von Global Fund for Women in San Francisco. Von 1997 bis 2001 Leiterin des palästinensischen Jerusalem Center for Women. Regelmässige Vorträge in Deutschland, Österreich und der Schweiz, u. a. über Erziehung, Alltag, Ökologie, Frauen und die politische Lage in Palästina. Sie lebt in Birseit.
1989 erhielt Sumaya Farhat-Naser die Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät der Universität Münster. 1995 wurde sie mit dem Bruno-Kreisky-Preis für Verdienste um die Menschenrechte und 1997 mit dem Evangelischen Buchpreis des Deutschen Verbands Evangelischer Büchereien sowie dem Versöhnungspreis Mount Zion Award in Jerusalem ausgezeichnet. Zudem erhielt sie 2000 den Augsburger Friedenspreis, ihr wurden die Hermann-Kesten-Medaille des P.E.N.-Zentrums Deutschland (2002), der Bremer Solidaritätspreis (2002), der Profaxpreis (2003) und der AMOS-Preis für Zivilcourage in Religion, Kirchen und Gesellschaft (2011) verliehen.
Der Lenos Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.
E-Book-Ausgabe 2017Copyright © 2017 by Lenos Verlag, BaselAlle Rechte vorbehaltenCoverfoto: Klaus PetruseISBN 978 3 85787 956 2
www.lenos.ch
Inhalt
1948
1966
1974
1976
1987
1995
1997
1998
2000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ernest Goldberger
Textnachweis
1948
Rings um meinen Heimatort Birseit wachsen Olivenbäume. Sie verbreiten eine Atmosphäre der Gelassenheit und Standhaftigkeit. Sie fordern Geduld und Genügsamkeit und versprechen ein gutes Leben. Früher wurden die reichen Vorräte an Olivenöl in Felszisternen gelagert, daher der Name Birseit – Ölbrunnen. Der Duft von Thymian und Oregano, Pistazien und Ginster, Pfefferminz und Salbei, von Zitrus- und Mandelblüten begleitet uns. Quellen sprudeln aus dem Gestein hervor und spenden kostbares Wasser. Dichter und Dichterinnen, Erzähler und Erzählerinnen haben seit je Palästina, diesen Ort der Freude, und ihre Liebe zu Land und Erde besungen. Wer Palästina verlassen hat, träumt von der Heimkehr und sehnt sich nach dem Duft der Sträucher, dem Schatten der Olivenbäume und dem Rauschen der Quellen.
Meine Familie lebt seit Jahrhunderten in Palästina. Früher hatten die semitischen Stämme im Winter diesseits, im Sommer jenseits des Jordans ihr Lager und begnügten sich dankbar mit dem, was der Boden hervorbrachte. Wie unsere Familie von dort nach Birseit gelangt ist, erzählt eine Geschichte, die von Generation zu Generation weitergegeben wird: Als eines Tages im Haus unseres Urahnen Farach ein Mädchen geboren wurde, war die Enttäuschung gross. Unter den Leuten, die sich bei Farach versammelt hatten und ihm Trost spendeten, befand sich auch ein fremder Gast, ein Muslim. Dessen Trostspruch erwiderte Farach mit den Worten: »Das Kind sei dir geschenkt.« Solche Aussprüche waren gebräuchliche Zeichen der Gastfreundschaft und Grosszügigkeit. Als aber das Mädchen sechzehn geworden war, kam jener Gast von damals wieder und forderte sein Geschenk. Der Vater erkannte, dass es dem Mann ernst war, und bereute seinen Ausspruch sehr – denn wie konnte er als Christ seine Tochter einem Muslim verschenken? Er bat um etwas Zeit für die Vorbereitungen, und sie wurde ihm gewährt. Als es Nacht wurde, floh Farach – um der Schande zu entgehen – mit seiner ganzen Familie in die Berge und liess sich im Dorf Ain Arîk bei Ramallah nieder. Einer seiner Söhne wanderte später weiter nach Birseit. Von ihm stammen die vier grossen Sippen des Ortes ab. Neben diesen christlichen Familien lebten auch zwei muslimische Sippen in Birseit. Das Zusammenleben all dieser Menschen beruhte auf Respekt und friedlicher Nachbarschaft.
Die Eltern meines Vaters wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts geboren. Sie erlebten türkische, britische und jordanische Besatzung, Kriege und Armut. Die muslimischen Männer mussten an der Seite der Türken in den Ersten Weltkrieg ziehen. Den Christen war der Heeresdienst verboten; sie mussten stattdessen Steuern zahlen.
Tagsüber arbeiteten Männer und Frauen auf dem Felde. Abends versammelten sich die Männer im Diwân, im Haus des Sippenältesten. Sie schlürften Tee, erzählten sich Geschichten und bestimmten über Dorf- und Familienpolitik. Oft war einer der Männer damit beschäftigt, Kaffeebohnen in einem Holzmörser zu zerstampfen. Weithin waren die ungewöhnlichen Rhythmen seiner Schläge zu hören. Das Geräusch verriet allen, wo sich die Männer versammelt hatten, und wirkte auch einladend für Gäste, die ins Dorf kamen.
Für die Frauen aber war der Arbeitstag, wenn sie vom Feld heimkehrten, noch nicht zu Ende. Sie kümmerten sich um den Haushalt und versorgten die versammelten Männer wie auch die eigene Familie mit Speis und Trank.
Meine Grossmutter erzählte häufig Geschichten aus ihrem Leben, und ich hörte ihr leidenschaftlich gerne zu. Sie erzählte aus ihrem Alltag, wie sie den ganzen Tag unter der glühenden Sonne auf dem Feld arbeitete, abends Weizen drosch und die Körner in ihrer Steinmühle mahlte. Dabei liess sie sich vom wellenartig an- und abschwellenden Geräusch der sich reibenden Steine tragen und hing ihren Gedanken nach. Sie dachte an ihre Leute, auch an die Verstorbenen. Oft weinte sie dabei vor Müdigkeit, und die Tränen erleichterten sie. Sie genoss diesen Moment der Ruhe. Danach knetete sie den Teig, der noch vor Sonnenaufgang im Holzbackofen gebacken wurde. Kurz darauf brach sie auf und gelangte nach zwei Stunden – den Säugling samt dem noch warmen Brot, Oliven, Öl und Gemüse in einem grossen, flachen Korb auf dem Kopf tragend – auf steinigem Weg zum Feld.
Grossmutter erzählte auch gerne von der einzigen Reise ihres Lebens: »Es war zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Ich war damals noch ein junges Mädchen. Die Engländer kämpften gegen die Türken, und wir lebten mitten im Kriegsgebiet in Not und Angst. Mehrere Leute aus unserem Dorf, auch aus unserer Familie, waren in den Kämpfen getötet worden. Viele flüchteten aus Angst in die Städte an der Küste, wo bereits die Engländer standen, oder nach Istanbul. Ich schloss mich dem Strom von Menschen aus unserer Gegend an, die zu Fuss nach Istanbul unterwegs waren. Die Flucht dauerte zwei Monate. In Istanbul erkannte mich ein Soldat aus unserem Dorf; er kümmerte sich um mich und schickte mich mit der nächsten Karawane zurück nach Birseit. Ohne ihn wäre ich wohl nie wieder nach Hause zurückgekehrt. Das war die erste und letzte Reise meines Lebens.« Als die Türken in Ramallah, zehn Kilometer von Birseit entfernt, von den Engländern besiegt wurden, kam es zu einem Waffenstillstand. Die Flüchtlinge kehrten nach und nach zurück. Ihre Häuser waren von den Türken geplündert worden, die Felder abgeerntet.
Ein andermal erzählte Grossmutter, wie es dazu kam, dass die Frauen im Dorf Schuhe tragen durften. Als Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten einfachen Lederschuhe aufkamen, waren sie den Männern vorbehalten, obwohl gerade die Frauen bei ihrer harten Arbeit auf dem Feld oft wunde Füsse hatten.
»Wir Frauen besassen zwar Schuhe, aber es ziemte sich nicht, sich damit im Dorf zu zeigen. So zogen wir sie erst ausserhalb des Dorfes an. Als wir eines Tages mit schweren Holzbürden auf dem Kopf ins Dorf zurückkamen, beeilten wir uns wie immer, die Schuhe rechtzeitig auszuziehen und zwischen dem Holz zu verstecken. Aber Salma, Mansûrs Tochter, hatte wunde, schmerzende Füsse und beschloss, die Schuhe nicht auszuziehen. Kaum war sie zu Hause angekommen, stürzte sich ihr Vater mit einem Stock wütend auf sie: ›Wie wagst du es, mir diese Schande anzutun! Das ganze Dorf spricht über die Tochter des Mansûr.‹
›Bitte, Vater‹, flehte sie, ›im Namen der heiligen Maria und des heiligen Georg, hör mich an, bevor du mich schlägst! Sag mir: Was ist besser und anständiger: die Schuhe an den Füssen oder auf dem Kopf zu tragen?‹
Verblüfft liess der Vater den erhobenen Arm sinken und antwortete: ›Du hast recht, meine Tochter.‹ Und er verliess das Haus.
Darauf ging Salma zu ihren Freundinnen und erzählte ihnen die Geschichte. Und sie beschlossen, von nun an die Schuhe anzubehalten. Und dabei blieb es.«
Meine Eltern wuchsen zur Zeit des britischen Mandats in Palästina auf. Die Engländer wollten die Gesellschaft modernisieren und mit der Gründung von Schulen ihren Einfluss verstärken. Mein Vater erhielt eine gute Schulbildung in Jerusalem, wo Grossvater in der Klinik der lutherischen Kirche als Hilfskraft arbeitete. Grossvater war offen für Neues und wusste auch Bescheid über das, was sich jenseits der Dorfgrenzen abspielte.
Meine Mutter, Tochter einer einfachen Bauernfamilie, hatte sich geweigert, die Schule zu besuchen, und blieb Analphabetin. Denn nach Vorschrift der Engländer hätte sie, wie alle Schülerinnen, eine Schuluniform tragen müssen. Meine Mutter und andere Mädchen ihres Alters brachten es nicht über sich, ihre palästinensische Tracht abzulegen, sich derart zu entblössen und ihre Kultur und Tradition preiszugeben. Heute leben in Birseit nur noch etwa dreissig Frauen, die diese Tradition beibehalten haben. Die meisten von ihnen sind Analphabetinnen.
Meine Mutter wurde mit siebzehn Jahren verheiratet. Sie brachte neun Kinder zur Welt, fünf Mädchen und vier Knaben. Die Geburt eines Kindes ist die Bestätigung der Fruchtbarkeit und Tauglichkeit der Frau. Die Wertschätzung stieg, wenn die Frau Söhne und möglichst wenige Töchter zur Welt brachte. Der Sohn, Träger des Familiennamens, galt und gilt auch heute noch als Beschützer der Familie; er sichert ihren Unterhalt und Besitz. Grosse Freude verbreitete sich daher unter denen, die vor der Tür der Gebärenden warteten, wenn der Ruf der Hebamme zu hören war: »Betet zum heiligen Georg! Es ist ein Sohn geboren!« Im Nu erfuhr es das ganze Dorf. Wurde ein Mädchen geboren, rief die Hebamme: »Betet zu unserer Mutter Maria! Ein Mädchen ist geboren!« Stille breitete sich aus. Trostworte wurden ausgesprochen wie: »Hauptsache, die Mutter hat es überstanden.« – »Wer eine Tochter bekommt, kann auch einen Sohn bekommen.« – »Wenn sie keinen Mann findet, kann sie im Alter für die Eltern sorgen.«
Das Kindbett dauerte in der Regel vierzig Tage. In dieser Zeit wohnte die Mutter oder eine der Schwestern der jungen Frau bei ihr, pflegte sie und versorgte Haus und Kinder. Es war üblich, dass die Grossmutter der Tochter und ihrer Familie zur Geburt einige Hühner schenkte. Und so gab es die ganze erste Woche über leckere Hühnergerichte.
Ich wurde 1948 geboren, in dem Jahr also, in dem auf dem Boden, der uns Palästinensern und Palästinenserinnen gehörte, der Staat Israel gegründet wurde. Mein Grossvater besass zu jener Zeit an der Stelle, wo sich heute der Flughafen Lod / Tel Aviv befindet, zwei Hektar Land. Dort, nur vierzig Kilometer vom Heimatort Birseit entfernt, pflanzte Vater mit Verwandten Zitrusfrüchte und baute Weizen und Gemüse an. Durch die Teilung Palästinas verloren sie Grundstück und Arbeit, und Vater kehrte zu seiner Familie nach Birseit zurück.
Birseit befand sich in dem Teil Palästinas, der nach dem Zerfall des palästinensischen Widerstands von der jordanischen Armee übernommen worden war. Die Widerstandsbewegung hatte die Befreiung des Landes von den Briten und die Errichtung eines Staates Palästina angestrebt und war auch gegen die jüdische Armee angetreten, die ihren eigenen Staat erkämpfte. Nach der Niederlage verfolgte die jordanische Armee die palästinensischen Widerstandskämpfer und proklamierte 1950 die Vereinigung des Westjordanlandes mit Transjordanien im Königreich Jordanien. Nationale Gefühle zu zeigen wurde den Palästinensern verboten. Die jordanische Regierung versuchte, die Palästinenser zu Bürgern des jordanischen Staates zu machen und sie so zu integrieren – mit wenig Erfolg. Zwei Gesellschaftsformen prallten in dem neuen Staat aufeinander: Während die jordanische Gesellschaft vorwiegend aus nomadischen Beduinen bestand, waren die Palästinenser erfahrene Ackerbauern, Handwerker und Händler, auch ausgebildete Lehrer gab es. Sitten und Gebräuche und die Dialekte waren ebenfalls unterschiedlich. Die Palästinenser waren gezwungen, sich in die beduinische Gesellschaft einzufügen, und dies bedeutete für sie einen Rückschritt. Aufgrund ihrer Fähigkeiten waren sie zwar die treibende Kraft beim Aufbau des Staates, doch die politische und militärische Macht lag in den Händen der Jordanier. Den Palästinensern fiel Loyalität gegenüber dem jordanischen Staat schwer. Je mehr man sie zu Jordaniern machen wollte, desto mehr klammerten sie sich an ihre palästinensische Identität.
Seit meiner Geburt lebten meine Grosseltern und meine Eltern zusammen in einem der traditionellen Bauernhäuser, die gewöhnlich aus einem einzigen gewölbten Raum bestanden. Die Häuser waren im Kreis um einen Hof gebaut und gaben dem Dorf das Aussehen eines von Kuppeln gekrönten Steinhaufens, der sich harmonisch in die karge Hügellandschaft einfügte. Im Hof verrichteten die Frauen gemeinsam die Hausarbeit. Eine kleine Treppe führte auf das Dach, wo die Wäsche getrocknet und Gemüse und Obst gedörrt wurden.
Mein Elternhaus war zweistöckig. Unten waren die Tiere untergebracht, und oben lebten die Menschen in einem Raum, der als Ess- und Schlafzimmer sowie als Lagerraum diente. Mittelpunkt des Raumes war der runde, niedrige Tisch. Zum Schlafen wurden abends Matratzen aus Schaf- und Ziegenwolle ausgebreitet, die tagsüber – bis auf eine oder zwei, die zum Sitzen dienten – unter einem Wandbogen aufgestapelt wurden. In Nischen und in Truhen, aus Stroh und Lehm gefertigt, wurden Lebensmittel aufbewahrt; sie trennten den Wohnraum vom Speicher. Kostbarkeiten wurden in der Brauttruhe verborgen.
Geschirr, Küchen- und Arbeitsgeräte waren aus Ton, Holz, Stroh und Leder gefertigt. Die Männer flochten grobe Körbe und Gefässe aus jungen Olivenzweigen, die Frauen stellten aus Weizenhalmen bunte, feine Schalen und Tabletts her.
Unter dem Haus, acht Meter tief in den Fels gehauen, befand sich die Ölzisterne; in ihr lagerte das Öl als Vorrat für Jahre.
In solch einfachen Verhältnissen lebte unsere Familie: rund zehn Personen aus drei Generationen. Mitunter waren es sogar mehr, denn bis zu ihrer Heirat lebten auch zwei Brüder meines Vaters bei uns, und später nahm Mutter noch die sechs Kinder eines Onkels bei uns auf, deren Mutter psychisch erkrankt war. Der Grossvater war in allen Lebensbereichen bestimmend. Neben seiner Arbeit in der Klinik handelte er mit Öl und Weizen. Die Grossmutter kannte ich nur als Gelähmte, die nach einem Schlaganfall bettlägerig und auf die Hilfe meiner Mutter angewiesen war. Wir mochten sie sehr, sie lachte gerne und erzählte uns Geschichten. Wenn wir etwas Dummes angestellt hatten, versteckten wir uns bei ihr.
Mein Vater war selten zu Hause. Obwohl er eine gute Schulbildung hatte, gehorchte er dem Befehl seines Vaters und ging als Fahrer zur jordanischen Armee. Grossvater beherrschte ihn so sehr, dass er nie eigene Wünsche zu äussern wagte. Er hatte nicht den Mut, seine Bildung und sein Können zu zeigen, und dies zu einer Zeit, als erst wenige schreiben und lesen konnten. Er fürchtete, woanders eingesetzt zu werden und dadurch seinem Vater zu missfallen, der Fahrer für den besten Beruf hielt. So blieb er fünfzehn Jahre beim Militär, ohne je befördert zu werden, und kehrte mit dreiundvierzig als Arbeitsloser nach Hause zurück.
Die Armut bekamen wir Kinder täglich zu spüren. Oft war nichts Essbares mehr im Haus. Voller Spannung warteten wir jeweils darauf, dass die Henne ein Ei legte. Dann sassen wir alle im Kreis auf dem Boden, starrten voller Freude auf das Spiegelei und assen behutsam nach den Regeln der Höflichkeit: Eins nach dem andern tauchten wir unser Brotstück in das Bratöl und kauten langsam, bis kein Öl mehr da war. Dann erst begannen wir der Reihe nach das Gelbe und schliesslich das Weisse vom Ei zu essen. Mittags gab es Gemüse, das wir meist selber gepflanzt oder in den Hügeln gesammelt hatten. Nur am Sonntag gab es Reis und ein Pfund Fleisch oder ein Huhn für die elfköpfige Familie.
Abends waren wir besonders hungrig. Meistens assen wir Brot, das wir in Olivenöl tauchten und mit einem Thymian-Oregano-Kräutergemisch würzten. Es schmeckte und schmeckt bis heute wunderbar. Aber manchmal waren wir es leid. Dann bereitete Mutter uns ein Teegericht. Alte Brotstücke wurden in einer Holz- oder Aluminiumschüssel mit gezuckertem Schwarz- oder Salbeitee begossen. Wenn das Brot aufgeweicht war, setzten wir uns im Kreis um die Schüssel. Das Geräusch der Löffel höre ich noch heute, und der Geschmack der süssen Brotstückchen ist mir so unvergesslich wie das Glücksgefühl über dieses besondere Essen.
Auch Grossvater konnte aus altem Brot ein leckeres Mahl zubereiten. Er schabte die schimmligen Stellen weg, weichte die Brocken mit etwas Wasser auf, bestrich sie mit Öl, streute Salz darauf und wärmte sie im Backofen. Auch das schmeckte wunderbar.
Besondere Feste waren Ostern oder Weihnachten. Dann schlachtete der Grossvater mütterlicherseits jeweils ein Lamm und lud seine Söhne und Töchter mit ihren Familien zum Essen ein.
1954 kam ich in die Dorfschule. Die Weichen für meine Ausbildung und damit für meinen weiteren Lebensweg aber stellte meine Tante Hanneh. Sie war zwanzig Jahre alt, hatte drei Kinder und lebte getrennt von ihrem Mann. Nach vier schlimmen Ehejahren hatte sie es gewagt auszubrechen, und das, obwohl es bereits als Schande galt, wenn Ehefrauen klagten oder sich dem Willen des Ehemannes widersetzten. Für Christen in Palästina war eine Scheidung erst nach siebenjähriger Trennung möglich.
Als Kind war Tante Hanneh Schülerin von Talitha Kumi gewesen, einer von Diakonissen geleiteten deutschen Internatsschule in Jerusalem. Nach der Trennung von ihrem Mann arbeitete sie in ihrer ehemaligen Schule. An ihren freien Tagen besuchte sie uns ab und zu und brachte Obst, Kleider, manchmal Käse und Fleischkonserven mit. Das habe ihr Schwester Bertha Harz, die Leiterin der Schule, für uns mitgegeben. Natürlich freuten wir uns immer auf ihren Besuch, und die Erfahrung, dass in der Not Hilfe vom Himmel fiel, prägte uns.
Eines Tages nahm mich Tante Hanneh beiseite. »Willst du mit nach Talitha Kumi kommen?«, fragte sie. »Ich werde mich im Internat um dich kümmern. Neben der Schule könntest du singen lernen, nähen und Hausarbeit. So brauchst du dich, wenn du gross bist, nicht vor schweren Zeiten zu fürchten.«
Ich sagte sofort ja. Später aber fühlte ich mich elend und weinte bitterlich, weil ich das Elternhaus würde verlassen müssen. Meine Mutter, die meinen Konflikt spürte, tröstete mich und sagte, dieser Vorschlag sei ein Segen Gottes. Im Übrigen werde sie mich besuchen kommen und während der Ferien sei ich ja zu Hause. Meine Mutter wusste, dass ich es schaffen würde. Am liebsten hätte sie auch meine ältere Schwester mitgehen lassen, aber sie war auf deren Hilfe angewiesen.
1966
Als ich vierzehn Jahre alt war, beschloss Grossvater, mich zu verheiraten. Ich erfuhr zufällig davon, als ich meine Mutter sagen hörte: »Lasst sie doch lernen und ihre Waffe selber tragen. Es reicht, dass ich Analphabetin geblieben bin.« Diese Worte gaben mir zusätzliche Kraft, mich dem Ansinnen zu widersetzen. Ich machte Grossvater, dem Haupt der Familie, klar, dass ich allein über mein Leben bestimmen würde. Grossvaters Schock war so gross, dass er kein Wort hervorbrachte und das Haus verliess.
Ich aber kehrte sofort in die Schule zurück und bat die Schwestern, mich während der Ferien im Internat zu behalten. Ich würde mein Schulgeld in Zukunft durch eigene Arbeit verdienen. Ich wollte der Familie finanziell nicht mehr zur Last fallen; sie sollten ihre Absicht, mich zu verheiraten, nicht damit begründen können. Die Angst aber blieb.
Mit Hilfe der Mutter und der Diakonissen schaffte ich schliesslich das Abitur. Dass ich kein Kleid für die Abschlussfeier hatte, bekümmerte mich sehr; ich wagte aber nicht, das zu Hause zu erzählen. Einen Tag vor dem Fest brachte mir eine Freundin, die aus einer wohlhabenden Familie stammte, ein schönes weisses Kleid. Ich weinte vor Rührung. Meine Mutter und die Geschwister weinten mit mir. Mein jüngerer Bruder empfand meinen Schulabschluss als historisches Ereignis. Er opferte seine ganzen Ersparnisse von fünf Piastern, kaufte Knaller und Feuerwerk und feuerte sie auf der Strasse ab – war seine Schwester doch die Erste in der Familie, die das Abitur bestanden hatte.
Die Diakonissen hatten besondere Pläne mit mir. Sie waren älter geworden, und aus Deutschland war keine Nachfolge zu erwarten. Die Schulleitung entschloss sich deshalb zur Ausbildung von Einheimischen, die später die Schule weiterführen sollten. Als Kandidatinnen wurden eine Kollegin und ich auserkoren.
Es war Zufall, dass uns zu jener Zeit eine Gruppe Lehrer und Lehrerinnen aus Hamburg besuchte. Sie waren von der Arbeit der Schule beeindruckt und bereit, sie zu unterstützen. Die Gruppe beschloss, sich für die Ausbildung der zwei Schülerinnen einzusetzen. Schwester Nadschla, die palästinensische Schulleiterin, schlug vor, dass ich die Deutschen auf ihrer weiteren Reise durchs Land begleiten sollte; so könnten sie mich kennenlernen und sehen, wie ordentlich, normal und nett ich sei.
Ein Traum wurde wahr: Ein Studium rückte in Sichtweite. Meiner Mutter erzählte ich alles, und sie half mir, heimlich einen Reisepass zu beschaffen. Grossvater unterrichtete ich erst wenige Tage vor dem Abflug von meinen Plänen. Er war überrascht, ja verblüfft und wusste nichts zu antworten. »Hör mir zu, Grossvater«, sagte ich, »seit zwanzig Jahren arbeitest du im deutschen Spital, du kennst die Deutschen, und ich weiss, dass du sie schätzt. Es müsste dir also gefallen, dass ich nun nach Deutschland gehe. Stell dir vor: Ich kehre nach der Ausbildung zurück, ich habe dann einen Beruf und kann der Familie helfen. Und keine Sorge: Für Reise und Studium brauche ich kein Geld von dir. Die Schule wird mir helfen.« Dann sang ich mit ihm »Lobe den Herrn«, und bevor er nein sagen konnte, hatte ich mein Elternhaus bereits verlassen. Mit Hilfe der Schwestern konnte ich wenige Tage später abreisen. Es war im September 1966. Schwester Nadschla begleitete uns bis Beirut.
Eine Szene vergesse ich nie: Ich stand am Jerusalemer Flughafen und zitterte vor Angst, es könnte etwas schiefgehen. Da sah ich Grossvaters hohe Gestalt auf mich zukommen. Lächelnd übergab er mir einen jordanischen Dinar, also rund drei Mark, und sagte: »Gehe hin mit Gott.« Mit diesem Geld und Grossvaters Segen reiste ich mit achtzehn Jahren nach Hamburg.
1974
Während meiner Studienzeit schrieb ich in meinen Briefen nach Hause nur über die guten Erfahrungen, nie aber über meine Probleme. Ich hatte Angst, dass man mich zurückrufen könnte. In jedem Brief versprach ich, ins Dorf zurückzukehren. »Pass auf!«, liess meine Mutter mir in Briefen mitteilen. »Die Ehre der Familie ist das Höchste im Leben. Ich warte auf Dich, denke daran. Es sind doch schon fünf Jahre vergangen. Was wird aus Dir?«
Ein Versagen meinerseits, das wusste ich, würde anderen Mädchen im Dorf den Weg zu einem Studium im Ausland versperren. Ich fühlte mich verpflichtet, meinen Weg erfolgreich zu beenden. Mir war immer bewusst, dass ich mich nicht mit Menschen anfreunden durfte, die mich in Versuchung bringen könnten, meine Ziele zu ändern oder meine Pflichten gegenüber meiner Familie und meinem Volk zu vernachlässigen.
Wunderschöne Gefühle überwältigten mich, wenn ich an zu Hause dachte, mich an die einfache Sprache meiner Mutter erinnerte, an die Augen und das Lachen meiner Geschwister und wenn ich die Wasserquelle, den Weinberg und den Feigenhain vor meinen Augen sah. Ich war fest entschlossen zurückzukehren. Ich wusste zudem, dass ich zu Hause nicht bloss eine Nummer sein würde, wie es Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland sind. Ich wollte ich selber sein und zu den Menschen gehören, die auf mich warteten. Sie alle kamen, um mich zu begrüssen, wenn ich zu Besuch war. Sie begegneten mir mit Respekt und liessen mich ihre Erwartungen spüren.
Das Studium näherte sich seinem Ende. Die Besetzung des Westjordanlandes, meiner Heimat, dauerte bereits sieben Jahre. Gespannt wartete ich auf die Annahme meines Antrags auf »Familienzusammenführung«, war ich doch zur Zeit der Volkszählung von 1967 bereits in Deutschland gewesen und gemäss israelischem Militärgesetz als »gebietsfremd« registriert. Tausenden meiner Landsleute ging es wie mir. Sie hatten das Recht auf Heimkehr verwirkt.
Nach dem vierten Antrag kam endlich eine positive Antwort. »Gott sei Dank, dass Du noch nicht verheiratet bist!«, liess Mutter mir schreiben. »Du darfst heimkommen. Leider dürfen Deine Schwester in Amman und mit ihr all jene, die verheiratet sind, nicht wieder zurückkehren. Du musst aber sofort kommen, um Deine Identitätskarte abzuholen, sonst verlierst Du Dein Recht auf Rückkehr.« Ich liess alles stehen und liegen, lieh mir das Geld für die Flugkarte und kehrte heim.
Zur selben Zeit hatte auch ein junger Mann aus meinem Dorf, der in Amsterdam studiert hatte, die Genehmigung erhalten, nach Hause zu fahren, um die Identitätskarte zu beziehen. Auch er hatte Glück, dass er noch nicht verheiratet war. Wir begegneten uns auf der Strasse, stellten uns gegenseitig vor, und da ich für mein Staatsexamen einige Untersuchungen über die palästinensischen Oliven brauchte, bot er sich an, mir zu helfen. Wir gingen einige Male gemeinsam in die Dörfer, unterhielten uns mit den Bauern und hatten so Gelegenheit, uns näher kennenzulernen. Allerdings war es nicht üblich, dass junge Leute sich, ohne verlobt zu sein, zusammen auf der Strasse blicken liessen.
Wir beschlossen, uns zu verloben. Eigentlich war es mir ein Rätsel, wie ich mich so schnell hatte entscheiden können. Eines Abends ging ich zu Grossvater und sagte: »Grossvater, Munîr möchte sich mit mir verloben, was meinst du dazu?« Er lächelte, lehnte sich schaukelnd in seinem Sessel zurück und sagte: »Wie schön, jetzt kann ich ruhig sterben. Ich ahnte etwas, ich hoffte es, deshalb drückte ich ein Auge zu, wenn ihr allein unterwegs wart.« In seinen Augen und nach traditionellen Wertvorstellungen war ich mit vierundzwanzig Jahren bereits zu alt, um noch einen Mann zu finden.
Einen Monat später waren wir verlobt. Ich fuhr nach Hamburg, um meine letzten Prüfungen abzulegen, und kehrte danach nach Hause zurück. Ich war das erste Mädchen aus meinem Dorf, das ein Studium im Ausland abgeschlossen und mit dem Staatsexamen für das höhere Lehramt einen hohen akademischen Grad erlangt hatte. Munîr, der sein Studium in Amsterdam bereits beendet hatte, bekam sofort einen Lehrstuhl am Birseit-College, als Dozent für Biochemie.
Sieben Jahre nach der Besetzung kehrte ich in mein Land zurück. Es war ein glühend heisser Junitag; zu Tausenden hatten sich Rückreisende beim jordanischen Grenzposten an der Jordanbrücke eingefunden. Besuchsgenehmigungen wurden nur während der Sommermonate erteilt, wenn Universitäten, Schulen und auch viele im Ausland Arbeitende Ferien hatten. Deshalb war der Andrang derer, die ihre Familien besuchen oder ihr Rückkehrrecht bestätigen wollten, so gross. Wir waren nervös, und angesichts der Warteschlangen befürchteten viele, den Grenzübertritt an diesem Tag nicht mehr zu schaffen. Wer bis zu dem im Rückreisepapier vermerkten Datum nicht einreiste, konnte im schlimmsten Fall das Recht auf die Heimkehr verwirken. Unter uns war eine Frau, die spätestens tags zuvor hätte einreisen sollen. Sie hatte aber übersehen, dass der angegebene Tag ein Samstag war, an dem die Grenze geschlossen blieb. Ihr Mann und die Kinder, die gültige Papiere hatten, überquerten weinend die Grenze, während sie nach Amman zurückreisen musste.
Nach der Kontrolle unserer Papiere warteten wir in Bussen auf das Zeichen der jordanischen Soldaten zur Weiterfahrt. Erst vier Stunden später durften wir endlich losfahren. Zwischen den beiden Grenzlinien hielt der Bus noch einmal an, und wir blieben, wiederum ohne ersichtlichen Grund, eine Stunde lang bei geschlossenen Fenstern in der prallen Sonne stehen. Der Bus war von Soldaten umstellt, die uns beobachteten, und wir wagten nicht, uns zu beschweren.
Endlich erreichten wir den israelischen Grenzposten. In einem grossen, kühlen Raum wurden unsere Papiere kontrolliert. Danach führte man uns zur Leibesvisitation. Wir, rund vierhundert Frauen, mussten unsere Schuhe ausziehen und vor den Untersuchungskabinen warten. Mit blossen Füssen, wie auf einem Fliessband nach vorne rutschend, sassen wir äusserst angespannt auf langen Bänken.
»Zieh dich aus!«, befahl die Soldatin, als ich endlich an der Reihe war.
»Was soll ich ausziehen?«
»Alles!«
»Ich schäme mich«, versuchte ich einzuwenden.
»Halt den Mund!«, tönte es zurück.
Während sie meinen Körper mit einem elektronischen Abtaster untersuchte, hörte ich aus der Nebenkabine, wie eine Leidensgenossin aufgefordert wurde, auf die Bank zu steigen und vor den Augen der Soldatin die Binde zu wechseln. Ich hörte ihr Schluchzen und weinte mit. Als ich aus der Kabine trat, sah ich mitten im Raum einen grossen Karton mit den in der Zwischenzeit kontrollierten Schuhen, aus dem sich jede die ihren hervorsuchen musste. Wir warteten. Die Soldatinnen sprachen kaum Arabisch und drückten ihre Befehle mit unmissverständlichen Gesten aus. Die Atmosphäre war gespannt. Wir alle waren verängstigt und fürchteten, etwas falsch zu machen. Tief verletzt und gedemütigt kam ich spätabends zu Hause an.
Ich hatte mich sehr auf das Wiedersehen mit meiner Familie gefreut, insbesondere mit meiner Mutter, der ich als Erwachsene neu würde begegnen können. Aber ich konnte nur zwei Wochen bleiben. Nach der Heirat würde ich meine Familie nicht mehr so oft, wie ich wollte, besuchen können, obwohl sie nur zweihundert Meter von meinem zukünftigen Heim entfernt wohnte. Es fiel mir nicht leicht, zu akzeptieren, dass ich von nun an zur Familie meines Mannes gehörte.
Anders als meine eigene gehörte Munîrs Familie zur Oberschicht von Birseit. Diese hatte ihm verschiedene Mädchen aus vornehmen Kreisen zur Heirat vorgeschlagen, aber er hatte kein Interesse gezeigt. Seine eigene Wahl schockierte dann alle. »Sie ist ja schwarz wie ein Schürhaken«, entfuhr es einer seiner Tanten in meiner Anwesenheit. Auch der Vater zeigte sich enttäuscht über den Geschmack seines Sohnes: »Dabei hättest du das feinste blondhaarige Mädchen des Dorfes haben können!« Munîr verteidigte mich. Wenn er sagte: »Sie ist die Beste, sie passt zu mir, und für mich ist sie die Schönste«, antworteten die Leute: »Ein Affe ist in den Augen seiner Mutter ein Reh.«
Heiraten war früher Sache der ganzen Familie gewesen. Ein Mädchen konnte zwar zustimmen oder ablehnen, aber frei entscheiden konnte es nicht. Der soziale und familiäre Druck war meist so stark, dass die jungen Frauen es selten schafften, sich zu widersetzen. »Traust du deiner Familie nicht?«, hiess es etwa. »Wir wissen, was für dich gut ist; wir werden dir immer beistehen.« Oder: »Du setzt die Ehre der Familie aufs Spiel!« – »Einen besseren Mann bekommst du ohnehin nicht.« – »Was werden die Leute sagen, wenn du nein sagst! Es könnte der Verdacht entstehen, dass du dich in einen anderen Mann verliebt hast. Eine Schande wäre das.« Die Mädchen, ohne Bildung und Arbeit, waren völlig von der Familie abhängig. Man gab ihnen zu verstehen, dass sie eine Last waren, welche die Familie so früh als möglich loswerden wollte. Deshalb war es klüger, sich zu fügen.
Heute entscheiden die jungen Menschen meist selber über ihre Heirat. Aber es bedarf im Allgemeinen noch immer des Segens der Familie. Die Heiratsprozedur folgt in einem Dorf wie Birseit weiterhin der Tradition: Nachdem die Heiratswilligen ihren Entschluss der Familie mitgeteilt haben, wird der Termin vereinbart, an dem die Familie des Mannes offiziell um die Hand des Mädchens anhält. Dreissig bis vierzig Männer aus der Familie des Bräutigams besuchen gemeinsam das Haus des Brautvaters, wo sie von ebenso vielen Männern empfangen werden. Nach dem üblichen Begrüssungsritual, bei dem man sich gegenseitig nach Gesundheit und Ernte und nach Neuigkeiten aus dem Dorf erkundigt, bittet der Älteste der Gäste mit einem Hüsteln um Aufmerksamkeit. Er beginnt folgende Rede: »Wir sind heute hierhergekommen, um zu vollziehen, wozu uns Gott berechtigt. Wir möchten, so Gott will, für unseren Sohn um die Hand eurer Tochter bitten. Wir hoffen, dass ihr euren Segen dazu gebt.« Darauf antwortet der Älteste der Brautfamilie: »Das Paar soll gesegnet sein.« Die Mädchen des Hauses lauschen flüsternd und kichernd an der Tür. Kaum ist das Segenswort gesprochen, muss die Braut den Raum betreten und den Männern den bereits vorbereiteten Kaffee anbieten.
Mit diesem Besuch wird die Heiratsabsicht verbindlich gemacht. Das ganze Dorf erfährt nun davon. Der Bräutigam darf die Familie besuchen und mit dem Mädchen ausgehen, aber nur in Begleitung von Familienangehörigen. Die Hochzeitsvorbereitungen beginnen: Der Bräutigam muss Hausrat und Aussteuer anschaffen und für die Braut Goldschmuck kaufen, der ihr als Sicherheit für Notzeiten dienen wird.
Die Hochzeit, zu der das ganze Dorf eingeladen wird, dauert drei Tage. Die Gäste bringen Geschenke, es wird getanzt und getafelt. Am Vorabend der Trauung färben Frauen die Hände der Braut mit Henna, um das Böse zu vertreiben und Glück herbeizuwünschen. Danach wird im Haus des Bräutigams ein Fest gefeiert. Die Braut darf teilnehmen, wenn die Familie es erlaubt, ansonsten bleibt sie mit der Mutter, den Schwestern und Freundinnen zu Hause. Am Hochzeitstag versammeln sich meist unverheiratete junge Männer im Haus des Bräutigams, der von einem Friseur zurechtgemacht und rasiert wird; die Männer singen und tanzen um ihn herum. Danach wird der Bräutigam in einem grossen Zug von tanzenden Menschen bis zur Kirche begleitet. Manchmal folgt ihnen die Brautfamilie, doch erst vor dem Kirchentor wird die Braut dem Bräutigam von zwei männlichen Verwandten übergeben. Nach der Trauung wird das Paar beglückwünscht und verabschiedet, und alle gehen nach Hause.
Die Leute im Dorf waren gespannt, wie wir, die wir im Ausland studiert hatten, unsere Hochzeit gestalten würden. Sie mutmassten darüber, was für ein Kleid und was für einen Schleier ich tragen würde und ob vielleicht einen Hut. Inspiriert von den Diakonissen und beeinflusst vom Studentenleben, zog ich aber Einfachheit und Genügsamkeit vor. So wollte ich kein weisses, europäisches Kleid tragen, sondern die palästinensische Bauerntracht meiner Mutter – war ich doch aus Liebe zu meinem Land und zu meinen Leuten nach Hause zurückgekehrt. Wie hätte ich mich da wie eine Fremde kleiden können!
In einem Punkt jedoch widersetzte ich mich der Tradition: Mein Bräutigam sollte nicht verpflichtet werden, mir Goldschmuck und andere Brautgaben zu überreichen. Es ist meine Überzeugung, dass der Wert einer Frau niemals mit Gold oder Geld aufgewogen werden kann. Ihr Wert liegt in dem, was sie gelernt hat, in ihren Fähigkeiten, ihrem Einsatz für andere Menschen und in ihrer Gabe, Menschen von den Idealen zu überzeugen, für die sie lebt. Die Brautgabe wäre mir wie ein Verrat erschienen.
Meine Mutter war entsetzt und schwor, meiner Hochzeit fernzubleiben. Ich versuchte, ihr meine Haltung verständlich zu machen. Aber sie meinte: »Wenn du keine Ansprüche stellst, werden die Leute sagen, du habest dich zu billig gegeben – und dabei bist du doch diejenige mit der besten Ausbildung!« – »Gerade deshalb«, antwortete ich. »Warum sollte sich Munîr verschulden? Es würde Jahre dauern, bis wir die Schulden abgetragen hätten. Viel klüger ist es, mit diesem Geld ein kleines Haus zu bauen. Ich würde mich schämen, Gold zu tragen. Wozu auch! Ich habe einen Beruf und brauche mich vor Notzeiten nicht zu fürchten.«
Meine ungewohnten Überlegungen lösten in unserem Haus erregte Diskussionen aus, an denen sich alle beteiligten. Sie endeten mit dem Einverständnis der Familie. Nach den vielen Tränen war das für mich eine echte Erleichterung.
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht im Dorf. Gespannt warteten nun alle auf die Hochzeit. Wie es üblich ist, luden wir das ganze Dorf ein. Mit achthundert Gästen hatten wir gerechnet, mehr als zweitausend, auch aus umliegenden Dörfern, kamen. Es wurde ein richtiges Volksfest – ich in der palästinensischen Tracht, Wagen und Kirche geschmückt mit Körben voll wilder Blumen, mit Olivenzweigen, Weizenähren und Granatapfelzweigen. Auf dem Wagendach wehten grüne, rote, weisse und schwarze Bänder – die Farben der palästinensischen Fahne, die von Israel verboten worden war. Für die kurze Strecke vom Haus zur Kirche brauchten wir zwei Stunden. In Kreisen tanzten und sangen Frauen und Männer traditionelle und spontan improvisierte Gesänge. Der traditionelle Stil unserer Hochzeit war Ausdruck der Botschaft, die ich in mir trug: Ich wollte die Verbundenheit mit den Menschen im Dorf spürbar machen, unserer Kultur mit Respekt begegnen und diesen Respekt auch anderen vermitteln. Ich war die letzte Braut in Birseit, die in der palästinensischen Tracht getraut wurde.
Mich wieder ins Dorfleben einzufügen war jedoch nicht leicht. Die Tradition verlangte, an allen fröhlichen und traurigen Anlässen teilzunehmen – an Verlobungen und Hochzeiten, bei Geburten, Tauffesten und bei Todesfällen. Meist ging ich mit Familienangehörigen hin, um zu zeigen, dass der Familienverband intakt war. Oft war das für mich aufreibend: Ich wurde beobachtet und musste mich ständig vorsehen, um nicht ins Gerede zu kommen. Einmal pro Woche war der Besuch bei den Ältesten der Familie Pflicht. Die Schwiegereltern sahen wir täglich. Da es weder eine Alters- noch eine Krankenversicherung gibt, sind die Eltern im Alter völlig auf die Söhne und deren Familien angewiesen. Diese sind verpflichtet, Pflege und Fürsorge der Eltern bis zu deren Tod zu übernehmen.
Gemäss den Regeln der palästinensischen Gesellschaft, die nun auch für mich wieder galten, hatte ich wie jede Frau zu schweigen, wenn Männer zugegen waren. Sie allein führen in einer gemischten Gesellschaft das Wort. Eine Frau, die sich ins Gespräch einmischen will, muss sich mit schriller, aufdringlicher Stimme bemerkbar machen; dies wird ihr jedoch übelgenommen, und der Mann einer solchen Frau erntet von den anderen Männern herablassendes Mitleid. Daran hat sich bis heute nur wenig geändert.
Als meine Schwester ein Jahr nach mir aus Deutschland zurückkehrte und heiratete, unterstützte ich sie in ihrem Entschluss, wie ich auf das Festessen zu verzichten, zu dem jeweils eine Woche nach der Hochzeit vierzig Personen aus beiden Familien ins Haus der Brauteltern eingeladen werden. Dieser Verzicht hatte für meine Schwester unangenehme Konsequenzen. Unsere Familie habe der eigenen Tochter gegenüber keinen Respekt gezeigt, behauptet die Schwiegermutter noch heute, und deshalb verdiene sie auch in der Familie des Ehemannes keinen Respekt. Seit achtzehn Jahren ist meine Schwester nun verheiratet und muss sich noch immer derart beleidigen und kränken lassen.
Sich von den Schwiegermüttern zu distanzieren ist fast unmöglich. Oft mischen sie sich in alle Angelegenheiten ein. Damit im Haus Frieden herrscht, muss die Schwiegertochter stets nachgeben. Andernfalls gibt es Streit mit ihrem Mann, der sich verpflichtet fühlt, in erster Linie seine Mutter zufriedenzustellen. Zum Glück gibt es auch Schwiegermütter wie die meine, die sich niemals einmischt und für das Haus ein Segen ist.
Um die Kraft zu haben, mit allen Widersprüchen und Problemen des Lebens zwischen Tradition und westlichem Lebensstil zurechtzukommen, schien uns ein eigenes gemütliches Zuhause wichtig. Es sollte ein Ort sein, wo wir allein, ohne Schwiegereltern und nach unseren eigenen Regeln leben konnten. Wir nahmen ein Darlehen auf und begannen gleich nach der Heirat mit dem Bau eines kleinen Hauses. Zur Geburt unseres Sohnes Anîs zogen wir ein. Jetzt sahen die Leute im Dorf ein, dass ich klug gehandelt hatte, als ich auf die Brautgabe verzichtete, und sie lobten unser Vorgehen. Ich hoffte, andere Frauen würden es nun ebenfalls wagen, auf die Brautgabe zu verzichten. Doch solange sie keinen Beruf haben, fehlt ihnen dazu die Sicherheit.
Während der ersten Jahre nach der Heimkehr ins Dorf fühlte ich mich in unseren vier Wänden sehr glücklich. Ein Jahr nach Anîs kam unser zweites Kind, Ghâda, zur Welt. Gemeinsam mit meiner Familie genoss ich die Natur und das einfache Leben. Oft wanderten wir ins Tal hinunter oder zum Olivenhain jenseits des Dorfes, wo wir Terrassen bauten, Steine wegräumten und die Bäume pflegten. Doch wurden wir unweigerlich auch jedes Mal, wenn wir das Haus verliessen, mit den Problemen konfrontiert, die durch die israelische Besatzung entstanden waren.
Es dauerte lange, bis ich mich an die ständige Militärpräsenz gewöhnt hatte. Im Dorf und in der unmittelbaren Umgebung erschreckten uns israelische Soldaten immer wieder mit grossangelegten militärischen Übungen, bis 1975 der palästinensische Widerstand sie daran hinderte. Manchmal wurden die Soldaten von Hunderten israelischer Zivilisten begleitet, die mit der israelischen Fahne durch unser Dorf zogen und patriotische Lieder sangen. Wir fühlten uns provoziert und erdrückt zugleich.
Mehrmals täglich fuhren Soldaten auf ihren Jeeps durchs Dorf, hielten junge Männer an und kontrollierten ihre Papiere. Kurz nach unserer Heimkehr stand mein Bruder Bassâm eines Abends mit Freunden an der Strassenecke vor der