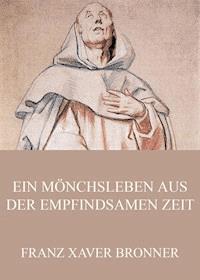
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Von 1782 bis 1785 war der Schweizer Dichter und Publizist Bronner Mitglied des Illuminatenordens. Aus dieser Zeit erzählt diese Autobiographie.
Das E-Book Ein Mönchsleben aus der empfindsamen Zeit wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1116
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Mönchsleben aus der empfindsamen Zeit
Franz Xaver Bronner
Inhalt:
Franz Xaver Bronner – Biografie und Bibliografie
Ein Mönchsleben aus der empfindsamen Zeit
Einleitung.
Erstes Kapitel - Früheste Kindheit.
Zweites Kapitel - In der Klosterschule und beim Kantor.
Drittes Kapitel - Seminarist in Dillingen.
Viertes Kapitel - Student in Neuhaus.
Fünftes Kapitel: - Novize in Donauwörth.
Sechstes Kapitel: - Der Pater Bonifacius.
Achtes Kapitel - Wieder im Kloster.
Neuntes Kapitel - Auf der Flucht nach der Schweiz.
Zehntes Kapitel - Notensetzer in Zürich.
Zweiter Band
Elftes Kapitel - Reise und Empfang in Augsburg.
Zwölftes Kapitel - Im Konvikt zu Dillingen.
Dreizehntes Kapitel - Kanzleigeschäfte und Liebschaften.
Vierzehntes Kapitel: - Registratur und geistliche Kämpfe.
Fünfzehntes Kapitel - Ewiger Betrug und neue Fluchtpläne.
Sechzehntes Kapitel - Zweite Flucht nach der Schweiz.
Siebzehntes Kapitel - Wieder in Zürich.
Achtzehntes Kapitel - Als Patriot in Frankreich.
Ein Mönchsleben aus der empfindsamen Zeit, F. X. Bronner
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849605476
www.jazzybee-verlag.de
Franz Xaver Bronner – Biografie und Bibliografie
Idyllendichter, geb. 23. Dez. 1758 zu Höchstädt im bayrischen Kreis Schwaben und Neuburg von armen Eltern, gest. 12. Aug. 1850 in Aarau, war anfangs Mönch, entfloh 1784 aus dem Kloster, führte nun ein sehr wechselvolles Leben und erhielt endlich eine Lehrerstelle in Aarau, die er 1810 mit einer Professur in Kasan vertauschte. 1817 nach Aarau zurückgekehrt, begann er seine frühere Wirksamkeit als Lehrer an der Kantonschule wieder, trat 1820 zum Protestantismus über und bekleidete seit 1830 die Stelle eines Regierungssekretärs, Archivars und Bibliothekars daselbst. In seinen letzten Jahren erblindet, starb er, fast 92 Jahre alt. Er schrieb in Geßners Art die Idyllen: »Fischergedichte und Erzählungen« (Zür. 1787) und »Neue Fischergedichte« (das. 1794, 2 Bde.); außerdem: »Der erste Krieg, in sechzig metrischen Dichtungen« (Aarau 1810, 2 Bde.); »Luftfahrten ins Idyllenland« (das. 1833, 2 Bde.); »Der Kanton Aargau, historisch-geographisch-statistisch geschildert« (St. Gallen 1844–45, 2 Bde.) und eine Geschichte seines Jugendlebens (Zür. 1795–97, 3 Bde.; neue Aufl. 1810).
Ein Mönchsleben aus der empfindsamen Zeit
Einleitung.
In dem doppeldeutigen Titel »Dichtung und Wahrheit«, den Goethe seiner herrlichen Selbstbiographie gegeben hat, hat er zugleich die zwei Pole festgelegt, nach denen hin Memoirenwerken und Biographien überhaupt wirkliche Bedeutung zuzukommen vermag. Die einen von ihnen sind vornehmlich interessant nach der Seite der Wahrheit hin, durch das Inhaltliche und Gegenständliche, das sie vorbringen, seien es nun weltgeschichtliche Ereignisse, seltsame Abenteuer oder kulturelle Merkwürdigkeiten, die anderen dagegen sind bedeutsam nach der Seite der Dichtung hin, durch Stil und künstlerische Darstellung, durch die Art dichterischer Durchdringung des Stoffes, durch die Fülle des poetischen Gehalts, der in dem Werk Gestalt gewonnen hat, und durch den auch anscheinend unwichtige und alltägliche Begebenheiten verklärt werden.
Die vorliegende Autobiographie von Franz Xaver Bronner, die aus dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts stammt, gehört ihrer wesentlichen Bedeutung nach durchaus zur Gattung der letzteren, wenn dies auch in diesem Falle keineswegs dahin verstanden werden darf, als ob sich hier der Verfasser dichterische Ausschmückungen und phantasievolle Willkürlichkeiten auf Kosten der Wahrheit erlaubt hätte. Im Gegenteil! Die ungeschminkte Wahrhaftigkeit alles dessen, was erzählt ist, ist ein bedeutsames Charakteristikum dieser Biographie. Trotzdem aber nicht ihr wesentlichstes; denn es sind keine großen Ereignisse, von denen uns darin berichtet wird – der Dichter selbst wollte sie im Untertitel allzu bescheiden »alltägliche Abenteuer eines unbedeutenden Menschen« nennen – was uns hingegen hier allein durch die poetische Verarbeitung der Geschehnisse vermittelt wird, das ist die Gefühlswelt einer ganzen Epoche, nämlich die der empfindsamen Zeit. So wenig die Gefühlswerte dieser Periode schon gänzlich der Vergangenheit angehören, wie verschiedentliche Erneuerungs- und Anknüpfungsversuche moderner Dichter beweisen, so unzugänglich oder wenigstens schwer genießbar sind für uns die Produkte dieser Zeit selbst; denn die ganze Idyllen- und Schäferpoesie, die uns in ein schönes Arkadien führen will, um uns den schwärmerischen Herzensergüssen von Daphnis und Chloe, von Damon und Phyllis lauschen zu lassen, sie vermag heute wohl schwerlich mehr jemand in lebendigem Sinne zu fesseln. Den Dichtern dieser Periode, auch ihrem besten Vertreter, dem Schweizer Salomon Geßner, mangelte es eben durchaus an der Fähigkeit, Menschen zu gestalten; ihre Personen haben kein Mark und Bein, es sind verzuckerte Schäfer und Schäferinnen ohne alle Individualität, Schattenwesen ohne jede Wirklichkeit, dazu vollbepackt mit süßen Empfindungen, überladen mit schönen Gefühlen. Auch Fr. X. Bronner, ein direkter Schüler und persönlicher Bekannter Geßners, zu welchem, als dem für ihn geeignetsten Lehrer, ihn eine seltsame Fügung des Schicksals aus Bayrisch-Schwaben verschlagen hatte, auch er würde wohl als Verfasser von empfindsamen Idyllen und Fischergedichten und als ein später Ausläufer dieser Dichtungsart (bis ins neunzehnte Jahrhundert hinein) lediglich eine historische Rolle in den Literaturgeschichten spielen, hätte er nicht diese Autobiographie verfaßt, die nicht nur von seinen Werken bei weitem das Beste ist, sondern auch nahezu das Einzige, das uns heutigen noch einen mühelosen, ja sogar in jeder Hinsicht lohnenden und ergötzlichen Zugang zu der Empfindungsweise dieser eigenartigen Welt zu verschaffen vermag. Denn hier hoben die besonderen Bedürfnisse der Dichtungsgattung, wenn man Biographien so nennen darf, von vornherein die Nachteile einer unwirklichen Schilderung auf, der die Dichter sonst verfielen, und forderten geradezu strengen Wirklichkeitssinn und bestimmte Charakterisierung, während andererseits die guten Seiten der Zeit, innige Gefühlswärme und anmutigste idyllische Kleinmalerei nun auf diesem tragfähigeren Untergrund viel stärker und intensiver zur Geltung kommen konnten. So entstand ein Werk, das auf uns keineswegs mehr einen gesuchten und befremdlichen Eindruck macht, sondern im Gegenteil ganz natürlich und ungezwungen wirkt, wenn auch natürlich der Zeitcharakter und die starke Betonung der empfindsamen Note dem Ganzen ein etwas altertümliches Gepräge verleihen.
Allerdings so gering, wie sie nach dem Bisherigen vielleicht erscheinen könnte, darf die Bedeutung des rein Inhaltlichen in diesen Memoiren doch nicht gewertet werden. Sind es im allgemeinen auch keine großen, spannenden Ereignisse, durch die wir gefesselt werden, so sind es doch menschlich so interessante Einblicke, die wir in das private, öffentliche und vor allem religiöse Leben des achtzehnten Jahrhunderts tun, sind es kulturgeschichtlich so bedeutsame Zustände, die geschildert werden, daß sich eine Neuausgabe schon von diesem Gesichtspunkt aus lohnen würde. Da ist es einmal das ganze, zum Teil noch recht mittelalterliche Leben in einem kleinen Städtchen, das uns mit reizenden Details lebendig gemacht wird und das in manchem noch dem heutigen gleichen mag; besonders interessant sind die für unsere Begriffe ganz haarsträubenden Schulverhältnisse unter des Herrn Kantors Leitung, wo kaum ein Tag verging, an dem nicht die berüchtigten »Schillinge« mit der oft noch durch Bleikugeln verstärkten Ochsensehne verabreicht wurden usw. Dann lernen wir das Zwangssystem in den geistlichen Seminarien und Konvikten kennen, die die Stätten der höheren Bildung vorstellen sollten, des ferneren die Wirkungen der geheimen Ordenschaften, die damals eine große Rolle spielten, vor allem der Freimaurer und der Illuminatisten. Die weitaus wichtigsten und wertvollsten Aufschlüsse gewährt jedoch die Darstellung des gesamten Klosterlebens, das Bronner vom Novizen bis zum Pater mit all seinen Mühsalen und geheimen Leiden durchgekostet hat, bis er sich endlich entschloß, sein Heil in der Flucht zu suchen. Da sehen wir ewige Parteisucht, Hader und Zank unter den Mönchen, verborgene Unzucht und Völlerei, das zur stumpfen Gewohnheit herabgesunkene Begehen der religiösen Riten, wozu vor allem das gedankenlose Ableiern der Chöre gehört, die den ewigen Kampfplatz für den Streit zwischen den Alten und den Jungen bilden, die Unterdrückung jeder Bildung in einem etwas freiheitlichen Sinne, all das wird mit anschaulichen Einzelheiten uns vor Augen geführt und einer strengen, wenn auch keineswegs gehässigen Kritik unterzogen. Von da aus werden dann die Schäden der gesamten Kirche aufgedeckt, wir tun tiefe Einblicke in die geistlichen Streitigkeiten der damaligen Zeit, insbesondere in die Schwindeleien und Betrügereien der Jesuiten, die immer das Mäntelchen nach dem Winde zu hängen verstehen. Die vielen dazwischen eingestreuten, genauen Reisebeschreibungen vermögen nebenher manche Kenntnisse über die damalige Art zu reisen zu vermitteln, und eine abenteuerreiche Tour nach Frankreich, die Bronner unternahm und die ihn fast unter die Guillotine gebracht hätte, führt uns schließlich mitten in die große Umsturzzeit und den Kriegstumult der französischen Revolution.
Also an sich genug des stofflich Anregenden! Aber trotz dieser interessanten und abwechslungsreichen Fülle würde derjenige doch das Buch schlecht gelesen haben, der nur nach jenem suchend und haschend es durchblättert hätte, ohne von den feinen und zarten Reizen der Darstellung, die hier durchweg zu finden sind, etwas zu empfinden, ja ohne geradezu von ihnen gefangen genommen zu werden; denn auf diesen liegt durchaus der Hauptwert und der Hauptnachdruck. Wieviel geringfügige, unbedeutende, ja anscheinend nichtssagende Begebenheiten sind hier eingestreut! Alle heimlichen Kinderspiele, alle Knabenunarten, alle kleinsten Vorkommnisse werden hier berichtet; aber wie werden sie erzählt! Entkleidet aller banalen Wirklichkeit, ganz erfüllt von dichterischer Anschauung und durchtränkt vom Zauber echtester Poesie! Es ist ein einheitlicher Geist, von dem aus alles gesehen wird und durch den alle Einzelheiten in den höheren Zusammenhang eines wenn auch nicht sehr umfassenden, so doch geschlossenen Weltbildes eingefügt werden. Gewiß war Bronner kein Feuergeist, der sich zu den Himmelshöhen höchster Begeisterung aufschwang oder in die Tiefen menschlicher Erkenntnis hinabstieg, sondern eine durchaus einfache, unkomplizierte Natur, harmonisch, ausgeglichen, schon als Knabe festgelegt in seinem Verhältnis zur Welt, nur durch einen klugen Verstand und die Stärke dichterischer Empfindung über das gute Mittelmaß hinausragend; dafür besaß er ein überreiches, außerordentlich sensitives Gemüt und eine feine Knabenseele, auf deren Goldgrund sich die Dinge der Welt mit unvergleichlicher Anmut und in zartester Lieblichkeit abmalten. So gilt seine ganze Liebe und Hingabe dem Kleinen und Kleinsten, in das er sich voller Innigkeit vertieft wie ein Kind, und das er bei aller Sachlichkeit und Schlichtheit der Darstellung mit all der süßen Inbrunst wiederzugeben weiß, mit der er es erfaßt hat. Und welche Naivität und echteste Kindlichkeit ist ihm dabei zu eigen! Welch' goldenes Kindergemüt leuchtet aus all seinen idyllischen Schilderungen hervor! Unwillkürlich denkt man an die einzig süße und wonnigliche Art, mit der die alten deutschen Meister auf ihren Gemälden die ganze Kleinwelt, Blumen, Gräser, Vögel, Quellen dargestellt haben, man denkt an Cranachsche spielende Putten, an Lochnersche Engelfiguren, aber auch mancher Holzbeinsche Kopf läßt sich in ernster Strenge dazwischen blicken. Diese wunderbare Vertiefung und Versenkung in den Mikrokosmos, eine spezifische Eigenart deutschen Geistes, hat in Bronner eine neue, bedeutsame Verkörperung gewonnen und hebt ihn allerdings gewaltig über die bloß empfindsamen Dichter hinaus, denen selten ganz natürliche Herzenstöne gelangen.
Nebenbei mag bemerkt werden, daß Bronner ja auch dem Volk entsprossen ist, in dem die idyllische Betrachtungsweise sozusagen Erbgut des Stammes ist, nämlich dem schwäbischen, und seine späteren Landsleute, ein Mörike, ein Kerner, ein Carl Mayer, sie würden wohl, hätten sie ihn gekannt, großen Gefallen an seiner Art gefunden haben, die so manche verwandte Züge mit ihnen aufweist.
Gewiß ist, daß mit all diesen Eigenschaften Bronners Biographie insofern eine Ausnahmestellung einnimmt, als nur schwerlich eine andere gefunden werden könnte, die sich mit ihr eben an echter Kindlichkeit und Naivität der Auffassung messen kann. Ebenso ist es kein Zufall, daß innerhalb derselben, wenigstens was die Darstellung anlangt, die Erzählungen aus der frühen und frühesten Jugend am meisten gelungen sind und das eigentliche Glanzstück bilden, so sehr, daß man diese Kindheitsgeschichte als eine der schönsten und lieblichsten ansprechen muß, die wir überhaupt in der deutschen Sprache besitzen. Hier fand Bronner sein eigentliches Feld; denn hier war natürlich die kindlichste Anschauung gerade die beste, weil sie allein in die rätselvollen Geheimnisse und die ahnungsvollen Gründe, die das Paradies der Kindheit birgt, einzudringen vermag und sich ganz deckte mit den Empfindungen, die dargestellt werden sollten; späterhin ist hingegen öfters leichte Diskrepanz zu spüren zwischen der kindlichen Schilderung und dem Bewußtsein des Lesers, daß es sich hier um die Erlebnisse und Gefühle eines erwachsenen Mannes handelt. Außerdem treten im weiteren die empfindsamen Elemente stärker in den Vordergrund und verleihen dem Ganzen einen etwas veränderten Charakter, der sich für unser Gefühl manchmal ins Barock-Seltsame, ja oft ins Komische steigert, wie etwa in den Liebesszenen, wo bei aller Lieblichkeit der Erzählung denn doch des Schmachtens und Schwärmens oft ein wenig zu viel wird.
Merkwürdig ist, daß bei einer so klar umrissenen Gesamteinstellung zur Welt und zum Leben, bei einer im allgemeinen so selten ausgeglichenen Denk- und Empfindungsweise, wie sie Bronner besaß, doch gewisse Kräfte in seinem Charakter tätig waren, die einander mehr oder weniger entgegenarbeiteten. Auf zwei Angelpunkten ruhte neben seiner dichterischen Einstellung eigentlich sein Wesen: der eine war ein heller Verstand, der die Welt vernünftig zu erklären suchte und innerhalb der gänzlich anderen Umgebung, in die er gestellt war, notwendig aufklärerisch und revolutionär sich entwickeln mußte. Dem stand entgegen seine seltene Weichheit des Gemüts, eine fast feminine Sanftmut, äußerste Bescheidenheit, Herzensgüte und Menschenliebe. Hätte er die letzteren Eigenschaften nicht oder nur beschränkt besessen, er würde vielleicht als ein Mann der Aufklärung eine ziemliche Rolle gespielt haben; so aber mußten, da ihm alle inneren Möglichkeiten zu einer brutalen Durchsetzung der Ideen sowohl, wie auch seiner selbst abgingen, alle revolutionären Gedanken in sich selbst zerfallen, und es blieb ihm nur übrig, sie in passiver Weise auf die eigene Person anzuwenden, indem er den Menschen und Verhältnissen, die er haßte, auszuweichen und zu entfliehen suchte. Das Gegenspiel dieser beiden Kräfte können wir durch seine ganze Biographie verfolgen. Schon mit achtzehn Jahren, als er ins Kloster sollte, bezeigte er den heftigsten Widerwillen dagegen, aber seine Sanftmut ließ ihn den drängenden Wünschen der Eltern, wenn auch unter Tränen, nachgeben. Einmal dort, prüfte er gleich als Novize das katholische Religionssystem nach allen Seiten, verwarf mit kühnem Freimut, wenn auch auf ziemlich rationalistische Art, eine Lehre um die andre, und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem richtigen Lutheraner, der alle äußeren Formen, wie Wallfahrten, Messelesen, Beichtsitzen, Reliquienverehrung als Irrlehren betrachtete und allein die gute und reine Gesinnung vor Gott gelten ließ. Kein Wunder, daß er sich später offen zum Protestantismus bekannte. Daß bei solcher Denkart das Kloster nicht der richtige Aufenthalt für ihn war, ist klar, aber erst ein äußerer Anlaß, die Eifersucht wegen eines Mädchens, ließ ihn nach langem Zögern die Flucht wirklich zur Ausführung bringen. Allein kaum war ein Jahr vergangen, so stand er freiwillig schon wieder unter der Botmäßigkeit der Kirche, die er innerlich doch verurteilte, und wurde von ihren Vertretern in der schmählichsten Weise betrogen und hintergangen, ohne daß er die Kraft gehabt hätte, sich dagegen zu wehren; es dauerte endlos lange, bis er sich diesem unwürdigen Zustand durch eine zweite Flucht entzog, da ihn immer wieder gewisse Rücksichten auf Personen, denen er nicht weh tun wollte, und denen er Dankbarkeit schulden zu müssen glaubte, zum Bleiben bestimmten (am rührendsten ist in dieser Hinsicht sein Verhältnis zu dem geistlichen Statthalter v. Ungelter). Die neugewonnene Freiheit dachte er zuerst am schönsten als Einsiedler zu genießen, sein aufklärerischer Drang ließ ihm aber keine Ruhe und bewog ihn zu einer Reise nach dem revolutionären Frankreich, das er sich, etwas vorschnell urteilend, als das gelobte Land der persönlichen Freiheit und der idealen Staatsverfassung vorstellte, und in dem er alle seine Ideen aufs schönste verwirklicht glaubte. Der kurze Einblick, den er tat, brachte ihm denn auch gleich so herbe Enttäuschungen, daß er völlig an der Durchführung seiner Pläne verzweifelte und sich beeilte, zu einer Privatbeschäftigung in seine geliebte Schweiz zurückzukehren.
Neben den Wirkungen seiner mönchischen Lebensart mag es dieser Zwiespalt in seinen Wesenskräften gewesen sein, aus dem sich das leicht schrullige und etwas sonderliche Wesen entwickelte, das mitunter, wenn auch nicht gerade häufig, bei ihm zutage tritt; denn er war ein bißchen, was man so nennt, ein Eigenbrödler und Umstandskrämer, sehr menschenscheu, bei starkem Bedürfnis nach Gesellschaft, schüchtern und bescheiden in seinem Auftreten, aber doch auf seine Art seinen Vorteil erspähend, äußerst vorsichtig, ja furchtsam bis zur Feigheit in seinen Unternehmungen, langsam in seinen Entschlüssen, dann aber wieder eigensinnig und zäh in der Durchführung derselben. Aber wie gesagt, es ist nur wie ein leichtes Hinneigen nach dieser Seite, und gewiß ist ein gut Teil davon der damaligen Empfindungsweise überhaupt zuzuschreiben. Denn sonst war er sehr heiteren und beweglichen Geistes, interessierte sich für alles mögliche, studierte beinah alles, was es damals zu studieren gab, Mathematik, Philosophie, Theologie, Literatur, Naturwissenschaften, Musik usw. und war in allen diesen Fächern auch irgendwie tätig. Ja selbst ganz moderne Anwandlungen hatte er: er konstruierte für sich elektrische Maschinen, stellte Versuche zu einem Perpetuum mobile an und ging sogar – was für uns Heutige von besonders akutem Interesse ist – allen Ernstes an den Bau eines Aeroplans, der allerdings recht kläglich mißglückte und ihn nie höher als einen Schuh über den Erdboden emporbrachte. Schließlich verschlug ihn sein Geschick in der Schweiz noch unter die Journalisten, indem er bald nach seiner Rückkehr aus Frankreich die Redaktion der Züricher Zeitung übernahm. Mit dieser Mitteilung schließt die Biographie ab. Aber die Reihe der Ämter und Tätigkeiten war für Bronner damit noch nicht erschöpft. Nach Gründung der helvetischen Republik wurde er Sekretär beim Ministerium der Künste und Wissenschaften, dann Professor in Aarau; durch einen seltsamen Entschluß siedelte er 1810 als Professor der Physik nach Kasan in Rußland über, kehrte jedoch 1817 nach Aarau zurück, wo er zum Protestantismus übertrat; hernach ward er Rektor der Kantonschule, Kantonsbibliothekar und Staatsarchivar. Im hohen Alter von 92 Jahren starb er am 11. August 1850.
Die vorliegende neue Ausgabe (die erste seit 1810) fußt auf der ersten Auflage von 1795-97. Allerdings mußte mannigfach gekürzt und zusammengestrichen werden, um das Werk für uns Heutige genießbar zu machen; denn es enthält viele ermüdende Längen, unter denen die künstlerische Einheitlichkeit sichtlich zu leiden hat. Schon Geßner, der im Grunde die Ausführlichkeit liebte und der Bronner sonst sehr schätzte, tadelte an ihm die allzu große Breite der Behandlung, und was für ihn störend war, wird für uns unerträglich. Es sind dies vor allem die seitenlangen Gebete, die in aller Vollständigkeit mitgeteilt werden, ebenso die endlosen Korrespondenzen, vielfache Wiederholungen und nicht zuletzt die vielen moralisierenden Betrachtungen, die überall eingestreut sind. Trotzdem ziemlich viel davon fallen mußte, ist eigentlich nichts dichterisch oder biographisch Wesentliches unterdrückt worden, vielmehr glaube ich, daß sich die Wirkung des Ganzen durch die knappere Zusammenfassung nur um ein gutes erhöht hat.
München, August 1912.
Oskar Lang.
Erstes Kapitel - Früheste Kindheit.
Mein Geburtsort – Eltern und Voreltern – Des Vaters Kampf mit der Armut – Erste Kindheit – Die fernsten Erinnerungen – Meine Brüder – Das Echo – Die Nachbarn – Meine erste Lüge – Fernere Erziehung – Erste ländliche Freuden – Ein Dieb und Betrüger, schon so jung – Sparbüchse – Zank und Trennung in der Familie – Taubheit.
Mein Geburtsort ist das Städtchen Höchstädt, im Fürstentume Pfalz-Neuburg, an der nordöstlichen Grenze von Schwaben, etwa eine Achtelmeile vom Ufer der Donau. Auf den nahen Ebenen erfocht der Marschall von Villars mit dem Kurfürsten von Bayern, den 20. September 1703, einen Sieg über die Kaiserlichen; im folgenden Jahre aber, den 13. August, gewann daselbst Marlborough mit dem Prinzen Eugen die berühmte blutige Schlacht, in welcher der unglückliche Marschall von Tallard, nebst zwölftausend seiner Veteranen, zu Blintheim, einem Dorfe, das eine halbe Meile weiter hinabwärts an der Donau liegt, gefangen genommen ward.
In einem Hohlwege, zunächst an der Vorstadt von Höchstädt (die alte Stadt genannt) ist ein Begräbnisplatz, wo eine Menge im Treffen Gefallener beisammen verweset. Als Knabe stand ich oft am steilen Abhange des Hohlweges, staunte die unzähligen Gebeine an, die da, bunt durcheinander geworfen, aus lockerem Lehm hervorstarrten, und versuchte zu erraten, ob mehr Deutsche oder mehr Franzosen hier begraben lägen; denn wir hielten die weißen Gebeine für die schwächern, also für französische, die gelblichen aber für die stärkeren oder für deutsche. Seitdem baute man dort eine bequemere Landstraße und grub den Totenhügel ab; aber sein Bild bleibt tief in meine Seele geprägt.
Im untern Teile des Städtchens, nicht fern vom Schlosse, dem ehemaligen Witwensitze der Herzoginnen von Neuburg, führte eine kleine Gasse den Hügel hinan, auf dem ein Nonnenkloster mit seinen geräumigen Gärten steht, das jetzt, nachdem die Nonnen vom Carmelitenorden teils ausgestorben, teils vertrieben sind, ein gewisser Herr Sack zum Eigentum erhalten hat. Am Abhang dieses Hügels birgt sich hinter einem umarmenden Rebstock, der schon mehrere Menschenalter hindurch seine Eigentümer mit Trauben gelabt hat, der Giebel eines halben Häuschens, in dem ich geboren ward, und das noch jetzt mein lieber Vater einsam bewohnt. Ein niedriges Ziegeldach, das sich bis zu den kleinen Fenstern beschattend herabsenkt, ein Gärtchen, etwa so groß als ein kleines Zimmer, eine baufällige Hütte daran, die einst die Dienste einer Scheune und Stallung tat, und ein enger Hofraum vor dem Eingange – machen das Bild der prächtigen Residenz vollständig.
Auf Reichtum, Ruhm und großes Ansehen meiner Vorfahren kann ich gewiß niemals stolz werden; denn alle waren arm, unbekannt und von der niedrigsten Herkunft. Meines Vaters Eltern, Georg und Lenore Bronner, kamen von dem Dorfe und Frauenkloster Maria-Mädingen, unweit Dillingen (wo sie, wie ihre Voreltern, Ziegler waren), nach Höchstädt, um auch da auf dem Ziegelstadel, dessen wahrer Eigentümer die Stadt ist, für einen bestimmten Jahrlohn die Ziegel- und Kalkbrennerei zu besorgen. Beide kannte ich noch; aber wenn wir Kinder sie zu besuchen kamen, achteten sie kaum unsrer Gegenwart, waren etwas rauh und unfreundlich, und so schieden wir immer kalt und unbekannt voneinander. Sie hatten vier Söhne, Georg, Hans, Jakob und Anton nebst einer Tochter Lenore. Hans, mein Vater, war der zweitgeborene. Georg, sein ältester Bruder, der auch Ziegler in Höchstädt ward, starb schon vor einigen Jahren und machte dem jüngsten ( Anton) Platz, der hierauf an seine Stelle kam. Jakob, der dritte, ist ein Rotgerber. Lenore heiratete einen Ziegler zu Wallerstein und liegt bereits begraben.
Die geringen Einkünfte der Großeltern erschwerten es ihnen sehr, diese fünf Kinder groß zu ziehen, und zwangen sie, so eingeschränkt und geringe wie möglich zu leben, und ihre Kleinen schon in der frühestesten Jugend zur strengsten Arbeit anzuhalten. Als Knabe fuhr mein Vater mit seinen Brüdern, wenn morgens im Winter die Eltern noch schliefen, und die Kleider nicht ohne sie zu wecken aus der Wohnstube geholt werden konnten, öfters mit bloßen Füßen und im Hemde auf Handschlitten den beschneiten Hügel hinab, auf dem der Ziegelstadel vor dem oberen Tore steht; und öfters mußte er im Frühling und im Herbste barfuß den Lehm treten und durcheinander kneten, über den eine Eishaut gefroren war: so wenig durfte er die Kälte achten.
Georg, Antonund mein Vater lernten bald die Geige, die Querflöte und den Baß spielen und verdienten sich in den Wirtshäusern der Gegend als Spielleute manchen Gulden. Bei lustigen Gesellschaften hieß es oft: »Laßt die Ziegler-Kompagnie holen!«
Mein Vater hatte das Unglück, von seinen Eltern verachtet zu werden; denn er schien ihnen nicht gewandt genug und allzu ängstlich. Einst ging er abends spät nach Hause; da fand er ein junges Schwein, das sich von der Herde verlaufen hatte, und trieb es, weil die Stadttore bereits gesperrt waren vor sich hin, um es die Nacht über im Ziegelstadel aufzubewahren, und morgens dem Eigentümer zurückzustellen. Seine Eltern kannten das Schwein und wußten, daß es dem reichsten Gastwirte in Höchstädt zugehörte. Dieser Umstand, ihre Armut, die höchste Wahrscheinlichkeit, unentdeckt zu bleiben, und die Meinung: Armen eine Nadel stehlen sei Todsünde, aber Reichen einige Gulden nehmen sei kaum eine bösliche Vergehung, – alles dieses zusammen machte die Versuchung so stark, daß ihr die armen Großeltern unterlagen, das Tier in ihren Stall sperrten und allen ihren Kindern strenge verboten, keinem Menschen etwas von dem gemachten Funde zu sagen, Hans mochte einwenden, was er immer wollte; bei dem einmal gefaßten Entschlusse blieb es, und er mußte das Schwein, nachdem es ein paar Wochen gemästet war, abschlachten und mit Appetit verzehren sehen. Aber mein guter Vater hütete sich wohl, einen Bissen davon zu genießen, und verkroch sich, so oft ein Stück davon auf den Tisch kam, hinter den Ofen oder in die Kammer, wo er dann das Gespötte seiner Brüder ward. Sein ängstliches Gewissen regte sich täglich mehr und mehr und ließ ihm keine Ruhe, bis er endlich im Beichtstuhl einem Kapuziner den ganzen Hergang erzählte. Aber wie erschrak er, als er statt des gehofften Trostes die Worte vernahm: »Du gottloser Sünder, du mußt das Schwein bezahlen; es ist unmöglich, dir die Lossprechung zu erteilen, ehe du mir das Geld dafür eingehändigt hast!« Ein ungerechtes, überaus strenges Urteil! Denn mein Vater, der etwa das fünfzehnte Jahr erreicht haben mochte, hatte weder Geld noch Verdienst. Aber alle seine Einwendungen fruchteten nichts; er mußte versprechen, so lange alle Kreuzer zusammenzuhalten, bis die Summe voll sein würde, auf welche der Kapuziner das Tier, der Beschreibung gemäß, taxiert hatte. Und mein Vater versprach es und sparte jede Kleinigkeit zusammen, die er etwa geschenkt bekam, oder mit Aufsetzen auf Kegelbahnen und durch andre kleine Arbeiten verdiente. Oft saß er damals in einem Busche und weinte bittere Tränen, wenn er rund um sich her alles so vergnügt sah, jeder andere Knabe Obst oder geräucherte Würstchen oder Bier genoß, und er allein trauern und darben mußte. Über anderthalb Jahre quälte er sich mit der Vergütung des nie begangenen Diebstahls, um dem Befehle seines Beichtvaters pünktlich Genüge zu leisten: und als er endlich die schwererworbene Summe beisammen hatte und sie dem Kapuziner darreichte, so sprach dieser: »Der reiche Eigentümer hat jetzt seinen Verlust schon längst verschmerzt; es wird besser sein, wenn ihm eine Vergütung dafür durch geistliche Mittel zukommt; ich will also das Geld zu Messen für ihn verwenden.«
Dieser Vorfall, und besonders die lang anhaltende Bekümmernis – der Vergütung wegen, brachte in den ohnehin etwas melancholischen Charakter meines Vaters eine gewisse Düsterheit, die sich nie wieder ganz verlor. Wenn er betete, so war es mit vieler Ängstlichkeit und Anstrengung: Wie hätte auch ein schuldloser Knabe Gott nicht als einen strengen Richter mit Schüchternheit anrufen sollen, dessen vorgebliche Statthalter, die Beichtväter, ihn so überaus strenge und unerbittlich behandelten? Leute, die nahe bei ihm knieten, hörten ihn manchmal das Vaterunser wiederholt von neuem anfangen und abbrechen mit dem Beisatze: »Es ist noch nicht recht!« Und er hatte keine geringe Arbeit, bis er mit seinem Rosenkranze zu Ende war. Beim Morgen- und Abendgebete, wenn er es allein verrichtete, betrug er sich ebenso. Aber wenn er mit uns Kindern betete, so merkte man nichts von skrupulöser Ängstlichkeit an ihm. Auch hat er sich dieselbe nach und nach immer mehr abgewöhnt. Allein das Mißtrauen gegen die Geistlichkeit verlor sich nie ganz aus seiner Seele, besonders da es von Zeit zu Zeit neue Nahrung erhielt, indem ihn die Mutter einigemal wegen Unfriedlichkeit in der Ehe bei Geistlichen verklagte, die dann ihre Partei nahmen und dem Vater mit manchem Verweise beschwerlich fielen, öfters äußerte er sich: »Ach, wir sind gewiß in vielen Stücken betrogen!«
Der Vater meiner Mutter hieß Anton Brucker, war ein Zimmermann und hatte in seiner Jugend sehr gern Mesnersdienste auf den umliegenden Dörfern, vorzüglich in Lutzingen und Unterglauheim, getan. Oft erzählte er mir mit einer gewissen Selbstgefälligkeit, daß er dort die Vesper mit den Geistlichen gesungen hätte, und setzte dann allemal bei: »Gottes Lob singen, ist ein Geschäft der Engel.« Er war ein kleiner, friedliebender, zufriedener, frommer und fleißiger Mann, der ruhig und wegen der Zukunft unbekümmert dahinlebte, seine Arbeit genau verrichtete und gar gern mit uns Kindern spielte. Wir hatten ihn auch herzlich lieb.
Meine liebe Großmutter, Anna Maria Brucker, war ein lebhaftes, gesprächiges, leicht aufbrausendes, im Grunde aber herzlich gutes Weib. Sie besorgte das Hauswesen emsig und getreu, aber nicht ängstlich. Wenn der Großvater, der zum 3. Orden des heiligen Franz v. Assisi gehörte, seine Ordensbrüder bei sich hatte, machte sie meistenteils ein etwas scheeles Gesicht. Doch war sie sehr eifrig im Gottesdienste und betrug sich mit jedermann friedlich.
Diese Großeltern hatten eine einzige Tochter, Barbara, ein hübsches braunes Mädchen, mittlern Wuchses, voll leichten Bluts, unbekümmert und rasch, lebhaft ohne Frechheit und fromm ohne Ängstlichkeit. So schilderten sie mir diejenigen, welche sie als Jungfrau gekannt hatten. In ihrer Jugend war sie sehr von Eingeweidewürmern geplagt. Sie stand beim Sternwirte in Höchstädt eine Zeitlang als Hausmagd in Diensten und half einst den Schnittern auf dem Acker die Garben binden. Auf einmal fiel sie ohnmächtig hin und schien tot zu sein. Erschrocken lief ein Schnitter fort, um ihr die Schiedung (Sterbeglocke) läuten zu lassen. Aber bald erholte sie sich wieder, brach einen häßlichen Wurm weg und lachte mit, als nun die Sterbeglocke erklang und ihr gesagt ward, daß man dieselbe für sie läute. Ein andermal war sie in Lebensgefahr, indem sie, während des Krieges 1742, von einem französischen Soldaten, dessen geilen Armen sie sich entrissen hatte, verfolgt ward. Als er sie nicht mehr einholen konnte, drückte er seine Pistole auf sie ab. Die Kugel flog ihr aber hart am Ohre vorüber und schlug sich durch den Bretterzaun, der den Hofraum der Klosterfrauen umschloß. Oft zeigte sie mir das durchbohrte, bereits morsche Brett.
Mein Vater mochte etwa 33 Jahre alt sein, meine Mutter 24; da führte sie der Zufall bei einem guten Bekannten zusammen. Der Zieglerhans war wohl gewachsen, flötete hübsch, scherzte gern, kramte allerlei schnackische Späße aus und gefiel meiner Mutter. Beide suchten Gelegenheit, öfters einander zu sehen, und verstanden sich bald so gut, daß ihnen der Wunsch, immer miteinander zu leben, oft zuvörderst auf den Lippen saß. Aber mein Vater ließ diesen Wunsch lange nicht laut werden; denn er hatte kein Heiratgut zu hoffen, wußte nicht, wie er eine Gattin ernähren sollte, und war auch zu blöde, um seiner Babet einen förmlichen Antrag zu tun. Meine Mutter beriet sich indes mit ihren Eltern, forschte die Gesinnungen derselben aus und stimmte sie so gut zugunsten ihres Lieblings, daß er ohne Scheu in ihr Haus kommen, sie besuchen und an Feiertagen zum Spaziergange abholen durfte. Da erklärten sie sich immer herzlicher gegeneinander, und mein Vater, von seiner Geliebten ermuntert, faßte endlich Mut, um ihre Hand zu bitten. Schüchtern stotterte er sein Verlangen heraus. Aber mein guter Großvater riß ihn geschwind aus seiner Verlegenheit und sprach: »Hans, du hast zwar kein Heiratgut, aber du bist ein arbeitsamer Mensch, bist kein Spieler, kein Trinker, kein Raufer, kein Mädchenjäger; wir wollen dir helfen; wenn dich meine Tochter will, so sollst du sie haben.« Meine Mutter, die indes mit schüchtern forschenden Blicken hinterm Ofen gestanden hatte, hüpfte nun auf ihn zu und umschlang ihn mit ihren Armen. Die Großeltern weinten und gaben den frohen Kindern ihren Segen. Dann ward beschlossen, das junge Paar sollte mit ihnen erst eine gemeinschaftliche Haushaltung führen; Babet sollte zum Heiratgut das Häuschen, das ich oben beschrieb, ein paar kleine Wiesen, samt einer halben Jauchert Ackers, und zwei Teile im Krautgarten empfangen, doch so, daß der Ertrag von allem auch von den Großeltern mitgenossen würde. Der Hochzeittag ward bestimmt, und der Zug ging morgens um 7 Uhr stille und ohne Gepränge zur Kirche; da rollte meiner Mutter ein Stein vor die Füße; man wußte weder woher er kam, noch welche Kraft ihn bewegt hatte. Das ward sogleich für eine üble Vorbedeutung genommen, und meine Mutter ging mit erschrockenem Herzen zum Altar. Mein Vater glaubt heute noch, das haben die bösen Leute (Zauberer und Hexen) getan. Wieviel Einfluß ein solcher Aberglaube auf ihr ganzes künftiges Leben hatte, läßt sich zum Teil daraus abnehmen, daß beide, wenn sie sich nach einem heftigen Zwiste, der eben nichts Seltenes war, wieder versöhnten, immer die Schuld davon der Zauberei beimaßen und sich's kaum beifallen ließen, daß die Quelle aller Zwietracht ihre Unnachgiebigkeit sei.
Zwei Jahre verstrichen, ohne daß die junge Frau Mutter ward. Im ersten Sommer seines Ehestandes lief mein Vater täglich morgens fünf Viertelstunden weit, von Höchstädt nach Dillingen, um dort als Ziegelknecht bei einem harten Herrn täglich um den Lohn von 15 Kreuzern fünfzehnhundert Ziegelsteine zu verfertigen. Fast jeden Abend eilte er wieder nach Hause zu seinem Weibchen. Dabei aß er nichts zu Mittag als trockenes Brot, und trank Wasser dazu. Bald nahm aber auch die Arbeit in Dillingen gänzlich ein Ende und er mußte sieben Stunden weit, bis nach Welden, einem Dorfe zwischen Augsburg und Wertingen, gehen, um im Ziegelstadel daselbst Arbeit und Verdienst zu erhalten. Weil es nun die Entfernung unmöglich machte, täglich nach Hause zu wandern, so ward verabredet, er wolle jeden Sonn- und Feiertag heim kommen. An den übrigen Tagen der Woche blieb er im Walde bei Welden in einer aus Baumreisern geflochtenen Hütte über Nacht. Abgefallenes Laub war sein Bett, ein Stein sein Kopfkissen. Ein Knabe, der als Handlanger ihm die verfertigten Ziegel an die gehörige Stelle tragen mußte, war sein Schlafgeselle. Sie tranken Wasser, das sie im irdenen Kruge aus der nahen Quelle schöpften, und aßen Brot dazu. Aber sie durften nicht mehr essen, als bereits für jede Mahlzeit ausgezirkelt war; denn sie konnten sich nur dann verproviantieren, wenn ein Feiertag sie nach Hause rief. Fiel nun eine ganze Woche ein (ohne Feiertag), so mußte der Laib zum Teil verschimmeln, und der Staub ging den Essenden wie ein Rauch zum Munde heraus. O wie sehnte sich damals mein lieber Vater immer nach der Heimat zurück! Wie bange erwartete ihn spät in der Nacht meine Mutter, um ihn sogleich mit Speise und Trank zu laben!
In einer solchen Märzennacht fing sich, wie mich mein Vater einst lächelnd versicherte, mein frühestes Dasein an. Möchte ich doch ausharrenden Mut, Geduld, Kraft und Fähigkeit, jedes Angemach zu besiegen, von ihm geerbt haben! Wer weiß, ob ich ihrer nicht noch sehr nötig bedarf?
Um das Einlaßgeld zu ersparen, stieg mein Vater, immer mit Lebensgefahr, über die Stadtmauer herein. Er wußte eine Stelle, wo die Mauer an einen Schloßturm stößt, und wo der Mörtel ausgespült war, und ein hoher Baum im Winkel stand, ganz geschickt zu seinem Vorhaben zu benutzen. Innen an der Stadtmauer führte eine steinerne Treppe zur Erde herab. Nur das Hinaufsteigen von außen hatte also seine Schwierigkeiten.
Neben der Zieglerarbeit verdiente mein Vater noch ein gutes Stück Geld als Spielmann, mit seiner Geige und Querflöte. Ohne dies hätte sein elender, obschon hart erworbener Zieglerverdienst zum Unterhalte nicht hingereicht. Aber wenn er an Sonn- und Festtagen bis morgens um drei, vier oder fünf Uhr den jungen Burschen zum Tanze aufgespielt hatte, so mußte er, ohne zu schlafen, nach Welden laufen, um an seine strenge Arbeit zu kommen. Dennoch war's unmöglich, zur bestimmten Morgenstunde dort einzutreffen. Um also seinen Herrn zu befriedigen, arbeitete er unausgesetzt auch in den beiden Feierstunden des Tages bis spät in die Nacht. Diese zu heftige Anstrengung von Kräften machte ihn in die Länge mißmutig und mürrisch. Wenn er heim kam und sah, daß sein Weib und die Großeltern nicht eben so überaus sparsam, wie er selbst tat, gewirtschaftet hatten, so verdroß es ihn, daß er sich so übermäßig plagen sollte, indes zu Hause dennoch nichts zurückgelegt wurde. Er hatte sich fest vorgesetzt, wohlhabend zu werden, oder auf einen grünen Zweig zu kommen, wie er sich ausdrückte, und dem Spitale in Höchstädt einige auf dem Hause haftende Schulden abzubezahlen, um von Zinsen befreit zu werden. Aber bei so geringen Einkünften wollte sich nichts in der Geldkasse sammeln. Er maß die Schuld dem Leichtsinn meiner Mutter und der Großeltern bei. So fing der Hader in unserer Familie an. Dazu kam dann noch die Schwangerschaft meiner Mutter. Wie diese zunahm, so nahm auch seine Furcht zu, sie alle würden bei Vermehrung der Mitesser notwendig an den Bettelstab geraten müssen. Mein Dasein verscheuchte also, unschuldigerweise, den Frieden vollends aus unserm Hause.
Im Winter, da in den Ziegelscheunen nichts zu verdienen war, kaufte der Vater zuvörderst auf den Dörfern sogenannte Ehschwing (das gröbste Werg) zusammen, half dann den Frauen grobes Garn zu Talglichtern oder Packsäcken spinnen und machte Strohtüren vor die Ställe, Strohdecken für die Gärtner, Darmsaiten für Geigen und Spinnräder, Vogelhäuschen, Bienenkörbe, geflochtene Nester für Tauben und Kanarienvögel usw. Diese beiden Arten Vögel zog er in Menge groß und trieb einen kleinen Handel damit, der für uns nicht unbeträchtlich war. Laub zur Streu für unsere Kuh, Eicheln für ein Schwein und Brennholz sammelte er im Walde.
Meine Mutter ergriffen die Wehen auf dem Wege, als sie eben einen Krug Wasser zu holen ausgegangen war. Beinahe hätte sie, um mich ins Leben zu fördern, das ihrige verloren. Man fürchtete, sie würde den Schmerzen erliegen. In ihrer Herzensangst verlobte sie sich dem heil. Franziskus Xaverius, dem man damals, auf Antrieb der Jesuiten von Dillingen, in der Pfarrkirche zu Höchstädt eben einen schönen neuen Altar errichtet hatte. Glücklich ward der Schmerzenssohn endlich den 23. Dezember 1758 geboren. Sie erzählte mir oft, ich sei ein schwaches gebrechliches Kind gewesen, das immer und besonders in der Kirche, als man mich zur Taufe trug, ein mörderliches Geschrei erhob. Ich erhielt wegen des Gelübdes meiner Mutter den Namen Franz Xaver, und weil mein Taufpate Michael hieß, einen zweiten Namen, Michael, in der Taufe.
Als ich einst, aus den Windeln losgewickelt, in der Wiege lag und von meiner Großmutter zu essen erhielt, ward sie schnell abgerufen und setzte das siedheiße Mus (Kinderbrei) zu mir ans Bettchen. Durch meine Bewegung neigte sich das Schüsselchen, und das herausrinnende Mus verbrannte mir den rechten Schenkel so sehr, daß man fürchtete, ich würde lahm und hinkend werden. Aber, Dank der Vorsehung! Mir blieb davon keine üble Wirkung zurück, als eine große, handbreite Narbe, die jetzt kaum mehr zu fühlen ist.
Den häßlichen Saugzapfen (feuchtes Brot in ein Tüchlein gewickelt, das man in unsrer Gegend den Kindern darreicht, um sie zu stillen) wollte ich im dritten Jahre kaum ablegen. Meine Mutter füllte ihn mir öfters mit Wermut, und einmal sogar mit Fischgalle an. Dann warf ich ihn freilich weg, aber ich suchte entweder die ältern wieder hervor, oder machte mir aus dem nächsten besten Lümpchen einen neuen. So viele Macht übten Gewohnheit und Sinnlichkeit über mich aus. Mein Vater sagte damals: »Bube, wenn du in deinem Leben so lange Kind bleibst, als du in deiner Kindheit den Zapfen trägst, so wirst du früher alt als klug.« Wahrlich, wenn nur der klug ist, der sich auf seinen Vorteil versteht und nichts versäumt, was ihn befördern kann, so hat mein lieber Vater als ein Prophet gesprochen; denn noch bis diese Stunde frage ich mich vor keiner Handlung: Was nützt sie dir? sondern folge blindlings meinem Herzen oder Kopfe, nicht viel besser als ein Kind. – Am Ende fiel es meinem Vater ein, alle Saugzapfen, soviel er deren habhaft werden konnte, an der Pfanne rußig zu machen; da mochte ich endlich keinen berühren; denn ich fürchtete, wenn ich schwarze Lippen bekäme, ausgelacht zu werden.
Noch erinnere ich mich lebhaft, wie meine Eltern sich freuten, als ich's zum erstenmal wagte, von der Stubentür, an die ich stehendes Kind mich lehnte, unsicher wankend, aber ohne mich anzuhalten, einem Apfel entgegen zu trippeln, mit dem sie lächelnd mich lockten. Noch weiß ich auch, als wär' es heute, wie ich, eine liebe Bürde, meiner Mutter auf dem Rücken hing, ihren Hals mit schwachen Armen, ihre Hüften mit den Beinchen umschlingend, und so, von ihr sorgfältig gehalten, an den Bach ritt, wo sie Leinwand und Netze wusch; wie sie dort lachte, und klatschend Mut mir einsprach, als ich für eine Nußschale, damals mein Schiffchen, mich gegen einen bösen Gänserich wehrte, den Zischenden herzhaft am Hals ergriff und lange mit seinen schlagenden Flügeln rang; wie sie frohlockte, wenn sich in mir eine neue Kraft, eine neue Fertigkeit entwickelte; wenn etwa mein Stimmchen, zum erstenmal, in wankenden Mißtönen ein Liedchen versuchte, zwitschernd und ungeübt, wie junge Schwalben unterm Dach; oder wenn es meinen tändelnden Händen gelang, zum erstenmal einen Gründling im Bache zu haschen oder gar einen Bürschling an der Angel zu fangen.
Mein jüngster Bruder Franz Joseph, der jetzt als Schuhmacher auf der Wanderung ist, erblickte beinahe fünf Jahre später, mein Bruder Hans Michel aber nicht völlig zwei Jahre später als ich das Tageslicht. Den Hans Michel verlangte eine angesehene Beamtenfrau zum Säugen; denn ihr Kind war gestorben, und sie hatte Schmerzen wegen Anhäufung der Milch. Nicht lange, so bekam dies mein Brüderchen offene Beulen in den Kniescheiben und an den Schenkeln, so daß man hindurchsehen konnte. So erzählte mir meine Mutter, und setzte allzeit bei: »Die Frau T. hat mich zwar wegen des Hans Michels wohl belohnt; aber ich glaube, sein ungesundes Wesen kommt größtenteils vom Saugen an fremder Brust her.« Er wurde doch wieder hergestellt, und zeigte bald eine besondere Geschicklichkeit in kleinen häuslichen Geschäften, so daß er beim Vater bald mehr galt als ich; allein ich blieb der Liebling der Mutter.
Nach dem Franz Joseph ward uns noch ein Brüderchen Joseph Anton geboren, der aber nur einige Wochen erlebte. Da fragte ich meinen Vater einst bei Tische: »Wo ist denn unser Brüderlein hergekommen?« Die Hebamme saß auch dabei. »Diese Frau da,« sagte er, »hat es aus dem Krautgarten hereingebracht; du kannst noch heute den hohlen Baum sehen, aus dem die kleinen Kinder immer herausschauen; die man dann abholen läßt, sobald man ihrer verlangt.« Wirklich führte er mich abends in den Krautgarten vors Tor hinaus, wo er die Erdäpfel besah, und die äußersten Blätter an den Kappisstöcken abbrach zum Futter für unsere Kuh. Auf dem Wege kamen wir an einen kleinen Teich, wo ein hohler Weidenstamm am Gestade stand. »Da sieh hinein,« sagte mein Vater. Und ich sah durch den hohlen Stamm im spiegelnden Wasser drunten mein Bild. »Siehst du einen Knaben herausschauen?« fragte mein Vater. »Ja, Vater, aber er sieht mir gleich,« antwortete ich. »Mag sein,« fuhr er fort, »viele Leute sehen einander gleich. Es sind noch eine Menge Buben in dieser Gegend herum zerstreuet. Rufe nur laut, was du rufen willst, sie werden dich gewiß sogleich verspotten.« Ich rief laut: »Buben, wo seid ihr?« – Und das Echo vom gegenüberstehenden Berge, auf dem die Ziegelscheune stand, antwortete unverweilt zu meiner größten Verwunderung: »Buben, wo seid ihr?« – Nun glaubte ich alles und wollte immer hinüberlaufen, um die spottenden Rufer auch zu sehen.
Unser Gäßchen (cul de sac) endigte sich zu oberst auf dem Hügel in einen länglichen Grasplatz, den der Garten der Klosterfrauen umgab. Dort lagen wir Kinder am liebsten auf dem Rasen und spielten und tändelten in den Blumen. Zunächst an diesen Grasplatz grenzte das Häuschen unsers Nachbars Blöckle. Anne, sein Weib, war die gutherzigste froheste Seele von der Welt, öfters erzählte mir meine Mutter, einst sei ich zur Anne in die Tenne geschlichen, wo ein Butterfäßchen voll Milchrahm zum Ausrühren bereit stand, habe da eine Handvoll Rahm nach der andern herausgenommen; soviel ich eben davon essen konnte, gegessen; was aber nicht gutwillig zum Munde hineinwollte, an die Wand, oder an den Boden, oder an mein Röckchen gestrichen; lange habe mich die gutherzige Nachbarin lächelnd belauscht und endlich sie heimlich herbeigerufen, um die lustige Malerei mit anzusehen. Meine Mutter setzte immer bei: »So gut wie des Blöckles Anne sind Tausende nicht; andere Nachbarn hätten dich braun und blau geschlagen, wenn sie dich bei einer solchen Arbeit ertappt hatten.« Ihr Mann war ein guter, friedlicher, alter Brummer. Was er redete, tönte wie gezankt; aber er tat niemandem etwas zuleide. Nur zuweilen machte er sich den Spaß, mich mit rauher Stimme zu schrecken.
Der nächste Nachbar, dem die andere, durch eine Zwischenwand abgesonderte Hälfte unsres Häuschens gehörte, hieß Bästle (Sebastian) und war ein seelenguter, gesprächiger Mann, der gern mit uns Kindern tändeln und plaudern mochte. Aber seine Frau Lisel (Elisabeth), die so unglücklich war, ihm zwei tote, aber nie ein lebendes Kind zu gebären, übrigens ein gutes Weib, sah uns immer mit scheelen Augen an, vielleicht eben darum, weil sie nicht auch Kinder hatte, und ihr das öftere Spielen ihres Mannes mit uns Kleinen ein stiller Vorwurf dünkte.
Im nächsten Hause daran, weiter hinabwärts, wohnte der Lumpenmichel (ein Mann namens Michael, der sich mit Lumpensammeln für Papierer ein gutes Stück Geld erworben hatte; andere wollten gar behaupten, er habe in alten Kleidern eine hübsche Summe eingenäht gefunden). Auch dieser Nachbar und sein Weib hatten keine Kinder und scherzten gern mit uns; doch waren sie etwas rauh und launisch, und so freundlich sie uns das einemal begegneten, so bitterböse konnten sie das anderemal uns verfolgen. Im oberen Gemache ihres Hauses wohnte ein Taglöhner Tobis, der mit Kindern zum Überflusse versehen war. Wir Kleinen besuchten einander oft und tändelten gar gern auf der Stiege, die aus des Lumpenmichels Wohnung zum Tobis hinaufführte. Die Treppe war unten nicht mit Brettern belegt, so daß man frei zwischen den Stufen hindurchsehen und -greifen konnte. Gerade darunter war Michels Küchentür, mit einem großen Vorlegeschloß gesperrt. Nun fand sich einst, bei dessen Rückkehr vom Sammeln, das Schloß mit Sand gefüllt, daß man nicht einmal den Schlüssel anstecken konnte. Darüber ward Michel sehr aufgebracht: »Das hat des Zieglerhansen verwünschter Bube getan!« schrie er und zerschlug das Schloß mit einem Beile, lief damit zu meinem Vater und forderte Vergütung. Mein Vater fragte ihn, »woher er denn wisse, daß ich das Schloß verdorben habe?« »Dein Bube,« sagte Michel, »spielt immer auf meiner Stiege; niemand als er hat's getan!« Sogleich ward ich vorgerufen und strenge gefragt; allein ich wußte von der ganzen Sache nichts; denn, wahrlich: ich konnte mit meinen kurzen Ärmchen das Schloß weder auf der Erde stehend, noch von der Treppe aus erreichen, und hätte das böse Stückchen, aus Mangel des physischen Vermögens, nicht einmal tun können, wenn ich auch gewollt hätte. Aber es war mir gar niemals etwas dergleichen zu Sinne gekommen. Michel ließ sich jedoch nicht abweisen, schimpfte meinen Vater und drohte ihm zuletzt gar mit Schlägen. Darüber entbrannte meines Vaters Zorn, der sich in ein paar tüchtigen Faustschlägen auf Michels Kopf ergoß. Michel klagte bei der Polizei, und das Ende vom Liebe war: Jede der beiden Parteien mußte 45 Kreuzer Strafgeld erlegen. Indessen war meine Mutter begierig, mit Gewißheit zu wissen, ob ich denn wirklich das Schloß verdorben hätte oder nicht. Sie nahm mich allein auf die Seite, schmeichelte mir und wandte alle ihre Beredsamkeit an, um ein aufrichtiges Geständnis mir abzulocken. Allein immer sagte ich standhaft: »Mutter, ich hab's nicht getan!« Sie liebkoste mich und drohte mir, dennoch blieb ich fest auf meinem Nein. Endlich nahm sie einen Kreuzer in die Hand, hielt mir ihn vor die Augen und sagte: »Kind! sieh, wenn du mir's aufrichtig gestehst und nicht wieder leugnest, daß du Sand in das Schloß geworfen hast, so geschieht dir nicht nur kein Leid, sondern ich gebe dir auch dies Geld; du kannst dir etwas Gutes darum kaufen. Aber wenn du beim Leugnen bleibst, so wird dich der Vater tüchtig peitschen!« Was sollte ich nun tun? Sie wollte ja durchaus eine Lüge von mir. Dabei gewann ich Geld und blieb ohne Strafe; sagte ich aber die Wahrheit, wie bisher, so hatte ich Schläge zu erwarten, und zwar vom Vater, der sie schrecklich derb aufzählte. Also log ich aus Interesse zum erstenmale und sagte: »Ja Mutter, ich hab's getan!« – Statt des Kreuzers gab sie mir nun einen tüchtigen Schilling (die Rute) und hieb so lange drein, bis die Rute zerfuhr. Ich mochte beteuern, so hoch ich konnte, daß ich unschuldig sei und mich nur zu einer Lüge hätte überreden lassen; alles war umsonst, man maß mir keinen Glauben mehr bei. O, was litt da mein junges Herz! Wie ganz empörte dies Verfahren jedes meiner Gefühle! Ingrimm durchglühte mich, und ich haßte die Mutter und den Vater, und alles was mich umgab. Zum Glücke hielt dieser Zustand nicht lange an. Aber ich traute fast niemals mehr einem Versprechen und hatte nun sehr frühe die Wortbrüchigkeit, die Abel der Lüge und die Falschheit der Menschen kennen gelernt. Wahrscheinlich hatte dieser Vorfall beträchtlichen Einfluß auf die Bildung meines Charakters.
Bald darauf ging der Kapuziner, Pater Homobonus Hantner, ein Verwandter meiner Mutter, durch Höchstädt und besuchte sie. Ich spielte eben mit einem kleinen Wägelchen. Da rief er mich Zu sich und fragte: »Wie heißest du?« »Xaverle,« sagte ich. »Ei,« fuhr er fort, »ich glaubte, du heißest Dorothee.« »Xaverle heiß' ich, nicht Dorothee,« erwiderte ich trotzig. Er hatte ein Bildchen in der Hand, auf dem, wie ich bei reifern Jahren sah, wirklich die heil. Dorothea, unter einem Baumblatte, das man wie ein Deckelchen aufheben konnte, abgemalt war. »Da nimm,« sagte er komisch ernsthaft, »dies ist dein Namenspatron; du heißest ja Dorothee!« Zornig rief ich: »Du lügst, du lügst!« schmiß das Bild auf den Boden und fuhr mit meinem Wägelchen weiter. Er aber hob sein Bild lächelnd wieder auf und legte es mir unvermerkt auf mein Fuhrwerk. Kaum sah ich es, so warf ich's weg und spie es an. Das brachte meine Mutter auf, der Kapuziner konnte sie nimmer abhalten, wie er bisher getan hatte; sie trug mich geschwind in die Küche und gab mir tüchtig die Rute. Dann mußte ich noch obendrein das verhaßte Bild auf dem Wägelchen herumführen. Als der Kapuziner fortging, sagte er mir: »Lebe wohl, Dorothee!« Grimmig antwortete ich: »Du lügst!« – und bekam von neuem die Rute. Ob mich dergleichen Behandlungen nicht immer wilder und hartnäckiger machen mußten?
Doch ich vermute, meine Mutter wollte hier nur ein Beispiel ihrer strengen Kinderzucht geben; denn sie behandelte mich sonst sehr liebreich und nachsichtig. Wenn sie im Sommer zur Bleiche fuhr, um das im Winter gesponnene grobe Werggarn zu laugen, nahm sie mich gewöhnlich auf dem Schubkarren mit sich. Dann setzte sie mich unter Bäumen ins hohe Gras, sah von Zeit zu Zeit sorgfältig nach mir um und lehrte mich aus Löwenzahnröhrchen Ketten machen, Äpfel und eßbare Schnecken in der Glut braten und an den seichten Wassergräbchen buntgestreifte Schnecklein suchen. Ich bewunderte die Walk, die Kessel und andere Anstalten der Bleiche. Manchmal trafen dort noch mehrere Kinder zusammen; da wurden denn allerlei Spiele auf die Bahn gebracht, aus Binsen kleine Flößchen gebaut, und wohl gar den Fischen in des Bleichers Teiche nachgestellt. Bei dieser Gelegenheit lernte ich das sogenannte Felbergärtlein kennen, einen Platz an drei kleinen Teichen, dicht mit Weiden bepflanzt, am Wege von der Bleiche zum untern Stadttor. Dort im Schatten war mein liebster Aufenthalt. So oft ich vor die Stadt hinausschleichen konnte, lief ich dorthin. Geringelte Steckenpferdchen zu schneiden, aus jungen Weidenrinden Pfeifen zu machen, Blumensträuße zu binden, schönfarbige Steinchen am Ufer zu suchen und Frösche zu fangen, waren mir die angenehmsten Beschäftigungen. Ich erinnere mich noch, daß ich einst, da ich noch kaum die ersten Beinkleider trug, ganz allein vor's Tor hinausschlenderte, auf der Wiese und am Bache Blumen pflückte und bis an des Mussen, eines Fischers, großen Ackergarten kam. Da erblickte ich durch die Stauden der Hecke schönen roten Kornmohn im Getreide des Gartens und fand eine kleine Tür, die nur angelehnt war. Fröhlich hüpfte ich hinein, pflückte nach Herzenslust Kornmohn, Cyanen und Rittersporn und watete unbekümmert kreuz und quer durch die Ähren. Plötzlich ergriff mich eine starke Hand hinten beim Hosenbande und trug mich schreienden Knaben, wie einen Frosch, freihängend und zappelnd, unter Androhung des Ohrenabschneidens und Henkens, zum Hause des Fischers, wo mehrere Leute auf der Bank vor der Tür saßen und mich lachend empfingen. Wie weggewischt war die Angst von meinem Herzen, als ich so freundliche Mienen sah. »Wo solche Gesichter sind,« das empfand ich, »da geht es nicht aufs Henken los.« Wirklich gab mir die Fischerin statt der Schläge Kuchen, nahm mich kosend auf den Arm und suchte mich für den ausgestandenen Schrecken schadlos zu halten. O, das tat mir über alle Maßen wohl! Der Sohn des Hauses mußte mich noch obendrein, samt meinen Blumen, nach Hause bringen.
Bei einem Jahrmarkte begaffte ich einst, in Gesellschaft ebenso kleiner Kinder, als ich selbst war, die Waren in den Krambuden. Vorzüglich gefiel es mir bei einem Tische mit vielen aus Töpferton gebrannten und buntglasierten Figürchen. Die Begierde, eines davon zu haben, wuchs in mir so heftig an, daß ich, nach langem Bewachen der Blicke des Krämers und der Umstehenden, wirklich mit nicht geringer Schlauheit ein Figürchen wegmauste und es unter mein Röckchen verbarg. Unbemerkt schlich ich damit fort, band dem Männchen zu Hause einen Faden um den Hals und ließ es, zum Fenster hinaus, an der Wand auf- und abtanzen. Da kam meine Mutter und fragte ganz freundlich: »Kind, wo hast du dies Männchen her?« Flugs war ich mit der Lüge da: »Ich hab' es gekauft!« – »Woher hast du aber das Geld genommen?« erwiderte die Mutter. – »Ich hab' es gefunden.« – »Wo?« – »Bei den Kupferschmieden unter den Ständen (Buden).« »Nun Hab' ich dich, du Lügner!« sagte sie nun sehr ernst, »die Kupferschmiede handeln nicht um Pfennige; gesteh nun augenblicklich, wie hast du's gemacht, das Spielzeug zu bekommen?« – Nun gestand ich aufrichtig alles. «Weil du denn die Wahrheit gesagt hast,« fuhr die Mutter fort, »so will ich selbst diesmal dich abstrafen; hättest du noch ferner geleugnet, so würde ich dich beim Vater verklagt haben.« Dann gab sie mir die Rute nach aller Strenge und machte mir treffende Vorstellungen über die Schwere meines Verbrechens, und daß dies der Anfang eines gottlosen, unglücklichen Lebens sei, welches gewöhnlich am Galgen oder durch Schwert und Rad geendigt werde. Zu guter Letzt mußte ich das entwendete Figürchen wieder heimtragen, und sollte den Krämer noch überdies um Verzeihung bitten. Ich schrie immer: »Ach Mutter, lieber noch einmal einen Schilling (die Rute)!« Aber es half nichts. Ohne Erbarmen mußte ich das Figürchen wieder die Stadt hinauftragen. Meine Mutter folgte mir in einiger Entfernung nach. Eine gute Weile verbarg ich mich im Gedränge und besann mich, wie ich meinen Raub am geschicktesten hinstellen könnte. Kaum war ich zu der Bude des Krämers gekommen, so bückte ich mich zwischen den Umstehenden hinab, setzte das Männchen geschwind auf die Erde unter dem Tische, sagte ganz ruhig: »Ich glaube, da ist etwas hinuntergefallen«, holte es herauf, um es ganz unbefangen auf den Tisch zu stellen, und lief, sobald es geschehen war, ohne weiteres davon. An eine Abbitte ward gar nicht gedacht, und meine Mutter, die mich am Tische des Krämers gesehen hatte, drang abends, als ich heimkam, auch nicht weiter darauf. Hätte sie vermuten können, daß ich, um nicht ein Dieb zu scheinen, so listig täuschen lernen würde, so wäre sie mir gewiß nicht von der Seite gegangen, bis ich mein Männchen zurückgegeben und wirklich abgebeten hätte; dann erst wäre die Korrektion ganz heilsam und vollständig gewesen. Aber bei der Art, wie ich es angehen durfte, mußte mir die schädliche Meinung im Herzen zurückbleiben, eine schlimme Sache sei durch Schlauheit immer, wenigstens in etwas, wieder gut zu machen.
Der Vater hatte mir eine irdene Sparbüchse gekauft. Darein steckte ich alle Heller und Pfennige, die ich geschenkt bekam; denn ich sollte mir, wenn die Summe erst hinreichend wäre, etwas Schönes darum kaufen dürfen. Aber als ich einst das ersparte Geld wirklich verlangte, hatte man die Sparbüchse geleert, und ich erhielt noch dazu einen Verweis, daß ich allzu hitzig mein Eigentum forderte. »Dahinein stecke ich gewiß nichts mehr,« dachte ich und empfand mit lebhaftem Verdruß das Unrecht, das mir geschehen war. So oft ich nun etwas geschenkt bekam, verbarg ich es in seltsamen Winkelchen. Hinter unserm Stubenofen war ein enger Raum, den wir Kinder uns zugeeignet hatten und wohin wir flohen, wenn Vater und Mutter miteinander in heftigen Wortwechsel gerieten. Dort hielten wir uns stille, enge zusammengedrängt und ruhig, bis der Sturm vorüber war. Kaum wagten wir es, leise einander in die Ohren zu flüstern; denn wenn der Vater übler Laune war, so besorgten wir, es möchte, auch beim geringsten Anlasse, tüchtige Schläge setzen. Nun hatte ich einst einen Kreuzer in eine Ofenritze zwischen die irdenen Kacheln hineingesteckt; das merkte mein Bruder Hans Michel und wollte mit einer Messerspitze den Kreuzer herausholen. Ich wehrte es ihm und schob den Kreuzer noch tiefer hinein, zuletzt so tief, daß ich ihn selbst nicht mehr herausbringen konnte. Weil ich die Schuld auf ihn warf, entspann sich ein Wortwechsel zwischen uns, dessen Geflüster immer lauter ward. »Was gibt's da hinten?« rief endlich der Vater mit zorniger Stimme, denn er war eben mit der Mutter uneins geworden. Mein Bruder wagte es, den Hergang zu erzählen. »Spitzbube,« sagte mein Vater darauf und riß mich hinter dem Ofen hervor; »gehört das Geld in die Ofenritzen? weißt du nicht, daß du es in den Sparhafen legen sollst?« Dann gab er mir ein paar tüchtige Ohrfeigen, unter denen die eine so übel geriet, daß ich bald darauf gar nichts mehr hörte. Meine Mutter und die Ahnfrau kamen mir zu Hilfe und verwiesen dem Vater mit Bitterkeit seine Behandlungsart. Darüber ward er noch mehr aufgebracht und drohte, meine Mutter zu schlagen. Die Großmutter stellte sich zwischen beide und nannte ihn einen Tiger; da gab er ihr im Zorne eine Ohrfeige; sie lief zur Tür hinaus, gerade dem Großvater entgegen, der eben von der Arbeit heimkam, und klagte ihm, was ihr widerfahren war, auf die eindringlichste Weise. Mein Großvater, in seinem ganzen Leben der friedlichste Mann, ward darüber so aufgebracht, daß er mit seiner Axt in der Hand und mit dem Zimmermannswerkzeuge, das er in einem Korbe auf dem Rücken trug, in die Stube trat, und mit zürnendem Ernste sprach: »Hans, woher hast du das Recht, mein Weib zu schlagen? Ist das der Dank, daß wir dir geholfen haben? Du wärest wert, daß ich dir auch eins versetzte!« »Was?« rief mein Vater mit wachsendem Ungestüm, »du Zimmermännlein! du wolltest mich schlagen?« und griff nach dem Großvater; aber dieser floh und ging mit seinem Handwerkszeuge zu seinem Bruder. Denselben Abend noch mietete er eine andere Wohnung, und den andern Morgen kamen er und die Ahnfrau still und traurig herbei und trugen ein Stück ihres Hausgerätes nach dem andern hinweg. O, das war so ein schmerzlicher Anblick! Ich weiß es deutlich noch; ich stand auf der Gasse, unserm Hause gegenüber, am Gartenzaune der Klosterfrauen, und konnte nichts als schluchzen und weinen.
Weil ich nun so taub war, daß ich gar nichts hörte, tat meine Mutter ein Gelübde, sie wolle in der Kapelle des sogenannten Zwinger-Herrgottleins, eines Kruzifixes im Zwinger, zunächst am obern Tore, eine Votivtafel aufhängen, wenn ich wieder hörend würde. Drei bis vier Wochen lang ging sie täglich dahin, um für mich zu beten, und ich hatte meine größte Freude, wenn ich so vor ihr her spazieren durfte; denn in der Nähe war eine erhabene Schanze, mit Sträuchern bewachsen, die ich überaus liebte, und wohin ich allzeit lief, wenn sie mir zu lange vor der Kapelle kniete. Die Taubheit war mir so wenig zur Last, daß ich meinen Verlust kaum bemerkte und beinahe froh war, nun nicht mehr zanken zu hören. Meine Mutter erzählte mir nachher, ihre tägliche Frage sei gewesen: »Xaverl! hörst du noch nichts?« aber nie hätte ich geantwortet. Ihr Herzeleid war unaussprechlich. Endlich, als man einst auf dem nahen Pfarrkirchenturm mit allen Glocken läutete, fragte ich sie, was so wunderlich summe? Sie faßte Hoffnung darob, und wirklich fand sie am folgenden Morgen mein ganzes Kopfkissen beschmutzt; denn ein Geschwür hatte sich geöffnet. Darauf hörte ich wieder sehr gut. Gott sei gedankt, daß er mir diesen so nötigen Sinn von neuem schenkte.
Zweites Kapitel - In der Klosterschule und beim Kantor.
Die Klosterfrauenschule – Allerlei Unarten – Die »Stiefelnonnen« – Erstes Schulgehen beim Herrn Kantor – Strafsitten – Der »Schilling« – Mechanische Tändeleien – Ueberladung des Magens und ein wichtiger Todesfall – Obstdiebereien – Unterhalt beim Großvater – Vergnügen im Grünen – Gefahren – Das Fischen – Das Erzählen – Hexen und Gespenster – Unterricht im Singen – Schöne Aussichten – Ich soll Geistlicher werden – Tagesordnung und erste Freundschaft – Jugendliche Religionsbegriffe – Die Blattern – Erster Verdienst – Die Bestechung und Strafe – Erdbeben und Ungewitter.
Der Bube ist alt genug, er muß in die Schule,« sagte mein Vater, »so ist er unter Tages beschäftigt und kommt uns vom Halse.« Ich ward also zu unsern Nachbarinnen, den Klosterfrauen, in die Unterweisung geschickt. Die Buchstaben konnte ich bald nennen; denn Vater und Mutter unterrichteten mich auch zu Hause. Aber es litt einigen Anstand, bis ich begriff, daß man im Lesen die Namen der Mitlauter nicht ganz, sondern nur den Anfangs- oder Endlaut davon aussprechen, und also, wenn Baum stand, nicht Be-a-u-em sondern Baum lesen müßte. Als ich dies gefaßt hatte, ging mir das übrige leicht vonstatten. Meine Schulgespielen waren meistens kleine Mädchen oder sehr junge Knaben. Die Mädchen lernten Lesen, Schreiben, Nähen, Stricken oder Spitzen klöppeln usw. Aber die Knaben buchstabierten beinahe alle im Namenbüchlein. Wenn sie größer wurden, schickte man sie zu den Schulmeistern.





























