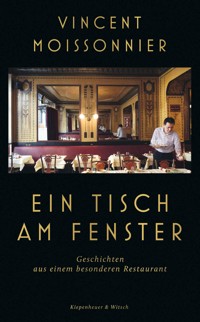
22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Märchenhafte und doch wahre Geschichten aus einem besonderen Restaurant Seit bald 40 Jahren stehen sich zur Mittagszeit in einer unscheinbaren Kölner Straße Menschen die Füße platt, lugen durch ein verhangenes Schaufenster und warten darauf, an einen zauberhaften Ort vorgelassen zu werden. Das Le Moissonnier ist ein in vielerlei Hinsicht ungewöhnliches Sternerestaurant und zugleich der Schauplatz so unzähliger wie unwahrscheinlicher Geschichten. Seine eigentliche Geschichte beginnt Anfang der 80er-Jahre, als Vincent und Liliane, beide aus Frankreich stammend und Berufseinsteiger im Gastronomiegewerbe, sich in Berlin über den Weg laufen. Im Nu nimmt eine Liebesgeschichte ihren Lauf und führt nach weiteren Lehrjahren und einem Umzug nach Köln zur Gründung eines eigenen Bistros. Wie von einem modernen Märchen erzählt dieses Buch von einer bescheidenen Idee und den Hürden einer Existenzgründung in der Fremde, von den Mühen des Aufstiegs und vom Zauber des Erfolgs. Wir lesen von auffälligen und unauffälligen Gästen, von den abenteuerlichsten Seiten der Arbeit mit Menschen in der Gastronomie und von den Grundlagen der gehobenen Küche. Denn das Buch macht auch vor der Schwingtür zum Allerheiligsten nicht halt: mit einer verblüffenden Offenheit berichtet es von der raffinierten und dabei zutiefst sinnlichen Arbeit einer Sterneküche. Ein Buch, das Genuss und Geschmack erfahrbar macht, das die wunderlichsten Gestalten zum Leben erweckt und einen besonderen Ort zum Strahlen bringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Vincent Moissonnier / Bert Gamerschlag
Ein Tisch am Fenster
Geschichten aus einem besonderen Restaurantmit einem Nachwort von Joschka Fischer
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Vincent Moissonnier / Bert Gamerschlag
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Vincent Moissonnier / Bert Gamerschlag
Vincent Moissonnier hat zusammen mit seiner Frau Liliane fast 40 Jahre lang das 2-Sterne-Restaurant ›Le Moissonnier‹ in Köln geführt. Seine Stil-Kolumne im Kölner-Stadt-Anzeiger wurde zum Erfolgshit quer durch die Generationen.
Bert Gamerschlag, Absolvent der Henri-Nannen-Schule, vorher Studium der Anglistik und Theologie u. a. in Kanada und Schottland. Nach fünf Jahren beim Spiegel ab 2001 beim Stern zuständig für alles, was man essen und trinken kann.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Seit bald 40 Jahren stehen sich zur Mittagszeit in einer unscheinbaren Kölner Straße Menschen die Füße platt, lugen durch ein verhangenes Schaufenster und warten darauf, an einen zauberhaften Ort vorgelassen zu werden. Das Le Moissonnier ist ein in vielerlei Hinsicht ungewöhnliches Sternerestaurant und zugleich der Schauplatz so unzähliger wie unwahrscheinlicher Geschichten.
Seine eigentliche Geschichte beginnt Anfang der 80er-Jahre, als Vincent und Liliane, beide aus Frankreich stammend und Berufseinsteiger im Gastronomiegewerbe, sich in Berlin über den Weg laufen. Im Nu nimmt eine Liebesgeschichte ihren Lauf und führt nach weiteren Lehrjahren und einem Umzug nach Köln zur Gründung eines eigenen Bistros.
Wie von einem modernen Märchen erzählt dieses Buch von einer bescheidenen Idee und den Hürden einer Existenzgründung in der Fremde, von den Mühen des Aufstiegs und vom Zauber des Erfolgs. Wir lesen von auffälligen und unauffälligen Gästen, von den abenteuerlichsten Seiten der Arbeit mit Menschen in der Gastronomie und von den Grundlagen der gehobenen Küche. Denn das Buch macht auch vor der Schwingtür zum Allerheiligsten nicht halt: mit einer verblüffenden Offenheit berichtet es von der raffinierten und dabei zutiefst sinnlichen Arbeit einer Sterneküche.
Ein Buch, das Genuss und Geschmack erfahrbar macht, das die wunderlichsten Gestalten zum Leben erweckt und einen besonderen Ort zum Strahlen bringt.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Kathrin Koschitzki
ISBN978-3-462-31252-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Bienvenue, herzlich Willkommen
Die Schwingtür
Ab in die Küche
High Noon
Wir finden eine Ruine
Am Anfang ist der Fond
Wo Liliane und ich herkommen
Sankt Moritz
Lebensmittel und Ausrüstung
Zierrat
Adieu Frankreich, bonjour Berlin
Von den Handgriffen
Köln: In Kellers Imperium
Hochzeit im Dom
Ein Riss in der Keller-Decke
Holm Hahn und die Selbstständigkeit
Von der Routine
Eric Menchon
Offenbarung
Die ersten Monate
Vorspeise: Langustine/Kaisergranat
Der Großmarkt
Hauptgericht: Dekonstruierte Taube mit Satellitentellern
Von der Vorläufigkeit
Geschmacksbildung – die Tränkners
»Hotel Royal«
Mitarbeiter
Wolfram Siebeck – und andere Kritiker
Bestes Brot
Kölner Behörden
Köln und das Päffgen
Dessert: »La poire de Kyoto« – japanische Birne
Außergewöhnliche Kunden
Irrwege
Kapriziöse Kunden
Traumhafte Gäste – Roger Willemsen et al.
Andere Gäste
Kinder
Haben Sie reserviert?
Zu teuer
Alkohol und Abhängigkeit
Absturz
Manieren
An der Garderobe
Ermüdung
Geschlossene Gesellschaft
Krachen im Gebälk
Die Reaktion der Menchons
Die Reaktion der Gäste
Lassen Sie uns über Geld reden
Letzter Abend
Coda
Und täglich grüßt …
Noch eine Coda
Anhang
Es ist französisch, es ist großartig und »et passt zu Kölle«! – Nachwort von Joschka Fischer
Moissonnier für zu Hause – Rezepte
Gebratenes Fischfilet mit Risotto
Navarin vom Lamm
Gefüllte Kalbsbrust
Entenbrust aus dem Ofen
Pâté en croûte Fleischpastete im Teigmantel
Bienvenue, herzlich Willkommen
Eine Welle baut sich auf, Unruhe schwappt an unsere Tür. Den ganzen Vormittag über sind die Menschen zügig an den Schaufenstern vorbeigelaufen, ganz normale Fußgänger. Jetzt, da es auf Mittag geht, ändert sich das. Aus Passanten werden Interessenten. Sie verlangsamen den Schritt, bleiben stehen und harren vor dem Fenster. Manche lungern, andere tigern auf und ab, blicken hoch zum Schriftzug »Le Moissonnier«, besprechen sich und schauen auf die Uhr. Einzelne drehen sich zur Scheibe, legen die Hand dagegen und spähen herein.
Und was sehen sie? Sie sehen ein Paar im gedämpften Licht. Sie sehen Liliane und mich. Wir sitzen da an einem kleinen Tisch im Hintergrund – ich mit dem Rücken zur Straße, den Blick abgewandt, den Kopf hinabgeneigt zum Teller; Liliane, sie hat die stärkeren Nerven, sitzt mit dem Blick zum Fenster, aber auch sie schaut nur selten hoch. Nur weil da jetzt schon Leute stehen, springen wir nicht gleich auf und lassen sie herein – und wenn sie das noch so gerne hätten! Mais non, mes chers, geduldet euch! Désolé, aber nach 37 Jahren im Dauereinsatz halten wir Haus mit unserer Energie.
Ich mag die Straße noch nicht sehen – die Unruhe draußen, die anschwellende Welle. Klar macht sie mich glücklich. Immerhin sind Gäste ja mein Beruf, und gleich werde ich ihnen meine Arme öffnen, und das mit Leidenschaft. Aber zugleich spannen sie mich an – wie den Dompteur die Manege einerseits glücklich macht und auch nervös. Die Manege ist sein Leben, aber in ihr zu funktionieren kostet Nerven. Die Raubtiere, da kommen sie, schon pendeln sie mit den Köpfen vor dem Eingang, mit ihren Pranken patschen sie an die Laufgangstäbe und wollen, dass es losgeht mit den Trommeln, dem Tusch, dem Licht, der Musik und dem bunten Mann da in der Mitte mit seiner Peitsche und dem Zylinder.
Liliane und ich sitzen also da und essen. Passend zur Anspannung ist es etwas Leichtes – ein Gemüse, ein wenig Fisch, meist das Personalessen für alle … Nur Nudeln nicht, Nudeln niemals! Alle wollen stets und immer »Pasta«, ich meide das amorphe Zeug.
Scheinbar ungerührt da sitzen heißt aber eben: nur scheinbar. In Wahrheit sind unsere Gedanken längst bei den Gästen. Um sie allein geht es ja. Um sie dreht sich alles. Sie sollen sich bei uns wohl- und perfekt aufgehoben fühlen. Und zum Erreichen von Perfektion ist vieles zu bedenken. In Vorbereitung auf unsere Vorstellung in der Manege murmelt Liliane mir ab und an etwas zu, und ich gebe kurze Antwort, bis … klopf klopf.
Moment mal! Pocht da tatsächlich jemand ans Fenster? Was! Was wollen die Leute?! Können sie nicht warten?! Ich will aufspringen, rausrennen und sie anpfeifen, doch Liliane bremst mich, sie kennt mich und wiegelt ab. »Hast du deine Tabletten genommen?«, fragt sie, blickt zur Uhr überm Eingang und sagt: »Viertel vor zwölf.«
Vor mir hinten rechts in der Wand sehe ich die doppelflügelige Glastür, die Trennung und zugleich die Verbindung zwischen dem Gastraum und der Küche, zwischen der Haupt- und der Hinterbühne. Unzählige Male wird sie sich bald öffnen und schließen, auf- und zuschwingen. Vor ihr im Gastraum herrscht jetzt letzte Ruhe, hinter ihr schlägt schon der Puls der Küche, von dort dringen Gefauche und Geklapper, schnurren Mixer, schnarren Schneebesen und klappern Messer beim Kontakt mit Edelstahl. Kurz vor dem Service tauchen die Köche Stabmixer in enge, hohe Gefäße und schäumen Flüssigkeiten auf – Saucen, Crèmes und Nages. Die Küchenklänge sind mein Leben. Ich höre Stimmen, kurze Lacher, fehlfarbenes Gefrotzel und krude Witze. Offenbar ist die Stimmung an den Herden gelassen. Das ist sie meistens, aber nicht immer. Auch in der Küche bin ich öfter Dompteur, als ich es möchte.
Der Glastür nähert sich ein Schatten, den Rücken voran drückt sie ein Körper auf und wendet sich im Gehen nach vorn in den Gastraum. Es ist Falk, »mein Falk«, wie ich ihn nenne. Ich bilde mir nichts weniger ein, als diesen jungen Mann »gemacht« zu haben, geformt, gebildet und geläutert, wie andere vor ihm. So wie auch ich als junger Kellner von Henry Levy »gemacht« worden bin; aber davon später mehr.
Vor seinen Bauch gepresst schleppt Falk einen Kübel mit Eiswürfeln herein und verstaut ihn in den Tiefen der Theke. Er tut dies wortlos. Alle arbeiten wir kurz vorm Öffnen beinah wortlos. Der Worte werden gleich mehr als genug gewechselt werden. Falk räumt und kramt und schiebt und lässt die Thekentür dann mit einem satten Schlupp-Geräusch zufallen, er richtet sich auf und prüft mit schweifendem Blick noch mal das Arrangement der Thekengeräte.
Die Ansammlung auf dem Bürgersteig, das Huschen des Personals, die Küchengeräusche – all das sind die Anzeichen für ein nahendes Beben – den Mittagsservice. Vor wenigen Minuten noch hat Christine den Gastraum durchgefegt und hier und da nachgewischt. Christine Augustin ist unsere Restaurantleiterin. Chefin mag sie sein – und doch ist sie Sklavin der Notwendigkeiten. So wie Liliane Sklavin ist und so wie auch ich es bin, so wie wir es alle sind. Mit dem Handstaubsauger ist sie auf die Knie gegangen und hat den Fußabtreter vor der Eingangstür von einem Krümel befreit. Jedes Blechtablett hat sie mit Sidolin eingesprüht und trocken poliert. So ist sie, sind wir, so müssen wir sämtlich sein – pingelig. Pingelig in jeder Hinsicht.
Liliane und ich scannen ein letztes Mal den Gastraum. Makellos. Die Tische sind mit auf Kniff gebügelten Tüchern eingedeckt; das habe ich in der Frühe selbst besorgt. Die Bestecke und Servietten in ihren Ringen sind millimetergenau platziert, hinter der Theke blinken die handpolierten Gläser, und es leuchtet das Prunkstück unseres Betriebs: die drei Meter lange Weinzapfanlage mit ihren dreißig Flaschen darin. In den Fenstern zur Straße – als Sichtschutz für die Gäste sind sie brusthoch mit Gaze verhangen – funkelt eine Kompanie Karaffen. Bald werden sie mit Wein gefüllt. Ich liebe das Umgießen von Wein aus dunklen Flaschen in hell blitzendes Glas, das Dekantieren gehört zum Zauber der großen Restaurants.
Was sehe ich noch? Auf einem schmal aufragenden Regal hinter dem zentralen Pfeiler des Raums stehen Flaschen mit Obstbränden und Rum. Das Regal selbst ist dunkel lasiert, mit Einschüben voller gestärkter, gefalteter Stoffservietten und mit Namensschildern aus Messing darunter – 35 sind es genau, sie tragen die Namen von Stammgästen. Für sie ist es wie für uns eine Auszeichnung, dass sie ihre eigenen Servietten haben und behalten. Rechts vom Pfeiler steht eine raumteilende Anrichte, auf deren mittlerer Ebene kleine Teller und Gläser stehen und auf deren oberer die Brotkörbe, ferner weiteres Besteck, eine noch ofenwarme Obst-Tarte aus der Hand unseres Patissiers Olivier Toussaint sowie ein metallener Weinkühler. Für diesen und für noch weitere Kühler ist das Eis gedacht, das Falk gerade hereingeschleppt hat.
Der Gastraum hat 42 Plätze, er ist weich möbliert und an den Wänden und Decken warm ausgemalt – bordeauxrot und cremig golden sind seine Farben, verziert mit Schablonenmalerei aus der Zeit des Art déco. Die Bänke entlang der Seitenwände sind kunstledern bezogen und mit Kokosfasern gepolstert, die Lehnstühle samten ausgeschlagen. Wir möchten, dass unsere Gäste es gemütlich haben, dass sie gern bei uns sitzen, ja, dass sie hier lümmeln und abhängen, angeregt und doch entspannt.
Jetzt könnte ich so etwas schreiben wie: »Und könnte die Schlange da draußen erst riechen, wie es aus der Küche duftet!« Schließlich wallen auf den Herden unserer Küche mehrere 50-Liter-Töpfe mit Fonds von Geflügel und Kalbsknochen darin, und in den Öfen gart das Tagesgericht, mit Fleisch farcierte Gemüsetörtchen: »Petits farcis niçois«. Da schmoren ausgehöhlte und fleischern gefüllte grüne Zucchini, rote Paprika, goldgelbe kleine Kartoffeln, violett-braune Auberginen – auf ihren Füllungen schmilzt geriebener Parmesan, glänzender Bratensaft läuft die Außenseiten herab, wirft kleine Blasen und sammelt sich auf den mit blubberndem Geflügelfond ausgegossenen Backblechböden, dazwischen genestelte Rosmarinzweige verströmen ein mediterranes Aroma.
Aber das schreibe ich nicht, denn bei uns riecht die Küche so wenig nach Essen wie der Gastraum nach Getränken. Dafür sorgt gute Technik. Eine Abluftanlage saugt die Wrasen aus den Öfen und von den Töpfen durch die Decke hoch übers Haus hinaus. Frisch ist die Luft in der Küche und genauso im Gastraum. Gastrogerüche sind kein gutes Zeichen für ein Lokal.
Aber jetzt: Auf fliegt die Schwingtür zur Küche und heraus tritt Eric Menchon, unser Küchenchef und Schutzpatron – ein kahler, stutzbärtiger Mittfünfziger in weißer Kochjacke. Sieht aus wie ein altersloser Yoga-Lehrer – kein Bauch, kein Anzeichen irgendeines Abusus … Fit ist der Mann! Er kommt an den Tisch, wo wir das Essen nun beendet haben, und legt uns einen Zettel hin – es ist eine von mehreren Bestelllisten für den nächsten Tag. Ein paar knappe, sachliche Worte, dann geht Eric zurück. Auf klappt die Schwingtüre und zu. Die Abläufe sind seit mehr als drei Jahrzehnten eingespielt. Gequatsche braucht es nicht.
Nun wird es Zeit, nur wenige Minuten sind es noch. Seit ich es mir beim Anziehen in der Früh um den Hals gelegt habe, baumelt ein Stoffband vor meiner Brust. Ich erhebe mich, drehe mich zur Spiegelwand (beide Längswände unseres Lokals sind nach französischer Bistrot-Fasson komplett ausgespiegelt) und schließe den Kragen, indem ich das bunte Band zur Fliege binde. Das ist einer der Höhepunkte meines Tages, das Fliegebinden ist der Trommelwirbel, ich bin bereit. Auch Liliane steht jetzt, sie streicht ihr Kleid glatt und bringt ihr nach innen geföhntes, nackenlanges Haar in Form, indem sie mit nach oben gerichteten offenen Händen darunter fasst und es leicht federnd hebt.
Ich gehe zur Kaffeemaschine an der Schwingtür, drücke Knöpfe, presse Tasten, lasse es brummen, fauchen und zischen und stelle uns und den Servicekräften, die jetzt aus allen Ecken in den Gastraum kommen, eine Reihe von Kaffeetassen hin, den finalen petit café. Auch die Köche kriegen ihn. Mit dem Konzentrat schlürfen wir uns den letzten Schuss der nötigen Fokussierung an, denn jetzt rückt der Minutenzeiger auf der Uhr über der Eingangstür um den letzten Strich vor auf die Zwölf.
Liliane tritt zum Eingang, zieht den an messingnen Ringen klimpernd gleitenden weinroten Samtvorhang zurück, dreht den Schlüssel, öffnet die Tür nach außen und lässt die Gäste heiteren Blicks und mit einem sonnigen Bonjour! herein. Auch die Gäste lächeln jetzt erwartungsvoll und sehen sich beim Eintreten um. Christine, unsere Kellnerin Daisy und ebenso meine zur Punktlandung aus dem Büro im ersten Stock herabgeschwebte Tochter Pauline, sie alle treten hinzu, helfen den Gästen aus den Mänteln und geleiten sie über den schwarz-weiß gefliesten Boden an die für sie reservierten Plätze.
Auch ich begrüße sie und nehme dann die Position auf meinem Feldherrenhügel ein – dem Raum hinter der Theke. Die Theke steht vor der rechten Wand des Gastraums und reicht fast an die Küchenschwingtür heran, sie ist drei Meter lang, mit einer trennenden Glasscheibe darauf, Edelstahlflächen dahinter und Kühlschubläden darunter. Hier rücke ich mir die Werkzeuge zurecht und prüfe die Schubläden mit den Austern darin – die einen länglich, die anderen rund geformt, grünsilbrig in der Farbe; ich checke die großen und kleinen Meeresschnecken, schwarzgrau wie Granit, und die orange- bis rosafarbenen Garnelen, groß sind sie und gebogen. In meinem Rücken ist die gläserne Schankanlage mit der Phalanx offener Weine darin – jeder einzeln auf seine eigene Temperatur gekühlt.
Seit dem Öffnen sind nicht zehn Minuten vergangen, da ist die Hälfte der Tische auch schon besetzt. Einige Gäste haben die Brillen auf der Nase, sie lesen die Speisekarte und tauschen sich mit ihren Tischnachbarn aus. Liliane und die Mädels (ich darf die Kellnerinnen so nennen, sie sind d’accord) gehen von Tisch zu Tisch und reichen die Weinkarten. Da ich alles fertig und am Platze weiß, komme auch ich noch mal hinter der Theke hervor und gehe rasch an einen Tisch mit einem besonders lieben Stammgast. Hubert (so nenne ich ihn hier) ist noch nicht so lang verwitwet und kann Zuspruch gebrauchen. An meiner statt geht nun Liliane hinter den Tresen, bedient das Telefon und notiert Sonderwünsche auf Zettel.
Auf dem Tresen liegt eine Vielzahl Kärtchen mit den aufgedruckten Beschreibungen aller Gerichte des Tages, die der Service mit den Tellern anreichen wird. Auch das gehört zum Zauber des Restaurants: dass die Kellner den Gästen beschreiben, was sich ihnen bietet. Das ist wie bei den Gästen eines diplomatischen Empfangs: Der Zeremonienmeister verliest, wer den Saal betritt und sich dem Souverän, bei uns dem Gast, naht. »Die Herzogin von Chateaubriand, rosa gebraten, mit einer begleitenden Sauce Béarnaise und Pommes Dauphines, dazu kleine dies und das …!« Da aber ja an einem Tisch nicht nur eines, sondern gleich vier oder sechs verschiedene Gerichte mit Einzelbeilagen erläutert werden, kann sich der Gast die Einzelheiten unmöglich merken. Ist die Kellnerin fort, entschlüsseln die Gäste auf den zurückgelassenen Kärtchen die Teller und die Speisen in all ihren Details.
Wo ich die Theke nun schon mal verlassen habe, nutze ich die Gelegenheit, verlasse Hubert, gehe von Tisch zu Tisch und beplaudere alle Gäste, bei denen es mir ratsam scheint. Denn das ist eigentlich meine Hauptaufgabe: dass ich plaudere, mich erkundige, Teilnahme zeige, rede und rate. Nur innerlich bin ich Dompteur, äußerlich bin ich Conférencier. Die Leute erwarten das von mir, sie freuen sich darauf. Hinter der Bar achten Falk und eine Schankhilfe auf Winke, vor dem Tresen stehen die Kellnerinnen in Habacht. Auf meine oder Lilianes Gesten hin oder auch nach eigenem Ermessen eilen sie hierhin und dorthin und werfen sich in jede Bresche, die der Wunsch eines Gastes schlagen mag. Je mehr Tische besetzt sind – und binnen dreißig Minuten sind sie es alle –, desto aufmerksamer nimmt Liliane ihre Position an der Kasse wahr, sie schaut, sie wacht und eilt als Reserve hinzu, wo immer es nötig scheint. Dabei trägt sie das für sie typische Madonnen-Lächeln und strahlt Ruhe aus. Liliane ist unser Schutz und Schirm, sie ist die Ikone auf den Mauern von Byzanz.
Die Schwingtür
Warum erzähle ich das alles hier in solcher Breite? Weil das Restaurant »Le Moissonnier« ungewöhnlich ist. Es existiert schon ungewöhnlich lange mit derselben Philosophie, und es arbeitet mit einer ungewöhnlich stabilen Mannschaft der immer selben Köche und großenteils sogar denselben Kellnern. Es ist ein Lokal, das seine Gäste, so versichern sie es mir, genauso des guten Service wegen besuchen wie wegen der guten Küche. Denn das für Gastronomieverhältnisse lange und stete Arbeitsleben ermöglicht Beziehungen, solche der Gäste zu den Restaurantkräften wie solche der Kräfte untereinander.
Meine Erzählung will diese Verhältnisse schildern, sie ist ein Portrait. Ist das zu selbstbewusst? Ich hoffe nicht. Ich glaube vielmehr, dass die gewissenhafte und ehrliche Darstellung einer anspruchsvollen Gastronomie nottut, auch, damit die Gesellschaft sieht, was gerade verloren geht. Ich will unsre Verhältnisse festhalten. Dabei wird sich meine Erzählung vom Jetzt zurück in die Vergangenheit schlängeln und dann wieder ins Heute und wechseln zwischen der Welt des Gastraums und der Gäste in die der Küche und der Köche.
Die Einzigen, die sich auf allen diesen Ebenen auskennen, in der Vergangenheit wie im Heute, im Gastraum wie in der Küche, das sind Liliane und ich. So wie die doppelte Schwingtür unseres Lokals die Bereiche der Gäste und der Küche trennt und auch zugänglich macht, so sind es Lilianes und meine Erinnerungen und ist es unser Beurteilungsvermögen, das all diese Ebenen begehbar macht. Ich will sie öffnen, was uns selbst betrifft, und zwar schonungslos.
Wenn »ich« diese Geschichte hier erzähle, dann sprechen eigentlich »wir«, denn Liliane und ich erinnern und erklären die Umstände gemeinsam. Aber weil ich das Plappermaul in unserer Beziehung bin, ich der Kommunikator und sie die Schweigerin, deshalb bleiben wir beim »ich«. In sehr starkem Maße beruht die Erzählung auch auf den Beiträgen von Patricia und Eric Menchon, unseren zwei Küchensäulen. Die aber sind beide noch zurückhaltender als Liliane, weshalb sie ebenfalls ins »ich« eingebunden sind. Ich möchte Sie, liebe Leser, mitnehmen in unsere Welt der anspruchsvollen Gastronomie. Wir sind sicherlich nicht die Einzigen, die sie betreiben. Aber es werden weniger. Und sonst macht es, sonst öffnet sich ja keiner. Treten Sie mit uns durch unsere Tür.
Ab in die Küche
Während sich also der Gastraum füllt, greifen im Küchenraum seit Stunden alle Hände ineinander. Vor der Schwingtür ist die Welt von Tuch und Polstern, hinter ihr ist die von Kacheln und Edelstahl. Nur wenig wird jetzt in der Küche noch gesprochen, allenfalls wird gemurmelt. Hörbar sind allein Erics Ansagen der Bestellungen für die nummerierten Tische, die ihm der hinein- und herauspendelnde Service auf Zetteln anreicht: »Zweimal Short Ribs für die 12. Zwei Plats du jour für die 3. Viermal Cabillaud und einmal Pigeon für die 5.«
Jetzt rotieren die Eisenpfannen durch den Raum. Die Köche wirbeln, sie pirouettieren, springen kühn und landen sicher. Dass ich kurz mal zu ihnen reingehe und schaue, wie es läuft, das müsste gar nicht sein. Die Prozesse sind eingespielt. Aber erstens bin ich ein nervöser Charakter und zweitens ein Johnny Controletti. Und drittens aber ist es immer ein Genuss, das Ballett der zehn Köche nach Eric Menchons Choreografie tanzen zu sehen. Außerdem nehme ich sie ja mit, die Leser.
Was also sehen wir? Da ist etwa Patricia. Sie erhitzt in einer schwarzen Eisenpfanne Öl bis zum Rauchpunkt und legt vier Portionen schneeweißen Kabeljau hinein, es sind präzise geschnittene Quadrate von ziemlich exakt fünf Zentimetern Kantenlänge und vier Zentimetern Höhe. Patricia ist Eric Menchons Frau und ein stoischer Charakter. Seit 35 Jahren arbeitet sie an seiner Seite und er an ihrer. Ihre Fischportionen zischen kurz und wütend auf und brutzeln dann leise knisternd weiter. Weitere sechs Stücke Fisch würzt und hält Patricia vor.
Sie überwacht den Bratvorgang nicht etwa mit den Augen, das würde ihre Aufmerksamkeit über Gebühr fesseln, sie wendet sich ab, lauscht dem Bratgeräusch lediglich und tut derweil etwas anderes. Etwa präpariert sie eine Rotbarbe für die Höllenhitze des Holzkohlegrills. Sie überzieht den Fisch mit einem gebundenen Würzlack und hüllt den zarten Schwanz in Alufolie, auf dass er auf dem Rost nicht verbrenne.
Klingt das Gebrutzel der Kabeljaustücke, wie es soll, kehrt Patricia zur Pfanne zurück, zieht sie vom Herd, wendet die bislang nur auf einer Seite goldbraun gebratenen Portionen und lässt sie in der Resthitze der Pfanne sanft weitergaren. Mit dem Druck ihres Mittelfingers prüft sie den Gargrad der Stücke, die erst einmal entspannen dürfen – später werden sie im Dampfgarer auf Temperatur gebracht.
Auf allen Posten herrscht Konzentration, nirgends aber Hektik. Den ganzen Morgen nämlich und den Vormittag hindurch haben die Köche sich vorbereitet. Sie haben geschnitten, pariert und präzisiert, haben rohe Lebensmittel abgedeckt und wenn nötig kalt oder auch warm gestellt – das alles, um zum Service auf die Sekunde hin alles parat zu haben. Heißwasserbecken halten Saucen vor und edelstählerne CO2-Druckbehälter Schäume, Crèmes und Gelees.
Jetzt, bei der Zubereitung, zeigt sich, wie entscheidend die Vorbereitungen des Morgens, der Tage und sogar der Wochen zuvor gewesen sind, denn Spitzenküche entsteht niemals im Nu, vielmehr fügen sich die Einzelteile wie vorbereitete Intarsien fugenlos ineinander. Beim Eintreffen der Gäste wäre keine Zeit, schnell noch etwas nachzuschnitzen.
Ich gehe zurück in den Gastraum. Der ist nun ganz gefüllt, frühe Gäste unterhalten sich, ihr angeregtes Gemurmel füllt den Raum mit Konvivialität; spät eingetroffene studieren ihre Karten, hier und da wird vorfreudig gelacht, Gläser werden gehoben, und es wird angestoßen. Es ist der Klang von harmonischer Gastronomie. Aus der Küche und durch die Flügeltür tönt nun in rapider Folge das PING der »sonnette«, des Tresenglöckchens für jeden der fertig angerichteten Teller. Klapp und klapp macht die Schwingtür, durch sie hindurch kommt und geht alles. Die Servicekräfte greifen die Teller von Erics Anrichte und tragen sie mit still gleitenden, raschen Schritten und ohne jedes Schwanken an die Tische. Nichts schwappt, nichts wackelt, die Mädels servieren mit höchster Präzision.
Hinter der Theke mache ich mich an das Bereiten meiner Meeresfrüchteplatten, auf denen ich Austern, Schnecken und Garnelen arrangiere. Es umschwirren mich die Stimmen von 42 Gästen und zehn Kellnerinnen, ergänzt vom Kling und Klang der Gläser, dem Hantieren mit Bestecken und dem PLOPP der gezogenen Korken.
Ich blende das aus, sobald ich mich an die Schalentiere mache. Austern sind harte Gegner aus zwei steinernen Schalen und einem Muskel, der unbefugtes Eindringen mit aller Kraft verhindern will. Hinten sind die Austernschalen rund und vorn zulaufend spitz. Eigentlich knacke ich Austern gelassen und sehr gern, aber auch nach vierzig Jahren im Geschäft muss ich mich konzentrieren. In meine Linke lege ich ein mehrfach gefaltetes frisches Küchentuch. Mit der Spitze nach vorn und der Rundung nach hinten zur Handfläche hin packe ich die Auster fest in das Tuch, setze das Spezialmesser (einen geschärften flachen Dorn aus Stahl) gleich hinter der Spitze an und zwänge die Klinge zwischen die zwei Panzerschalen. Die Auster will nicht, so viel ist klar. Sie macht dicht. Den Druck erhöhend neige ich meinen Körper etwas nach links und dringe mit der rechten Hand und dem Messer gewaltig hebelnd vor. Wenn ich jetzt abglitte und mir den Stahl in die Hand oder den Unterschenkel rammte … Aber da macht es ein schmatzendes KNACK. Das war Auster eins. Es erwarten mich noch Dutzende.
Das wird dauern. Darum möchte ich abschweifen, liebe Leser, und Ihre Aufmerksamkeit noch einmal aus dem Gastraum in die Küche lenken und auf die vorbereitenden Arbeiten dort. Folgen Sie mir erneut durch die Schwingtür. Aber passen Sie auf Ihre Finger auf, klemmen Sie sich nicht. Mir ist da mal was passiert …
Unser Tag beginnt um fünf, dann bringen die Lieferanten die Tagesware, sie haben dazu die Schlüssel zu Haus und Hof. Ihren Wagen kurz auf der Straße parkend, bringen sie Fische und Meeresfrüchte und stellen sie im Innenhof in einen großen, knapp über null Grad temperierten Container. So ich Glück habe, bekomme ich das in meinem Bett im ersten Stock nicht mit. Dort schlafe ich unter der Woche in einem Zimmer zur Straße und vergeude so nicht die Zeit im Chaos des Kölner Berufsverkehrs. Wochentags schläft Liliane von mir getrennt; es geht nicht anders und schenkt uns etwas Ruhe. Höre ich das Geklapper der Lieferanten aber doch, dann weiß ich: Alles geht seinen Gang. Viele, viele Jahre lang war ich gegen fünf schon längst auf dem Großmarkt und habe dort eingekauft, erst vor wenigen Jahren habe ich das aufgegeben. Warum, auch dazu komme ich später.
Um sieben krieche ich aus den Federn, mache mich präsentabel und checke über die Nacht eingegangene E-Mails und Nachrichten. Ab acht Uhr bin ich unten im Restaurant und werfe die Kaffeemaschine an. Auch meine Tochter Pauline trifft dann ein, und wir besprechen den Tag. Liliane und ich sind ein Fleisch, Pauline ist unsere rechte Hand. In rascher Folge kommen nun Liliane, Eric und Patricia sowie alle anderen Köche an. Damit ich beruhigt bin und das Team am Start weiß, sagen alle einmal kurz Guten Tag.
Die ersten Verrichtungen werden nicht groß besprochen, sie sind eingeübt. Eric kontrolliert die Vollständigkeit und Qualität der Ware – er schaut, fühlt, wägt, wittert und sieht zu, dass das zu Kühlende gekühlt, das zu Lüftende gelüftet und das zu Entbeinende entbeint wird. Keine Sekunde verstreicht ungenutzt. Danach setzt er sich mit seinen Souschefs zusammen und bespricht das Tagesprogramm. Dabei trinken sie Kaffee und essen Mettbrötchen mit rieselfein gewürfelten Schalotten darauf. Das dauert fünf Minuten.
Was sich ab dann in der Küche abspielt, gleicht einem Gefecht – so mir erlaubt ist, Gäste mit Gegnern zu vergleichen. Natürlich sind Gäste niemals Gegner, wohl aber sind sie Gegenüber, und zwar Gegenüber mit einer berechtigt hohen Erwartung und mit Beschwerdepotenzial. Sie glücklich zu machen ist das Wichtigste. Zwar haben gute Köche keine Angst vor den Erwartungen anderer, denn sie sind intrinsisch motiviert. Spitzenmäßig zu kochen ist ihnen Berufung und nicht nur Beruf. Ein Koch, der nicht von sich aus seine Gäste glücklich machen wollte, würde nur eine Abfolge von Handgriffen erledigen. Der gute Koch dagegen ist beseelt. Das sieht man schon bei jedem Griff. Trotzdem ist seine Arbeit eine Operation auf dem Gefechtsfeld, von den Tischen sollen bitte nur Jauchzer der Begeisterung zurückkommen und keine Klagen.
Ich höre keinen Einspruch und bleibe also bei meinem Gefechtsvergleich. Demgemäß entspricht Erics Vorbesprechung mit seinen Souschefs der Lagebesprechung des Generals mit seinem Stab. Sie beugen sich über die Karten mit den Positionen der Gäste in »rot« und denen der Küche in »blau«. Nur wenn Rot nach zwei bis drei Stunden des Treffens zufrieden abzieht, hat Blau gewonnen – und zugleich natürlich Rot, denn das Ziel von Blau ist ja das vollkommene Glück von Rot.
Alle müssen auf dem Quivive, alle Posten mit fachlich ausgebildeten, bestens trainierten und ausgeruhten Kräften besetzt und mit genügend Lebensmitteln ausgerüstet sein. Beginnt das Treffen, ist alles »mis en place«, also tipptopp vorbereitet und an seinen Platz gestellt. Die Mise-en-Place ist das A und O der Küche.
»Haben wir eine Zahl?«, fragt mich Eric, wenn ich am späteren Vormittag kurz in die Küche komme, und er meint damit die Zahl der Reservierungen: Ich sage dann, was ich von Liliane gehört habe, sie führt die Gästelisten und weist die Plätze zu. Ich sage ihm also eine Zahl wie »26« oder »32«, das muss reichen, und dann greift alles ineinander.
Das Rauschen der Dunstabzüge, das Geplänkel der elektrisch geschlagenen Schneekessel, das Surren und Fauchen der Stabmixer, das Schlackern der mit Crèmes und Emulsionen befüllten Spritzbeutel, das Klirren und Klappern der vom Service aufgetürmten und abgeräumten Teller, das Gepiepe und Geklingel der Signaluhren – sie alle sind der Gefechtslärm, der von unseren Köchen verlangt, sich nahezu allein über Blicke und Gesten zu verständigen, damit die wesentlichen Befehle wie »dreimal Taube, fünfmal Kabeljau, einmal Risotto« bei normaler Stimme hörbar bleiben. Rufe oder gar Gebrüll sind Eric ein Graus – sie verbieten sich aber auch, weil die Trennung zwischen dem Geplauder im Gastraum und dem Getümmel in der Küche nur aus der Schwingtür besteht, die dazu noch ständig auf- und zugeht.
Die Schwingtür, deren Glas nadelstreifig teilmattiert ist, ist die Blut-Hirn-Schranke zwischen Gastraum und Küche, zwischen meiner Welt und Erics. Nichts Störendes darf durch sie nach außen dringen, allein die Kellner dürfen sie queren – und Eric natürlich, wenn er zum Ende des Service vor die Gäste tritt, gemessenen Schrittes seine Tour um die Tische macht und leicht verlegen Lob und Huldigungen entgegennimmt. Könnte er sich diese Tour ersparen, er ließe sie sein, denn Eric ist das Gegenteil eines Showmasters. Aber die Gäste sehen ihn halt gern, sie möchten die Hand streicheln, die sie so köstlich gefüttert hat, sie lieben, den zu ehren, der ihnen das Tellerglück vom Himmel holt.
Jetzt am Mittag liegen die Huldigungen noch fern. Bleiben wir in der Küche und bei der Arbeit dort. Auch nach mehr als dreißig Arbeitsjahren fasziniert mich die Akribie, mit der alle bei der Sache sind. Treten wir erneut Patricia an die Seite. Gleich nach ihrer Ankunft am frühen Morgen hat sie das Fleisch der enorm großen und auf knapp über null Grad gekühlten Kabeljaue portionsgerecht zugeschnitten. Im vorderen Teil des Fisches, gleich hinter dem Kopf, ist das Fleisch so dick, dass sie die Stücke nur rechteckig zuzuschneiden braucht. Hinten aber, wo das Fleisch dünner werdend ausläuft, muss sie so schneiden, dass sie die Teile gegengleich aufeinanderlegen kann, sodass sie dann von identischer Höhe und also dick wie die Vorderstücke sind. Die Geschichte enzymatisch zu verkleben ist nicht nötig, da sich das Eiweiß der Lagen beim Garen auf natürliche Weise verbindet. Der Portionszuschnitt ist eine der vielen Aufgaben Patricias. Wie sie es schafft, dass die Fischportionen wie vom Laser geschnitten sind und mehr oder minder gleich viel wiegen, ist mir ein Rätsel.
Während die einen Köche ihre Gerichte mittags finalisieren, bereiten andere schon die Zutaten für den Abend vor. In Patricias Nachbarschaft putzt und schneidet ein Kollege rohe Artischocken zu. Er bricht und zieht die Stiele ab, schneidet die Stachelblüten mit dem Messer in Form, löst mit dem Kugelausstecher das Heu aus ihrer Mitte (Artischocken sind Disteln mit einem Kern nicht essbarer Blütenstände), er lagert die geputzten Teile gegen das Braunwerden in Zitronenwasser und gart sie danach knapp in kochendem Salzwasser vor.
Aus fingerlangen Stücken Räucheraal schneidet ein anderer mit einem chirurgisch scharfen Filetiermesser papierdünne Scheiben Fischfleisch – die vorbereitende Arbeit für die »Lisette«, das von Eric entwickelte »Sandwich« aus Makrele, Geflügelleber und Aal. Fertig portioniert und in Folie eingeschlagen gekühlt wird es später ausgewickelt und auf der Plancha gegart, dem stählernen Bratfeld.
An einem anderen Platz schneidet ein weiterer Koch standfest gelierte Rinderkonsommee in dünne Schichten und stellt sie kalt. Die glasklaren Scheiben werden später im heißen Ofen oder auf dem Grill ganz kurz auf gegartes Fleisch gelegt, wo sie schmelzen und das Fleisch mit Glanz und Saft überziehen.
Die fummeligste Arbeit aber leistet Eric. An seinem Vormittagsposten an der Tür zum Hof hat er sich Kerbelblättchen, Minze, Kresse und allerlei essbare Blüten von den Stielen gezupft – eine unendlich kleinteilige Arbeit. Seine Miniaturen verstaut er in Kunststoffdosen, deren Böden er mit absorbierendem Küchenpapier auslegt, und stellt sie dann kalt. Jetzt und in der Anrichtezone am Küchenausgang (seinem Mittags- und Abendposten) legt er die einzelnen Teller damit farbig und zierlich aus.
Pingelig werkelt der eine, großflächig schafft der andere: Während Eric seine Minimalismen zupft, bereitet ein Lehrling einige Liter lavaheißer Buchweizenpolenta zu, er gießt die frisch gekochte, magmatische Masse auf ein zuvor geöltes Blech, verstreicht sie dort mit einem Winkelmesser, bedeckt sie mit einer Schicht aus Klarsichtfolie und glättet sie – darüberstreichend – vollends aus. Die Folie verhindert, dass sich eine Haut auf der Polenta bildet. Nach dem Erkalten stellt er die Masse ins Kühlhaus. Einmal erstarrt, lassen sich daraus Rechtecke schneiden oder Kreise stechen, die man über dem Grill oder auf der Plancha knusprig gart.
Zu einem Rinderfilet, das Patricia außen braun und innen »bleu« brät (also fast roh), serviert Eric seine »Sauce Béarnaise«, von der er am Morgen fünf Liter zubereitet hat. »Alle Saucen à la minute zuzubereiten geht heute nicht mehr«, sagt Eric und ich stimme zu. Das Personal reicht einfach nicht. Außerdem ist der Saucenhunger unserer Gäste derart groß, dass wir der ständigen Frage nach »noch mehr Sauce« nicht entsprechen könnten, bereiteten wir sie nicht in größerer Menge vor.
Wir finden eine Ruine
Im Lauf der Jahre haben mehr und mehr Stadtführer auf ihrer Runde durchs Kölner Agnesviertel vor unseren Fenstern gehalten und erzählt, dass unser »Sternetempel« seit Jahrzehnten Gäste aus aller Welt in diese eher triste Kölner Nebenlage locke. Mitte der 1980er, als wir noch auf der Suche nach Räumen für ein Lokal waren, sprachen aber weder der Zustand des Hauses noch seine Lage dafür, dass dort je ein französisches Bistrot eröffnen könnte. Kaum einer gab einen Pfifferling darauf, dass »Le Moissonnier« länger als drei Monate überleben und dabei jemals mehr als einen volksnahen Charakter haben würde.
Zwar war das Haus Krefelder Straße 25 im zerbombten Köln als eines der wenigen halbwegs heil geblieben, aber dann war dort zu Beginn der 1980er-Jahre eine Spielhölle eingezogen. In der ging es rasch wild und wilder zu, bis zwei Finsterlinge einander im Schaufenster über den Haufen schossen – danach entzog die Stadt dem Laden die Konzession und ließ seine Fenster verbrettern und vernageln.
Oben und hinten im Haus hatten damals (wie auch heute) zahlreiche Mietparteien ihre Wohnung, darunter waren einige mit undurchsichtigen Verhältnissen (heute nicht mehr). Hinter den Wohnungstüren schien jedes Zimmer gleich eine ganze Großfamilie zu beherbergen – über manchen brannten gar rote Lämpchen, denn im Dämmer des Hausflurs schafften Prostituierte an, und ihr Weg zum Arbeitsplatz nach oben war nur kurz. Manche Geschäfte wurden stehenden Fußes gleich im Flur erledigt. So verhielt es sich sogar noch, als wir bereits eröffnet hatten, sodass unartikulierte Geräusche durch die nur dünne Wand drangen, die den Hausflur vom Gastraum trennt.
Das alles war uns unbekannt, als wir das Lokal auf eine Zeitungsannonce hin besahen und uns an einem Wochenende vorsichtig Schritt für Schritt von hinten in die düsteren Räume tasteten. In den Stockwerken darüber hatte es kurz zuvor gebrannt, über einem Loch in der Decke gähnte ein verkohltes Chaos. Vor uns hatten andere Interessenten den Ort besichtigt und dankend abgewunken. Aber wie begabte Winzer auch in einem steinigen und steilen Stück scheinbaren Unlands ihren künftigen Weinberg erkennen, sahen wir in dem abgeranzten Ambiente die schönen raumteilenden Bögen unter der Decke, und unser geistiges Auge sah sie als Träger von Dekorationsbemalungen. Schnell wussten wir: Hier sollte unser Lokal sein, hier und nirgends sonst.
Allerdings ahnten wir beim Unterzeichnen des Pachtvertrags nichts von den Wehen des Um- und Ausbaus. Der Eigentümer und Verpächter hatte auf uns den Eindruck eines Mannes von hoher Bildung gemacht. Er war eloquent, unterrichtete Philosophie an einer Kölner Schule, war nebenbei Kirchenmaler und kannte sich – oh wie sympathisch – auch mit Weinen aus.
Ein Organisator war er aber nicht. Und verlässlich auch nicht. Wohl nicht aus Bosheit, mehr aus Überforderung hatte er die Wohnung im ersten Stock, wo wir unsere Zelte aufschlagen wollten, doppelt vermietet. Gerade hatten wir eine Couch hinaufgeschleppt, als wir beim Herbeischaffen weiterer Möbel eine türkische Mutter vorfanden, die – genau wie wir – einen Mietvertrag in die Luft hielt und bei unserem Anblick verzweifelt schrie. Auch sie wollte einziehen. Allein der Umstand, dass die bereits in der Wohnung stehende Couch zweifelsfrei uns gehörte und die Dame nur mit einem Papier wedeln konnte, überzeugte die Polizei, dass die stärkeren Anspruchsrechte wohl bei den Franzosen lägen.
Zu allem Überfluss hatte der Eigentümer auch das Ladenlokal doppelt verpachtet – wobei der andere Interessent sogar vor uns da war. Kategorischer Imperativ hin oder her, offenbar hatte der Philosoph uns interessanter gefunden, und somit standen da erneut zwei Parteien mit einem gültigen Vertrag. Wir haben nie erfahren, wie sich der Vermieter aus dieser Lage gewunden hat.
Dass wir die Lokalräume im Erdgeschoss im November 1986 vertraglich gemietet und in der Folge Tische, Stühle, Geschirr, Gläser, Weißzeug und nicht zuletzt die Weinschankanlage bestellt hatten, hieß nicht, dass die dauerkiffende und Ströme von Kölsch kippende Bauarbeitertruppe des Vermieters sich bei der Renovierung gesputet hätte. Die Jungs kümmerten sich mehr um Joints und Bier als um Mörtel und Kelle. Die Arbeiten schleppten sich zum Verzweifeln lange hin.
Wir lebten damals allein von Lilianes Gehalt, und entsprechend waren wir nervös. Am 10. April 1987 konnten wir dann endlich eröffnen. Rückblickend scheinen fünf Monate Renovierungsarbeiten nicht so lang, aber für Einsteiger ohne große Einkünfte hätte alles schneller vorangehen können. Unruhe und Selbstzweifel peinigten mich, eine Charakterschwäche, um die ich weiß und die später noch stärker wirksam würde. Ich schnitzte und feilte immerzu weiter am Konzept, bestellte Gläser um, Porzellan neu und machte überhaupt Druck. Zwischenzeitlich zog eine von Lilianes Schwestern nach Köln und kümmerte sich als Au-pair um unsere Tochter Pauline.
Das alles erzähle ich also dem Hubert beim Wein. Dann erheben wir uns, er zahlt und geht in seine Kanzlei, während ich mich nach oben zu einer »sieste« zurückziehe, wie man in Frankreich sagt, zu einem Schläfchen. Auch Eric ist für drei Stunden weg, wobei Patricia ihn nach Hause chauffiert und er seinen Schlaf schon im Wagen beginnt. Zu Hause haut er sich dann auf die Couch, schläft richtig fest und kehrt zum Abend mit der S-Bahn in die Stadt zurück – ohne Patricia, die arbeitet nur halbe Tage, da Eric und sie zwei Töchter haben. Auch die anderen Köche gehen zwischenzeitlich nach Hause und verschnaufen, bevor es abends noch einmal und stärker wieder losgeht.
Das war für 36 lange Jahre das Mörderische an unserem Unternehmen, dass wir zwar zwei Sterne im Guide Michelin hatten, aber täglich gleich zweimal öffneten, mittags und abends. Das ist eher ungewöhnlich für ein Spitzenrestaurant, von denen die meisten nur abends öffnen und sich den ganzen Tag der Vorbereitung allein des Abendservice widmen können.
Wir aber, die wir weder einen Sponsor noch ein Hotel im Hintergrund, wohl aber fixe Kosten ohne Ende hatten, fuhren zwei Schichten. Die Köche waren einverstanden. Sie waren Arbeitstiere und wussten, dass ihre Gehälter irgendwoher kommen mussten.
Damit ich den Tag überlebte und auch abends bis 24 Uhr noch halbwegs luzide brabbeln konnte, legte ich mich nachmittags zwei Stunden zum Schlafen ins Büro. Ich schraubte mir Ohropax in die Muschel, schaltete einen Ventilator ein (weil mich das surrende Geräusch beruhigt) und haute mich auf eine Schlafcouch. Vor meinem Zimmer machte Liliane derweil die Buchführung und passte auf, dass mich niemand störte.
Am Anfang ist der Fond
Wenn Sie erlauben, liebe Leser, nutze ich die erzählte Zeit meines Mittagsschlafs, um Sie in den Küchenalltag zurückzuführen. Denn wenn sie vor den Köstlichkeiten sitzen, die Eric und seine Mannschaft seit 36 Jahren aus der Küche schicken, fragen sich viele der Gäste: Wie machen die das?!
Ich beginne mit einem essenziellen Teil jeglicher anspruchsvollen Küchenarbeit (in der westlichen Küche jedenfalls) – den Fonds. »Kein gutes Gericht ohne eine gute Sauce und keine Sauce ohne Fond«, sagt Eric. Und was genau sind Fonds? Es sind flüssige Auszüge fester Lebensmittel, sie ähneln Tees, nur sind es Auszüge aus Fleisch, Fisch und Gemüse. Weil sie nur unterstützen und nicht vorschmecken sollen, werden Fonds weder gesalzen noch gewürzt. Als Grundlage für seine Küche bereitet Eric drei Basisversionen zu, eine aus Geflügel, eine aus Kalb und eine dritte aus Fisch. Diese Basisfonds baut er nach Bedarf mithilfe weiterer Garprozesse und neuer Zutaten geschmacklich aus – so macht er aus seinem Kalbsfond mit zusätzlichen Knochen von Wild ein Wildfond, mit Taubenknochen und Geflügelfond einen Taubenfond und aus einem Haufen Karkassen von Krebsen und Langustinen unter Zuhilfenahme von Fischfond einen Krustentierfond.
Der mengenmäßig wichtigste ist der täglich hergestellte Geflügelfond, auch Fond Blanc, also weißer Fond, genannt. Erics Gerichte schmecken allesamt dicht und unterschwellig intensiv, niemals aber offen salzig. Wenn auf den Tellern der Gäste selbst jede kleine Gemüsebeilage brilliert und aus sich selbst heraus leuchtet, warum ist das so? Weil Eric seine Gemüse nicht mit Wasser gart, sondern mit Fond Blanc. Er braucht davon 50 Liter pro Woche. Da aus einem Ansatz mit zunächst 50 Litern Wasser am Ende eine Reduktion von nur 20 oder auch nur mal 15 Liter Fond bleibt, braucht er also drei Ansätze, um auf die benötigte Gesamtmenge zu kommen.





























