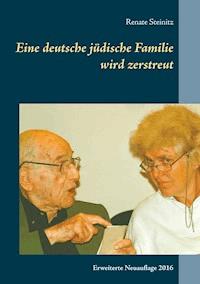
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dies ist die Geschichte meiner Familie, soweit ich sie anhand von Urkunden und anderen Überlieferungen, aus Lebenserinnerungen und Briefen naher und fernerer Verwandter zurückverfolgen konnte. Zunächst wollte ich meine Wurzeln kennenlernen. Dabei habe ich eine weit verzweigte Familie entdeckt. Und das Schicksal meiner Familie von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis in die heutige Zeit scheint mir exemplarisch für jüdische Schicksale in Deutschland zu sein. Der soziale Kontext der Juden veränderte sich innerhalb weniger Generationen radikal: von Diskriminierung und Isolation über mehr oder minder geglückte Assimilation in die Gesellschaft bis zur Ermordung oder Vertreibung in alle Welt und – im Glücksfall – zu einem Leben in einer neuen Heimat. Mit dem Schreiben begonnen habe ich nach unserem ersten Familientreffen 1998 in Berlin. 2008 erschien die erste Fassung. Inspiriert von weiteren Familientreffen, bei denen ich wertvolle Anregungen bekam, habe ich danach vieles ergänzen und Familienmitglieder gewinnen können, eigene Darstellungen hinzuzufügen. Weitere Recherchen und Hinweise mir bisher unbekannter Quellen erbrachten eine Materialfülle, die ich unbedingt noch verwerten wollte. Vieles davon findet sich im Teil II, der den durchaus möglichen, aber bislang ungewissen Verbindungen zur Wurzel unseres Stammbaumes nachspürt. Aufgeschrieben habe ich diese Familiengeschichte für uns alle. Auch für Freunde, die mich zu dieser Arbeit ermuntert haben und sich nun für das Ergebnis interessieren. Und vielleicht hat die Generation der in diesem Jahrhundert geborenen später einmal Lust, hier anzuknüpfen. Berlin, im August 2016 Renate Steinitz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Die Geschichte der Familie Steinitz von 1751 bis heute
Stammvater Salomon und Sohn Mosche Laib
Salomon Steinitz
Mosche Laib
Mosche Laibs Nachkommen
3.1. Mosche Laibs Sohn Israel 1*
3.2. Mosche Laibs Sohn Siegfried 2*
3.3. Mosche Laibs Sohn Julius 3*
3.4. Mosche Laibs Sohn Sigismund 4*
3.5. Sigismunds Sohn Ernst 41*
3.6. Sigismunds Sohn Kurt 42*
3.7. Kurts Sohn Wolfgang 423*
3.8. Mosche Laibs Töchter Ida 5* und Selma 5’*
3.9. Mosche Laibs Tochter Anna 6* (Lichtenstein)
Die Vertreibung
4.1. Sowjetunion – Schweden
4.1.1. Kurts Tochter Ruth 422* (Peters)
4.1.1.1. Ruths 422* Sohn Jan
4.1.1.2. Ruths 422* Tochter Monica (Bassow)
4.1.2. Kurts Sohn Wolfgang 423*
4.1.2.1. Wolfgangs 423* Sohn Klaus
4.1.2.2. Wolfgangs 423* Tochter Renate/Reni
4.1.3. Die Familien Peters und Steinitz in Schweden
4.2. Palästina/Israel
4.2.1. Sigismunds Sohn Walter 43*
4.2.2. Walters Sohn Ernst 431*
4.2.2.1. Ernsts 431* Tochter Miriam (Gidron)
4.2.3. Walters Sohn Heinz 432*
4.2.3.1. Heinz’ 432* Sohn Raphael/Raphi
4.2.3.2. Heinz’ 432* Sohn Gideon/Gidi
4.2.3.3. Heinz’ 432* Sohn Benjamin/Banini
4.2.4. Walters Sohn Gideon 433*
4.2.5. Kurts Sohn Hans 421*
4.2.5.1. Hans’ 421* Tochter Ruth
4.2.5.2. Hans’ 421* Sohn Dan
4.2.5.3. Chawas Sohn Michael Strauss
4.2.6. Julius’ Sohn Franz 31*
4.2.7. Franz’ Sohn Kurt 311*
4.2.7.1. Kurts 311* Tochter Rachel (Cohen)
4.2.7.2. Kurts 311* Tochter Ilana (Richardson)
4.2.8. Idas Sohn Hans 51*
4.2.9. Hans’ Sohn Hermann 511*
4.2.9.1. Hermanns 511* Tochter Hannah (Rosen)
4.2.10. Hans’ Sohn Erich/Ezra 512*
4.3. Italien
4.3.1. Kurts Tochter Ulla (Tenenbaum) 425*
4.3.2. Ullas 425* Tochter Katrin Tamara/Katja
4.3.3. Ullas 425* Sohn Alexander Victor/Sascha
4.4. USA, Kanada
4.4.1. Ottos Söhne Robert 131* und Stephan 132*
4.4.1.1. Roberts 131* Söhne Michael und Richy
4.4.2. Siegfrieds Sohn Ernst 21* und Käthe Traumann
4.4.3. Ernsts Tochter Ilse 211* (Berg)
4.4.4. Siegfrieds Sohn Otto 23*
4.4.4.1. Ottos Kinder Kurt 231* und Susi 232* (Ettinger)
4.4.5. Julius’ Tochter Ilse 32* (Nast)
4.4.6. Elses 63* und Fritz Opels Sohn Fritz Kaspar 631*
4.5. Ägypten – USA
4.5.1. Kurts Tochter Marianne/Jannu 424* (Waly)
4.5.2. Mariannes 424* Sohn Haidar Waly
4.6. Neuseeland
4.6.1. Else Opels Tochter Marianne 632* (Haiselden)
4.7. England
4.7.1. Idas Tochter Martha Steinitz 59*
4.7.2. Ottos Tochter Eva Steinitz 133*
4.7.3. Käthes Sohn Werner Goerke 561*
In Deutschland geblieben, deportiert, ermordet
5.1. Israels 1* Kinder Paul 11*, Richard 12* und Franziska 14*
5.2. Israels 1* Sohn Otto 13* und Idas 5* Tochter Else 53*
5.3. Idas 5* Sohn Georg 57* und Elli Heinrich
5.4. Idas 5* Tochter Käthe 56* (Goerke)
5.5. Anna Lichtensteins Tochter Else 63* (Opel)
5.6. Otto Jacobsohn und Erna
5.6.1. Anja Jacobsohn (Kerbel)
5.6.2. Lilo Jacobsohn (Schiebler)
Nach dem Krieg: Filialen in allen Ländern
6.1. Die neue Heimat
6.2. Die Juden und Nachkriegsdeutschland
6.3. Die Rückkehr der Familien von Ruth und Wolfgang
Sind wir verwandt?
Salomons Kinder Helene und Jakob
1.1. Josef Arie/Jossi Kornweitz
1.2. Zwi Steinitz
1.3. Georg Steinitz (1893-1940?)
Salomons Tochter Jeanette (Cassirer)
2.1. Jim Falk
Salomons Tochter Wilhelmine – Nicholas Rose
Salomons Sohn Julius – Eugen
Simon von Cassel – Warburg
5.1. Sophie Meyerstein (Levy)
5.2. Gottlieb Klein
5.3. Peter Silton
5.4. Gerry Fry
The Lost Tribes – noch auf der Suche
6.1. Hans Steinitz und Tochter Lucy
6.2. Hans Steinitz und Trude Sojka
6.3. Sebastian David Steinitz
6.3.1. Joanna Bochenska
6.3.2. Lotte Steinitz – Ingeborg Hunzinger
6.3.3. Beate Schaller
6.3.4. Ernst Steinitz – Dominic
6.4. Jonas Steinitz – Siegmund – Franz
6.5. Hugo Steinitz
6.6. Heinrich Steinitz
Weitere Anfragen
Literaturverzeichnis
Stammbaum
Die Geschichte der Familie Steinitz von 1751 bis heute
Die Steinitz’ – eine jüdische Familie? Eine seltsame Frage? Sie bewegt mich seit längerer Zeit.
Meine Großeltern Kurt und Else Steinitz waren 1913 in Breslau aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten. Mein Vater Wolfgang Steinitz hatte schon als Jugendlicher radikal mit jüdischer Tradition gebrochen. Er hätte sich womöglich über die Bezeichnung „jüdische Familie“ gewundert.
Obwohl: Wolfgangs Großvater Sigismund war Kohlenhändler und stand noch fest im jüdischen Milieu. Als „Nichtarier“ wurde Wolfgang 1933 von der Berliner Universität relegiert. Im schwedischen Exil bezahlte teilweise eine jüdische Stiftung seine Assistentenstelle an der Stockholmer Universität.
Wolfgangs Schwester Ulla Tenenbaum (s. Kapitel 4.3.1.) meinte zum Titel meiner Familiengeschichte: „Wer Jude ist, das bestimmen doch nur die anderen!“
Wolfgangs Bruder Hans (s. Kapitel 4.2.5.) ist dagegen sehr bewusst nach Palästina emigriert. Er schreibt 1981 meiner Mutter zum Vorwort eines Buches von Wolfgang, das sie ihm geschickt hatte:
Warum wird niemals Wolfs jüdische Herkunft auch nur erwähnt?! Vielleicht wendet man ein, dass das unwichtig sei. [...] Eine objektive Darstellung sollte so ein Faktum getreulich und wahrheitsgemäß überliefern und die autonome Meinungsbildung der denkenden Nachwelt überlassen.
Diesen Brief hab ich bei der Neuordnung meines Privatarchivs entdeckt.1 Er bestärkt mich darin, der Geschichte unserer Familie nachzuspüren.
Auch für meinen Bruder und mich wäre früher die Frage „Sind wir eine jüdische Familie?“ seltsam gewesen.
Obwohl: Als etwa Fünfjährige soll ich gesagt haben „Jetzt bin ich Halbjude, wenn ich groß bin, bin ich Ganzjude“. Das kam wohl nicht von ungefähr; meine Mutter war Nichtjüdin. Natürlich war mir nicht bewusst, dass ich mit „Halbjude“ ein Nazi-Wort übernommen hatte.
Erst spät näherte ich mich der jüdischen Herkunft meines Vaters und nahm wahr, wie groß unsere Sippe ist und wie eng die Verwandten – außerhalb der abgeschotteten DDR – über Kontinente hinweg miteinander verbunden sind.
Spät haben wir auch jüdische Witze für uns entdeckt.2 Meine beiden Söhne und ich brauchten nur ein Stichwort zu nennen für den in einer bestimmten Situation passenden Witz. Apropos „Stichwort“:
Drei Juden sitzen im Zugabteil und erzählen sich Witze. Weil sie die Witze schon so lange kennen, haben sie ihnen einfach Zahlen zugeordnet. Ein vierter Jude kommt dazu, hört sie Zahlen rufen und alle lachen herzlich. Der Neue denkt, das kann ich auch und nennt eine Zahl. Alle schweigen. „Warum lacht ihr denn nicht, war der nicht gut?“ – „Ja schon, man muss ihn aber auch erzählen können.“
Als ich 1985 meinen entfernten Verwandten Stephan Steinitz 132*3 in den USA (s. Kapitel 4.4.1.) besuchte – zum ersten Mal durfte ich als DDR-Bürgerin 1985 Verwandte im westlichen Ausland besuchen – studierten wir zusammen den von ihm verfassten Stammbaum der Familie und wir identifizierten alte Fotos. Nach dem Fall der Berliner Mauer war 1990 mein erstes Reiseziel Israel und die bis dahin meist unbekannten Mitglieder der Familie. Yoram, Sohn von Erich/Ezra 512* Steinitz (s. Kapitel 4.2.10.), zeigte mir ein zwei Meter breites Stammbaum-Poster, das inzwischen auf drei Meter angewachsen ist. Nach weiteren Besuchen bei Verwandten – und nachdem ich die Vorzüge des Internets auch für mich entdeckt hatte – wurde der Kontakt immer lebendiger. Glücklicherweise bekamen von der internetversierten jüngeren Generation mein Sohn Jan in Berlin und meine Nichte Erika, Enkelin von Marianne Waly 424*, in Boston (USA) (s. Kapitel 4.5.1.) auch Lust auf die Erforschung der Familiengeschichte. Jan begann 1997 eine Internet-Suche und schrieb an 70 E-Mail-Adressen. Etwa 40 Steinitze antworteten, aber nicht alle waren mit uns verwandt. Es entstanden mehrere Projekte: Erika und Jan übertrugen alle Informationen in eine Datenbank. Jan richtete eine Familienwebsite4 ein. Ich sammle alles mir zugängliche Material in meinem Familienarchiv.
Mein Sohn und ich kamen auf die Idee, ein Familientreffen zu veranstalten und wir schrieben einen Rundbrief an die uns bekannten Adressen. Das Treffen fand 1998 in einem Landhotel bei Berlin statt, mit Ausflügen in die Stadt und sogar mit einer Klezmer-Band, die bei mir zu Hause auf der Terrasse aufspielte. Mehr als vierzig Verwandte waren gekommen und viele erzählten Geschichten aus ihren Familien.5 Ein zweites Treffen fand im April 2000 in Jerusalem statt, vorbereitet vor allem von Benjamin/Banini (Sohn von Heinz Steinitz 432*) und seiner Frau Rivka. Und im Juni 2006 organisierten meine Söhne und ich ein weiteres Treffen in Berlin mit einem Ausflug nach Breslau, wo die meisten Familienmitglieder zu Beginn des 20. Jh. gelebt hatten. Und wieder erzählten wir uns Familiengeschichten.6 Der Enkel meines Bruders Klaus, Benjamin/Benni Steinitz, der sich bei der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus viel mit dem Judentum beschäftigt (s. Kapitel 4.1.2.1), bereitet ein weiteres Familientreffen im September 2016 mit vor.
Kaum zu erklären, aber schon beim ersten Treffen hatten wir das Gefühl von Vertrautheit und Zusammengehörigkeit, einschließlich politischer Kontroversen. Und wir wurden inne, welch außergewöhnliches Glück es ist, nach der Shoah, der Massenvernichtung der Juden unter Hitler, noch eine so große Familie zu haben.
Bei der Vorbereitung unseres ersten Familientreffens 1998 begann ich mit den ersten Notizen zur Geschichte unserer Familie. Es wurde ein Unternehmen, das ich für mich die unendliche Geschichte unserer Familie nenne. Die erste Auflage erschien 2008. Inzwischen habe ich weitere Familienmitglieder gefunden, so dass diese Neuauflage wesentlich umfänglicher geworden ist. Dabei beschränke ich mich in Teil I (bis auf eine Ausnahme im Kapitel 5.6.) auf die Nachkommen von Salomons Sohn Mosche Laib. Meistens reichen meine Informationen bis zur Generation meiner Eltern, die im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts Geborenen. Dort, wo ich Kontakt mit den Jüngeren habe, versuchte ich sie zu bewegen, etwas über ihr Leben aufzuschreiben. In den meisten Fällen ist es geglückt, aber manchmal bekam ich nur Berichte über Berufe oder einen kahlen Stammbaum. Um die Berichte nicht zu zersplittern, habe ich die jüngere Generation vor allem im Kapitel 4. „Die Vertreibung“ beschrieben.
Während ich an der erweiterten Fassung schrieb, starben die ältesten Mitglieder unserer großen Familie, die Anfang des 20. Jahrhunderts Geborenen:
Lore Baum, Witwe von Robert Steinitz 131*
Ulla Steinitz 425* und ihr Mann Marco Tenenbaum
Marianne Opel 632*, Witwe von Tom Haiselden
Elisabeth Bruck, Witwe von Kurt Steinitz 311*
Toni Sakur, Witwe von Gideon Steinitz 433*
Ihnen möchte ich hier auch ein „Denk-mal“ setzen. Jetzt sind wir, die nach 1925 Geborenen, die älteste Generation.
Meine weitere Suche nach neuen Verwandten und den Nachfahren weiterer Kinder von Salomon hat schon zu ersten Erfolgen geführt.
Deshalb eröffne ich einen Teil II mit dem Titel „Sind wir verwandt?“.
So könnte die Familiengeschichte wachsen und fortgeschrieben werden. Ich habe hiermit den Anfang gemacht und schreibe immer weiter in der Hoffnung, dass es eine Tradition wird. Wo ich Fotos von Verwandten habe, füge ich sie ein.
Ich bin mir bewusst und es sollte immer berücksichtigt werden, dass alle Familienerinnerungen, auch meine eigenen, subjektiv sind und keinen Anspruch auf wissenschaftliche Exaktheit haben.
Was ist typisch jüdisch an den Steinitzen?
Ich weiß, woher die Legende vom Reichtum der Juden kommt: Sie bezahlen alles. (S. Lec: Unfrisierte Gedanken S. →)
Die Frage „Was ist typisch jüdisch?“ bewegt mich, wenn ich in dem anwachsenden Stapel schriftlicher Nachrichten der Familie aus verschiedenen Zeiten und verschiedenen Ländern blättere. Die Familie rückt mir immer näher. Manchmal sind mir nur magere Geburts- und Todesdaten bekannt, zwischen denen ich mir ein Schicksal vorzustellen versuche. „Typisch jüdisch“ will ich aus der Belastung der antisemitischen Bedeutung herausnehmen. Wir haben weder besonders krumme Nasen noch großen Reichtum. Typisch jüdisch ist für mich vielmehr, dass innerhalb weniger Generationen der soziale Kontext sich radikal veränderte – von der Diskriminierung und Isolation der Juden über eine mehr oder weniger geglückte Assimilation in die deutsche Gesellschaft bis hin zur Verfolgung und Ermordung. Wer das Konzentrationslager überlebte oder rechtzeitig emigrieren konnte, wurde in alle Welt zerstreut (griechisch Diaspora – „Zerstreuung“). Und wurde schließlich sesshaft in der neuen Heimat.
Insofern habe ich die Puzzle-Arbeit, unterschiedliche Quellen aufzuspüren und miteinander zu verbinden, nicht allein für mich und meine Familie immer weiter getrieben. Die Beschreibung der Schicksale der Familie Steinitz verstehe ich auch als Fallstudie über die Wege vieler jüdischer Familien und ihren Zusammenhalt in ruhigen wie in Notzeiten, und derer gab es viele.
Im Varieté: Ein Vortragskünstler tritt auf. Ein Jude zu seinem Nachbarn: „Einer von unsere Leut.“ Eine Sängerin, ein Tänzer: „Auch von unsere Leut.“ „Oh, Jesus!“ stöhnt der Nachbar. „Auch von unsere Leut!“
(S. Landmann: Jüdische Witze)
Wenn ich im Stammbaum der Familie Steinitz herumklettere, bin ich erstaunt, wie viele fruchtbare Äste er trägt. Und ich treffe auf bekannte Namen: Durch Heirat kamen die Geschlechter Cassirer7 und Warburg8 in unsere Familie (oder wir in deren), mein Onkel Hans 421* war in zweiter Ehe mit Martin Bubers Tochter Chawa verheiratet, Hans’ Tochter Ruth ist mit Bubers Enkelsohn Michael Strauss verheiratet9.
Von Salomon Steinitz’ Sohn Mosche Laib. (Teil I) haben wir die meisten Nachrichten. Ich sammle aber auch alles, was ich von den anderen Kindern Salomons erfahre, auch Unsicheres, zur Fortführung einladend in Teil II,
Bei den vereinten Forschungen zur Familiengeschichte haben wir bisher, die Angeheirateten eingerechnet, über 500 Nachkommen von Salomon in unsere Datenbank eintragen können. Dabei sind uns bisher nur die wenigsten der 19 Kinder von Salomon und ihre Nachfahren bekannt.
Die Steinitze hatten immer – wie in jüdischen Kreisen üblich und zu vielen Zeiten durchaus nötig – untereinander Verbindung. Im Stammbaum mochten sie weit voneinander entfernt sein, im Leben aber hielten sie auch über die Grenzen der engen Familie hinaus zusammen. Gemeinsame Erfahrungen und Erinnerungen sowie bis zu Beginn des 20. Jh. auch die gleiche Religion gaben Sicherheit; man unterstützte sich wechselseitig. Auch heute gibt es Besuche quer über die Kontinente; zu Beginn des 20. Jh. indes war die Entfernung geringer, die meisten lebten in Deutschland.
1 Der größte Teil des Wolfgang-Steinitz-Nachlasses befindet sich im Berliner Akademie-Archiv
2 Jüdische Witze, ausgewählt von Salcia Landmann, waren lange eine sprudelnde Quelle für uns.
3 Mit „Zahl*“ wird auf die jeweilige Position im Stammbaum von Mosche Laib verwiesen.
4family.steinitz.net
5 In meinem Archiv finde ich: Dans (Israel) sechsseitige Geschichte „From Germany to Palestine“; Katrins (Tochter meines Bruders Klaus) Geschichten über ihre beiden Großväter Wolfgang Steinitz und Kurt Stern „Geschichte und Familiengeschichten“
6 Unter anderem hat Rivka beim Meeting in ihrer Rede „Open Circles“ über die vielen Beziehungen in der großen Familie erzählt.
7 Die Verwandtschaft mit der bekannten Cassirer-Familie ist schon fester Bestandteil der fortgeführten Familiengeschichte, s. Teil II, Kapitel 2.
8 Die Warburgs gehören zu den Vorfahren meiner Großmutter Else Jacobsohn, verheiratet mit Kurt Steinitz. Ihr Stammbaum reicht zurück bis ins 16. Jh. zurück. Da ich im Herbst 2011 einen direkten Nachfahren Nicholas Rose von ihnen kennen gelernt habe, möchte ich in Teil II das Kapitel 3. diesem Zweig widmen.
9 Martin Buber (1878-1965), Schüler und Freund von Theodor Herzl, war ein jüdischer Religionsphilosoph, der die kulturelle und geistige Erneuerung des Judentums vertrat. 1930 wurde er Honorarprofessor für Sozialwissenschaften an der Universität Frankfurt/M. 1935 verboten ihm die Nazis jede öffentliche Tätigkeit. Er emigrierte 1938 nach Palästina und wurde Professor für Sozialpsychologie in Jerusalem. 1944 trat er in der Schrift „Israel und Palästina“ für eine jüdisch-arabische Verständigung ein. Buber war 1960-1962 der erste Präsident der Akademie der Wissenschaften Israels. 1955 war er Mitbegründer des Leo Baeck Instituts.
I Stammvater Salomon und Sohn Mosche Laib
1. Salomon Steinitz
Ehe sie verpflichtet wurden, einen festen Familiennamen zu tragen, benannten sich jüdische Familien oft – wie auch bei Nichtjuden anzutreffen – nach ihrem jeweiligen Herkunftsort. Beispiele aus der Familie sind Prager, Guttentager, Cassel.
Varianten von „Steinitz“ finden sich als Ortsbezeichnungen in Böhmen, Südmähren und Moldawien. Verwandte haben mir von einem Ort Ždánice im Steinitzer Wald in Mähren geschrieben. Der russisch-amerikanische Linguist Roman Jakobson (Harvard University) schrieb nach dem Krieg meinem Vater Wolfgang über die mögliche Herkunft der Familie Steinitz. Beim Durchforsten jüdischer Bibliotheken in New York hatte er einen Ort in Südmähren gefunden, der im Mittelalter Stanica hieß. Es war ein reich entwickeltes jüdisches Gemeinwesen. In jüdischen Texten wurde der Ort Stejnic genannt. Eine Sippe, aus der u.a. Rabbiner für die umliegenden jüdischen Gemeinden hervorgingen, nannte sich Stejnic. Einige ihrer Mitglieder gelangten nach Schlesien, nachdem sie im 13. Jahrhundert aus ihrer Heimat vertrieben worden waren. Ob darunter die Vorfahren von Salomon waren?
Jürgen Kunze, ein früherer Kollege an der Akademie der Wissenschaften, sieht als namenskundlicher Experte hierzu folgende Möglichkeiten: (i) der Familienname Steinitz ist ein Herkunftsname, der auf Siedlungsnamen beruht; (ii) die Basisnamen stammen sämtlich aus slawischen Sprachen; (iii) es gibt vermutlich mehrere Sippen dieses Namens, zwischen denen keine genealogischen Verbindungen bestehen (pers. Mitteilung). Von Gerhard Schlosser aus Cottbus bekam ich die Information, dass in Oberschlesien ein Dorf bis 1933 Stanitz hieß. Die Nazis machten daraus Standorf, aber die Bevölkerung nahm die Nazi-Umbenennung nicht an. Seit 1945 nennen es die Polen Stanica. 2011 bekam ich eine ganz andere, nicht jüdische Herleitung des Eigennamens: der Name setze sich zusammen aus „Stein“, abgeleitet von einem wendisch-sorbischen Heerführer Steno und „itz“ wendisch „Sohn des“. In Deutschland haben mehrere Orte den Namen Steinitz. Mein Bruder gab mir jetzt eine Wanderkarte zum Ort Steinitz, am nördlichen Tagebaurand Welzow-Süd. Von einem neu gefundenen Fast-Verwandten Helmut Steinitz bekam ich folgende Information: Um 1640 taucht in den alten Matrikeln der böhmischen Diözese Leitmeritz der Name Steinitz auf. Da kauft ein Mattes Steinitz ein Häuschen in dem Ort Stran.
Unser ältester bekannter Vorfahr ist Salomon Steinitz. Er ist 1751 in Cosel geboren. Er war Lehrer einer jüdischen Schule. Salomon zog nach Langendorf und hatte mit seiner ersten Frau, deren Namen ich nicht kenne, sechs Kinder. Nur vom Sohn Ludwig, der 1780 geboren wurde, kennen wir Nachkommen. Nach dem Tod seiner ersten Frau 1790 schloss Salomon eine zweite Ehe mit Rachel Guttentager (geb. 1779 in Guttentag) Sie hatten zusammen dreizehn Kinder, von denen die letzten vier in Gleiwitz geboren wurden. Salomon hatte also neunzehn Kinder! Die Familie war 1811 nach Gleiwitz gezogen.
In Gleiwitz erwarb Salomon 1813 auf Grund des Preußischen Emanzipationsedikts10 die preußische Staatsbürgerschaft. In den Gleiwitzer Magistratsurkunden lesen wir über ihn im schönsten Bürokraten-Deutsch der damaligen Zeit:
[…] daß nachstehend aufgeführte Jüdische Familien Häupter zu Gleiwitz durchaus nicht im Stande sind, die Stempel und Expeditionsgebühren für die denselben von Einer Königl. Hochpreißlichen Regierung von Schlesien ertheilten Staatsbürger Atteste zu bezahlen.
[...] 9. der Jude Salomon Steinitz [...] weil selbige in der größten Armuth sind und bei ihrem Alter nur vom Bettel-Brod ihrer Glaubens-Genoßen leben, solches wird behufs der höchsten Niederschlagung der Stempel- und Exped. Gebühren hiermit auf Pflicht und Wahrheit attestiret. Gleiwitz, den 18. December 1813, Magistratus [...] Die Juden erklärten, daß sie die höchste Gnade in Betref der ihnen geschenkten Kosten für die Staatsbürger-Atteste mit dem größten unterthänigsten Danke anerkennen, und zugleich hiermit ausdrücklich bekennen, die ausgefertigten Königlichen Regierungsatteste als Preuß. Einländer und Staats-Bürger richtig erhalten zu haben. Ferner verpflichteten sich dieselben, für sich und ihre Kinder, daß sie unter keinem Vorwande sich andere Nahmen geben würden, als blos die eingeschriebenen, noch, daß ihre Söhne ihre Familiennahmen im geringsten ändern, und andere willkührliche Nahmen annehmen dürften, wie seithero sonst geschehen ist. Auch unterwarfen sie sich dem Befehle, daß sie sich bei Führung ihrer Handelsbücher, sowie auch bei der Abfassung ihrer Verträge und rechtlichen Willens-Erklärungen nur der deutschen oder einer anderen lebenden Sprache und bei ihren Nahmens Unterschriften keiner andern als der Deutschen oder Lateinischen Schriftzüge bedienen dürften. Jedoch bathen sie zum Theil, daß ihnen wegen Alter das Erlernen der deutschen oder lateinischen Schriftzüge schwer gehe, mit ihnen dahero in einzelnen Fällen Nachsicht gehabt werden möchte. Dagegen erzögen sie ihre Kinder im Unterricht des deutschen Lesens und Schreibens und in der Liebe für den König, das ganze Preuß. Haus und Vaterland, worauf dieses Protokoll geschlossen und nach geschehener Vorlesung und Genehmigung von sämtlichen Comparanten unterschrieben wurde. Magistratus11
In einander nahe gelegenen Kleinstädten12 lebten Salomons Nachkommen bis zum Ende des 19. Jh.13Gottlieb Klein (s. Teil II, Kapitel 5.2.) hat die jüdische Geschichte bis zur Reformation beschrieben; meine Zusammenfassung:
Die nachbiblische Geschichte der Juden ist ein Martyrium, von der christlichen Kirche verursacht. Bei den Kreuzzügen im 11. und 12. Jahrhundert wurden über hunderttausend Juden getötet. Einige Fürsten im Deutsch-Römischen Reich nahmen sog. Hof-Juden unter ihren Schutz. Die Fürsten konnten aber frei über sie verfügen. Als die Macht der Kaiser und Fürsten Anfang des 13. Jahrhunderts aber zu wackeln begann, fingen die „dunklen Jahrhunderte“ für die Juden an. 1215 bestimmte der Papst, dass Juden ein sichtbares Zeichen tragen mussten (den späteren Judenstern). Die Unterdrückung der Juden war aber nicht überall gleich. In Mitteleuropa gab es verschiedene, auch wissenschaftliche Verbindungen zwischen Christen und Juden. Sie wurden aber abgebrochen aus Angst der Kirchen vor Ketzerei. In Paris wurden Schriften des Talmud verbrannt, jüdische Gebete wurden verboten. Mönchsorden waren oft das ausführende Organ der Kirche. In Spanien hatten die Juden lange Zeit in Freiheit und Wohlstand gelebt – bis viele von ihnen „zu Gottes Ehren“ 1442 getötet wurden. Die Juden hatten aber auch Verteidiger in der Kirche. In der Fehde zwischen dogmatischem und humanistischem Christentum konnte auch das humanistische siegen. 1520 ließ Papst Leo X. den Talmud drucken. Der Weg zur Reformation unter Martin Luther war frei. Als die Juden aber ihren Glauben nicht änderten, ging auch Luthers Einstellung in Hass über. In seiner Schrift „Von den Juden und ihren Lügen“ (1545) greift er die Juden mit den gleichen Argumenten an wie im 13. Jahrhundert.
Die vor der Reichsgründung 1871 zersplitterten deutschen Länder behielten in unterschiedlichem Maß die Ausgrenzung der Juden bis weit ins 19. Jh. bei. Das sog. Emanzipationsedikt 1812 brachte zunächst nur den Juden in Preußen die Staatsbürgerschaft. Viele Einzelstaaten zögerten noch lange. Gleichstellungsedikte wurden erlassen – und wieder zurückgenommen. Die Juden hatten vielerorts keine freie Wahl des Wohnortes (bis 1812 waren ihnen viele Großstädte wie auch Breslau versperrt). Auch viele Berufe waren ihnen verwehrt. Sie durften keinen Landbesitz haben und hatten keinen Zugang zu höherer militärischer Laufbahn und Beamtenschaft. Es waren ihnen fast nur Handel oder Kleinhandwerk als Berufe zugänglich. Mit Ausnahme wohlhabender Juden14 hatten sie kaum eine Chance, ihrem sozialen Ghetto zu entkommen. Erst 1871 erlangte das Emanzipationsedikt im ganzen Bismarck-Reich Geltung. Im Alltag hatten Juden jedoch weiterhin mit Ressentiments zu kämpfen.
Nach Moses Mendelssohn, dem Mitte des 18. Jh. unter vielen Entbehrungen der Aufstieg in die deutsche Gelehrtenwelt gelang, entstanden in Westpreußen weltliche Schulen für jüdische Kinder. Literarische Salons wurden oft von jüdischen Frauen geführt, ein berühmter Salon im frühen 19. Jh. war der von Rahel Levin, verheiratete Varnhagen in Berlin15. In Ostpreußen wird die relative Gleichstellung der Juden, etwa ihre Zulassung zu Universitäten, erst nach 1871 erreicht. Dann aber setzt der Aufstieg ein – auch in der Familie Steinitz.
10 „Edikt betreffend die bürgerlichen Verhältnisse der Juden in dem preußischen Staate“ vom 11.3.1812 (vgl. Walter Grab in: Juden in Preußen. Dortmund: 4. Aufl. 1983, S. 25). Als Beilage des Amtsblattes der königlichen Breslauischen Regierung von 1812 gibt es ein „Verzeichniß der in der Provinz Schlesien [...] befindlichen jüdischen Staatsbürger“. Es enthält neun Personen mit dem Namen Steinitz, wohnhaft u. a. in Groß-Strehlitz, Gleiwitz, Langendorf, darunter Salomon und Sebastian David (s. Teil II, Kapitel 6.3.).
11 Aus dem Staatsarchiv Kattowitz, Außenstelle Gleiwitz
12 Ihre Wohnorte in Oberschlesien, südöstlich von Breslau waren Beuthen, Cosel, Gleiwitz, Groß Strehlitz, Guttentag, Hotzenplotz, Kattowitz, Langendorf, Laufen, Oberheiduk und Ratibor, die meisten nahe beieinander liegend.
13 In Teil II, Kapitel 6.3. ist der Ort Langendorf ein möglicher Ansatz für die Verbindung des Urahns Sebastian David Steinitz von mehreren heutigen Familien mit unserem Salomon.
14 Schon früh waren sog. Hofjuden als Steuereintreiber, Wirtschafts- und Finanzberater von Landesherren reich geworden. Sie blieben aber Außenseiter und führten ein riskantes Leben, denn sie waren oft Ziel des aufflackernden Volkszorns.
15 Carola Stern hat in dem Buch „Der Text meines Herzens“ sehr einfühlsam Rahel Varnhagens Leben dargestellt.
2. Mosche Laib
Von diesem Sohn Salomons und seinen Nachfahren stammen die meisten der uns bis jetzt bekannten Verwandten ab. Mosche Laib ist 1797 in Langendorf geboren. 1874 starb er in Beuthen. Er war von Beruf Frachtfuhrmann. Mit seiner ersten Frau geb. Holländer (geb. ca. 1800 in Groß Strehlitz) hatte er zwei Söhne. Von Israel 1* (geb. 1828) kennen wir die Nachkommen, s. Kapitel 3.1. Mit Philippine Prager (1822-1878) hatte er die Kinder Siegfried 2* (1840), Julius 3* (1844), Sigismund 4* (1845,) Ida 5* (1848), Rosalie (1849), Selma 5´* (1852), Anna 6* (1855). Sie haben jeweils ein Unterkapitel im Buch.
Mosche Laib (in den Urkunden Moses Loebel genannt) und seine Söhne waren wie viele Juden Händler – Kohlenhändler haben wir viele in der Familie – und Kleinhandwerker. Das sollte sich in der übernächsten Generation radikal ändern. Bis zur Reichsgründung gab es auch in Oberschlesien für Juden keine Freizügigkeit. Noch 1841 brauchte Mosche Laib für einen Umzug ein Führungszeugnis:
Abzugs- resp. Führungsattest für den Bürger u. Frachtfuhrmann Moses Steinitz: [...] Der Bürger M.S. hat während seines Aufenthaltes am hiesigen Ort sich gut geführt, was demselben bei seinem Abzuge von hier nach Gleiwitz amtlich attestiret wird. Groß-Strehlitz, den 9. Oktober 1841. Der Magistrat
Bildung hatte bei den Juden traditionsgemäß einen hohen Stellenwert. In der Jüdischen Schule (Cheder)16 lernten Jungen schon ab drei Jahren die hebräische Sprache und studierten die Thora. Disputieren, argumentieren und unterschiedliche Sichtweisen betrachten wurde in der Synagoge praktiziert. Ein Grund für den überproportional hohen Anteil von Juden in intellektuellen Berufen war, sobald ihnen das Studium gestattet wurde, gewiss ihre hohe Ausbildungskultur.17 Man wollte oft nicht mehr in die Fußstapfen des Vaters treten, sondern strebte nach intellektueller und künstlerischer Tätigkeit. Da hier die beruflichen Aussichten trotz formaler Gleichstellung eingeschränkt blieben und eine Staatsanstellung als Lehrer, Professor oder Richter wegen des anhaltenden Antisemitismus schwer zu erlangen war, drängten die meisten jüdischen Akademiker in die so genannten freien Berufe und wurden Anwälte, Notare oder Ärzte.
Zu Beginn des 19. Jh. benutzte ein Jude in Preußen drei Sprachen: Hebräisch für Gebet und Gelehrsamkeit, Jiddisch18 für den Alltag und die Volksliteratur, sowie Deutsch für den Umgang mit der nichtjüdischen Umwelt. Mit den Integrationsbemühungen in die deutsche Gesellschaft Mitte des 19. Jh. setzte ein gesellschaftlicher Abstieg des Jiddischen ein, es wurde nur noch von den Ärmeren gesprochen, Gebildete sprachen Deutsch. Die hebräische Schrift vermittelte jedoch auch weiterhin das Gefühl von Vertrautheit. Mosche Laib korrespondierte mit den Eltern seiner zukünftigen Schwiegertochter zwar auf Deutsch, aber in hebräischer (sog. jüdischer) Schrift. Ein Brief von 1869 an ihn ist erhalten geblieben. Zu unserem zweiten Familientreffen 2000 in Jerusalem bekam ich von Banini eine Kopie des Briefes mit Fotos von Mosche Laib und einigen seiner Nachkommen, deutsch in hebräischer Schrift. Er hängt jetzt als Poster bei mir zu Hause. Ich zitiere aus dem Brief:
Ihre lieben Zeilen in der lang entbehrten jüdischen Schrift haben uns sehr erfreut und wollen wir sie als Glück verkündigende Vorboten für die künftige Verbindung unserer Kinder betrachten. Ich erwidere Ihnen deshalb auch in dieser mir etwas ungewohnten Schrift, weil sie mich an die alten guten Zeiten und an das gemütliche Verkehren der zusammengehörenden Familien lebhaft erinnert. Mit Ihrer vorausgeschickten Bemerkung, dass unsere Kinder eine angeborene starke Neigung besitzen, ihre Herzensangelegenheiten selbst zu bestimmen und zu ordnen ohne fremde Beihilfe und Einmischung, scheinen Sie den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben.
Erstaunlich, wie früh schon die Jugendlichen sich von den Eltern emanzipierten!
Der freie Zugang zu höheren Schulen und Universitäten für Juden hatte mit der Reichsgründung 1871 begonnen. Die meisten Steinitze, die Generation der nach 1870 Geborenen, schafften wie viele andere Juden den Sprung aus der Isolierung. Viele studierten, ergriffen unterschiedliche Berufe, aber Arzt und Rechtsanwalt blieben auch für sie bis ins 20. Jh. die häufigsten Berufe. Oft gingen eigener Berufswunsch und Entscheidung des Vaters auseinander. Von 25 männlichen Familienmitgliedern dieser Generation waren sieben Mediziner und vier Juristen.
Inzwischen waren viele Familienmitglieder aus den umliegenden Kleinstädten nach Breslau gezogen. Joseph Arie/Jossi Kornweitz, ein neu entdeckter Verwandter, s. Teil II, Kapitel 1.1., hat bei seinen Archivarbeiten Breslauer Adressbücher19 von 1896 bis 1943 nach dem Namen „Steinitz“ durchgesehen, natürlich nicht alles Familienangehörige. Die Häufung der Steinitz-Familie in Breslau veranlasste aber immerhin eine Angeheiratete zu der scherzhaften Drohung „wird zu 10 Jahren verschärftes Breslau verurteilt“. Die Zahl der Eintragungen in den Adressbüchern schwankt um 25. Das ändert sich auch in den Jahren nach 1920 nicht. Es fällt nur auf, dass inzwischen viele Frauen (vw. ‚verwitwet‘) den Platz eingenommen haben. Die nächste Generation hat zum großen Teil Breslau verlassen, viele leben in Berlin. Nach 1935 verlassen die Übriggebliebenen Breslau meist, um noch rechtzeitig zu emigrieren. Steinitze, die noch blieben, sind mit dem aufgezwungenen zusätzlichen Vornamen Israel bzw. Sarah im Adressbuch vermerkt.20 1941 bleibt Martha Steinitz, Witwe des Mathematikers Ernst Steinitz (s. Kapitel 3.5.) als einzige der Familie in Breslau übrig. Sie war aus Palästina zurückgekehrt, weil sie dort nicht heimisch werden konnte. Am 27. Juli 1942 wird Martha zusammen mit 1100 anderen verhafteten Juden aus Breslau nach Theresienstadt (Terezin) deportiert, zwei Monate später weiter in das KZ Treblinka.
Ab 1942 gibt es im Breslauer Adressbuch unter „Steinitz“ keinen Eintrag mehr.
16 Der Unterricht im Cheder (Hebräisch „Zimmer“) fand im Haus des Lehrers statt, der von der jüdischen Gemeinde bzw. einer Gruppe von Eltern finanziert wurde. Der Unterricht fand in kleinen Gruppen mit Jungen verschiedener Altersgruppen statt. Diese Form der Erziehung war in der Regel nur Jungen zugänglich, Mädchen lernten meist bei den Müttern nebenher.
17 Chaim Noll in einem TAZ-Interview 25.8.2009: „Das rabbinische Judentum hat es geschafft, dieses eigentlich vom Untergang bedrohte Volk 2.000 Jahre lang zusammenzuhalten.“ Die rabbinische Denkmethode hat die Juden befähigt, auch auf anderen Gebieten – Medizin, Atomphysik, Psychoanalyse, Kunst – große Denkleistungen zu vollbringen.
18 Jiddisch ist ein Abzweig des Mittelhochdeutschen, durchsetzt mit hebräischen und aramäischen Wörtern und wird in hebräischen Lettern geschrieben. Die im 14. Jh. vor Verfolgung nach Osten flüchtenden Juden nahmen ihren Heimatdialekt mit und fügten noch slawische Elemente ein (Ostjiddisch). Im 19. Jh. setzte wiederum die jüdische Immigration aus Osteuropa nach Deutschland ein. Die Immigranten und ihre ostjiddische Sprache wurden von den Juden in den alten deutschen Gebieten ziemlich herablassend betrachtet. Hier war das Westjiddische längst im Rückgang begriffen und man sprach Deutsch.
19 Zunächst herausgegeben von Graß, Bart und Company, Breslau, Herrenstr. 20. Ab 1907 Verlag August Scherl, Deutsche Adressbuch-Gesellschaft, Breslau, Junkernstr. 41.43
20 Diese Information hat mir Sandra Ball, die Großnichte von Martha Schindler, letztere verheiratet mit Walter Steinitz 43*, geschickt. Sie stammt aus der „Theresienstädter Gedenkinitiative“ Akademie-Verlag Prag (2000).
3. Mosche Laibs Nachkommen
Von Mosches neun Kindern kann ich sechs ihrer Nachkommen (1* bis 6*) bis zur heutigen Zeit verfolgen. Bei einigen setzen Erinnerungen erst ab der folgenden Generation ein. Meine Ausführungen sind natürlich umfangreicher, wenn ich mich auf schriftliche Lebensberichte stützen kann und erst recht, soweit sie meine engere Familie betreffen, Kurt 42* und Else und ihre Kinder (Kapitel 3.6. und 3.7.) und meine Generation.
In der Familie Steinitz sind die Wirkungen der Emanzipation der Juden um die Wende zum 20. Jh. beispielhaft zu verfolgen. Mosches Kinder haben meist noch den traditionellen jüdischen Beruf eines Händlers oder Handwerkers. Aber schon deren Kinder, vorerst nur die Söhne, studieren. Den Kindeskindern ist es bereits eine Selbstverständlichkeit, die Universität besuchen zu können. Die junge Generation ist nach dem I. Weltkrieg viel unterwegs in Deutschland, zum Studium, auf Wanderungen und zu Kongressen, und meist wohnen sie bei Tanten und Onkeln. Man weiß, dass man miteinander verwandt ist, nur nicht immer wie.
3.1. Mosche Laibs Sohn Israel 1*
Israel ist 1828 geboren. Er war mit Rosalie Böhm (1834 Oppeln – 1914 Rosenberg) verheiratet und hatte die Kinder Paul 11* (1869), Richard 12*(1870), Otto 13* (1872), Franziska 14* (1875). Von seinem Urgroßvater hat Michael (Lores und Roberts 131* Sohn, s. Kapitel 4.4.1.1.) die Erinnerung, dass er wie sein Bruder Sigismund Kohlenhändler war. Michaels Onkel Stephan 132* (s. Kapitel 4.4.1.), den ich bei meiner ersten Reise 1985 in New York besuchte, meinte dagegen, er sei Notar gewesen. Eine extreme Verwechslung? In der nächsten Generation war dieser Sprung zu intellektuellen Berufen schon üblich. Doch eine Gleichstellung der Juden war immer noch nicht erreicht. Beim Umzug von Gleiwitz nach Breslau 1846 musste auch Israel ein Abzugsattest beibringen:
Abzugsattest für Sohn Israel von Moses Steinitz. Er hat sich stets ordentlich aufgeführt, was ihm beim Abzuge nach Breslau, woselbst er die Handlung zu erlernen beabsichtigt, hiermit amtlich attestiert wird. Gleiwitz 10.3.1846, Der Magistrat
Israel starb 1905 in Rosenberg (Oberschlesien). Alle seine vier Kinder wurden im hohen Alter von den Nazis ermordet (s. Kapitel 5.1. und 5.2.).
3.2. Mosche Laibs Sohn Siegfried 2*
Siegfried lebte von 1840 bis 1889. Er war mit Selma Friedenstein verheiratet und hatte die Söhne Julius 22* (geb. 1878), Ernst 21* (geb. 1881) und Otto 23* (geb. 1886). Über Siegfried und Selma selbst weiß ich nichts. Aber wie schon in der nächsten Generation üblich: ihr Sohn Ernst 21* studiert und – auch nicht überraschend – er studiert Medizin. In Berlin lernt er Käthe Traumann kennen. Sie heiraten und so kommt eine später sehr bekannte Künstlerin und Kunstwissenschaftlerin in unsere Familie (s. Kapitel 4.4.2.). Über Siegfrieds Sohn Julius 22* habe ich nur die Information aus der Nazizeit: verschollen (s. Kapitel 5.), und „verschollen“ bedeutet meist: ermordet. Zu seinem Sohn Otto 23* s. Kapitel 4.4.4.
3.3. Mosche Laibs Sohn Julius 3*
Julius ist 1844 in Gleiwitz geboren und 1919 gestorben. Er war mit Rosalie Freund (1847-1937) verheiratet. Auch hier setzt die Erinnerung der Nachkommen erst bei ihren Kindern und Kindeskindern ein: Julius’ und Rosalies Tochter Martha (geb. 1875) heiratete ihren Cousin Ernst Steinitz 41*, einen bedeutenden Mathematiker (s. Kapitel 3.5.). Der Sohn Franz (geb. 1877) war ein bekannter Kinderarzt in Breslau, dessen Sohn Kurt 311* war ebenfalls Mediziner (s. Kapitel 4.2.6. und 4.2.7.). Ilse 32* (geb. 1888) war verheiratet mit Willy Nast (s. Kapitel 4.4.5.).
3.4. Mosche Laibs Sohn Sigismund 4*
Ein besonders beeindruckendes Beispiel für den schnellen Aufstieg jüdischer Männer um die Jahrhundertwende ist der Werdegang der Söhne von Sigismund (geb. ca. 1845 in Gleiwitz). Sigismund selbst hatte als Kohlenhändler noch einen traditionell jüdischen Beruf.
Er heiratete Auguste Cohn (geb. ca. 1850) und sie verdiente als Pensionsmutter noch etwas hinzu. Das Ehepaar zog später nach Breslau, wo es bis zum Tod blieb. Siegmund starb 1892, Auguste 1906.
Alle drei seiner zwischen 1871 und 1882 geborenen Söhne studierten. Ernst 41* (geb. 1871) wurde 1920 Ordinarius für Mathematik an der Universität Kiel und ein berühmter Mathematiker (s. Kapitel 3.5.). Mein Großvater Kurt 42*(geb. 1872) wurde ein in Breslau geachteter Rechtsanwalt (s. Kapitel 3.6.). Walter 43* (geb. 1882) wurde Arzt, Kardiologe und Professor für Zoologie in Breslau. In der Emigration wurde er Mitbegründer der Siedlung Ramot Hashavim in Palästina (s. Kapitel 4.2.1.). Zwei der Söhne von Sigismund, Ernst 41* und Kurt 42*, starben im besten Mannesalter und vor der Nazizeit, erlebten also nicht mehr die Vertreibung.
3.5. Sigismunds Sohn Ernst 41*
Ernst ist 1871 in Laurahütte geboren. Von ihm wusste ich bislang nur, dass er ein bekannter Mathematiker war. Mathematiker und Mathematikhistoriker haben mir geholfen, mehr von ihm zu erfahren.
Im Oktober 2005 besuchten mich Walters 43* Enkel Benjamin/Banini Steinitz und seine Frau Rivka. Sie brachten für mein Privatarchiv Briefwechsel zwischen Hans Röhl und Walter Steinitz aus dem Jahre 1962 mit, sowie Röhls Prüfungsarbeit.
In dem Brief vom März 1962 schrieb der Mathematikstudent Hans Röhl aus Kiel an Ernsts jüngsten Bruder Walter 43* in Ramot Hashavim (Israel) (s. Kapitel 4.2.1.) und bat ihn um Auskünfte über die wissenschaftliche Tätigkeit und das Leben seines Bruders Ernst. Walter antwortete ihm:
Aus Erzählungen weiß ich, dass Ernst bis zu meiner Geburt ein guter Schüler war, dann aber dem (11 Jahre jüngeren, R.S.) Neugeborenen so viel Zeit gewidmet hat, dass er in der Schule sitzen blieb. Dadurch kam er mit dem ein Jahr jüngeren Bruder Kurt 42* (s. Kapitel 3.6.) in eine Klasse und beide Brüder absolvierten gemeinsam das Friedrich-Gymnasium in Breslau. Sie müssen hervorragende Schüler gewesen sein, denn als ich später das gleiche Gymnasium besuchte, wurden sie mir ständig von den Lehrern als Muster vorgehalten.
Ernsts hervorragende Begabung für Mathematik zeigte sich schon früh, doch hielt ihr ein zweites Talent die Waage: Er war sehr musikalisch. 13 Jahre lang ist er am schlesischen Konservatorium praktisch und theoretisch als Pianist ausgebildet worden. Bei den öffentlichen Veranstaltungen der Musikschule wurde er stets als Musterschüler herausgestellt. Schon sehr früh hat er einige Klaviersonaten und mit 17 Jahren ein Klaviertrio geschrieben. Letzteres wurde vom Konservatorium öffentlich und noch viele Jahre im Familien- und Bekanntenkreis aufgeführt.
Noch als Primaner schwankte Ernst zwischen Musik und Mathematik als zukünftigem Beruf. Schließlich entschied er sich für Mathematik, weil er „in scharfer Selbstkritik sich keine genügende kompositorische Originalität zutraute“ (Walter). Die Musik hat ihn aber sein ganzes Leben begleitet.
1890 begann Ernst das Studium der Mathematik an der Universität Breslau. Während seiner Studienzeit schrieb die philosophische Fakultät eine mathematische Preisaufgabe aus. Ernst löste die Aufgabe als erster und gewann hierfür 200 RM in bar und das Recht auf gebührenfreie Promotion. Er promovierte 1894 in Breslau, ging dann nach Berlin. Sein Bruder Walter schreibt weiterhin an Röhl:
Hier musste er seinen Lebensunterhalt durch Stundengeben erwerben, Ernst hätte sich gern an der Berliner Universität als Privatdozent habilitiert, da dies aber große Schwierigkeiten bot, habilitierte er 1897 an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg. [...] Er verkehrte viel im Hause des Mathematikers Hensel, einem Enkel von Fanny Mendelssohn, der hochmusikalischen Schwester des Componisten Felix M. [...] bei den Kammermusikabenden spielte Hensel Geige, Ernst Klavier, die weiteren Instrumente waren Berufsmusikern anvertraut.
In Berlin begann auch seine enge Freundschaft mit dem Mathematiker Otto Toeplitz. Dessen Witwe Erna schrieb an Röhl:
Ernst Steinitz war eine anima candida (reine Seele), aber so still, verschlossen und in sich gekehrt.
Walters Beschreibung von Ernsts Persönlichkeit trifft sich mit der von Erna Toeplitz:
Was im persönlichen Verkehr mit meinem Bruder am meisten in die Augen fiel, war seine ungewöhnliche Schweigsamkeit. Sie war Ausdruck seiner inneren Konzentration auf die ihn beschäftigenden Probleme. Bei der Arbeit legte er seine Notizblätter auf einen Tisch in der Mitte des Zimmers und begann dann eine stundenlange schweigende Wanderung um den Tisch, die er nur unterbrach, um eine kurze Notiz zu machen, dann – Hände auf den Rücken gefaltet – setzte er sie fort, ohne von sonst noch im Zimmer vorhandenen Personen Notiz zu nehmen. Diese schweigende Konzentration nahmen die Leute für Zerstreutheit und amüsierten sich köstlich über die in der Tat oft komischen Antworten oder auch Taten, die er in diesem von der Umwelt abwesenden Geisteszustand sich leistete.
Auch in jüngster Zeit herrscht wissenschaftliches Interesse am Lebenskontext von Ernst Steinitz. Im März 2006 schrieb der Mathematiker Karsten Johnsen von der Universität Kiel:
Ich schreibe zurzeit einen kleinen Aufsatz über das Leben und das Werk des bedeutenden Mathematikers Ernst Steinitz. Ist dieser ein Mitglied Ihrer Familie? Wenn ja, können Sie mir etwas mitteilen über die Nachkommen?
Im August 2006 bekam ich eine Anfrage von einem weiteren Ernst-Steinitz-Forscher, dem Mathematiker und Mathematikhistoriker Harald Gropp. Er arbeitet schon seit einigen Jahren über Ernst Steinitz. H. Gropp schrieb mir:
Für mich ist das ganze deshalb wieder aktuell, weil ich im September in Polen (nicht allzu weit weg von Laurahütte) auf einer mathematischen Konferenz einen Vortrag halte, der in einem gewissen Zusammenhang mit Ernst Steinitz steht. Es wäre schön, wenn ich bis dahin etwas mehr über das Schicksal seiner Nachkommen wüsste.
Gropp hatte auf dem Internationalen Mathematikerkongress 1998 in Berlin einen Vortrag über drei deutsche Mathematiker, darunter Ernst Steinitz, gehalten, über den er u. a. folgendes sagte21:
The most important contributions of Steinitz in mathematics are the development of modern field theory (1910) and systematic investigation of the theory of polyeder (1934).
Auch Röhl schrieb über Ernst Steinitz’ Arbeiten zur Polyedertheorie (Röhl 1962, S. 18 ff.). Sie war schon Gegenstand eines Vortrags von Ernst 1904 gewesen und beschäftigte ihn besonders in seinen letzten Lebensjahren. In seinem wissenschaftlichen Nachlass fand sich das nahezu vollständige Manuskript einer zusammenfassenden Darstellung dieser Theorie. 1904 nahm Ernst am 3. Internationalen Kongress für Mathematik (ICM) in Heidelberg teil, als Professor an der Technischen Hochschule Charlottenburg (s. dazu H. Gropp 1988). 1910 wurde er als Ordinarius an die neu gegründete Technische Hochschule in Breslau berufen. Im gleichen Jahr erschien seine Arbeit „Algebraische Theorie der Körper“, die als eine Quelle der heutigen Auffassung von Algebra betrachtet wird.
Jetzt konnte Ernst einen eigenen Hausstand gründen und seine Cousine Martha Steinitz 33* heiraten. 1912 wurde ihr Sohn Erhard geboren. Mit der späteren Berufung an die Kieler Universität 1920 brachte Ernst sein mathematisches Talent zur vollen Entfaltung. Die dort geschriebenen Arbeiten machten ihn bald in Mathematikerkreisen bekannt.
Ernst starb 1928 mit erst 57 Jahren an einer Herzklappenentzündung, ein Jahr vor seinem Bruder Kurt 42*, meinem Großvater. „Sein früher Tod war für die mathematische Wissenschaft ein großer Verlust“(Röhl). Aber obwohl er ein langjähriges Mitglied der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (DMV) war, wurde ihm kein ehrender Nachruf in den Jahresberichten des DMV gewidmet, so schreibt Johnsen. Doch eine Todesanzeige vom Rektor und Konsistorium der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist uns erhalten geblieben.
Ernst hat ein umfangreiches und vielfältiges wissenschaftliches Werk hinterlassen, das bis heute große Beachtung findet. Seine beiden Hauptwerke befassen sich mit Theorie der Körper (1910) und Theorie der Polyeder (posthum 1934). Johnsen schreibt weiter:
Ernst Steinitz hat ein knappes Jahrzehnt in Kiel gewirkt. Die Christian-Albrechts-Universität hat allen Grund, sich dieses Mannes, dessen einflussreiches Werk ihn ohne Zweifel in die erste Reihe der Mathematiker des frühen 20. Jahrhunderts stellt, dankbar zu erinnern und das Gedenken an ihn auch in einer äußeren Form auszudrücken.
Ein Hörsaal der Universität Kiel hat 2006 den Namen Ernst Steinitz erhalten. Ein Foto und eine kurze Darstellung seines Lebens schmücken die Hörsaalwand.
Ernsts Frau Martha war auch eine geborene Steinitz, sie hatten denselben Großvater Mosche Laib (s. Kapitel 2.). Martha ist 1876 in Breslau als Tochter von Julius Steinitz 3* und Rosalie Freund (s. Kapitel 3.3.) geboren.
Nach dem frühen Tod ihres Mannes ging Martha zurück nach Breslau. Breslau war die Stadt, wohin die Steinitze aus den umliegenden Kleinstädten zu Beginn des 20. Jh. meist gezogen waren. 1935 emigrierte sie mit ihrem Sohn Erhard 331* nach Palästina, konnte dort aber nicht heimisch werden und kehrte nach Breslau zurück. 1941 bleibt Martha als einzige der Familie Steinitz in Breslau. Bald darauf wird sie von den Nazis deportiert. Ihre Großnichte Sandra Ball schickte mir folgende Details aus der „Theresienstädter Gedenkinitiative“, erschienen beim Akademie-Verlag Prag 2000: Martha hatte die Gefangenennr. 1076. Es waren 1100 Menschen auf dem Transport von Breslau nach Terezin (Theresienstadt) am 27. Januar 1942. Am 23. September 1942 wurde Martha zusammen mit 1080 weiteren Gefangenen nach Treblinka transportiert. Ein weiteres Beispiel für die bürokratische Pedanterie der faschistischen Vernichtungsmaschinerie. Ab 1942 gibt es keinen Eintrag „Steinitz“ im Breslauer Adressbuch.
Marthas und Ernsts Sohn Erhard 331* blieb in Palästina. Er hatte kurz vor seiner Emigration Ilse Schlesinger geheiratet. Willy Cohn schreibt in seinem Breslauer Tagebuch, das die Unsicherheit der Juden und den verzweifelten Versuch, ein normales Leben zu führen, widerspiegelt:22
13. Dezember 1935 [...] Synagoge. Etwas Frieden, aber das Herz ist immer unruhig. [...] Auf der Straßenbahn die Tochter von Dr. Schlesinger getroffen; sie hat rasch einen früheren Schüler von mir, Erhard Steinitz, Sohn eines verstorbenen Kieler Professors, geheiratet, um nach Erez zu kommen; das heißt sie hat ihn auch gern. Jetzt geht alles etwas rasch! (Willy Cohn, Band 1 S. 306)
In Palästina spielte Erhard im Opernorchester vom Tage der Gründung an. 1938 wurde Tochter Naomi geboren. Erhard starb 1948 mit erst 36 Jahren, seine Frau Ilse starb 1963.
3.6. Sigismunds Sohn Kurt 42*
Kurt ist 1872 in Laurahütte geboren. Er ist der Sohn des Kohlenhändlers Sigismund 4*, s. Kapitel 3.4. Wie seine Brüder schaffte er den Sprung ins Bürgertum und studierte Jura. 1894 promovierte Kurt und bekam 1898 die Bestallungsurkunde zum Rechtsanwalt am Oberlandesgericht Breslau.
Kurt war ein liberaler Demokrat. Die Titel seiner Schriften weisen seine außerordentliche soziale Engagiertheit aus.23 1902 hielt er einen Vortragszyklus bei der psychologischen Gesellschaft zu Breslau: „Der Verantwortlichkeitsgedanke im 19. Jahrhundert (mit besonderer Rücksicht auf das Strafrecht)“. Ein Abschnitt darin hat mich besonders beeindruckt:
Das Recht des Staates, Verbrecher zur Verantwortung zu ziehen, muss ergänzt werden durch das Recht des Verbrechers. Durch das Strafrecht zieht der Staat sich seine Grenzen. Jeder Strafrechtspflege muss die alte Wahrheit vorschweben: Es ist besser, zehn Schuldige frei ausgehen zu lassen, als einen Unschuldigen zu verurteilen.24
1901 heiratete Kurt Else Jacobson. Sie ist 1877 in Breslau geboren. Die Vorfahren meiner Großmutter Else lassen sich zurückverfolgen bis ins 16. Jh. (s. Teil II, Kapitel 5.). Elses Vater war Kunsthändler und hatte ein Antiquariat in Breslau. Else hatte eine Ausbildung zur Lehrerin absolviert, aber schon bald nach der Heirat war sie mit der Pflege ihrer Kinder ausgelastet. 1902 wurde Hans 421* geboren, 1903 Ruth 422*, 1905 Wolfgang 423*, 1910 Marianne 424* und schließlich 1916 Ulla 425*.
Die Zugehörigkeit zu Deutschland muss für meine Großeltern selbstverständlich gewesen sein. Die jüdische Religion war für sie unwichtig geworden. Sie waren 1913 aus der jüdischen Religionsgemeinschaft ausgetreten; in der Geburtsurkunde der jüngsten Tochter Ulla steht in der Rubrik Religion der Eltern: „Dissidenten“.25
Kurts erster Sohn Hans 421* erinnert sich bei einem auf Tonband aufgezeichneten Gespräch mit seinem Sohn Dan in den 70er Jahren (s. auch Kapitel 4.2.5.)26:
Man wusste, man stammt von Juden ab, aber es wurde davon kein Gebrauch gemacht, weder von Wolfgang noch von mir, noch von den (anderen) Geschwistern. [...] Groß geschrieben waren dagegen die Wissenschaften und die Kunst. Und die Kunst war für die Eltern, aber auch für uns, zum größten Teil Musik.
Hans und Wolfgang lernten Klavier bzw. Geige spielen. Im Haus Steinitz gab es später oft Abende, an denen sie zusammen musizierten – natürlich klassische Musik – und viele Verwandte fanden sich ein.
Über die politische Einstellung des Vaters sagt Hans in demselben Gespräch:
Bestimmend war eine liberale Weltanschauung, er war kosmopolitisch eingestellt – glaubte an den Sieg der Vernunft und die Mäßigkeit. Beim Kriegsausbruch 1914 war er ganz deprimiert. So was von Gegensatz habe ich selten gesehen: diese begeisterte Umgebung, dass es nun endlich losgeht – und mein Vater weinend! Er dürfte einer der wenigen gewesen sein, die das kommende Unheil voraussahen. Das war Vater, eine sehr fest gefügte Persönlichkeit, die mich enorm beeinflusst hat. Bei Wolfgang kam dann der Gegensatz zu dessen kommunistischen Haltung ins Spiel. Sie konnten natürlich nicht zu einer Verständigung gelangen.
Kurt starb schon 1929 in Breslau. Ihm wurden viele ehrende Todesanzeigen gewidmet. In der Chronik der kgl. Universität Breslau wird berichtet: Kurt 42* und sein Bruder Ernst 41* (s. Kapitel 3.5.) haben im selben Jahr einen Preis der Universität Breslau erhalten, Kurt in Jura und Ernst in Mathematik.
Bis zu seinem Tod lebte Kurt mit seiner Frau Else und den beiden kleineren Töchtern Marianne/Jannu (s. Kapitel 4.5.1.) und Ulla (s. Kapitel 4.3.1.) in Breslau. Hans studierte Medizin. Nach dem Willen des Vaters sollte der jüngere Sohn Wolfgang Rechtsanwalt werden, der aber wehrte sich dagegen (s. Kapitel 3.7.).
Die drei älteren Geschwister verabschiedeten sich, so bald sie konnten, von der elterlichen Autorität und zogen nach Berlin bzw. Braunschweig. Ende 1931 zog Else auch nach Berlin und kaufte ein Reihenhaus in Dahlem. Dort lebte sie zeitweise mit ihren Töchtern Marianne und Ulla und mit Wolfgang, seiner Frau Inge Kasten und deren 1932 geborenen Sohn, meinem Bruder Klaus zusammen.
Die Mosche-Nachfahren der nächsten Generation sind im 4. Kapitel „Die Vertreibung“ zusammengefasst. Um ihre Lebensgeschichten zusammenhängend darzustellen, bringe ich sie in dem entsprechenden Exilland Kapitel 4.1. bis 4.7. unter. Eine Ausnahme muss ich aber machen: meine Eltern. Von ihnen weiß ich natürlich am meisten, und ich kann auf ein gut gefülltes Archiv zurückgreifen. Sie kommen außer in diesem Kapitel in den Kapiteln 4.1. und 6.3. zusammen mit der Familie von Wolfgangs Schwester Ruth (Peters) 422* vor.
3.7. Kurts Sohn Wolfgang 423*
Wolfgang ist 1905 in Breslau geboren. Sein späterer Beruf als Philologe und Volkskundler gründet in seinen schon früh erkennbaren Vorlieben.27
Ich lese im oben erwähnten Tonband-Gespräch von Wolfgangs Bruder Hans mit seinem Sohn Dan und mir fällt auf, dass er nur Gutes über seinen Bruder erzählt; viel mir Bekanntes, mit einem liebevollen Blick – bis auf dessen politische Einstellung. Dessen frühes Interesse für Folklore beobachtet Hans bei einer gemeinsamen Landverschickung 1916. Der 11-jährige Wolfgang befragte die alten Leute nach noch lebendigen Geschichten. Er legte Verzeichnisse von Flurnamen in einem Gebiet an, wo sich der polnische und der deutsche Kulturkreis begegneten. Er sammelte auch Folklore, Kinderspiele, Kinderlieder und Rätsel. All dies notierte er in Oktav-Heftchen. die er durch alle Fährnisse der Emigration hindurch gerettet hat.28 Diese ausgeprägte Sammelleidenschaft behielt er zeitlebens, nur der Gegenstand wechselte.
Bald wurde die Sammelfreude ernsthafter; Wolfgang sammelte Märchen, Volkslieder und -sprüche. Mit genauen Quellenangaben schickte er 1920 eine Sammlung Volkslieder an die Schlesische Gesellschaft für Volkskunde. Er war viel unterwegs, in Deutschland und in Schweden. Anlaufstellen in Schweden waren Verwandte, aber seine Hauptinteressen waren volkskundlichen Museen und bäuerliche Bräuche. Das Musizieren, das er in Kindheit und Jugend zusammen mit seinem Bruder Hans intensiv betrieb, bekam bald eine volkskundliche Färbung. Wolfgang nahm seine Geige, später die Ziehharmonika, auf seinen volkskundlichen Ausflügen mit und spielte in den Dörfern, vor allem in Finnland und Estland, später auch in Schweden, zum Tanz auf. So fand er schnell Kontakt zur ländlichen Bevölkerung. Ich erinnere mich daran, wie er während unserer Emigration in Schweden bei einem der traditionell gefeierten Mittsommerfeste Ziehharmonika spielte. Nach 1945 hat er aus Zeitmangel das aktive Musizieren vernachlässigt, aber abends, wenn er müde von der Arbeit war, legte meine Mutter oft eine Schallplatte mit klassischer Musik auf. Anders sein Bruder Hans, der bis ins hohe Alter ernsthaft Musik betrieb. Auch Wolfgangs wachsendes Interesse für Sprachen hatte Bezüge zur Volkskunde. Als 18-Jähriger beschreibt er 1923 in einem Geburtstagsbrief an den Vater einen Lebensentwurf, dem er zeitlebens treu geblieben ist:
Was ich dir jetzt schicke, wird dir vielleicht zuerst nicht so sehr schön erscheinen; aber ich glaube, wenn ihr seht, wie sehr ich in





























