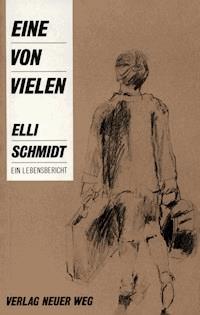
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Neuer Weg
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ich möchte mich an Frauen wie an Männer, an die Jungen wie die Alten wenden. Manches ist mir nicht leicht gefallen, wieder aus der Erinnerung auszugraben, über einiges hatte ich noch nie so öffentlich gesprochen. Aber ich denke, daß gerade die persönlichen Erfahrungen manchem Menschen Mut machen können, egal wie alt er ist, einen aktiven Beitrag für die Veränderung der Verhältnisse zu leisten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elli Schmidt
Eine von vielen
Elli Schmidt
Eine von vielen
Ein Lebensbericht
Mit Zeichnungen von Cornelia Lenartz
Verlag Neuer Weg
Elli Schmidt
Eine von vielen
Zeichnungen und Umschlagbild von Cornelia Lenartz
1. Auflage 1991
Alle Rechte bei:
Neuer Weg Verlag und Druck GmbH
Kaninenberghöhe 2, 4300 Essen 1
Gesamtherstellung:
Neuer Weg Verlag und Druck GmbH
Kaninenberghöhe 2, 4300 Essen 1
ISBN 3-88021-210-4
Vorwort
So genau weiß ich gar nicht mehr, wann mir Elli Schmidt das erste Mal begegnete. Aber das Bild hat sich mir eingeprägt: eine kleine Gestalt mit energischen Bewegungen. Dichtes, kaum ergrautes Haar. Augen, die fast hinter tausend Lach- und Sorgenfältchen verschwinden und doch voller Leben und wachem Interesse stecken. Wir verstanden uns auf Anhieb, und heute entgehe ich genausowenig wie all die anderen, die sie näher kennen, ihren Begrüßungsumarmungen mit den Fragen voller Anteilnahme nach unserem Wohlergehen.
Ihre Erzählungen über ihre Kindheit nach dem Ersten Weltkrieg, über ihre Zeit als junge Frau während des Hitlerfaschismus und des Krieges, besonders aber auch über die Zeit danach, als sie mit einer organisierten politischen Tätigkeit Schlußfolgerungen aus diesen Erfahrungen zog, legten den Gedanken nahe: Das sollten auch andere erfahren.
Elli gehört zu der Generation von Frauen, die meist noch ganz traditionell zur Hausfrau und Mutter erzogen wurden.
Der Krieg stellte sie unvorbereitet auf eigene Füße. Irgendwie mußten sie sich und nicht selten viele Kinder durchbringen. Bei allem Elend — sie entwickelten auch ein neues Selbstbewußtsein, das viele von ihnen nach dem Krieg in heftige Konflikte geraten ließ. Die Männer kamen zurück, und die Frauen sollten nun wieder ins zweite Glied treten. Eingespannt fürs Trümmerräumen und Wiederaufbauen fanden sie sich oft unversehens als Hüterinnen ihrer Enkel oder Pflegerinnen ihrer Eltern wieder, ohne jemals ein eigenes Leben gelebt zu haben. Ich habe mit vielen Frauen dieser Altersgruppe gesprochen, gehören doch auch meine Mutter und meine Schwiegermutter dazu. Und ich habe mich immer darüber geärgert, daß kaum etwas davon uns Jüngeren zugänglich ist. Daß ein Millionenheer von Frauen mit wichtigen Erfahrungen zum Schweigen verurteilt ist und eine solche Menge von Kenntnissen und Kraft brachliegt.
Sicher, es gibt auch Bücher darüber — aber sie sind eher aus dem bildungsbürgerlichen Bereich oder schildern bäuerliches Leben, wie die »Herbstmilch« von Anna Wimschneider. Arbeiterfrauen aber, die »unpolitischen« zumal, bleiben in der Literatur, aber auch in den Dokumentarberichten weitgehend stumm.
Wir — auch der Verlag Neuer Weg, den ich angesprochen hatte — wollten darum diesen Lebensbericht. Aber bis zur Fertigstellung des nun vorliegenden Buchs war es noch ein weiter Weg. Erst einmal mußte ich Ellis Bedenken beiseite räumen, sich ans Werk zu machen. Ich selbst hatte mit solcher Arbeit auch keine Erfahrung. Gliederungen besprechen, kapitelweise die erarbeiteten Seiten kritisch beleuchten — das wollte ich, aber keinesfalls stellvertretend für Elli schreiben oder ihren eigenen Stil manipulieren.
Um das Manuskript übertragen zu können, mußte ich lernen, ihre kleine, regelmäßige Sütterlinschrift zu entziffern, mich manches Mal schimpfend durch eine Ansammlung von Zetteln und Zettelchen mit Anmerkungen und Änderungen wühlen, weil Elli beharrlich auf einem höchst sparsamen Umgang mit Papier besteht. Natürlich haben wir auch viel Spaß bei der Arbeit gehabt, oft gelacht, besonders über ihre humorvoll-lakonischen Schlußfolgerungen aus manchem Erlebnis.
Meine malende Schwester Cornelia fand sich bereit, das Buch zu illustrieren, zumal insbesondere aus der Jugendzeit keine Fotos von Elli mehr existieren. Sie sind in den Kriegswirren verlorengegangen.
Die Erarbeitung des Berichts lief aber auch nicht ohne Auseinandersetzungen zwischen Elli und mir ab. Über manche Dinge, wie über ihre ledige Mutterschaft, hatte sie noch nie gesprochen. Es brauchte viel Geduld und Überzeugungsarbeit, sie zu bewegen, gerade solche bitteren und lange tabuisierten Erfahrungen aufzuschreiben. Dabei ist auch jetzt noch manches für mein Gefühl etwas knapp weggekommen. So das zwiespältige Verhältnis zu ihrer Mutter, auch ihre eigenen Probleme, ihre Kinder in die Selbständigkeit zu entlassen, insbesondere den behinderten Sohn Klaus.
Aber ich hoffe, daß einfühlsame Leserinnen und Leser gerade an diesen Stellen auch das nicht Ausgesprochene bemerken.
Besonders wünsche ich mir, daß dieses Buch zu einer Ermutigung werden kann, nicht nur für die Frauen, nicht nur für die Alten, die Rolle des passiven Opfers der gesellschaftlichen Entwicklung zu verlassen und einen Beitrag zur Veränderung zu leisten — für eine bessere Zukunft für uns und unsere Kinder.
Anna Nassauer
Landleben
1914 bin ich in Ziegenort, Kreis Ückermünde, einem pommerschen Dorf am Haff, geboren. Ich war das ältere von zwei Mädchen. Meine Schwester wurde 1918 geboren, war also vier Jahre jünger. Vater war von Beruf Seemann und Mutter die Älteste von zehn Kindern auf einem Bauernhof. So hatten wir zwar eine Wohnung in Ziegenort, aber meine ersten Lebensjahre spielten sich doch auf dem Hof in der bäuerlichen Großfamilie ab.
Als erstes Enkelkind bin ich von allen verwöhnt worden, ganz besonders von Tante Martha. Sie war für meine Schwester und mich auf dem Hof die Bezugsperson, sehr kinderlieb und immer für mich da, egal, was wir auch anstellten. Tante Martha kümmerte sich als Zweitälteste mit der Großmutter um den Haushalt und die Schweinefütterung. Sie hatte einen Buckel, und es wurde erzählt, das liege daran, daß sie als Schulkind von einem Lehrer so schlimm geschlagen wurde. Ich glaube, sie hat ein Leben lang schwer daran getragen und blieb ledig.
Die Zeit auf dem Hof ist für mich mit vielen schönen Erinnerungen verbunden. Ich will versuchen, die wichtigsten zu berichten.
Da sind zunächst die Familienfeiern im großen Kreis, denn zu den kirchlichen Festtagen kam die ganze Familie zusammen, und das ganze Haus roch schon eine Woche vorher nach Kuchen. Weihnachten schmückte eine große Tanne, die vom Boden bis zur Decke reichte, das Wohnzimmer, und Silvester gab es zusätzlich Gewürzkuchen und Berliner Pfannkuchen.
Meine Schwester und ich bekamen einmal zu Ostern zwei wunderschöne große Schokoladehasen, die stellten wir aufs Klavier. Eines Tages hatte irgend jemand die Ohren abgebissen. Da war das Geschrei groß.
Pfingsten versammelten sich alle auf dem Platz vor der Scheune, es wurden Volkslieder gesungen und dazu pommersche Tänze aufgeführt. Dieser Brauch wurde von den Großeltern hochgehalten.
Die Bauern mußten schwer arbeiten. Trotzdem verstanden sie es, auf ihre Art zu feiern. So erinnere ich mich an eine Doppelhochzeit. Ein Bruder und eine Schwester meiner Mutter haben am gleichen Tag geheiratet. Da war vielleicht was los! Das halbe Dorf hat bei der Vorbereitung mitgeholfen. Aus diesem Anlaß wurde extra geschlachtet und Unmengen Kuchen gebacken. Gefeiert wurde auf dem Innenhof, und dort wurde am nächsten Morgen nach altem Brauch der Schleier abgetanzt. Dazu tanzten beide Brautpaare, und die Gäste versuchten, den Schleier abzureißen, bis es nichts mehr zu reißen gab.
Bei dieser Gelegenheit bemerkte ich die Nachstellungen eines älteren Verwandten, der die kleineren Mädchen belästigen wollte. Er wurde während der Feier nicht aus den Augen gelassen, damit nichts passierte. Obwohl offenbar alle von seinem Treiben wußten, wurde er von niemandem ernstlich zur Rechenschaft gezogen. Es blieb in der Familie und wurde so vertuscht. Erst viel später habe ich die ganze Tragweite dieses Geschehens richtig begriffen. Noch heute wird ja der sexuelle Mißbrauch von Kindern, insbesondere von Mädchen, als Tabuthema behandelt. Erst in den letzten Jahren wird öffentlich über diese besonders schlimme Auswirkung der Unterdrückung von Frauen diskutiert. Das war damals undenkbar.
Auf gesunde Ernährung wurde viel Wert gelegt. Brot wurde in einem eigens dafür eingerichteten Backofen auf Vorrat gebacken. Ich habe früh gelernt, daß frisches Brot nicht gut verträglich ist.
In einem Butterfaß wurde die Butter von Hand hergestellt, ein paar Tage mit Salz durchgeknetet, ohne chemische Zusätze. Beim Buttermachen hab ich immer gern geholfen, und ich erinnere mich an die gute Buttermilch mit richtigen Butterklümpchen. Die hatte nichts gemein mit der sauren Milch, die heute als »Buttermilch« im Handel angeboten wird.
Ein großes Ereignis war das Schlachten. In der Waschküche auf dem Hof wurde gewurstet. Die Gewürze waren dabei sehr wichtig, denn jede Wurst hatte einen anderen Geschmack. Im großen Kessel wurde Blut- und Leberwurst gekocht, und unterm Dach in der Räucherkammer hingen Dauerwurst und ganze Speckseiten. Das Fleisch wurde in einem riesengroßen Faß portionsweise mit Salz eingepökelt, denn eine andere Möglichkeit, das Fleisch haltbar zu machen, gab es nicht. Ich muß sagen, es schmeckte prima.
Zur Erntezeit ging es auf dem Hof besonders betriebsam zu. Es gab keine Schwierigkeit, genug Erntehelfer zu bekommen, im Gegenteil, sie fragten vorher schon an. Ein extra Schlachtfest sicherte die Versorgung der Leute, darauf legten die Großeltern besonderen Wert. Am großen Tisch auf zwei Böcken aßen wir dann alle zusammen nach Feierabend.
Durch ihre Arbeit fühlten sich die Menschen sehr naturverbunden. Die Bauern wußten genau, wann Unwetter, Regen oder Sturm kam, und danach richteten sich Tagesablauf und Arbeitseinteilung. Um ein Beispiel anzuführen: Einmal wurde zur Heuernte den ganzen Tag ohne jede Pause eingefahren, weil Großvater ein Gewitter vorausgesagt hatte. Und tatsächlich, nachdem in aller Eile Fuder um Fuder in der Scheune verladen war, prasselte ein Gewitterregen herunter. Durch den Regen wäre das trockene Heu auf dem Feld verfault — ein ungeheurer finanzieller Verlust für den Hof, denn für das Vieh hätten dann Heuballen eingekauft werden müssen.
Die Bauern mußten nicht nur hart arbeiten, sondern waren zugleich Manager und Finanzminister ihres Hofes. Sie konnten wegen Wettereinflüssen oder Viehsterben erheblich in Schulden geraten oder Pleite machen.
Natürlich konnten auch persönliche Schwächen Probleme bringen. So ging ein Bruder meiner Mutter, Onkel Robert, ein paarmal in der Woche in die Dorfwirtschaft und trank mehr als gut war. Dafür hatte er am anderen Tag große Schwierigkeiten, morgens früh das Vieh zu versorgen. Zwischen den Großeltern gab es darüber oft Diskussionen, weil Oma den Sohn in Schutz nahm. Hätte Onkel Robert nach Großvaters Tod den Hof übernommen, er wäre nach kurzer Zeit wohl heruntergewirtschaftet worden. Aber Oma war eine tüchtige Bäuerin und hat das Schlimmste zu verhindern gewußt.
Überhaupt nahmen die Frauen damals auf dem Lande eine besondere Stellung ein. Sie arbeiteten tatkräftig mit auf dem Feld und bei der Versorgung des Viehs, trugen darüber hinaus die Verantwortung für die Verarbeitung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. So erinnere ich mich, daß meine Großmutter auch zu Lebzeiten des Großvaters völlig gleichberechtigt bei Anschaffungen und Arbeitsplanung ihre Mitsprache wahrnahm.
Auch mit der Klassenjustiz machten meine Großeltern schon ihre Erfahrungen. Bei einem starken Gewitter schlug der Blitz ein, und das Wohnhaus brannte bis auf den Grund nieder. Nur das Nebengebäude und die Stallungen blieben erhalten. Oma war vollkommen verstört. Ihr durch jahrzehntelange harte Arbeit erworbener Besitz ging zum großen Teil in Flammen auf. Aufgrund der falschen Zeugenaussage eines benachbarten neidischen Großbauern kam es aber noch schlimmer: Die Versicherung weigerte sich, für den Schaden zu zahlen, und leitete statt dessen ein Gerichtsverfahren wegen Brandstiftung ein. Zwei Familienmitglieder kamen in Untersuchungshaft. Nach anderthalb Jahren wurden sie »aus Mangel an Beweisen« entlassen, aber soviel wog die falsche Aussage eines Reichen gegenüber den Aussagen vieler einfacher Bauern.
Schulzeit
Von 1920 bis 1926 ging ich in Ziegenort in die Dorfschule, in der überwiegend Platt gesprochen wurde. In diesen ländlichen Schulen wurde den Bauernkindern nur das Allernötigste beigebracht. In einem Klassenzimmer wurden drei verschiedene Jahrgänge unterrichtet, und man kann sich vorstellen, wie das Lernpensum aussah.
Andererseits bildeten die Lehrer mit den Bauern durch die Kinder auch eine Gemeinschaft, kannten sie doch ihre Sorgen und Nöte. Während der Sommermonate, zur Erntezeit, mußten die meisten Kinder auf dem Feld mithelfen. Denn die kleinen Bauern waren finanziell nicht in der Lage, zusätzlich Erntehelfer einzustellen. Dies wurde von den Lehrern stillschweigend akzeptiert.
Meine Mutter und ihre jüngeren Geschwister, hauptsächlich die Tanten, beaufsichtigten in den ersten Schuljahren meine Hausaufgaben. Der Hafenmeister Beetz, ein Freund der Familie, hatte ihnen Nachhilfeunterricht gegeben, und so kam ich zu einer guten Grundschulausbildung. Er war es Ställe, das Vieh zu besichtigen, und endlich konnte ich auch wieder Platt sprechen.
Zurückblickend ist mir heute bewußt, welche Probleme Mutter damals bedrückten. Da mein Vater als Seemann die meiste Zeit ihrer Ehe von Zuhause fort war, hatte sie weitgehend alleine die Verantwortung für meine Schwester und mich. Das wurde ihr oft auch von der Umgebung nicht leicht gemacht.





























