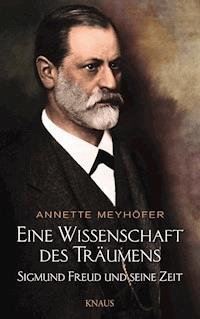Inhaltsverzeichnis
Widmung
DER STOFF ZUM TRÄUMEN
FRÜHE UNORDNUNG
LIEBELEIEN UND DIE MÜHEN DER ADOLESZENZ
Copyright
Für W.T.
DER STOFF ZUM TRÄUMEN
FRÜHE UNORDNUNG
Er wurde mit einer Glückshaube geboren, wie der Lieblingsheld seiner Jugend, David Copperfield. Der Legende nach waren jene Kinder, deren Kopf bei der Geburt noch von den Überresten der Eihaut bedeckt war, zu Höherem bestimmt, manchmal sogar mit übernatürlichen Fähigkeiten gesegnet, jedenfalls begabt zu besonderem Glück. Nach der Freudschen Familiensaga hatte eine alte Frau der jungen Mutter dies bekräftigt und dem Kleinen eine große Zukunft vorausgesagt. Sicherlich kamen solche Prophezeiungen häufig vor,«es gibt», schrieb er später,«so viel erwartungsfrohe Mütter und so viel alte Bäuerinnen oder andere alte Weiber, deren Macht auf Erden vergangen ist, und die sich darum der Zukunft zugewendet haben».1 Und die Freuds schienen des Glücks noch viel bedürftiger, als es die meisten ohnehin sind.
Am 6. Mai 1856, abends um halb sieben, kam er zur Welt, in der Schlossergasse 117, in Freiberg im nordöstlichen Mähren, dem heutigen Příbor. Eine Woche später wurde Sigismund Schlomo Freud, so benannt nach dem kürzlich verstorbenen Großvater, rituell beschnitten; in der Familienbibel ist es festgehalten. Der Vater, Jacob Freud, war damals Anfang vierzig, ein Wollhändler aus dem galizischen Tysmenitz, nahe dem Karpatenbogen; etwas mehr als zehn Jahre zuvor hatte er sich in Mähren niedergelassen. Die Mutter, Amalia Nathanson mit Mädchennamen, war gerade 21 und ebenfalls in Galizien geboren, in Brody, doch aufgewachsen in Odessa und Wien. Sie war Jacobs zweite Frau, vielleicht sogar die dritte. Wie so viele Familiengeschichten jener Zeit, zumal die der Juden auf Wanderschaft, bleibt auch die der Freuds in Dunkel gehüllt, trotz all der akribischen Recherchen, die bisher angestellt wurden.
Sigmund Freud selber glaubte von seiner väterlichen Familie zu wissen,«daß sie lange Zeiten am Rhein (in Köln) gelebt hat, aus Anlaß einer Judenverfolgung im 14. oder 15. Jahrhundert nach dem Osten floh und im Laufe des 19. Jahrhunderts die Rückwanderung von Litauen über Galizien nach dem deutschen Österreich antrat».2 Jacob Freud stammte nach Meinung des Sohnes aus einem chassidischen Milieu, dem er sich aber schon lange entfremdet hatte. Über die Zahl seiner Geschwister ist nichts Genaues bekannt, ein Bruder lebte wohl in Breslau, ein anderer, Josef, in Wien. Vermutlich begann seine Wanderung nach Westen 1838, zusammen mit seinem Großvater mütterlicherseits, Siskind Hofmann. Sechs Jahre später, 1844, ersuchten die beiden Händler«von Tüchern, Wolle, Honig, Talg etc.»in Freiberg erstmals um«Duldung», das heißt um Aufenthaltsund Gewerberecht. Bei seiner Hochzeit mit Amalia Nathanson gab er an, seit 1852 Witwer zu sein; aus der ersten Ehe mit einer Sally Kanner hatte er zwei erwachsene Söhne, Emanuel und Philipp.3 Wenn es tatsächlich zwischen diesen beiden Frauen, Sally und Amalia, noch eine andere, eine gewisse Rebekka, gegeben haben sollte, so kann die Verbindung nur von kurzer Dauer gewesen sein.
Aber die Freiberger Verhältnisse waren ohnehin geheimnisvoll genug für das Sigismund Schlomo genannte Kind. Seine Halbbrüder waren im Alter der Mutter, in ihren frühen Zwanzigern, so daß ihm der Vater eher wie ein Großvater erscheinen mußte. Emanuel, der Ältere, hatte selbst bereits zwei Kinder, Johann, später John genannt, und Pauline - dies waren also sein Neffe, ein Jahr älter als er selbst, und seine ein Jahr jüngere Nichte. Sicherlich war der Altersunterschied zwischen Jacob Freud und Amalia nicht ungewöhnlich. Nur warum hatte eine junge Frau aus Wien einen Mann geheiratet, dem sie in ein Nest von gerade 4500 Einwohnern, 200 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, und in eine ungewisse Zukunft folgen mußte?
Sie war eine«große Schönheit», behauptete später ihr Enkel Martin, Sigmund Freuds ältester Sohn; zumindest scheint sie in ihrer Jugend recht hübsch, sogar attraktiv gewesen zu sein. Er selbst hat sich kaum je über die Mutter geäußert, allenfalls indirekt und niemals über ihr Wesen und ihren Charakter. Niemanden hat er so diskret behandelt. Die detailliertesten Portraits von Amalia Freud haben ihre Enkel gezeichnet, und diese waren, glaubhaft oder nicht, alles andere als schmeichelhaft. Eine typische ostgalizische Jüdin sei sie gewesen, sehr gefühlsbetont, leicht hinweggerissen von ihren Emotionen, von großem Lebenshunger und unbezwingbarem Geist, jedenfalls nie völlig assimiliert, nicht das, was man unter einer«Dame»verstand. 4 In den Augen von Freuds Nichte, Judith Bernays Heller, die als Kind eine Weile bei den Großeltern gelebt hatte, war sie eine herrschsüchtige Tyrannin, hektisch, launisch, anspruchsvoll und ungeheuer eitel. Doch sie war auch eine tüchtige und zupackende Frau, die ihre große Familie zusammenzuhalten verstand und bis ins hohe Alter eine eindrucksvolle Erscheinung blieb, mit gut geformten Gesichtszügen und grauen Haaren à la Pompadour, die der Friseur jeden Morgen frisch zu legen hatte. Und sie konnte im Kreis ihrer zahlreichen Freunde und Bekannten charmant und witzig sein, war selbstironisch und, vielleicht ihre höchste Tugend, nie zum Jammern aufgelegt. 5
Jedenfalls muß schon die junge Amalia Freud eine höchst vitale Person gewesen sein, da ihr Mann weit häufiger in den Wolken und immer ein wenig in Distanz zu seiner Familie zu leben schien.«Tiefe Weisheit und phantastisch leichten Sinn»hat ihm der Sohn später liebevoll spöttisch attestiert, der Vater sei«ein interessanter Mensch»und«innerlich sehr glücklich»gewesen. 6 Und so sahen ihn auch seine Kindeskinder: als einen liebenswürdigen, großzügigen Mann, freundlich und humorvoll, der niemals seine Ruhe verlor, der, ganz im Gegensatz zu seiner Frau, nie die Stimme erhob, sondern das Leben offenbar mit einem Augenzwinkern betrachtete:«Ist nicht alles, was wir hier tun oder sagen, ein großer Spaß?»7 Möglicherweise hatte er auch die junge Amalia damit beeindrucken können, und schließlich war er durchaus stattlich mit seinem Franz-Joseph-Bart, groß und breitschultrig, ein gebildeter und belesener Autodidakt, der seinen Ältesten bis zur Gymnasialzeit zu Hause unterrichtete.
Vielleicht hatte man die Ehe, wie damals üblich, arrangiert, vielleicht war Jacob Freud ursprünglich recht wohlhabend gewesen; Sigmund Freud behauptete es jedenfalls. Und seine älteste Schwester Anna, die mit der Wahrheit allerdings nicht immer auf bestem Fuß stand, deklarierte den Vater sogar zum Besitzer einer Tuchfabrik. Tatsächlich sind Jacob Freuds Vermögensverhältnisse zur Freiberger Zeit mehr als ungewiß. Die Familie lebte, als Sigmund Freud geboren wurde, in einem Zimmer von kaum 40 Quadratmetern im ersten Stock der Schlosserei Zajíc, und sie vergrößerte sich rasch. Kaum anderthalb Jahre nach dem ersten wurde ein zweiter Sohn geboren, Julius, der jedoch nur sechs Monate überlebte. Aber schon Ende 1858 kam Anna zur Welt. Immerhin leistete man sich ein Kindermädchen, eine katholische Tschechin, Monika Zajíc, vielleicht eine Verwandte des Schlossers, vielleicht aber auch ganz anders - nämlich Resi Wittek - mit Namen.8
Es gibt nichts als Mutmaßungen. Aus Träumen und vagen Erinnerungen hat Freud selbst das große Reich der Phantasie, das die Kindheit ist, rekonstruiert; und seine Biographien folgten ihm darin, nahmen ihn beim Wort, zweifelten ihn an, korrigierten, widerlegten ihn, auf der nicht enden wollenden Suche nach immer neuen Fakten über eine verlorene Zeit. Doch was verraten Dokumente und Tatsachen, auch die allerletzten, die am besten gesicherten, im Grunde über jenen, für den sie allein Bedeutung haben?«Vielleicht ist es überhaupt zweifelhaft, ob wir bewußte Erinnerungen aus der Kindheit haben oder vielmehr bloß an die Kindheit. Unsere Kindheitserinnerungen zeigen uns die ersten Lebensjahre, nicht wie sie waren, sondern wie sie späteren Erweckungszeiten erschienen sind»9, schrieb Freud noch 1899, als er schon begonnen hatte, jene frühesten, zum größten Teil der Amnesie verfallenen«prähistorischen»Jahre als die entscheidenden, die wichtigsten im Leben zu deuten. Sie mag glücklich gewesen sein, diese Zeit in Freiberg, als er in den Wäldern und auf den Wiesen mit John und Pauline spielte. Oder so gewöhnlich unglücklich wie die Kindheit der meisten. Gewiß aber waren die ersten Jahre voller Rätsel, voller Zweifel, voller Verluste für diesen«erstgeborenen Sohn einer jugendlichen Mutter».10
Zu gerne möchte man jene Worte, die Freud auf Goethe münzte, auf ihn selbst anwenden - daß wer«der unbestreitbare Liebling der Mutter»gewesen ist,«fürs Leben jenes Eroberergefühl»behalte,«jene Zuversicht des Erfolgs, welche nicht selten wirklich den Erfolg nach sich zieht»11. Ja, er war Amalias«Goldjunge», ihr«goldiger», ihr«goldener»Sigi, so nannte sie ihn noch in späten Jahren. Aber wie rasch war ihm damals das Brüderchen gefolgt, das ihm die nährende Zuwendung, die Aufmerksamkeit der Mutter entzog; wie rasch war es aus seiner Kinderwelt wieder verschwunden. Ob er dies wahrnahm, mit seinen kaum zwei Jahren, oder ob er von Julius’ Tod nur aus den Erzählungen der Erwachsenen wußte? Doch als Ende 1858 die Schwester Anna geboren wurde, plagten ihn - so erschien es dem vierzigjährigen Freud - seltsame Träume und Phantasien: Die Mutter ist weg, er heult verzweifelt, bis ihm Halbbruder Philipp einen Kasten aufsperrt; auch darin ist sie nicht. Er weint weiter, bis sie endlich, schlank und schön, zur Tür hereinkommt. Um dieselbe Zeit, da Amalia Freud im Wochenbett lag, verschwand, so rekonstruierte er, die Frau, ob nun Monika Zajíc oder Resi Wittek, die sich um ihn gekümmert hatte: ein häßliches älteres, aber kluges Weib, das ihn oft in die Kirche mitgenommen, ihm vom lieben Gott und der Hölle erzählt hatte, ihn lobte wegen seiner Fähigkeiten und schimpfte wegen seiner Ungeschicktheit. Man hatte all seine Kreuzerl und Zehner, auch Spielzeug, das ihm gehörte, bei ihr gefunden, und Philipp hatte sie wegen Diebstahls bei der Polizei angezeigt, sie«einkasteln»lassen, wie er zu scherzen pflegte.12 Aber welche Rolle hatte dieser Bruder damals überhaupt gespielt, unverheiratet und Amalia Freud so nahe im Alter?
Bald danach, 1859, ging die Zeit in Freiberg, die Zeit der Geheimnisse, zu Ende. Die Freuds verließen den Ort, an dem der Vater so lange ansässig gewesen war - wegen einer neuen Welle des Antisemitismus, wegen des Niedergangs der Textilbranche? Vielleicht. Mehr als ein«vielleicht»gibt es in dieser Geschichte nicht, keinen Beleg für Verfolgungen und Haßaktionen gegen die Juden in Mähren zu jener Zeit und insbesondere gegen jene gerade mal 130 in Freiberg, keinen Beweis dafür, daß Jacob Freuds Geschäft eine ungünstige Wendung nahm aufgrund einer Katastrophe in dem Industriezweig. Im Gegenteil, die Textilbranche hatte gerade zu prosperieren begonnen: Ein Kollege von Jacob Freud, Ignaz Fluß, blieb in Freiberg und brachte es zu einem ansehnlichen Vermögen. Der Vater von Stefan Zweig, ebenfalls aus Mähren und aus einer Textilhändlerfamilie stammend, kaufte einen Webstuhl und wurde Millionär. Solche Karrieren waren nicht selten, viel häufiger aber waren Kleingewerbetreibende wie Jacob Freud dem verspäteten, aber um so entschiedener betriebenen Industrialisierungs- und Modernisierungsprozeß nicht gewachsen; unglückliche Investitionen und mangelndes Geschick konnten jederzeit in den Bankrott führen. Im Freudschen Familienroman brachte dieses Jahr 1859 eine besonders dramatische Wende: Die Familie zerfiel.
Der Vater hatte sich schon im Februar von der Freiberger Tuchmacherinnung ein Zeugnis ausstellen lassen, dem zufolge er sich als«routinirter Commissionär und reeler Kaufmann», als Wohltäter und«friedlicher moralischer und ehrlicher Menschenfreund»erwiesen habe, dessen«Abzug»man mit Bedauern sah.13 Er wollte sich in der Messestadt Leipzig niederlassen, Frau und Kinder sollten etwas später nachkommen. Ob ihn seine erwachsenen Söhne dahin begleiteten oder ob sie direkt nach England, nach Manchester, emigrierten, ist unklar. Nach einer anderen Version waren sie sogar schon früher ausgewandert, möglicherweise gar nach Transvaal in Südafrika, um dort eine Straußenfarm zu betreiben, ein Unternehmen, das jedoch rasch zusammenbrach, so daß der Vater zu ihrer finanziellen Rettung sein Freiberger Geschäft auflösen mußte. Wahrscheinlich wollte Jacob Freud die Söhne nur vor dem drohenden österreichischen Militärdienst bewahren. Doch warum mußte dann die ganze Familie ihre Heimat verlassen? Für den dreijährigen Freud bedeutete dies zweifellos eine weitere schwierige Trennung, die schwierigste von allen. Er verlor seine Gefährten: John, mit dem er sich prügelte, mit dem er sich verbündete, und die kleine Pauline, die ihrer beider kindliche Sexualneugier erregte. Die heikle familiäre Balance zerbrach, auch wenn ihn der Weggang des geheimnisvollen Philipp weniger gedauert haben mag; Emanuel und dessen Frau Maria vermißte er sicherlich. Nun war er allein mit dem«alten»Mann Jacob, mit seiner jungen Mutter und der Schwester, der schon bald weitere Kinder folgten.
Er hatte seinen Traumspielplatz in den Freiberger Wäldern verloren, und der Umzug nach Leipzig sollte nur der erste Ortswechsel sein, ein Intermezzo. Vergeblich ersuchte Jacob Freud in der Stadt, die trotz gesetzlicher Gleichstellung das Wohnrecht für Juden streng reglementierte, um eine Aufenthaltsbewilligung. Er konnte nicht nachweisen, daß seine Geschäfte umfangreich genug und damit von Nutzen für die Stadt seien; er war nur ein kleiner Händler, der nichts zu seinen Gunsten vorbringen konnte -«im Gegentheil scheint seine Vergangenheit anzurathen, daß unser Platz vor einem solchen Geschäftsmann bewahrt werde»14, beschied die Leipziger Handelsdeputation. Das bedeutete nicht, daß er für unredlich galt, nur scheint es die Mär vom Freiberger Wohlleben zu widerlegen. Am 19. August 1859 wurde er aufgefordert, mit seiner Familie Leipzig zu verlassen. Im Herbst brachen sie auf nach Wien. Ihr Zug ging über Breslau, wo Sigmund Freud auf dem Bahnhof zum erstenmal im Leben Gasflammen sah. In der Erinnerung erschienen sie ihm wie«brennende Geister in der Hölle».15«Als die Juden fuhren über das Rote Meer, waren alle Kaffeehäuser in der Leopoldstadt leer», so ging ein Wiener Lied aus jener Zeit. Martin Freud erinnerte sich noch daran, überzeugt, daß es für seinen Vater ein Schock gewesen sein mußte, in das«überfüllte und nicht besonders saubere Judenviertel»zu kommen, dessen Bewohner«nicht von der besten Art»waren.16 Sigmund Freud selbst hat über seine erste Zeit in Wien nur gesagt:«Dann kamen lange harte Jahre; (…) sie waren nicht wert, sich etwas daraus zu merken.»17 Die Leopoldstadt, benannt nach jenem Kaiser, der 1669/70 die Juden aus Wien vertrieben hatte, war«ein freiwilliges Ghetto»; so beschrieb sie Joseph Roth, der 1913, mehr als fünfzig Jahre nach Freud, auf dem legendären Nordbahnhof am Praterstern ankam, mit jenem nicht enden wollenden Zug vor allem aus dem Osten, aus Galizien stammender Juden, und der wie die meisten gleich dort, im II. Bezirk, dem ehemaligen«Unteren-Werd-Ghetto», geblieben war. Ferdinand III. hatte, nach mittelalterlichem Vorbild, 1624 die Juden, die«unter dem Schutz des kaiserlichen Hauses»standen, dahin umgesiedelt, in das kaum bewohnte, als nicht besonders gesund geltende Auengebiet unmittelbar jenseits der Mauern Wiens, doch auf der anderen Seite des Donaukanals und nur über eine Holzbrücke mit der inneren Stadt verbunden. Dennoch hatten damals die Fischer entlang des Kanals protestiert gegen die Eindringlinge, und die Wiener Stadtoberen wollten sich mit der Zwangsaussiedlung der Juden nicht begnügen, zumal das Ghetto mit drei Synagogen, einem Krankenhaus und, fast einzigartig für jene Zeit, einem Budget für die Reinigung der Gassen und Straßen sich rasch zu einer prosperierenden Vorstadt mit stetig wachsender Einwohnerzahl entwickelte: Immer mehr Juden aus dem Osten flüchteten sich vor den Pogromen in Polen, Rußland, der Ukraine auf die Insel im Strom.
Aber schon 1670 mußten die mehr als 1600 dort lebenden Menschen auf Erlaß des unter dem Einfluß seiner Frau, einer«kompromißlosen Katholikin», stehenden Leopolds I. den«Unteren Werd»verlassen. Eine Synagoge wurde niedergerissen und, zu Ehren des Kaisers, die Leopoldskirche errichtet. Neun Jahre später wütete die Pest in Wien, und Abraham a Sancta Clara predigte gegen die an allem Unheil Schuldigen, die«ehrvergessenen, gottlosen, gewissenlosen, boshaften, schalkhaften, verruchten und verfluchten Gesellen und Bösewichte, Kotkäfer und Galgenzeiserl, Blutegel, Bluthunde»18. Eine kleine Zahl von Juden, darunter der Bankier Oppenheimer und sein Neffe und Nachfolger Samuel Wertheimer, kehrte schon bald zurück; Wien brauchte Geld für den Kampf gegen die Türkenbelagerung. Doch erst mehr als ein Jahrhundert danach gewährte das Toleranzpatent Josephs II., dessen Mutter Maria Theresia ihre«Hofjuden»nur hinter einer spanischen Wand zu empfangen pflegte, den Juden die«Rechte und Vorrechte der übrigen Untertanen»; das heißt, man gestand ihnen, von aufklärerischem Geist und ökonomischem Interesse beseelt, ihre Bürgerpflichten zu. Sie mußten Militärdienst leisten, durften keine neuen Synagogen mehr errichten, sollten Reformschulen besuchen, wo zwar immer noch die Bibel, jedoch in deutscher Sprache, studiert wurde, und sie mußten deutsche Familiennamen annehmen.
Aber trotz all dieser Einschränkungen - und mit etlichen Jahren Verspätung im Vergleich zu Berlin und anderen Städten - entwickelte sich nach dem Wiener Kongreß ein neuer Geist, eine neue Blüte des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens. Jüdische Bankiers wie die Rothschilds wurden in den Adelsstand erhoben, Fanny von Arnstein eröffnete, nach dem Vorbild der Rahel Varnhagen und Henriette Herz, ihren glanzvollen Salon. Jüdische Intellektuelle beteiligten sich schließlich an der 1848er Revolution, in deren Gefolge es zu einer fast völligen Emanzipation kommen sollte. Amalia Freud, die damals schon in Wien lebte, soll ein Bild aus jener Zeit aufbewahrt haben, das von Kugeln durchlöchert war.
Hatte es vor 1848 - offiziell - nur 179«Tolerierte»gegeben, so lebten 1857 wieder 6000 Juden in Wien. Und gut die Hälfte von ihnen hatte sich wieder in der Leopoldstadt niedergelassen. Aber zu jener Zeit, als die Freuds dort ankamen, war die«Mazzesinsel», wie sie im Volksmund genannt wurde, kein Ghetto mehr, auch kein freiwilliges. Viele Juden wohnten in Häusern, in denen auch Christen lebten. Johann Strauß, selbst jüdischer Herkunft, hatte hier gewohnt und hier, auf der Vergnügungsinsel der Wiener, zusammen mit Joseph Lanner seine ersten Auftritte gehabt. Nestroy hatte bis 1860 das berühmte Carltheater geleitet, und 1865 wurde der Cavaliere Suppe Demelli, der Operettenkönig Franz von Suppé, Kapellmeister am Leopoldstädter Theater. Dennoch überwiegen auf den Listen berühmter Persönlichkeiten die jüdischen Namen: Hier wuchsen Arnold Schönberg und Lise Meitner auf; hier wurde Arthur Schnitzler geboren, hier verbrachte er, zur selben Zeit wie der nur sechs Jahre ältere Freud, seine Kindheit. Damals, so erinnert er sich in seiner Autobiographie Jugend in Wien, war die Leopoldstadt ein«vornehmes und angesehenes Viertel», und«insbesondere ihre Hauptstraße, in der auch das Carltheater stand, wußte etwas von ihrem Glanz auch über die spärlichen Stunden hinaus zu bewahren, da in Equipagen und Fiakern die große, die elegante, die leichtlebige Welt von den Pferderennen oder von Blumenfesten aus der ‹Hauptallee› zurückgesaust kam»19.
Aber Schnitzlers Vater Johann, der einst auf einem Leiterwagen aus Ungarn nach Wien gekommen war und sein Studium als Hauslehrer finanziert hatte, gehörte zu den angesehensten Ärzten der Stadt; die Familie wohnte in der Praterstraße, die einmal als eine der vornehmsten Adressen Wiens galt. Der Kern der«Mazzesinsel»war jedoch ein Armenviertel, wo die Wohnungen eng und düster und dennoch für die meisten zu teuer waren, so daß untervermietet wurde und manchmal nur ein Kreidestrich den Raum begrenzte, der dem«Zimmerherrn»und dem«Bettgeher»überlassen war. Und die Wohnungsnot, die in ganz Wien herrschte, wurde immer schlimmer. Überall aus dem Vielvölkerstaat strömten, von Anmut und von Hoffnung getrieben, die Massen in die Hauptstadt, um ihr altes Elend gegen ein neues einzutauschen. Bis 1910 wuchs die Gesamtbevölkerung auf zwei Millionen Menschen und die Zahl der Juden auf gut 200 000. Immerhin blieb den Freuds wohl der schlimmste Mangel erspart, sie hatten nach den - so wenig zuverlässigen - Erinnerungen der ältesten Tochter Anna sogar viele Zimmer. In Wahrheit bezogen sie die erste größere Wohnung, in der Kaiser-Josef-Straße, vermutlich erst in den siebziger Jahren und wechselten davor häufig ihr Domizil.20 Wovon Jacob Freud die Familie ernährte, ist ungewiß. Ein Eintrag im Wiener Handelsregister wurde nicht gefunden, vielleicht war er für andere Wollhändler tätig, vielleicht halfen die Nathansons gelegentlich, und später kam Geld von den Söhnen in England.
Dabei vergrößerte sich die Familie ständig weiter; 1860 wurde Rosa geboren, danach, fast Jahr um Jahr aufeinanderfolgend, Maria, Mitzi genannt, dann Adolfine - Dolfi - und Pauline und schließlich, 1866, zehn Jahre nach Sigmund, wieder ein Sohn, Alexander. Jedenfalls waren sie alles andere als wohlhabend; auch hier hat Anna Freud sich die Vergangenheit geschönt. Gewiß, in der Kaiser-Josef-Straße hatten sie angeblich zwei Wohnräume, drei Schlafzimmer und ein«Kabinett», das konnten sich die wenigsten Juden der Leopoldstadt leisten, doch nahmen diesen Luxus neun Personen in Anspruch. Judith Bernays Heller erinnerte sich, daß sie später, zu Beginn der neunziger Jahre, mit dem Großvater in einem Zimmer schlafen mußte, während sich die drei jungen Frauen, die noch zu Hause geblieben waren, einen Raum mit Amalia teilten. Sigmund Freud war jedenfalls vermutlich schon Student, als er zum erstenmal ein Zimmer für sich allein hatte, das besagte«Kabinett», einen schmalen engen Raum mit einem kleinen Fenster auf die Straße. Ein Badezimmer gab es in solchen Wohnungen nicht, aber darüber verfügten selbst wohlhabendere Familien selten. Wie die Freuds ließen auch die Schnitzlers am Wochenende in einer Holzwanne oder einem Zuber heißes Wasser aus der Badeanstalt herbeischaffen. Die ganze Stadt krankte an den mangelhaften hygienischen Zuständen. Amalia Freud zog sich schließlich, wie der Sohn es dezent ausdrückte, eine Lungeninfiltration zu, vermutlich eine veritable Tuberkulose. Diese war so verbreitet und gefürchtet, daß man sie noch lange Zeit auch Morbus Vindobonensis nannte, die Wiener Krankheit.
Aber trotz der Enge und der wirtschaftlichen Not versuchte man, den bürgerlichen Schein zu wahren. Einmal wurde sogar, wie in allen guten Mittelstandsfamilien, ein Klavier angeschafft, das jedoch, da der hoffnungsvolle, aber weder musikalische noch musikliebende Sohn bei seinen Studien nicht gestört werden durfte, wieder fortgebracht werden mußte. Und Jacob Freud ließ auch, es muß gegen Ende der 60er Jahre gewesen sein, ein Portrait seiner sieben Kinder anfertigen, wenngleich der unbekannte Künstler, der damit beauftragt worden war, kaum Handwerk oder gar Talent mitzubringen schien: Wie Puppen sehen vor allem die Mädchen aus, mit ihren viel zu großen Köpfen auf den kleinen Körpern. Wenigstens hatte der Maler gnädigerweise die Löcher in seinen Schuhsohlen übersehen, spottete Sigmund Freud. Doch nie sollte es den Kindern fehlen an dem, worauf jüdische Familien traditionell größten Wert legten, was für sie, so der Historiker George Mosse, gleichbedeutend mit ihrem Jüdischsein war: an Möglichkeiten, sich zu bilden. Einmal, erinnert sich Freud in der Traumdeutung, machte sich der Vater sogar den Scherz, Anna und ihm«ein Buch mit farbigen Tafeln (Beschreibung einer Reise in Persien) zur Vernichtung zu überlassen. Es war erzieherisch kaum zu rechtfertigen». Aber damals, er war etwa fünf Jahre alt, begann Freuds Leseleidenschaft zu erwachen, seine Gier, Bücher zu besitzen und zu sammeln. Der Scherz des Vaters war höhere Klugheit, seine Kinder sollten ganz selbstverständlich mit Büchern aufwachsen; nie hätte es dieser Mann an Achtung vor der Schrift, vor dem Wissen fehlen lassen. Nur ein einziges Mal, aber daran erinnerte sich Freud bitter, machte ihm der Vater Vorwürfe, weil er ein«ansehnliches Konto beim Buchhändler und keine Mittel, es zu begleichen»hatte.21
Die finanziellen Opfer, welche die Freuds vor allem für ihren begabten Ältesten aufbrachten, müssen beträchtlich gewesen sein. Aber solche Väter wie Jacob Freud waren keine Seltenheit. Gustav Mahlers Vater las, wenn er mit seinem Wagen Waren auslieferte, französische Philosophen. Der Vater des späteren Sozialistenführers Victor Adler begeisterte sich, obwohl aus einer orthodoxen Familie stammend, für die Werke der französischen Aufklärung. Als er nach seiner Beteiligung an der gescheiterten Revolution von 1848 seine Intellektuellenkarriere aufgeben mußte, um als Kaufmann Geld zu verdienen, wollte er wenigstens seinen Kindern ermöglichen, was ihm verwehrt geblieben war: an allen geistigen Freuden teilzuhaben und sich in allen Studien zu bilden. Selbst die Töchter waren in jüdischen Haushalten nicht ausgeschlossen von diesem Bildungsprogramm. Anders als ihre Mitschülerinnen, die bestenfalls Mädchenbücher lasen, fanden sie meist früh Zugang zur Literatur, auch zur zeitgenössischen, und diskutierten mit ihren Freundinnen über Lyrik und Musik. Anna Freud interessierte sich mit vierzehn oder fünfzehn für Dumas und Balzac; sie mußte die Bücher jedoch unter der Bettdecke verstecken. Zu unmoralisch für ein junges Mädchen, hatte ihr älterer Bruder beschieden:«Anna, das darfst du noch nicht lesen.»22
Karl Kraus, dessen Vater seine Polemiken und satirischen Schriften finanziell unterstützte, hat zynisch bemerkt, daß es den auf Bildung so Bedachten nur darum ging, den Vater oder Großvater vergessen zu machen, der bloß ein einfacher Händler gewesen war. Doch ohne jene tradierte Achtung vor Gelehrsamkeit, die in den großbürgerlichen Salons ebenso zu Hause war wie in den Zimmern der Leopoldstadt, hätte man sich schwerlich in einer Hochkultur assimilieren können, die man zum größten Teil selber geschaffen hatte. Und worauf hätten jene, denen der wirtschaftliche Aufstieg verwehrt war, ihre Hoffnungen für ihre Kinder setzen sollen, wenn nicht auf die Macht des Wissens, den einzigen Ausweg aus der Misere und das einzig mögliche Entreebillett für ein besseres Leben? Als Sigmund Freud 1891 seinen 35. Geburtstag feierte, schenkte ihm der Vater die Philippsonsche Familienbibel mit der Widmung:«Mein geliebter Sohn, es war in deinem siebten Lebensjahr, daß der Geist des Allmächtigen dich überkam und dich drängte zu lernen. Der Geist des Allmächtigen spricht zu dir und sagt: ‹Lies in Meinem Buch; wenn Du so tust, so eröffnen sich dir die Quellen des Wissens und Verstehens.›»23
Dabei hatte, wie in den meisten assimilierten oder um Assimilation bemühten Familien, die Religion kaum eine Rolle in Freuds Erziehung gespielt, auch wenn er später gern behauptete, die frühe Bibellektüre habe ihn stark beeinflußt. Aber sie war nur eine weitere Quelle ästhetischer und wissenschaftlicher Bildung. Die Philippson-Bibel war das Werk eines aufgeklärten Rabbiners, der nicht nur das Alte Testament ins Deutsche übersetzt, sondern es auch mit ausführlichen Kommentaren zur Religionsgeschichte und zur antiken Historie versehen hatte. Und mehr noch als diese Texte beeindruckten den Jungen die Illustrationen, an die 500 Holzschnitte von ägyptischen Tiergottheiten und alten persischen Standarten, die ihm in seinen Träumen erschienen und seine Phantasie beflügelten. Auch für die Freuds wurde die Religion zu dem, was sie für die wohlhabenderen Wiener Juden längst war, zu einem«pieux souvenir de famille», wie der Gräzist und Philosoph Theodor Gomperz sie nannte, zu einer frommen Erinnerung. Auch für Jacob Freud, der nur ein paar Dekaden zuvor Tysmenitz verlassen hatte, und für seine Frau Amalia, die ihre galizische Herkunft nie verleugnen konnte, war die völlige Assimilation ohne Taufe das Ideal; auch sie verstanden sich«in scharfem Gegensatz zu den jüdischen Einwanderern aus dem Osten»in ihrem Kaftan, mit den Schläfenlocken und ihren orthodoxen Riten.
Allerdings studierte Jacob Freud auch in Wien noch immer den Talmud, und man hielt die traditionellen Feiertage ein. Damit unterschieden sich die Freuds von vielen anderen aus Mähren, Böhmen oder Ungarn zugewanderten Juden. Schon Arthur Schnitzlers Großeltern feierten nicht mehr das Laubhüttenfest und heiligten nicht mehr den Sabbat, selbst wenn seine Großmutter einen guten Teil des Tages im Tempel beim Gebet verbrachte. Theodor Herzls Familie ließ den Sohn zwar die Bar-Mizwa begehen, doch zog man es vor, diese«Confirmation»zu nennen. Als in späteren Jahren der Oberrabbiner von Wien, Moritz Güdemann, den Zionistenführer einmal kurz vor Weihnachten besuchte, erblickte er im Salon einen riesigen geschmückten Christbaum; danach soll er Herzls Wohnung nicht mehr betreten haben. Auch Amalia Freud feierte begeistert Weihnachten und Silvester, erinnern sich später die Enkel. Aber zumindest zu Lebzeiten Jacob Freuds beging man noch den traditionellen Seder, die Zeremonie zu Beginn des Passah-Festes; eindrucksvoll trug er dabei das Ritual vor, das er auswendig kannte. Der Sohn hatte nur Spott übrig für Feiertage und Speisevorschriften. Man mache der Religion mit Unrecht den Vorwurf, daß sie metaphysischen Wesens sei und ihr die sinnliche Gewißheit fehle, schrieb er seinem engsten Freund Eduard Silberstein.«Die Religion wendet sich vielmehr ausschließlich an die Sinne, und selbst der Gottesleugner, der das Glück hat, einer leidlich frommen Familie anzugehören, kann den Feiertag nicht leugnen, wenn er einen Neujahrsbissen zum Munde führt. Man kann sagen, daß die Religion, mäßig genossen, die Verdauung reizt, aber im Übermaße sie schädigt.»Nichts war, frei nach Goethe, schwerer zu ertragen als eine Reihe von schönen Tagen:«Der Mensch verdirbt sich den Magen.»Dabei wirkten«die Ostern verstopfend durch ungesäuertes Brot und harte Eier. Jom Kippur ist ein so funester Tag, nicht so sehr durch Gottes Zorn, als durch das Zwetschkenmus, das die Ausleerungen betreibt (…). Heute aber lehrt mich das Röcheln von 2 Fischen und einer Gans draußen in der Küche, daß der Versöhnungstag bevorsteht.»Gewiß mache der Magen, so der jugendliche Zyniker,«Revolution, wenn man die Religion abschaffen würde».24
Dennoch war Freuds Jugend in Wien eine«typisch»jüdische. Mit gerade neun, ein Jahr vor dem gewöhnlichen Eintrittsalter, bestand der begabte Junge die Aufnahmeprüfung am Sperlgymnasium, das damals noch in der Taborstraße lag. Erst in den siebziger Jahren zog die Schule um, in die Kleine Sperlgasse 2a und 2c, dorthin, wo sich einst das legendäre Vergnügungsetablissement«Sperl»befunden hatte, von Johann Strauß in einem Walzer und in einer Polka verewigt. Hier hatte die«Fiaker-Milli»gesungen und ihren Cancan getanzt, der so berühmt war, daß Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss ihr in der Oper Arabella ein Denkmal setzten. Hier, in dem Gebäude der alten Schule, richteten die Nazis nach 1938, als die Leopoldstadt wieder zum Ghetto geworden war, ein Deportationssammellager ein. Zwischen 1870 und 1910 waren fünfundsiebzig Prozent aller Schüler des Sperlgymnasiums jüdischer Herkunft, viele davon, wie Freud, Söhne von Kaufleuten und Händlern aus den Kronländern. Er wurde schnell Klassenbester. Damit wäre es eigentlich möglich gewesen, eine Erlassung des Schulgeldes zu beantragen, doch findet sich nirgendwo ein Vermerk darüber.
In dem kleinen Aufsatz Zur Psychologie des Gymnasiasten beschrieb Freud jene Jahre auf dem Sperlgymnasium als die Zeit der«Ahnungen und Irrungen, (…) schmerzhaften Umbildungen und beseligenden Erfolge»; eine ganze«untergegangene Kulturwelt»sah er darin, die ihm die erste Berührung mit den Wissenschaften brachte und ein Trost blieb«in den Kämpfen des Lebens». Dabei nahm den Schüler oft weniger die Beschäftigung mit dem Unterrichtsstoff als die mit den Lehrern in Anspruch, diesen Ersatzvätern in der zweiten Hälfte der Kindheit, da die«ursprüngliche Hochschätzung des Vaters untergraben»wird und man beginnt, ihn zu kritisieren, sozial einzuordnen und für die Enttäuschung, daß er nicht mächtig, weise und reich ist, büßen zu lassen. All die widerstreitenden Gefühle zwischen Auflehnung und Unterwerfung konnten sich nun auf die Lehrer richten.25 Besonders eng schloß Freud sich seinem Religions- und Hebräischlehrer Samuel Hammerschlag an, in dessen Seele«ein starker Funke von dem Geiste der großen jüdischen Wahrheitsbekenner und Propheten»26 glühte. Das meiste, was er bei ihm gelernt hatte, vergaß er später, doch blieb er auch nach der Schulzeit mit Hammerschlag und dessen Familie befreundet, die ihn, den Studenten, den jungen Arzt, wiewohl selber in bescheidenen Verhältnissen lebend, sogar finanziell unterstützte.«Er hat mich rührend lieb», schrieb Freud 1883 seiner Braut über den alten Lehrer,«ich stehe seit Jahren wie ein Sohn zu ihm.»27
Als er zehn oder zwölf war, hatte ihm Jacob Freud eine Geschichte aus seiner Jugend erzählt: An einem Samstag war er in den Straßen seines Geburtsorts spazierengegangen, schön gekleidet, mit einer neuen Pelzmütze auf dem Kopf. Da kam ein Christ daher, haute ihm mit einem Schlag die Mütze in den Kot und rief dabei:«Jud, herunter vom Trottoir.»Was der Vater dann getan habe? Jacob Freud antwortete gelassen:«Ich bin auf den Fahrweg gegangen und habe die Mütze aufgehoben.»Er hatte dem Sohn mit seiner Geschichte zeigen wollen, wieviel besser dieser es doch habe. Zu Freuds Schulzeiten war kaum etwas von jenem Antisemitismus zu spüren, der schon so bald wieder seine ganze Macht zeigen sollte. Nicht einmal das Wort habe es damals gegeben, meinte Arthur Schnitzler, man sprach statt dessen von«Judenfressern». Aber Freud empfand die Demütigung und das wenig heldenhafte Benehmen des«großen starken Mannes, der mich Kleinen an der Hand führte», als unerträglich. Er flüchtete sich in eine Rachephantasie: Vor ihm entstand, wie er in der Traumdeutung erzählt, jene Szene, da der Vater des semitischen Hannibal, Hamilkar Barkas, den Sohn vor dem Hausaltar schwören läßt, an den Römern Vergeltung zu üben.28 Und noch andere Helden und Identifikationsfiguren bevölkerten fortan die Imagination des ehrgeizigen Jungen: Napoleons General Masséna, der Wien erobert, sein Quartier in der Leopoldstadt genommen hatte und fälschlicherweise für einen Juden gehalten worden war, Menasse mit ursprünglichem Namen. Oder der Puritaner Oliver Cromwell, der den König hinrichten ließ und den Juden, nach dreihundert Jahren der Verbannung, nach England zurückzukehren erlaubte. Auch Alexander der Große, Mitwisser oder sogar Mittäter beim Mord an seinem Vater Philipp von Makedonien, gehörte zu diesen Heroen; angeblich war es Sigmund Freud, der diesen Namen für den kleinen Bruder auswählte.
Seiner Braut Martha erzählte er später, er sei, obwohl man es ihm kaum ansehe, schon in der Schule«immer ein kühner Oppositionsmann»gewesen, stets bereit, ein Extrem zu bekennen - und dafür auch zu büßen. Erst als er Primus wurde und man ihm Vertrauen schenkte, hätten die Klagen aufgehört.29 Aber der Zögling Freud hatte auch im Betragen stets hervorragende Noten. Seine Rebellion, wenn es denn eine war, blieb eine innere, ihm selbst vermutlich kaum bewußte, die mehr einer Flucht glich. Die Schule, seine Leidenschaft fürs Lernen, seine Vertiefung in die Bücher waren für ihn die einzige Möglichkeit, der Enge, dem Lärm zu Hause zu entkommen; den zerrissenen Gefühlen für den Vater, dessen Schwäche er sich nicht länger verbergen konnte, den er rächen und zugleich übertrumpfen wollte, aber auch den Ohnmachtsempfindungen gegenüber der Mutter, die von ihren Schwangerschaften, der Sorge um die kleineren Kinder, von ihrer Krankheit völlig in Anspruch genommen war und die, nicht anders als ihr Mann, all ihre Sehnsucht nach dem besseren Leben, all ihren unterdrückten Ehrgeiz auf den Ältesten projizierte. Freuds frühe Größenphantasien waren ein Versuch, die großen Erwartungen zu ertragen, die in ihn gesetzt wurden.
Aber die Familie hatte ja nichts als ihre Hoffnungen, und gerade jetzt brauchte sie diese so dringlich. 1866 war Jacob Freuds Bruder Josef in Wien wegen Betrugs zu zehn Jahren schweren Kerkers verurteilt worden. Er hatte falsche Rubelnoten verbreitet. Man nahm an, daß diese in England hergestellt worden waren, und damit gerieten laut Polizeibericht auch die«in Manchester lebenden Brudersöhne des Josef Freud», Emanuel und Philipp, unter Verdacht, die angeblich in einem Brief behauptet hatten,«Geld wie Sand am Meer»zu besitzen.30 Dem war gewiß nicht so, auch wenn sie es, der Ältere zumal, mit den Jahren in England zu einigem Wohlstand gebracht hatten. Und nun stand möglicherweise die ganze Familie unter Beobachtung. Bei Sigmunds Eltern soll sogar eine Hausdurchsuchung stattgefunden haben. Er erinnerte sich in einer Traumassoziation, daß der Vater zwar zu sagen pflegte, sein Bruder Josef sei kein schlechter Mensch, bloß ein Schwachkopf, doch sei er damals«aus Kummer in wenigen Tagen grau»geworden.31 Allein der Glaube an die Zukunft ließ die elende Gegenwart, erfüllt von Not und nunmehr auch noch von Schande, vergessen. Und hatte nicht, bei einem Ausflug in den nahen Prater, ein Stegreifdichter dem elf- oder zwölfjährigen Sigmund in ein paar Reimen prophezeit, er werde es dereinst zum«Minister»bringen? Das Kind mit der Glückshaube war zu Höherem bestimmt, kein Zweifel, und die Zeit schien allen Versprechungen günstig:«Es war die Zeit des Bürgerministeriums, der Vater hatte kurz vorher die Bilder der bürgerlichen Doktoren Herbst, Giskra, Unger, Berger u. a. nach Hause gebracht, und wir hatten diesen Herren zur Ehre illuminiert. Es waren sogar Juden unter ihnen; jeder fleißige Judenknabe trug also das Ministerportefeuille in seiner Schultasche.»Wie jeder von Napoleons Soldaten den Marschallstab im Tornister getragen hatte.32
Aber dies eine Mal schien der unermüdliche Hoffer Jacob Freud, der ewige Projekteschmied, nicht bloß seinen Illusionen zu erliegen. So wie er glaubten die meisten Juden, daß ihren Kindern die Zukunft offenstand. Gewiß, die jüdischen Minister in der Regierung waren Konvertiten, wie Julius Glaser und Josef Unger, nur so hatten sie eine Karriere machen können, die für ihre ehemaligen Glaubensbrüder, die sich der Taufe verweigerten, unerreichbar blieb. Aber die vom Bürgerministerium dekretierte Verfassung von 1867 garantierte den Juden endlich Gleichheit vor dem Gesetz und bürgerliche Rechte, ein Höhepunkt im langen Kampf um Emanzipation. Zwar waren sie nach wie vor, sofern sie nicht konvertierten, ausgeschlossen von der Beamtenlaufbahn, aber sie strömten nunmehr in Scharen in die freien Berufe. An der Universität nahm die Zahl jüdischer Studenten derart zu, daß in den achtziger Jahren fast die Hälfte aller Wiener Anwälte, Ärzte und Journalisten Juden waren. Nur die Skeptiker, die Weitblickenderen blieben bei ihren Zweifeln. So glaubte Theodor Gomperz, immerhin aus einer der prominentesten Familien Wiens stammend und ein Gelehrter von Weltruf, nicht daran, daß er einmal an der Universität anerkannt werden würde. Seine akademische Karriere hatte durch das Konkordat von 1855 - das der katholischen Kirche allen Einfluß auf das Schulwesen sicherte - eine schwere Zäsur erfahren. Als er schließlich, nach Jahren als Privatgelehrter, Ordinarius für Alte Geschichte wurde, bot man ihm sogar einen Adelstitel an; als guter Liberaler lehnte er aber ab, genauso wie sein nichtjüdischer Kollege, der Professor für Physik und Philosophie Ernst Mach.
Es war eine trügerische Welt der Sicherheit.«Nicht ungestraft habe ich meine Kindheit und meine erste Jünglingszeit in einer Atmosphäre verbracht, die durch den sogenannten Liberalismus der 60er und 70er Jahre bestimmt war», schrieb Arthur Schnitzler in seiner Autobiographie.«Der eigentliche Grundirrtum dieser Weltanschauung scheint mir darin bestanden zu haben, daß gewisse Werte von vornherein als fix und unbestreitbar angenommen wurden, daß in den jungen Leuten der falsche Glaube erweckt wurde, sie hätten irgendwelchen klar gesetzten Zielen auf einem vorbestimmten Wege zuzustreben, um dann ohne weiters ihr Haus und ihre Welt auf sicherem Grunde aufbauen zu können. Man glaubte damals zu wissen, was das Wahre, Gute und Schöne war, und das ganze Leben lag in großartiger Einfachheit dar.»33 Die Liberalen jener Zeit, wiewohl nach dem Trauma von 1848 weder blinde Fortschrittsgläubige noch glühende Utopisten, waren sicher, daß der Feudalismus an sein Ende gekommen war. Sie übersahen allerdings, daß sie, wie Carl Schorske über das Wien des Fin de siècle schrieb, 1861«beinahe aus Versehen»an die Macht gekommen waren, die sie von Anfang an mit dem Adel und der kaiserlichen Bürokratie teilen mußten. Ihre neue Spitzenstellung im Staat verdankten sie weniger der eigenen Stärke als den Stößen, die äußere Feinde der alten Ordnung der Monarchie versetzt hatten. Zwar war Kaiser Franz Joseph nach 1848 zu immer mehr Konzessionen und diversen Verfassungsexperimenten bereit gewesen, doch erst die Niederlagen von Solferino 1859 gegen Frankreich und Piemont und vor allem die gegen die Preußen 1866 führten zur verspäteten Umwandlung des Kaiserreichs in eine konstitutionelle Monarchie.«Casca il mondo»hatte der Sekretär des Papstes Pius IX. angesichts der Niederlage von Königgrätz ausgerufen.
Aber die alte Welt zerbrach nicht, noch nicht. Sie gewann sogar bald schon neue, nicht einmal dem Kaiser erwünschte Verbündete. Die Gesellschaft hielt sich nicht an die Emanzipations- und Bildungsprogramme des Liberalismus. Österreich sei durch eine langjährige Zurückhaltung in die Lage gebracht worden, heute mit demjenigen Liberalismus Epoche zu machen, der in Deutschland in der Hauptsache schon seit zwanzig Jahren, in vielen seiner Teile bereits seit fünfzig Jahren, zu einem überwundenen Standpunkte gehörte, hatte der Zyniker Bismarck über die Zeit des Bürgerministeriums bemerkt. Im Grunde blieb der Einfluß der Liberalen stets begrenzt auf die deutsche Mittelschicht und die deutschen Juden. Diese aber hatten wie keine andere gesellschaftliche Gruppe ihr eigenes Schicksal damit verbunden; ihr Glück stand und fiel mit dem des kosmopolitischen liberalen Staates mit starker zentralistischer Ausrichtung.«Dem Juden war der Liberalismus mehr als eine politische Doctrin, ein bequemes Prinzip und eine populäre Tagesmeinung», schrieb der streitbare Rabbiner und Publizist Joseph Bloch,«er war sein geistiges Asyl, sein schützender Port nach tausendjähriger Heimatlosigkeit, die endliche Erfüllung der vergeblichen Sehnsucht seiner Ahnen, sein Freiheitsbrief nach einer Knechtschaft namenloser Härte und Schmach, seine Schutzgöttin, seine Herzenskönigin, welcher er diente mit der ganzen Glut seiner Seele, für die er stritt auf den Barrikaden und in den Volksversammlungen, in dem Parlament, in der Literatur und in der Tagespresse; ihretwegen ertrug er willig den Zorn der Mächtigen!»34 In seiner kurzen, kaum zwei Dekaden währenden Blüte führte der österreichische Liberalismus nur zu einigen wenigen Fortschritten in der Politik - die Regierung klammerte sich geradezu an das alte undemokratische Klassenwahlrecht -, dafür aber zu entscheidenden Entwicklungen in Kultur und Wirtschaft, ja sogar zu einer späten industriellen Revolution. Doch auch der laissez-faire-Kapitalismus jener Jahre sollte sich rächen, und zwar abermals an jenen, die man als ewige Sündenböcke identifiziert hatte.
Nein, Jacob Freud hatte sich keinen verrückten Utopien hingegeben, nicht mehr als diese ganze Stadt, dieses aus Illusionen, Täuschungen und Enttäuschungen gebildete Wien,«weder jeune cocotte noch vieille pieuse», wie Freuds späterer Schüler Hanns Sachs sagte. Das Symbol dafür war die Ringstraße. Hier, in der Neugestaltung Wiens, hatte sich das liberale Bürgertum am stärksten ausgelebt, sich seine machtvollste Selbstdarstellung geschaffen. Die Ringstraßen-Zeit wurde für Österreich zum Begriff für eine Epoche, wie das Viktorianische in England, die Gründerzeit in Deutschland, das«Seconde Empire»für die Franzosen. Sie stand für Befreiung und Modernisierung - und, nur wenige Jahre später, für den Niedergang liberaler Kultur. Bereits 1857 hatte der Kaiser angekündigt, die alten Wälle und Militäranlagen um die Innere Stadt schleifen zu lassen. Wien sollte erweitert und ein Boulevard angelegt werden, der es mit den Pariser Vorbildern aufnehmen konnte. 1865 wurde der Pracht-Corso eingeweiht, die Fertigstellung der einzelnen Bauten dauerte noch bis 1889:«Keine Paläste, Festungen und Kirchen beherrschen die Ringstraße», so Schorske,«sondern die Zentren einer konstitutionellen Regierung und einer aufgeklärten Kultur.»35 In der Architektur, die wie überall in Europa ganz im Zeichen des Historismus stand, feierte das Bürgertum seinen«Sieg»über die alte Macht von Kaiser und Kirche. Der später so oft kritisierte Pluralismus des Baustils, den damals selbst Jacob Burckhardt als Fortschritt gegenüber der einstigen Uniformität begrüßte, hatte Methode: Das neogotische Rathaus sollte an die mittelalterliche freie Stadtgemeinde erinnern, das Burgtheater an den Frühbarock, die Universität dagegen wurde im Renaissance-Stil neu gebaut. Das Parlament mit seinen antikisierenden, als klassisch-griechisch geltenden Elementen gemahnte an die Entstehung der Demokratie in Athen. Zwischen jenen Institutionen des Verfassungsstaates und seinen Bildungsstätten, zwischen den Palais der alten Aristokratie und des neuen Industrie- und Geldadels, der verächtlich so genannten Ringstraßenbarone, nobilitierten sich die Fassaden der Mietshäuser des zu Macht und Reichtum gekommenen Bürgertums. Das alte Zentrum der Macht in der Inneren Stadt sollte durch den Ringstraßenbau degradiert werden zu einem Museum feudaler Zeiten. Zugleich wollte man sich ein Bollwerk schaffen gegen die Vorstädte der Kleinbürger und Arbeiter. Was einst ein Gürtel militärischer Absonderung gewesen war, wurde nun zu einem der gesellschaftlichen Trennung - und am Ende zum Symbol für die Entfernung von der wirklichen Macht: Als ob, nach dem berühmten Wort des Architekten Adolf Loos,«ein moderner Potemkin»jemanden glauben machen wollte, er sei«in eine Stadt von lauter Nobili versetzt»worden.
Schon der sechzehnjährige Freud fand dieses Wien«ekelhaft», und auch später drückte er, der für eine Weile seine Wohnung und Praxis am Schottenring hatte, immer wieder seine Abneigung aus gegen die Stadt, durch die er nach der Arbeit so oft spazierenging. Der Stephansdom war für ihn nur«der abscheuliche Turm». Seinen Kindern, die beeindruckt waren von den schönen Häusern am Ring, von den hervorspringenden Verzierungen und den zahllosen Schornsteinen, erzählte er gern das Märchen vom Kaffeekränzchen bei des Teufels Großmutter: Die«alte Dame»flog aus irgendeinem Grund mit einem Tablett über Wien, mit«Töpfen, Krügen, Tassen und Untertassen in teuflischem Dekor». Und dieses Tablett kippte aus irgendeinem Grund um, das Kaffeegeschirr verteilte sich über die Dächer der Stadt, und jedes Stück blieb stecken.36 Ein anderer glaubte noch viele Jahre später an die Magie und Macht der Fassade; wie aus Tausendundeiner Nacht erschienen ihm die Bauten der Ringstraße, Gottfried Sempers Burgtheater und das von dem Dänen Theophil Hansen entworfene Parlament. Ein«hellenistisches Wunderwerk auf deutschem Boden»nannte es der junge Adolf Hitler, als er 1907 nach Wien kam.37
LIEBELEIEN UND DIE MÜHEN DER ADOLESZENZ
Im Sommer 1872 kehrt Freud in die Welt seiner Kindheit zurück, nach Freiberg. In diesen wenigen Wochen, in denen er auf einsamen Spaziergängen«die wiedergefundenen herrlichen Wälder»durchstreift, gibt er sich dem Bau von Luftschlössern hin. Seltsamerweise betreffen diese nicht die Zukunft, sondern suchten«die Vergangenheit zu verbessern».1 Er träumt: Was wäre, wenn der Vater geblieben, wenn er mehr Glück in seinem Geschäft gehabt hätte, so wie der erfolgreiche Färbereibesitzer Ignaz Fluß, bei dessen Familie er zu Gast ist. Wenn er hätte auf dem Lande aufwachsen und das Mädchen heiraten können, das ihm dann über Jahre vertraut gewesen wäre? Das Mädchen Gisela, an das er nun kaum ein neutrales, geschweige liebenswürdiges Wort zu richten, dem er sich kaum zu nähern wagt, diese«wilde thrakische Schönheit»von vermutlich gerade dreizehn Jahren, mit langem schwarzem Haar, mit Adlernase und gepreßtem Mund und mit«einem manchmal ganz gleichgültigen Gesichtsausdruck», die Tochter seiner Gastgeber.2 Nicht einmal ihren Namen mag er aussprechen, ohnehin nennen Freund Silberstein und er ihre Angebeteten lieber ihre«Prinzipien». Sein«Prinzip»tauft er die«Ichthyosaura», nach der Fischechse, einem ausgestorbenen Flußwesen, oder auch den«saurischen Mythos»; dazu hatte ihn neben ihrem Familiennamen vermutlich das damals in Schüler- und Studentenkreisen beliebte Gedicht von Joseph Victor von Scheffel, Der Ichthyosaurus, inspiriert:
Es rauscht in den Schachtelhalmen, Verdächtig leuchtet das Meer, Da schwimmt mit Tränen im Auge Ein Ichthyosaurus daher …
Nein, niemand darf von seiner Schwärmerei wissen, vor allem das Mädchen nicht, nur dem Freund vertraut er an, daß er eine Zuneigung gefaßt habe, weich gemacht durch das Wiedersehen mit der Heimat, durch die Erinnerung an ein Idyll, das es vielleicht nie gab.
Denn noch auf eine ganz andere, weiter reichende Weise versucht Freud, die Vergangenheit zu korrigieren. Zeitweise scheint seine Neigung weniger der jungen Gisela als deren Mutter zu gelten - dieser so liebenswürdigen Wirtin, die ihn in die engste Familie zog und ihn umsorgte, als er seiner Zahnschmerzen wegen reinen Spiritus getrunken hatte und an heftiger Übelkeit litt:«Solche Freundlichkeit und Güte kann ich unmöglich verdienen (…). Sie sieht wohl ein, daß ich stets einer Aufmunterung bedarf zu sprechen oder zuzugreifen, und läßt es nie daran fehlen.»Vor allem bewundert er, daß diese einfache Bürgersfrau sich eine Bildung angeeignet hat,«deren sich ein 19jähriges Salondämchen nicht zu schämen brauchte», daß sie ihre Klassiker gelesen hat, sich aber auch auf allen anderen Gebieten und sogar in der Politik auskennt und an der Führung der Fabrik genauso wie ihr Mann beteiligt ist.«Andere Mütter - und warum verbergen, daß die unsrigen darunter sind? wir werden sie deshalb nicht weniger lieben - kümmern sich nur um die leiblichen Angelegenheiten ihrer Söhne, über die geistige Entwicklung derselben ist ihnen die Kontrolle aus der Hand genommen»3, schreibt er Silberstein. Er hatte begonnen, seinen Namen Sigismund in Sigmund zu ändern.
Doch das Geheimnis, das er aus seiner Neigung für die«Ichthyosaura»machte, alarmierte seine Biographen. Als erster kam ihm sein Schüler Siegfried Bernfeld auf die Spur, der hinter dem Patienten, von dem Freud 1899 in seinem Aufsatz Über Deckerinnerungen berichtete, diesem etwa 38jährigen, akademisch gebildeten, an einer kleinen Phobie leidenden Mann, den schlecht getarnten Autor selbst entdeckte. Vermutlich wollte er damals, so kurz vor der Veröffentlichung der Traumdeutung, in der er sich mehr oder weniger schonungslos entblößte, alle weiteren Mutmaßungen über seine Person verhindern. Warum sonst sollte er, ein über vierzigjähriger, seit dreizehn Jahren verheirateter Mann, sich jener Maske bedienen, um ein Erlebnis aus seiner Adoleszenz zu deuten, das sich doch kaum unterschied von den gewöhnlichen Krisen jener meist so trübseligen, von Pickeln und Liebeskummer beherrschten Lebensphase? Seiner Frau Martha hatte er schon während ihrer Verlobungszeit davon erzählt. Die Welt durfte zwar erfahren, daß sich hinter der Gedankenschüchternheit, dem unsinnigen Hamlettum des Pubertierenden, eine arge sexuelle Aggression verbarg, daß der«nichtsnutzige Jüngling»damals geflohen war vor seinen«grobsinnlichen»Phantasien, die um die Brautnacht, um den Akt der Defloration kreisten; aber sie mußte nicht wissen, daß der Taugenichts Freud hieß.4
Als Gisela Fluß mit ihrer Familie 1873, ein Jahr nach der Begegnung in Freiberg, nach Wien kommt, da will er sie nicht sehen, will sich dem«hydrographischen System, das die Flüsse bilden», fernhalten. Auf seine Neigung zu ihr habe er, wie er Silberstein mitteilt, nicht deshalb verzichtet, weil eine andere ihren Platz eingenommen hätte, sondern weil dieser leer bleiben solle - beziehungsweise«weil es keinen leeren Raum in der Natur gibt, wollen wir sagen, daß er sich mit etwas anderem wie mit Luft gefüllt hat».5 Das allzu lange Spiel hat ihn ermüdet und in die Irre geleitet. Wie es bei Scheffel heißt:
Es starb zur selbigen Stunde Die ganze Saurierei, Sie kamen zu tief in die Kreide, da war es natürlich vorbei.
Aber noch zwei Jahre danach, 1875, als er von der bevorstehenden Heirat Giselas erfährt, schreibt er ein wütendes Spottgedicht, das Hochzeitscarmen. Die«thrakische»Schönheit will ihm nunmehr kugelförmig erscheinen, mit kürbisartigem Kopf, worin«unansehnlich und machtlos im schmalen Gehirn die Vernunft thront». Dem glücklichen Paar wünscht er:
Segen erfülle ihr Haus, nie raste am Herd der Braten, nie sei leer des Papiers die eiserngefestete Kassa, und so mögen sie beide das Los vollenden des Lebens gleich den Insekten und Würmern, die unsere Erde bevölkern, ungestörter Atmung begabt und Nahrungsaufnahme, nie von dem Geiste berührt …
Wie Prospero in Shakespeares Sturm will er den Zauberstab versenken, der all die Wirrungen hervorgerufen hat,«eine neue Zeit ohne geheim wirkende Kräfte breche herein, die keiner Poesie und Phantasie bedarf», keiner Ausflüge ins Alluvium oder Diluvium, in die«grausige Urvergangenheit, da wilde Geschöpfe, vom Menschen ungestraft, am Sauerstoff der Atmosphäre zehrten».6 Vom ersten Entwurf zu diesen wüsten Hexametern sind einige wenige Zeilen erhalten, in denen der böse Spötter ganz anders spricht, nämlich von«entsetzlichem Jammer»und von Zyankali, Äther, Arsen,«ganz weißem und echtem». Darum bittet er den Freund, und um«einen Revolver dazu, von 6 gezogenen Läufen - bleierne Kugeln mit Schrot, doch alles gut und solide - denn nicht ertrag ich das garstige Schicksal».7
Sicherlich steckte in jenen Übertreibungen einer Liebe, die vor allem aus Sehnsucht nach Liebe bestand, ein Gutteil pubertärer Koketterie, aber auch wirklicher Kummer und Angst vor dem Verlust verbargen sich darunter, ebenso wie all die Unsicherheit, die Zuflucht sucht im intellektuellen Spiel, und all die Aggression, auch die gegen sich selbst, gegen die eigene blödsinnige Schüchternheit. Vielleicht war sogar die ganze Verehelichung der sechzehnjährigen Ichthyosaura, die nunmehr einen anderen küßt, nur eine Phantasie Freuds. Er machte sich damit das Mädchen, dem er sich nicht zu nähern wagte, unerreichbar, und setzte seinen jugendlichen Träumereien ein Ende, indem er seine Fluß-Echse auf alle Zeit ins Reich der Mythologie verbannte. Das vermutete zumindest der Herausgeber der Briefe, Walter Boehlich, da sich nirgendwo ein Hinweis auf eine Heirat fand, wohl aber ein späterer Eintrag im Trauungsbuch der Kultusgemeinde der Leopoldstadt, daß die ledige Gisela Fluß am 27. Februar 1881 mit dem Pressburger Kaufmann Emil Popper die Ehe schloß. Vielleicht hatte sich der frühere Hochzeitsplan auch ganz einfach zerschlagen.8
Seine Verlustangst überträgt Freud nunmehr auf den Freund, den engsten, den innigsten seiner Jugend. Er hatte Eduard Silberstein, einen aus Rumänien stammenden Juden, ein halbes Jahr jünger als er selbst, vermutlich in der Schule oder in Roznau kennengelernt, einem Kurort nicht weit von Freiberg, wohin sich Amalia Freud wegen ihres Lungenleidens in jenen Jahren öfter zurückzog. Jedenfalls standen sie einander schon 1870 so nahe, daß die Freuds, wie immer in finanziellen Schwierigkeiten, daran dachten, Eduard und seinen Bruder als Pensionäre aufzunehmen. Daraus wurde nichts.«Wir waren Freunde in einer Zeit, da man in der Freundschaft nicht einen Sport und nicht einen Vorteil sieht, sondern den Freund braucht, um mit ihm zu leben», beschrieb er später ihr Verhältnis zueinander.9 Zusammen lernten sie Spanisch, ohne Lehrer, ohne Lexikon, nur mit Hilfe eines Lesebuchs. Und sie schufen sich eine Art Privatmythologie, indem sie die«Academia Castellana»gründeten und sich mit Geheimnamen ansprachen, Cervantes’ humoristisch-philosophischem Gespräch der Hunde entliehen. Silberstein war Berganza, der geschwätzigere, lebensfreudigere, während Freud die Rolle des moralisierenden Cipion übernahm, den der Autor sagen läßt:«Halte deine Zunge in Zaum, denn sie ist die Anstifterin des größten Unglücks im Leben.»
Ende 1871 hatte ihre regelmäßige intensive Korrespondenz begonnen, von der nur Freuds Briefe erhalten sind. Manche davon sind kleine literarische Versuche,«Meisterstücke von Unsinn», verspielt und altklug, auch albern und kitschig; andere mehr bekenntnishaft und von den gewöhnlichen Torheiten und Kränkungen der Adoleszenz handelnd. Aber nun, nachdem er das zarte Pflänzchen seiner ersten Neigung, seine Ichthyosaura, so pathetisch begraben hat, glaubte er, auch an seinem«querido Berganza»zweifeln zu müssen, der weder einen längeren Brief noch die versprochene Photographie von sich schickt. Er mahnt ihn, häufiger und pünktlicher zu schreiben.«Es ist aber das untrügliche Kennzeichen des in sich zerfahrenen und den Freunden entfremdeten Menschen, daß ihm das Briefschreiben zur Last wird», doziert er nörgelnd.«Die selbstlose Teilnahme an allem, was den andern angeht und befällt, ist ja oft die einzige, sicherlich aber wertvollste Leistung eines Freundes.»10 Ein andermal träumt Freud von einem gemeinsamen Leben mit Silberstein, gemeinschaftlichen Studienreisen, geheimen Spaziergängen, vielleicht mit Prinzipien.
Seine Briefe sind Werbungen, Beschwörungen, in denen Neigung und Furcht sich eng umschlingen. Immer wieder muß er dem anderen - und sich selbst - versichern, daß ihre Freundschaft nie enden werde,«kleben wir doch aneinander, als ob die Natur uns als Blutsverwandte auf diese Erde gesetzt hätte».11 Die Furcht, den Freund zu verlieren, womöglich an ein«Prinzip», verbirgt er hinter altväterlichem Moralisieren: Der junge Mann war aus vielen Gründen, nicht unbedingt nur aus moralischen, ein Kind seiner Zeit, ein guter Viktorianer. Arthur Schnitzler durchtanzte seine Jugend als einen Kongreß der süßen Mädels, der Fännchens, Mitzis und Annerls, und führte Buch über sein Geschlechtsleben, mit Strichlisten und peniblen Koitusbilanzen. Doch neben einem Schnitzler gab es immer auch einen Freud - und neben einem flotten Eduard, der zuerst in Anna Freud verliebt war und dann in eine Fanny und schließlich in alle Mädchen weit und breit, immer auch einen keuschen Sigismund, dem zuviel Romantik gefährlich erscheint.«Übrigens muß ein Mensch nicht alles wollen, und wenn mir Damengesellschaft beschwerlich bleibt, so freue ich mich dafür, daß sie Dir umso leichter ist.»12 Wie sollte einem, der aufgewachsen war in einem von Frauen bestimmten Haushalt, auch der Umgang mit jenen Wesen leichtfallen, die seine Kindheit, seine Jugend, sein ganzes bisheriges Leben dominiert hatten und noch immer beherrschten? Ein bißchen Eifersucht auf den unbekümmerten Silberstein kann er nicht leugnen, schließlich hält er sich für wenig attraktiv. Dazu kommt die bitterliche Armut. Geldnot wirkt nicht besonders anziehend auf das andere Geschlecht, das mit Küssen allein sich nie begnügt. Und so glaubt er, allem jugendlichen Leichtsinn, allen Vergnügungen entsagen zu müssen.
Doch er hat noch seinen Witz. Den verliert der gestrenge junge Mann, der Balzac und Dumas zensiert und sich Gedanken über die Sittlichkeit der Kameliendame und«dieser ganzen französischen Mordbrandehebruchtirolerei»13 macht, auch dann nicht, wenn er den Freund wieder einmal mahnen muß:«Die Gleichgiltigkeit, mit der Du mir vom ersten Kuß Deines Prinzips erzählst, gilt mir in doppelter Hinsicht als ein böses Zeichen, vorerst, daß Du so leicht Küsse nimmst, und zuzweit, daß Du Küsse so leicht nimmst. Es ist meine Pflicht, Dich aufmerksam zu machen auf eine Berechnung des berühmten Statistikers Malthus, der nachwies, daß sich die Küsse in einer ungemein rasch aufsteigenden Proportion zu vermehren streben, so daß nach kurzer Zeit vom Beginn der Reihe an gerechnet das kleine Areal des Gesichtchens ihnen nicht genügt und sie zur Auswanderung gezwungen werden.»14 Bekanntlich hatte Malthus die These aufgestellt, daß alle Lebewesen die Neigung haben, sich in höherem Maße zu vermehren, als es die ihnen zur Verfügung stehende Nahrungsmenge zuläßt. Sicherlich spielen dem jungen Freud hier die eigenen erotischen Phantasien den üblichen Streich: Der andere könnte womöglich das tun, was er sich verboten hat. Aber hinter dieser ironisch ummäntelten Projektion steckte auch eine ganz reale Sorge, immerhin war er nun Student der Medizin im zweiten Semester. Doch mußte man nicht die Universität besuchen, um von den Gefahren zu wissen, die dem ausschweifenden Küsser drohten. Man mußte wohl auch nicht so weit gehen wie Schnitzlers Vater, der, nachdem er das Tagebuch des damals Sechzehn- oder Siebzehnjährigen entdeckt hatte, dem Sohn die drei großen Atlanten seines Kollegen, des Dermatologen Moriz Kaposi, über venerische Krankheiten durchzublättern gab.
Aber sein Eduard will gar nicht auf Freud hören, er ist einfach zu leichtsinnig und flirtet sogar mit einer gerade Sechzehnjährigen.
Verlagsgruppe Random House
1. Auflage
Copyright © 2006 by Albrecht Knaus, München, in der
Verlagsgruppe Random House GmbH Druck und Einband: GGP Media GmbH, Pößneck
eISBN : 978-3-641-01137-6
www.knaus-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de